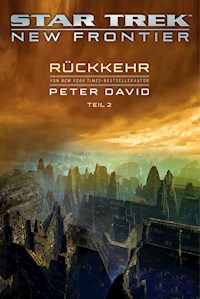
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Captain Mackenzie Calhoun und die Crew der U.S.S. Excalibur sind zurück! Und es geht direkt nach den atemberaubenden Ereignissen in New Frontier: Mörderisches Spiel weiter. Calhoun hat bei seiner Suche auf Xenex keine Überlebenden gefunden und ist nun fest entschlossen, das Volk, das die Xenexianer getötet hat – die D'myurj und ihre Verbündeten, die Brüder – aufzuspüren und Rache an ihnen zu nehmen. Calhouns Suche führt die Besatzung der Excalibur in ein Taschenuniversum, wo er nicht nur die Heimatwelt der D'myurj entdeckt, sondern auch ein anderes Volk, das Calhouns Entschlossenheit teilt, seine Gegner auszulöschen. Aber ist dieses neue Volk wirklich ein Verbündeter … oder eine noch größere Bedrohung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STAR TREK
NEW FRONTIER™
Rückkehr
TEIL 2
PETER DAVID
Based onStar Trekcreated by Gene Roddenberry
Ins Deutsche übertragen vonHelga Parmiter & Claudia Kern
Die deutsche Ausgabe von STAR TREK – NEW FRONTIER: RÜCKKEHR · TEIL 2 wird herausgegeben von Cross Cult, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.
Herausgeber: Andreas Mergenthaler, Übersetzung: Helga Parmiter & Claudia Kern; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Katrin Aust; Korrektorat: Peter Schild; Satz: Rowan Rüster; Cover Artwork: Doug Drexler.
Titel der Originalausgabe: STAR TREK – NEW FRONTIER: THE RETURNED, PART 2
German translation copyright © 2022 by Cross Cult.
Original English language edition copyright © 2015 by CBS Studios Inc. All rights reserved.
™ & © 2022 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
This book is published by arrangement with Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., pursuant to an exclusive license from CBS Studios Inc.
E-Book ISBN 978-3-96658-867-6 (Juli 2022)
WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.STARTREKROMANE.DE · WWW.STARTREK.COM
INHALT
WAS BISHER GESCHAH
THALLON
DAS SCHIFF
EXCALIBUR
NEU THALLON
EXCALIBUR
THALLON
EXCALIBUR
NEU THALLON
EXCALIBUR
THALLON
EXCALIBUR
NEU THALLON
EXCALIBUR
THALLON
HEIMATWELT DER D’MYURJ
THALLON
HEIMATWELT DER D’MYURJ
EXCALIBUR
NEU THALLON
WAS BISHER GESCHAH
Jedes einzelne Leben auf Xenex wurde von den D’myurj ausgelöscht. Mackenzie Calhoun beschließt, durch den Hüter der Ewigkeit in der Zeit zurückzureisen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, ungeachtet der Konsequenzen. Mark McHenry trifft ein und überzeugt Calhoun, es sich noch einmal zu überlegen und einen anderen Weg zu finden, sein Volk zu rächen.
Mithilfe seiner Fähigkeiten bringt McHenry sie zur Raumstation Bravo und befreit Soleta aus der Gedankenverschmelzung, in der sie gefangen war. Soleta informiert Calhoun, dass die D’myurj aus einem Taschenuniversum kommen, wo sie vermisste Sternenflottenoffiziere festhalten. In der Hoffnung, unentdeckt durch den thallonianischen Raum reisen zu können, installiert Soleta ihre Tarnvorrichtung auf der Excalibur. Doch die Thallonianer spüren sie auf, weil Xyon, Calhouns Sohn, einen Peilsender auf dem Schiff versteckt hat. Die Thallonianer versprechen dem Schiff sichere Passage im Austausch gegen Robin Lefler und ihren Sohn Cwansi. Calhoun lehnt ab. McHenry bietet jedoch an, Lefler zu den Thallonianern zu bringen, und begleitet sie zu deren Planeten.
Die Excalibur fliegt durch das Wurmloch in das Taschenuniversum, wo sie ein im Raum treibendes D’myurj-Schiff entdecken. Die gesamte Besatzung ist tot, bis auf ein Besatzungsmitglied, das sie warnt, zu fliehen.
THALLON
Shanter Khen hat ununterbrochen gebetet.
Den anderen in seinem Orden macht seine Besessenheit Sorgen, denn es gibt keine bessere Beschreibung seines Verhaltens als Besessenheit.
Sie wissen sehr wohl, dass es aus negativen Bereichen seiner Persönlichkeit stammt. Sie wissen, dass er den derzeitigen Herrscher von Thallon, die Person namens Elia Canto, verachtet. Sie wissen, dass er den Ehrfurchtgebietenden, den Gott von ganz Thallon, um Hilfe bittet, das unbekannte, unnahbare Wesen, das von oben auf die Thallonianer herabschaut und ihnen bei ihrem erbärmlichen Leben zusieht.
Was, so fragen sich die Brüder, glaubt Shanter Khen, wird der Ehrfurchtgebietende tun? Elia Canto stürzen? Vielleicht wird der Ehrfurchtgebietende verkünden, dass Fa Cwan, Khens langjähriger Freund und Verbündeter, rechtmäßig den Thron besteigen sollte? Jeder weiß, dass Cwan den Thron schon lange begehrt und versucht hat, Unterstützer für die Durchsetzung seines Anspruchs zu versammeln. Zweifellos wäre Cwan bereit, Canto direkt herauszufordern. Er ist ein Krieger der alten Schule und hat keinerlei Bedenken, sich mit Canto bis zum Tod zu duellieren. Leider hat Canto nicht das geringste Interesse an derartigen Dingen. Er ist durch Cleverness und List dorthin gelangt, wo er jetzt ist. Außerdem verfügt Canto über eine kleine Armee, die ihm sowohl als Verbündete als auch als Leibwächter dient und die sich bereitwillig zwischen Cwan und einen eventuellen Anschlag auf Cantos Leben stellen würde. Ein physischer Angriff scheint also nicht das Mittel der Wahl zu sein.
Khen hatte vor über einem Monat ein längeres Treffen mit Cwan. Vielleicht ist »Treffen« nicht der richtige Ausdruck. »Saufgelage« wäre wohl eher angebracht. Die alten Freunde trafen sich, um Möglichkeiten zu besprechen, die sie verfolgen könnten, und der Alkohol floss in Strömen. Cwans Kater hielt eineinhalb Tage lang an.
Khen war überhaupt nicht verkatert, eine Leistung, die Cwan nie verstehen wird. Als Khen aufwachte, war er stattdessen so konzentriert wie nie zuvor. Er wusste ohne jeden Zweifel, dass er sich an den Ehrfurchtgebietenden wenden musste.
Auf den ersten Blick scheint dies eine lächerliche Vorstellung zu sein. So sehr der Ehrfurchtgebietende im Laufe der Jahre auch verehrt wurde, er trat nie wirklich in Erscheinung. In der Geschichte Thallons gab es eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen sich die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise entwickelten, nachdem Einzelne eindringlich zum Ehrfurchtgebietenden gebetet hatten. Der Ehrfurchtgebietende wurde dann prompt für den Erfolg verantwortlich gemacht. Einige thallonianische Philosophen meinten, das sei ein verdammt schlechtes Argument als Beweis für die Existenz des Ehrfurchtgebietenden, aber sie wurden hingerichtet und spielten daher in der Diskussion keine Rolle.
Aber Khen ist überzeugt, dass der Ehrfurchtgebietende weiterhin auf die Aktivitäten der Bewohner von Thallon herabschaut. Er glaubt, der Ehrfurchtgebietende wird eingreifen und seine Wünsche erfüllen, wenn er seine Bitten zielstrebig und ergeben genug vorbringt.
Er beschließt, dass dazu nur uneingeschränkte Hingabe nötig ist. Er muss dem Ehrfurchtgebietenden zeigen, dass nichts in ganz Thallon mit Khens Hingabe vergleichbar ist. Er muss zum Tempel des Ehrfurchtgebietenden gehen und ihn anbeten und anflehen, bis dieser tatsächlich in seiner ganzen Göttlichkeit erscheint und dafür sorgt, dass Cwan die Kontrolle über Thallon ergreift.
Zu diesem Zweck zieht sich Khen in den Tempel des Ehrfurchtgebietenden zurück, der zu seinem zweiten Zuhause wird. Die Brüder seines Ordens äußern sich besorgt über Khens Entscheidung, aber nur untereinander. Sie sagen kein Wort zu Khen, denn sie glauben, es sei ihre Pflicht, jedes Vorhaben, das mit dem Gebet zu tun hat, voll und ganz zu unterstützen. In den folgenden Wochen besuchen sie Khen abwechselnd in seiner Isolation, während er sich vor der großen Statue des Ehrfurchtgebietenden niederwirft. Er bleibt fast die ganze Zeit über so, nur zum Essen und Schlafen macht er Pausen. Er verbringt seine Zeit ausschließlich damit.
Während der ersten Woche akzeptieren sie sein neues Vorhaben und verdrängen ihre Sorgen über seine neue Besessenheit.
In der zweiten auch.
In der dritten Woche haben sie alle Versuche, ihre Bedenken zu verbergen, aufgegeben. Sie sorgen sich nicht darum, dass Khens Aktivitäten ein schlechtes Licht auf sie werfen könnten. Tatsächlich kümmert es niemanden, was Khen tut. Die Aktivitäten des Ordens sind nur selten von Interesse für Außenstehende. Dennoch machen sie sich Sorgen über seine Besessenheit. Es scheint, dass er sich von allem, was der Realität nahekommt, verabschiedet hat und sich stattdessen voll und ganz auf die unaufhörlichen Gebete zum Ehrfurchtgebietenden konzentriert. Aber da er der Anführer ihres Ordens ist, denken alle, dass es ihnen nicht zusteht, seine Hingabe infrage zu stellen.
Als die vierte Woche anbricht, beraten sich die Brüder und beschließen schließlich, dass etwas unternommen werden muss. Khen scheint schlicht den Verstand verloren zu haben und es obliegt seinen Brüdern, mit ihm zu reden. Nach einiger Diskussion wird beschlossen, dass Prätor Baan mit ihm sprechen soll. Baan ist das zweitälteste Mitglied des Ordens und kennt Khen am längsten.
Baan nähert sich dem Tempel des Ehrfurchtgebietenden. Er versteht nicht, warum Khen in diesen Geisteszustand verfallen ist. Natürlich glaubt Baan genauso an den Ehrfurchtgebietenden wie jeder andere in seinem Orden, aber er kann nicht verstehen, warum Khen unaufhörlich zu ihrem Gott betet. Es scheint einfach nicht richtig zu sein.
Der Tempel ist recht karg. An den Wänden stehen schlichte Bänke für die Gläubigen, aber im Moment ist niemand dort. Nur Khen ist anwesend und er hat die Bänke verschmäht. Stattdessen kniet er vor der Statue des Ehrfurchtgebietenden. Baan hatte erwartet, einen stetigen Strom von Gebeten zu hören, so wie es immer war, wenn er nach seinem Freund und Bruder sah. Aber zum ersten Mal seit Wochen betet Khen nicht. Er steht immer noch wie angewurzelt vor der Statue, aber er spricht kein einziges Wort. Baan wertet das als positives Zeichen. Wenn Khen mit seinem endlosen Flehen zum Ehrfurchtgebietenden aufgehört hat, ist es vielleicht möglich, mit ihm zu sprechen und ihn davon zu überzeugen, eine Pause von seinen Andachten einzulegen.
Baan kniet nieder und spricht leise und sanft zu Khen. »Wie geht es dir?«, fragt er.
»Gut«, antwortet Khen. »Sehr gut sogar.«
»Möchtest du zum Orden zurückkehren? Dort gibt es Essen für dich. Gutes Essen, nicht die Reste, von denen du dich ernährt hast.« Er macht sich nicht die Mühe, zu erwähnen, dass es dort auch ein Bad gibt. Das sollte Khen unbedingt in Anspruch nehmen, denn er riecht ziemlich übel. Außerdem ist sein rotes Gesicht von einem Bart bedeckt. Die Thallonianer achten peinlich genau darauf, sauber rasiert zu sein, und so ist der Anblick von Khens Gesicht wirklich schockierend. »Du kannst anständig essen, dich sauber machen. Du kannst …«
»Das ist alles nicht nötig«, sagt Khen, »denn ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich muss den Anweisungen des Ehrfurchtgebietenden gehorchen.«
Baan starrt ihn verständnislos an. »Was meinst du? Welche Anweisungen?«
Khen dreht sich um und sieht Baan zum ersten Mal an. Als er spricht, umweht sein fauliger Atem Baan und dieser kann nur mit Mühe verhindern, dass er davor zurückweicht. Khen packt Baan an den Schultern und setzt ein Lächeln auf, das seine Augen jedoch nicht erreicht. Baan findet das etwas beunruhigend, ist aber bereit, es darauf zurückzuführen, dass sein Freund in den letzten Wochen kaum geruht hat.
»Mein Freund, der Ehrfurchtgebietende hat zu mir gesprochen. Er hat meine Gebete erhört.«
»Er … Das hat Er?« Baan weiß nicht genau, wie er reagieren soll. Er betrachtet es als eine interessante Prüfung seines Glaubens. Könnte der Ehrfurchtgebietende wirklich zu Khen gesprochen haben? Natürlich kommuniziert jeder mit den Göttern auf seine eigene Weise. Es ist nicht angebracht, einen anderen der Lüge oder der Täuschung zu bezichtigen, wenn dieser glaubt, dass ein Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Die heiligen Bücher sind voll von Geschichten über Männer, die behaupten, im Namen göttlicher Anweisungen zu handeln, und diese Männer werden in der Regel als die Besten und Klügsten ihres religiösen Ordens angesehen. Daher steht es Baan nicht zu, Khens Behauptung infrage zu stellen. Dennoch verspürt er das Bedürfnis, weiter nachzuhaken. »Wie hat Er mit dir kommuniziert? Hat Er in deinem Geist zu dir gesprochen?«
»In meinem Geist? Nein, nein. Ganz und gar nicht. Er erschien genau hier, direkt vor mir, vor kaum einer Stunde. Er ist tatsächlich erschienen, Baan. Er stand vor mir, so real wie du jetzt.« Seine Stimme zittert vor Aufregung. »Ich muss zugeben, dass ich überrascht war. Ein Teil von mir hatte die Vorstellung aufgegeben, dass Er jemals tatsächlich zu mir kommen würde. Wenn man so lange gebetet hat wie ich, erscheint Seine tatsächliche Anwesenheit immer unwahrscheinlicher. Und doch, endlich, endlich …« Khen hält inne, anscheinend sind ihm die Worte ausgegangen. Sein rotes Gesicht leuchtet im fahlen Licht der untergehenden Sonne. »Er ist tatsächlich gekommen.«
Baan muss fragen. »Und was hat Er gesagt? Hat Er gesagt, dass er dir helfen wird, Cwan als neuen Anführer einzusetzen?«
Khen nickt. »Das hat Er. Er hat genau das gesagt. Aber …« Er verstummt.
»Aber was?«
»Er sagt, ich soll Ihm zeigen, dass mir nichts wichtiger ist, als Cwan als Herrscher einzusetzen.«
»Und wie sollst du Ihm das zeigen?«
»Ich muss ein Opfer bringen.«
Baan versteht das nicht. »Welche Art von Opfer? Wir haben uns zu religiöser Treue verpflichtet. Du hast nichts, was du opfern könntest.«
»Das ist nicht ganz richtig«, sagt Khen. »Es gibt eine Sache, die ich habe. Etwas, das für mich sehr wichtig ist. Etwas, das wir alle haben.«
»Was soll das sein?«
»Einander«, erwidert Khen.
Baan versteht immer noch nicht, wovon Khen spricht. Und er versteht es auch weiterhin nicht, bis Khens Hände sich plötzlich um seine Kehle legen. Baans Augen weiten sich vor Schreck und er sieht die Konzentration und Entschlossenheit in Khens Miene. In diesem Gesicht ist keine Spur des Mannes zu sehen, den er seit Jahren kennt. Da ist nichts von dem ruhigen, hingebungsvollen Mann zu sehen, der so lange an seiner Seite gebetet hat und mit dem er viele gelehrte Debatten geführt hat.
»Es tut mir so leid«, flüstert Khen. In seinem Gesicht ist keine echte Trauer zu erkennen, kein Bedauern in seinen Augen. Er konzentriert sich auf eine Sache und nur darauf: Baan zu erwürgen.
Baan versucht verzweifelt, Khen von sich zu stoßen. Er kann nicht atmen, da Khens Hände immer fester zudrücken. Baan fällt nach hinten, aber Khen geht mit ihm zu Boden. Sie fallen hin und Baan kämpft um sein Leben, indem er verzweifelt auf Khens Arme und Kopf einschlägt. Khens Kraft wächst, während die von Baan schwindet. Baan versucht zu sprechen, versucht um sein Leben zu betteln, aber er ist nicht in der Lage, andere Laute als erbärmliches Keuchen hervorzubringen. Er hämmert immer schwächer auf Khens Oberkörper ein. Schwärze senkt sich auf ihn hinab und sein letzter Gedanke, bevor ihm das Leben entgleitet, ist, dass der Ehrfurchtgebietende ein viel rachsüchtigeres und bösartigeres Wesen ist, als er es je für möglich gehalten hätte.
Khen würgt seinen Freund noch minutenlang, nachdem Baan gestorben ist, weil er nicht sicher sein kann, dass er die Tat vollbracht hat. Verständlich, wenn man bedenkt, dass Khen noch nie jemanden getötet hat. Er musste es noch nie tun und bis zu diesem Moment war er sich sicher, dass er dazu nie in der Lage sein würde. Es ist interessant, zu welchen Taten man fähig ist, wenn man von einem Gott den Auftrag erhält, sie als Beweis für die eigene Entschlossenheit auszuführen.
Schließlich lässt Khen in der Überzeugung, dass Baan wirklich tot ist, los und fällt auf sein Hinterteil. Er sitzt da und starrt auf Baans reglosen Körper. Langsam dämmert ihm das Ausmaß dessen, was er gerade getan hat. Er hat Baan seiner Zukunft beraubt. Es war vielleicht keine glorreiche, wenn man bedenkt, dass jeder von Baans Tagen identisch war mit dem Tag davor und dem Tag davor, und es war sehr wahrscheinlich, dass er in seiner gesamten Existenz nie etwas Wichtiges erreichen würde.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Baan ein guter und anständiger Mann war und es in keiner Weise verdient hatte, von jemandem ermordet zu werden, den er als Bruder betrachtete.
Scham steigt in Khen auf. Er ist nicht stolz auf das, was er getan hat, und er stellt überrascht fest, dass ihm die Tränen übers Gesicht rinnen. Seine Brust fängt an zu beben und es fällt ihm plötzlich schwer zu atmen. Was habe ich getan, was habe ich getan, geht ihm immer wieder durch den Kopf.
»Nun sieh einer an. Ich bin überrascht.«
Sein Kopf schnellt herum und er wirft sich sofort auf den Boden.
Der Ehrfurchtgebietende steht vor ihm. Er sieht ihn nachdenklich an, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Du hast viel versprochen«, fährt der Ehrfurchtgebietende fort, »aber ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass du meine Herausforderung annehmen würdest. Du hast noch nie getötet, nehme ich an.« Es scheint keine Frage zu sein, aber Khen schüttelt trotzdem schnell den Kopf. »Ja, das habe ich auch nicht angenommen. Du kommst mir nicht wie ein Mörder vor.«
»Ich habe getan, was du wolltest.« Khen stellt zu seiner Überraschung fest, dass er flüstert. Er gibt sich keine Mühe, seine Stimme wiederzufinden. Irgendwie scheint es angemessener zu sein, in der Gegenwart eines Gottes zu flüstern. »Ich habe einen getötet, der für mich wie ein Bruder war.«
»Ja, du hast ihn zweifellos umgebracht, das stimmt. Und zwar mit bloßen Händen. Was für eine Leistung. Und wie fühlst du dich dabei?«
»Ich fühle, was immer du wünschst, Erhabener.«
»Das ist nicht gerade die beste Antwort der Welt«, teilt ihm der Ehrfurchtgebietende mit. »Ich bevorzuge Leute, die in der Lage sind, selbst zu denken.«
»Ich habe mich dir hingegeben, Erhabener. Ich bin nicht mehr fähig, für mich selbst zu denken.«
Der Ehrfurchtgebietende kratzt sich nachdenklich am Kinn. »Ja. Ja, ich nehme an, das hast du. Also gut.« Er klatscht in die Hände. »Abgemacht ist abgemacht. Lass uns deinem Freund die Verantwortung übertragen.«
Khen ist voller Freude.
DAS SCHIFF
Überall lagen tote D’myurj und Brüder, mindestens ein Dutzend Leichen. Viele der D’myurj hatten schwere Verbrennungen erlitten, was höchstwahrscheinlich daran lag, dass Teile der Brücke explodiert waren. Ihre Kleidung war zerfetzt, die Haut weggebrannt.
Die Brüder waren in einer kaum besseren Verfassung. Sie trugen noch ihre Rüstung, aber es hatte eine Auseinandersetzung gegeben. Einen brutalen Nahkampf, wie es aussah, und der war deutlich zu Ungunsten der Brüder ausgegangen. Teile ihrer Rüstung waren aufgerissen worden wie mit einer Kettensäge. Calhoun hatte geglaubt, diese Rüstung wäre undurchdringlich, aber das stimmte offensichtlich nicht.
»Verdammt«, flüsterte Kebron. Meyer und Boyajian schien übel zu sein, aber sie rissen sich zusammen.
Die wie immer leidenschaftslose Soleta untersuchte die Leichen mit einem Trikorder. »Sie sind alle tot. Jeder einzelne von ihnen.«
»Wissen wir, wie sie gestorben sind?«
»Es gab einen Kampf. Sie haben verloren.«
Das war ziemlich offensichtlich.
Sie machte einen Schritt nach vorn und schrie überrascht auf. Jemand hatte nach ihrem Knöchel gegriffen. Sie ging neben dem D’myurj, der das getan hatte, in die Knie. Er lag auf dem Bauch und sie drehte ihn schnell um.
Calhoun trat ebenfalls vor. Ihm wurde übel, als er den Mann ansah. Seine Haut war so stark verbrannt, dass sein Gesicht nicht mehr zu erkennen war. Er hätte tot sein sollen und Calhoun konnte kaum fassen, dass er noch lebte. Das passte zu dem, was Halliwell gesagt hatte: Seine Lebenszeichen waren so schwach, dass sie den Instrumenten der Excalibur entgangen waren.
Er berührte sein Abzeichen. »Calhoun an Transporterraum. Es gibt einen Überlebenden. Beamen Sie ihn direkt zur Krankenstation.«
»Ja, Sir. Ich sage Bescheid, dass ein Patient unterwegs ist.«
Dem D’myurj gelang es, den Kopf Calhoun zuzuwenden. Ein Auge schien blind zu sein, das andere hatte noch ein wenig Sehvermögen und richtete sich auf Calhoun.
»Keine Angst«, sagte er. »Wir werden Ihnen helfen.«
Der Mund des D’myurj bewegte sich. Unter großen Mühen gelang es ihm, ein Wort hervorzubringen.
»Flieht.«
»Fliehen?«, wiederholte Calhoun. »Das verstehe ich nicht. Wovor sollten wir fliehen? Kommen die Kreaturen, die Ihnen das angetan haben, zurück? Sind Sie …?«
Er bekam keine Antworten auf seine Fragen. Plötzlich ertönte auf der Brücke das Summen eines Transporterstrahls und Sekunden später war der D’myurj verschwunden und ließ den Landetrupp zurück.
»Das klingt unheilvoll«, sagte Soleta.
»Allerdings.« Er tippte auf sein Abzeichen. »Calhoun an Excalibur.«
»Excalibur. Burgoyne hier.«
»Burgy, scannen wir weiterhin das Gebiet?«
»Aye, Sir«, meldete Burgoynes Stimme. »Keine Anzeichen für andere Schiffe in der Nähe. Wir sind allein.«
»Sollte sich daran etwas ändern, möchte ich das als Erster wissen.«
»Ja, Sir.«
Calhoun wandte sich an das Außenteam: »Schwärmen Sie aus. Suchen Sie jeden Zentimeter des Schiffs ab. Wenn noch jemand am Leben ist, informieren Sie mich.«
Kebron, Meyer und Boyajian machten sich auf den Weg, um zu sehen, was sie entdecken konnten.
Soleta blieb jedoch bei Calhoun. Er fand das etwas merkwürdig. »Wollen Sie sich nicht umsehen, Soleta? Nachsehen, ob es etwas zu finden gibt?«
»Ich halte das nicht für notwendig, Captain. Ich finde es klüger, wenn ich hier bei Ihnen bleibe.«
»Warum?«
Calhoun dachte, dass er sich das vielleicht nur einbildete, aber darüber zu sprechen schien ihr tatsächlich etwas unangenehm zu sein. Schließlich sagte Soleta: »Sie sind ungeschützt. Wir sind auf einem Schiff voller Feinde. Sie scheinen alle tot zu sein, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Wenn einer von ihnen angreifen sollte, brauchen Sie Schutz. Den kann ich Ihnen bieten.«
Calhoun zog eine Augenbraue hoch. »Sie glauben, ich sei unfähig, mich selbst zu schützen?«
»Sie sind der Captain des Schiffs und Ihre Sicherheit ist von größter Bedeutung. Es ist meine Pflicht, Sie zu schützen, wenn die Situation es erfordert.«
»Soleta, bei allem Respekt, ich kann mir nur schwer ein Szenario vorstellen, in dem ich Schutz bräuchte, den ich nicht selbst …«
Ihre Hand umklammerte seine Schulter, bevor er noch etwas sagen konnte, und dann wusste er nur noch, dass er langsam wieder zu sich kam. Er lag auf dem Deck der Brücke und sein Hinterkopf schmerzte, nachdem er ihn sich beim Sturz gestoßen hatte. Soleta befand sich auf der anderen Seite der Brücke und saß vor etwas, das wie eine Computerkonsole aussah. Sie versuchte offensichtlich, diese wieder in Gang zu bringen, schien aber keinen Erfolg zu haben. Sie sah herüber und bemerkte, dass er sich aufgesetzt hatte. »Gut. Sie sind wach«, sagte sie knapp.
»Was zum Teufel war das?«, fragte er.
»Das war ein Angriff. Sie waren nicht darauf vorbereitet und waren ziemlich schnell unterlegen. Sollte das in einer Kampfsituation passieren und Sie wären unvorbereitet, wären Sie bewusstlos und könnten sich nicht mehr schützen. Ich möchte nicht, dass das passiert.«
»Das hätten Sie nicht tun müssen.« Er stand auf und fühlte sich dabei ein wenig schwindelig.
»Ich denke doch, um meinen Standpunkt klarzumachen«, beharrte die Vulkanierin.
Er hätte Einwände vorbringen können, beschloss aber, dass es das nicht wert war. »Wie lange war ich weg?«
»Vier Minuten und siebenundzwanzig Sekunden. Ich hätte Sie noch viel länger außer Gefecht setzen können, aber ich war der Meinung, dass weniger als fünf Minuten ausreichen, um meine Bedenken deutlich zu machen.«
»Das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen.« Er rieb sich die Schulter, um die Durchblutung wiederherzustellen. »Kein Glück mit ihrem Bordcomputer?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe mein Bestes versucht, aber es ist mir nicht gelungen, darauf zuzugreifen. Das Schiff hat massive Schäden erlitten, auch am Zentralkern. Ehrlich gesagt ist es erstaunlich, dass die Schwerkraft und die Lebenserhaltung noch funktionieren. Es mag ein rudimentäres Computerprogramm geben, das die Dinge am Laufen hält, aber es ist sicher nicht in der Lage, uns zu sagen, was hier passiert ist.«
»Haben Sie eine Idee?«
»Captain«, sagte Soleta mit großer Geduld, »wir befinden uns in einem Taschenuniversum. Wir haben keine Ahnung, welche Völker es bewohnen. Wären wir wieder in unserem eigenen Universum, könnte ich sicherlich Vermutungen darüber anstellen, wer dafür verantwortlich ist. Aber hier? Ich habe keinen blassen Schimmer.«
Er erkannte, dass sie recht hatte. Es war unfair von ihm, sie unter Druck zu setzen, eine Erklärung zu liefern, die sie logisch betrachtet nicht liefern konnte. Er tippte noch einmal auf seinen Kommunikator. »Calhoun an Kebron.«
»Kebron hier.«
»Was haben wir, Zak?«
»Beeindruckend viel Nichts, Captain. Auf dem gesamten Schiff sieht es genauso aus wie auf der Brücke. Überall Leichen. Wer auch immer hier durchkam, hat die Besatzung des Schiffs ausgelöscht. Totale Zerstörung. Ich vermute, dass die Besatzung nicht einen Treffer landen konnte.«
»Warum sagen Sie das?«
»Keine feindlichen Leichen. Hier muss es einen Nahkampf gegeben haben. Das kann nicht vom Beschuss eines anderen Schiffs stammen, sonst wäre dieses Schiff in Stücke gerissen worden. Also müssen sie an Bord gekommen und die Besatzung in einen Kampf verwickelt haben.«
»Sie könnten die Leichen mitgenommen haben.«
»Könnten sie. Aber mein Trikorder sagt, dass das Blut nur von den D’myurj und den Brüdern stammt. Ich bezweifle, dass derjenige, der die Leichen mitgenommen hat, Zeit damit vergeudet hätte, ihr Blut aufzuwischen.«
Calhoun gab es nur ungern zu, aber das ergab Sinn. »In Ordnung. Suchen Sie weiter.«
»Ehrlich gesagt, Captain, gehen uns die Orte aus, an denen wir suchen könnten. Meyer und Boyajian haben auch nichts anderes gefunden.«
»Kommen Sie wieder zur Brücke. Wir kehren zurück zum …«
Plötzlich piepte sein Kommunikator. Jemand anders versuchte, ihn zu erreichen. »Kehren Sie auf die Brücke zurück. Beeilen Sie sich.« Der Captain wusste, warum er wollte, dass Kebron sich beeilte. Calhoun hatte einen recht verlässlichen sechsten Sinn, der ihn warnte, wenn Gefahr im Verzug war, und dieser war plötzlich angesprungen. Seine Nackenhaare stellten sich auf und das gefiel ihm gar nicht. Er tippte ein zweites Mal auf seinen Kommunikator. »Calhoun hier.«
»Captain, wir haben Gesellschaft«, war Burgoynes Stimme zu hören. »Sie sind gerade auf den Langstreckensensoren aufgetaucht, aber sie kommen unglaublich schnell näher. Sie sollten in zehn Sekunden hier sein.«
»Zehn Sekunden?« Calhoun konnte es nicht fassen. Was zum Teufel stimmte mit den Langstreckensensoren nicht?
Burgoyne beantwortete die unausgesprochene Frage. »Es liegt nicht an den Sensoren, Sir. Das Schiff bewegt sich einfach schneller als alles, was wir bisher erlebt haben … Und es ist hier. Verdammt.«
»Bericht.«
»Es ist riesig. Ich habe noch nie etwas so Großes gesehen. Es ist so groß wie zehn Raumschiffe. Captain, ich würde vorschlagen, dass wir ein Feuergefecht mit ihm vermeiden.«
»Die Excalibur ist getarnt?«
»Ja, Captain.«
Calhoun ging seine Optionen durch. Zugegeben, das Schiff konnte feuern, während es getarnt war, das war sein Vorteil. Aber es konnte den Transporter nicht aktivieren, während es unsichtbar war. Die einzige Möglichkeit, das Außenteam zurückzubeamen, bestand darin, die Tarnung fallen zu lassen. Wenn die Excalibur das tat, könnte sie sich allerdings in genau dem Feuergefecht wiederfinden, das Burgy vermeiden wollte.
»Bleiben Sie getarnt. Wir werden hier Verstecke finden, für den Fall, dass sie an Bord kommen. Tun Sie nichts, bis Sie von mir gehört haben. Calhoun Ende.« Dann tippte er wieder auf seinen Kommunikator. »Calhoun an Außenteam. Wir haben Besuch. Machen Sie sich möglichst unsichtbar, bis wir wissen, womit wir es zu tun haben.«
»Unsichtbar?«, kam Kebrons ungläubige Stimme zurück. »Captain, Sie wissen schon, wie ich aussehe?«
»Tun Sie Ihr Bestes. Calhoun Ende.«
»Captain«, sagte Soleta eindringlich.
Er wandte sich ihr zu und sah zu seiner Überraschung, dass sie neben einer offenen Tür stand, die in einen relativ kleinen Lagerraum führte. Darin befanden sich Waffen. Soleta war bereits dabei, die Waffen herauszuholen und sie auf die Leichen in der Nähe zu werfen, um den Anschein zu erwecken, dass sie im Kampf benutzt worden waren. »Kommen Sie schon«, drängte sie und nickte in Richtung des Lagers.
Er trat hinein, schnappte sich etwas, das eine Art großes Gewehr zu sein schien, und warf es zur Seite. Soleta sprang hinter ihm hinein und schlug die Tür zu. Es war kaum genug Platz für sie beide, aber Calhoun kam zu dem Schluss, dass sie damit auskommen mussten.
Oben in der Tür befanden sich mehrere schmale Schlitze, vermutlich um die Luft zirkulieren zu lassen. Sie waren gerade breit genug, um die Brücke zu beobachten und zu sehen, ob jemand hereinkam. Er hoffte, dass es nicht so weit kommen würde. Im Idealfall war das neue Schiff nur auf der Durchreise und würde ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Er hatte jedoch das Gefühl, dass es nicht so kommen würde, denn dazu hätten sie ein wenig Glück haben müssen und das war leider nicht sehr oft der Fall.
Lange Minuten vergingen und mit jeder Minute wuchs in Calhoun die Hoffnung, dass sie eine Konfrontation mit Fremden, über die sie absolut nichts wussten, doch vermeiden könnten. Er sah zu Soleta und stellte fest, dass sie ihn anstarrte. Nicht nur das, ihre Nähe schien zu einem Problem zu werden. »Alles in Ordnung?«, flüsterte er.
Die Vulkanierin antwortete nicht sofort, als wäre sie sich nicht bewusst, dass er sie angesprochen hatte. Dann blinzelte sie, als hätte sie gedacht, er würde mit jemand anders sprechen. »Was? Ach. Ja. Es geht mir gut.«
Seiner Meinung nach ging es Soleta nicht gut. Aber er konnte keine weiteren Fragen stellen, denn plötzlich hörten sie das Summen von Energie, das sich wie Transporterstrahlen anhörte. Aber der Ton war anders. Höher.
Das Licht des Transporters war so hell, dass Calhoun den Blick abwenden musste. Soleta jedoch tat das nicht. Sie starrte direkt durch die Schlitze, das Licht schien ihr direkt ins Gesicht und sie blinzelte nicht einmal. Die vulkanische Sonne war viel heller und deshalb waren ihre Augen deutlich unempfindlicher als die von Calhoun. »Wir haben Besuch«, flüsterte sie ganz leise.
Die Helligkeit schwand schließlich und Calhoun spähte durch die schmalen Schlitze nach draußen, um zu sehen, wer angekommen war. Er befürchtete, dass es noch mehr D’myurj sein könnten und dass sie, nachdem sie das Gemetzel gesehen hatten, das ihrer Art widerfahren war, vorrangig herausfinden wollen würden, wer eine solch grausame Tat begangen hatte. Wenn sie Calhoun und Soleta fanden, würden sie sie wahrscheinlich beschuldigen und sofort hinrichten. Das war kein sehr ermutigendes Szenario.
Er war überrascht und erleichtert zugleich, als er sah, dass es weder die D’myurj noch die Brüder waren. Aber als er die Neuankömmlinge musterte, wurde ihm klar, dass ihre Situation womöglich noch schlimmer war.
Dies waren ohne Frage die am bedrohlichsten aussehenden Krieger, die Calhoun je gesehen hatte.





























