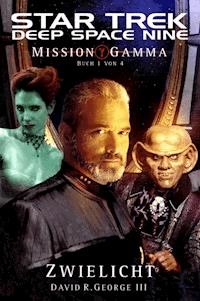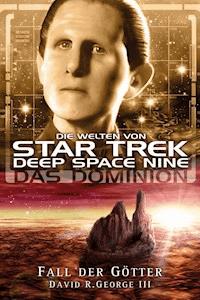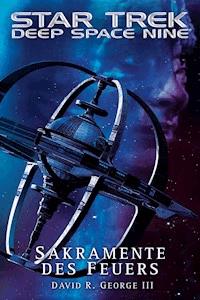Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Star Trek - Typhon Pact
- Sprache: Deutsch
Nachdem die letzte Borg-Invasion ganze Welten zerstört, dreiundsechzig Milliarden Personen das Leben gekostet und der Sternenflotte einen lähmenden Schlag versetzt hatte, haben sich sechs der Vereinigten Föderation der Planeten feindlich gesinnte Nationen zum Typhon-Pakt zusammengeschlossen: das Romulanische Sternenimperium, die Breen-Konföderation, die Tholianische Versammlung, die Gorn-Hegemonie, die Tzenkethi-Koalition und der Heilige Orden der Kinshaya. Beinahe drei Jahre fochten die Föderation und die Klingonen als Verbündete innerhalb des Khitomer-Abkommens mit dem benachbarten Bündnis, dem Typhon Pakt, einen vorwiegend kalten Krieg aus. Doch als die Sternenflotte wieder aufgebaut wird, werden Splittergruppen innerhalb des Paktes nervös aus Sorge um ihre Unfähigkeit, einen Quanten-Slipstream-Antrieb zu entwickeln, der sich mit dem der Föderation messen kann. Werden Anführer wie Föderationspräsidentin Bacco und der romulanische Praetor Kamemor einen anhaltenden Frieden bewirken, oder wird sich der kalte Krieg zwischen den beiden Allianzen verschärfen, und eventuell zu einem ausgewachsenen heißen Krieg führen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STAR TREK™
TYPHON PACT
HEIMSUCHUNG
DAVID R. GEORGE III
Based uponStar Trek and Star Trek: The Next Generationcreated by Gene RoddenberryandStar Trek: Deep Space Ninecreated by Rick Berman & Michael Piller
Ins Deutsche übertragen vonChristian Humberg
Die deutsche Ausgabe von STAR TREK – TYPHON PACT: HEIMSUCHUNGwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, Übersetzung: Christian Humberg; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Andrea Bottlinger und Gisela Schell; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: Doug Drexler; Print-Ausgabe gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice. Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe:STAR TREK – TYPHON PACT: PLAGUES OF NIGHT
German translation copyright © 2014 by Amigo Grafik GbR.
Original English language edition copyright © 2012 by CBS Studios Inc. All rights reserved.
™ & © 2014 CBS Studios Inc. © 2014 Paramount Pictures Corporation. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
This book is published by arrangement with Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc.,pursuant to an exclusive license from CBS Studios Inc.
Print ISBN 978-3-86425-284-6 (März 2014) • E-Book ISBN 978-3-86425-319-5 (März 2014)
WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.STARTREKROMANE.DE · WWW.STARTREK.COM
Macbeth:
Hofft Ihr nun nicht, dass Eure Kinder Könige Sein werden, da derselbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es Euch verhieß?
Banquo:
Hum! Stünd’ es so, möcht’ es Euch leicht verleiten, Den Cawdor zu vergessen und die Krone Zu suchen. – Es ist wunderbar! Und oft Lockt uns der Hölle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Verderbens Rand. Uns zu Verbrechen fürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen!
– William Shakespeare, Macbeth, Akt 1, Szene 5
Und jeder Tag bringt eine neue Dunkelheit –Eine Täuschung, einen VerratOder schlichte Brutalität –Zusammengefügt wie Plagen der Nacht.
– K. C. Hunter, Himmelszyklen. In: Nyx und Eos
INHALT
AB INITIO
I FURCHT UND ZWEIFEL
APRIL 2382
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
JUNI 2382
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
AUGUST 2382
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
OKTOBER 2382
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
II UNSRE BLÖSSE
FEBRUAR – APRIL 2383
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
JUNI 2383
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
AUGUST 2383
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
TRANSITUS
DANKSAGUNG
ÜBER DEN AUTOR
WENN DAS GLEICHGEWICHT DES SCHRECKENS BRÜCHIG WIRD
ROMANE BEI CROSS CULT
AB INITIO
Ein Fluss aus Feuer flutete den Gang. Durch die Schottfenster sah man uniformierte Sternenflottenoffiziere vor der Explosionswelle fliehen. Sie waren nicht schnell genug. Die Flammen packten sie, umhüllten sie, bis niemand mehr leben konnte.
Subcommander Orventa T’Jul stand vor dem Hauptmonitor auf der Brücke der Dekkona, des romulanischen Schiffes, dessen Kommandozweite sie war. Seite an Seite mit Marius, ihrem Vorgesetzten, verfolgte sie das Drama, das sich auf Utopia Planitia abspielte. Das Kernstück der Flottenwerft, eine Raumstation, umkreiste den vierten Planeten des Sol-Systems und lag somit im Herzen der Föderation. Am unteren Monitorrand ragte die überwiegend öde Welt ins Bild, ein rostroter Bogen, auf dessen nachtschwarzer Seite hier und da Lichter prangten – Städte. Über Sol IV hing eine stattliche Menge Raumschiffe in verschiedenen Fertigungsphasen in den Docks. Sie zeugten von den anhaltenden Bemühungen der Sternenflotte, die im Vorjahr von den invasorischen Borg verursachte Zerstörung auszugleichen. T’Jul fragte sich, wie viele dieser Schiffe wohl mit dem revolutionären Slipstream-Antrieb ausgestattet waren und wann die VFP diesen taktischen Vorteil gegen Romulus ins Feld zu führen beabsichtigte. Der Gedanke erinnerte sie daran, wie wichtig ihre Mission unter Commander Marius war.
»Sie verlieren Atmosphäre«, berichtete Centurion Kozik von der taktischen Konsole. Die Brücke war in grünliches Licht getaucht. Die Tarnvorrichtung des Schiffes war aktiv.
»Sehr gut«, sagte Marius neben T’Jul. »Der Damm bekommt seinen ersten Riss.«
T’Jul sah zu der schmalen Röhre, die eine der vier äußeren, hemisphärischen Module der Station mit ihrem großen, zylindrischen Kern verband. Etwa nach zwei Dritteln der Röhre war ein schartiger Riss entstanden, und Luft strömte ins Vakuum. Wahrscheinlich waren die Notschotten längst zugefallen. Und bedeutete dieser blauweiße Energieblitz dort nicht, dass ein Kraftfeld erschien, den Riss zu versiegeln?
Sie ahnte den nächsten Befehl ihres Kommandanten und sah zu ihm. Marius nickte.
»Bringen Sie uns in Position«, gab T’Jul an Lieutenant Torlanta weiter. Die Konsole der Pilotin befand sich auf der Steuerbordseite der Brücke, dicht vor dem Hauptschirm.
Sofort flogen Torlantas Finger über das Interface. »Ja, Subcommander.«
T’Jul widmete sich wieder dem Monitor, dessen Bild sich analog zu den Bewegungen der Dekkona veränderte. Ihr war, als fühle sie das raubvogelhafte Schiff erwachen und spüre das Feuer der Schubdüsen, die es näher zur Station manövrierten. T’Jul genoss diese Empfindung, sehnte sich einmal mehr nach einem eigenen Kommando, einem eigenen Schiff und einer Besatzung, die ihre Befehle so selbstverständlich in Taten umsetzte wie ihr zentrales Nervensystem ihre Gedanken in Bewegungen.
Utopia Planitia wuchs und wuchs auf dem Bildschirm und glitt dann nach unten weg. Die Dekkona flog am zylindrischen Stationskern entlang und erreichte die zweite, obere Anordnung: vier weitere, schlanke und im Kreis angeordnete Arme, an deren äußeren Enden jeweils zwei kuppelförmige Konstrukte prangten.
Marius drehte sich um und stieg die Stufen zum Kommandosessel hinauf. »Auf Extraktion vorbereiten«, befahl er, kaum dass er saß.
»Verstanden.« T’Jul nickte knapp. Der kritischste Moment ihres Auftrages war nah. Schnell trat sie zu ihrer Konsole an der Backbordseite der Brücke und ließ Lieutenant Rixora eine entsprechende Nachricht zukommen.
Hoffentlich erfüllte der Agent der Breen seinen Teil der Mission. Wie die Explosion zeigte, war er in die entscheidende Phase gelangt. Schon bald würde es präzisester Absprachen zwischen Kazren und der Dekkona-Besatzung bedürfen, sie zu beenden.
T’Jul machte auf dem Absatz kehrt und hielt auf eine der hinteren Brückentüren zu. Just als diese vor ihr aufglitt, meldete sich Lieutenant Korvess von der Kommunikationskonsole, die steuerbord neben der Taktik lag. »Commander, laut stationsinternem Komm-Verkehr steht die Ergreifung des Agenten kurz bevor.«
Besorgt blieb T’Jul stehen, blickte zurück. Marius sah die stämmige, ältliche Korvess an. Diese hatte einen Finger am Ohrstöpsel, der ihr aus dem grauen Haar ragte.
Marius schien etwas erwidern zu wollen, doch Kozik kam ihm zuvor. »Das Patrouillenschiff der Sternenflotte aktiviert seinen Traktorstrahl.«
»Haben sie uns entdeckt?«, verlangte Marius zu wissen.
T’Jul war, als zöge sich ihr Magen zusammen. Mit der modernsten Variante der Tarnvorrichtungen sollten Schiffe wie die Dekkona für die Föderation eigentlich unauffindbar sein, doch bislang hatte kein Romulaner diese in der Praxis getestet. Das Patrouillenschiff – die U.S.S. Sparrow – mochte genauso gut Positronen oder andere Partikel verfolgen und der Dekkona so näher kommen.
Kozik hantierte an seiner Konsole herum. »Ich glaube, nicht«, antwortete er dann. »Das Patrouillenschiff bewegt sich ni…«
Ein grelles Licht füllte den Hauptmonitor aus und ließ Kozik verstummen. T’Jul sah, wie sich ein gewaltiger Feuerball aus dem unteren Stationskern löste. Trümmerstücke und brennende Atmosphäre jagten der Sparrow entgegen, erreichten sie binnen Sekunden. Das Sternenflottenschiff erbebte unter der Wucht des Ansturms, schien jedoch kaum Schaden zu nehmen.
Dasselbe ließ sich nicht über die Station selbst sagen. Ein großes Loch klaffte im unteren Viertel ihres zylindrischen Kerns, und die Kuppel, in der er endete, war beinahe abgetrennt worden. Sämtliche Lichter im Stationsinneren, so schien es, erloschen kurz. Nur oberhalb der beschädigten Region kehrte das Licht zurück.
»Utopia Planitia hat keine Schilde mehr«, sagte Kozik.
»Los!«, befahl Commander Marius. »Bringen Sie uns zum Treffpunkt. Sofort.«
T’Jul wartete nicht auf die ohnehin obligatorische Bestätigung des Befehls. Sie eilte von der Brücke, passierte die Luke zur Rettungskapsel, und erreichte einen der beiden parallel verlaufenden Korridore, die in den Bauch des Schiffes führten. Mattgrauer Teppich bedeckte den Boden. Rechts und links von ihr führten weitere Türen in weitere Räume, bis nach zwei Dritteln des Weges eine Schleuse kam. Der Korridor war leer, befanden sich doch alle auf ihren Positionen.
T’Jul eilte voraus. Sobald sie den Turbolift passierte, wurde aus dem schnellen Schritt ihrer langen Beine ein Lauf, der sie vorbei an Konferenzräumen, Ingenieurstationen, Ausrüstungskammern, Waffenschränken und Transporterräumen führte.
Die zweite Explosion hätte nicht so schnell folgen sollen, dachte T’Jul. Kazrens Plan zufolge lenkte die erste von seinem Datendiebstahl im Computersystem der Werft ab, Explosion zwei deaktivierte dann die Schilde, sobald er den Treffpunkt erreichte. Zwischen beiden sollten mehr als ein paar Augenblicke liegen. Er steckt in Schwierigkeiten, folgerte sie. Und mit ihm die gesamte Mission.
Die große Luke, die den vorderen Gangbereich vom hinteren trennte, öffnete sich, kaum dass T’Jul sich ihr näherte. Der Subcommander trat über die Schwelle, den Blick aufs Ziel gerichtet. Links ging eine zweiflügelige Tür ab, hinter der die jüngste Anschaffung der Dekkona wartete. In der gesamten Imperialen romulanischen Flotte besaß kein weiteres Schiff derart fortschrittliche Technik.
In die Wand neben der Tür war eine Sicherheitstafel eingelassen. T’Jul presste ihre Handfläche dagegen. Rotes Licht leuchtete auf, als der Scanner ihren Abdruck analysierte, dann erschienen Angaben aus ihrer Dienstakte auf dem kleinen Display daneben: Rang, Dienstnummer, Posten. Ein Foto ihres Gesichts begleitete die stichwortartige Auflistung ihres Lebens bei der Flotte. Mit ihrem brünetten Haar und den grünen Augen war T’Jul eine Ausnahme unter den Romulanern. Ihre Frisur unterstrich diesen Status, trug sie das Haar doch merklich länger und lockerer als die meisten ihrer Mitbürger. Im Militär erntete sie gleichermaßen Lob wie Tadel für diesen offen zur Schau gestellten Individualismus. Schon oft hatte sie sich gefragt, ob sie erst dann ein eigenes Kommando bekam, wenn sie sich den Konventionen beugte. T’Juls Leistungen empfahlen sie mehr als deutlich für die Commander-Würde. Sie wusste nicht, was sie noch tun sollte, um sich diesen Rang endlich zu verdienen.
Das harte, metallische Geräusch sich öffnender Türschlösser riss T’Jul aus ihren Gedanken. Die Türflügel verschwanden in der Wand, sie konnte eintreten. Kaum befand sie sich im Inneren des Phasenübergang-Kontrollraums, glitt die Tür wieder zu. Der Kontrollraum wurde von einer großen Plattform bestimmt, einer Art Tisch. Auf diesem lag ein elaboriertes Geflecht aus silbrig-dünnen Röhren, das bei T’Jul Assoziationen an ein tholianisches Energienetz weckte. Im Zentrum des Mechanismus erspähte sie sechs schwarze Flächen – zwei oben, zwei längs, zwei hinten – von denen jede an vier der Röhren grenzte.
In der rechten Kabinenwand prangte ein Monitor und zeigte einen Ausschnitt der Außenhülle Utopia Planitias. Auf dem Deck darunter stand eine Art Kiste, deren Front mit unleserlichen Lettern beschrieben und in deren Oberseite eine Tastatur eingelassen war. An der linken Wand des Raumes standen zwei Offiziere – die Lieutenants Diveln und Rixora – an einer langen, frei stehenden Konsole. T’Jul kam sofort zur Sache. »Zeigen Sie mir das Schiff«, befahl sie und deutete auf den Monitor.
»Ja, Subcommander«, sagte Diveln. Auf dem Bildschirm erschien eine Simulation der getarnten Dekkona vom Heck des Schiffes aus gesehen und vor dem Hintergrund Utopia Planitias. Die Dekkona präsentierte dem Betrachter ihren langen Bauch, und am Bildende erstreckte sich einer der Verbindungsgänge der Station von ganz rechts nach ganz links. Je näher das Schiff dem Stationskern kam, desto größer wurde er. Dann stoppte die Dekkona.
»Wir sind in Position, Subcommander«, sagte Rixora. »Allerdings erfassen wir das Signal des Agenten nicht länger.«
»Wir versuchen’s mit Plan B«, befahl T’Jul und sah die zwei Offiziere scharf an. »Passive Sensoren. Beschränken Sie sich auf den Stationsbereich, in dem der Treffpunkt liegt, verstanden?« Nur für diesen Zweck waren Kazrens physische Parameter im Computer gespeichert.
»Ja, Subcommander«, sagte Rixora. »Beginne den Scan.«
Commander Marius würde nichts riskieren, sollten sie Kazren so nicht aufspüren. Nicht einmal aktive Sensorik wäre für ihn eine Option, das wusste T’Jul. Ein Erfolg der Mission würde dem Imperium große Vorteile bringen, doch übertriebener Wagemut mochte zur Vernichtung der Dekkona und ihrer Besatzung führen – wenn nicht sogar zu Gefangenschaft. Marius ließ die Mission lieber scheitern, als dieses Risiko einzugehen. Als Praetor Tal’Aura den Plan vor einiger Zeit bewilligt hatte …
»Subcommander«, meldete sich Rixora. »Ich habe den Agenten lokalisiert. Er lebt und befindet sich nahe dem Treffpunkt. Er bewegt sich nicht.«
Weil seine Verfolger ihm dicht auf den Fersen sind, vermutete T’Jul. »Ist er allein?«
Rixora berührte einige Tasten. »Ja. Bislang.«
T’Jul wollte Kazrens Lage besser einschätzen können und dafür einen breiteren Sensorscan anordnen. Das barg allerdings eine Gefahr, die Marius nicht gefallen würde, machte es die Dekkona doch leichter auffindbar. Und fehlte ihnen nicht ohnehin die nötige Zeit? Je früher sie aus dem Sol-System aufbrachen, desto größer war ihre Chance, den Föderationsraum unbeschadet zu verlassen.
»Bringen Sie uns rein«, befahl sie.
»Ich signalisiere der Brücke, dass wir die Flugkontrolle übernehmen«, sagte Diveln. »Aktiviere Schubdüsen.«
T’Jul sah zum Monitor, wo sich das Bild des getarnten Schiffes einmal mehr der Raumstation näherte. Diveln betete den schwindenden Abstand herunter, zählte in Zehnerschritten von hundert Einheiten abwärts. Bei fünfzig glitt die Brücke der Dekkona über Utopia Planitias Verbindungsarm hinweg. Bei zwanzig bestätigte Rixora Kazrens Standort und Status. Bei zehn schwebte der lange Hals der Dekkona – in dem auch der Raum für die Phasenübergang-Kontrolle lag – mittig über dem Verbindungsstück. Wie es Commander Marius’ Plan erforderte, wurde es Zeit für den finalen Befehl.
»Rührt sich Kazren noch immer nicht?«, fragte T’Jul. »Ist er nach wie vor allein?«
Rixora konsultierte ihre Konsole. »Ja, Subcommander.«
»Dann beginnen Sie die Übernahme.«
»Übernahme beginnt«, erwiderte Rixora.
Auf der Plattform kam Bewegung in die Silberstäbe. T’Jul sah, wie sich die Röhren, die an die schwarzen Flächen grenzten, ausdehnten und zusammenzogen. Als sie ihre gewünschte Form erreicht hatten, sortierten sie sich in der Flächenmitte zu einer Art Rechteck zusammen – in das gerade so ein stehender Humanoider passte.
Diveln zählte weiter, von zehn herunter. T’Jul blickte erneut zum Hauptmonitor, wo die stilisierte Dekkona auf den Verbindungsarm niedersank. Das Schiff ging sehr langsam vor, doch T’Jul wappnete sich trotzdem für eine Kollision. Sie misstraute der neuen Technik ein wenig. Dann aber glitt der Raumschiffhals wie geplant über den Stationsarm hinweg, und die Dekkona stoppte.
»Übernahmepunkt erreicht«, sagte Rixora. »Starte Phasenübergang.«
Die neue romulanische Tarnvorrichtung ermöglichte mehr als Quasi-Unsichtbarkeit. Sie veränderte die Materiestruktur der getarnten Objekte, wodurch diese andere Materie durchdringen konnten. Der kleine, von den dunklen Flächen begrenzte Zwischenraum zwischen den Röhren befand sich momentan auf der Station Utopia Planitia im Normalraum rings um den Breen-Agenten.
Der Fuß der Plattform erstrahlte plötzlich in gleißendem Weiß. T’Jul sah die Luft im Innern des Rechtecks flimmern. Amorphe Kleckse blaugrüner Färbung entstanden und formten die Gestalt eines Mannes. Als das Gleißen verging, bogen sich die Flächen zur Seite, und Kazren stand da. Sein Körper war in einen anderen Phasenzustand eingetreten.
T’Jul sah zu Diveln und Rixora. »Entfernen wir uns von der Station. Richten Sie Commander Marius aus, dass wir zum Übergabeort aufbrechen können.«
»Ja, Subcommander«, sagte Rixora.
Kazren trat von der Plattform und auf T’Jul zu. Wo sie groß und schlank war, hatte der Breen eine eher stämmige, kompakte Figur. Seine großen grünen Augen und seine bronzefarbene Haut kontrastierten mit dem dünnen weißen Haar auf seinem Kopf. »Subcommander«, sagte er und zog einen föderationstypischen isolinearen Chip aus einer Tasche seines blauen Ingenieuroveralls. »Wir haben unser Ziel erreicht.«
Der gefährlichste Teil der Mission war überstanden. Begeisterung wallte in T’Jul auf, als sie daran dachte, was das für das Romulanische Imperium bedeuten mochte. Sie wollte gerade nach dem Datenträger greifen, als Kazren die Faust darum ballte. »Unser Befehl lautet, die Pläne direkt nach Salavat zu bringen«, sagte er.
»Selbstverständlich«, erwiderte T’Jul und bemühte sich, ihren Frust zu verbergen. Salavat war eine Welt der Breen-Konföderation, doch Commander Marius wollte die gestohlenen Daten fürs Romulanische Imperium. Er befürwortete die Allianz zwischen Romulus und den fünf anderen Nationen des Typhon-Paktes zwar, hatte allerdings schon oft erklärt, wie schwer es ihm fiel, Fremden zu vertrauen.
T’Jul widerstand dem Impuls, Kazrens Hand zu packen und die Faust mit Gewalt zu öffnen. Der Breen hatte die Pläne des Quanten-Slipstream-Antriebs besorgt, das musste fürs Erste genügen. Und so lange Kazren auf Marius’ Schiff war, würde es das auch.
»Gestatten Sie, Subcommander?«, fragte der Agent und deutete auf die kleine Kiste unter dem Monitor.
»Unbedingt«, erwiderte T’Jul und hoffte, ihr Nicken wirkte großzügig.
Kazren steckte den isolinearen Chip zurück in seine Tasche und trat zu der Kiste, wo er einen Code eingab. Signallaute bestätigten die Reaktion des Verschlussmechanismus. Der Breen hob den Deckel von der Kiste und entnahm ihr einen Ganzkörperanzug. T’Jul hatte gehört, dass diese Kleidungsstücke als Kälteanzüge bezeichnet wurden. Sie erzeugten für ihre Träger eine Umgebungstemperatur, die der Kälte der Breen-Heimatwelt glich. Überraschenderweise hatte Kazren den Anzug während der mehr als zweihundert Tage gar nicht gebraucht, die er auf Utopia Planitia als ziviler Ingenieur verbracht hatte. T’Jul fragte sich, ob auch die wenigen anderen Dinge, die sie über die Breen zu wissen glaubte, falsch waren.
Kazren zog das Kleidungsstück an und setzte den schnauzenförmigen Helm auf, den seine Leute ausnahmslos alle trugen. Die Sachen ließen ihn schlanker und größer wirken. Als elektronisches Rauschen aus seinem Helm drang, übertrug T’Juls Universalübersetzer es in Worte. »Danke, Subcommander.«
Sie nickte erneut und sah zu dem horizontalen grünen Leuchtfeld gleich über der Schnauze seines Helmes. Dort mussten seine Augen sein.
»Wurde mir bereits ein Quartier zugewiesen?«, fragte er. »Ich bin erschöpft.«
T’Jul deutete in Richtung der Kontrollkonsole am anderen Raumende. »Lieutenant Diveln wird Sie hinführen.«
Kazren verneigte sich knapp und folgte Diveln dann zur Tür.
»Trop Kazren«, bediente sich T’Jul seines Titels, dessen Bedeutung sie nicht kannte. Sofort blieb der Breen stehen. »Sobald Sie sich eingerichtet haben, würde Commander Marius gern mit Ihnen sprechen. Bevor Sie sich zur Ruhe legen.« Schliefen Breen im Liegen? T’Jul wusste nicht einmal das. Schliefen sie überhaupt?
»Selbstverständlich«, sagte Kazren. »Ich erwarte seinen Besuch.« Dann trat er mit Diveln in den Flur.
T’Jul sah zu Rixora, die die Phasenübergang-Konsole wieder sicherte. Auf dem Monitor hatte das Sternenfeld die Flottenraumstation bereits abgelöst. Das beruhigte T’Jul ein wenig. Die Dekkona war für ihren Geschmack schon zu lange in feindlichem Gebiet. Gut, dass sie sich nun – wenn schon nicht gen Heimat – in die freundlichen Provinzen eines Alliierten aufmachen durfte.
Im Korridor schlug der Subcommander den Weg zur Brücke ein. Sie wollte Commander Marius einen Lagebericht geben. Dann, das ahnte sie, würde sie ihn zu Kazrens Gästequartier begleiten, wo der Commander einen umfassenden Bericht des Breen erwartete. Einmal mehr dachte sie an die Slipstream-Pläne, und einmal mehr begeisterte sie der Gedanke.
T’Jul dürstete es nicht nach einem Krieg, sie verstand und respektierte das Gleichgewicht der Mächte. Trotz der weiterentwickelten Tarnvorrichtung der romulanischen Flotte hatte die Föderation mit dem Quanten-Slipstream-Antrieb einen entscheidenden Vorteil besessen. Sobald Commander Marius den Breen an seine Konföderation übergeben konnte, die Pläne an deren Ingenieure gingen und diese aus den technischen Daten Wirklichkeit erschufen, würde sich alles ändern.
Nein, T’Jul wollte keinen Krieg. Sollte es jedoch zu einem kommen, wollte sie ihrer Seite den Sieg garantieren. Sie würde tun, was immer sie konnte, damit das Romulanische Sternenimperium und der Typhon-Pakt triumphierten.
I
FURCHT UND ZWEIFEL
Banquo:
Uns erschüttern Furcht und Zweifel.Hier in der großen Hand des Höchsten steh’ ich,Und unter diesem Schirme kämpf’ ich jederBeschuldigung entgegen, die VerrathUnd Bosheit wider mich ersinnen mögen!
– William Shakespeare, Macbeth, Akt II, Szene 3
APRIL 2382
1
Kasidy Yates sah eine Welle aus Feuer auf sich zurasen. Trümmerstücke der Außenhülle tanzten zwischen den Flammen, die sich mit unerbittlicher Macht an der Atmosphäre und dem Leib der geschundenen Raumstation gütlich taten. Immer weiter stieg die Flut, bis sie den gesamten Monitor ihrer Komm-Konsole ausfüllte, erst dann wechselte die Aufzeichnung zu einem Anblick der Explosionsfolgen. Kas sah die Station nun von außen, den roten Mars im Hintergrund, und das Feuer hatte wenig von ihrem Kern übrig gelassen. Die große Kuppel am Ende von Utopia Planitia, dunkel und scheinbar verlassen, hing nur noch gerade so am Rest der Station.
Kasidy war, als greife eine eiskalte Hand nach ihrem Herzen, um es zu zerdrücken. Den Nachrichten zufolge war es auf der Werft zu einem Industrieunfall gekommen. Die Sternenflotte blieb die Zahl der Opfer bislang schuldig, doch Kasidy ahnte, dass es welche gegeben hatte – sogar viele.
Sie hieb regelrecht nach den Tasten der Konsole, als sie sie deaktivierte, dann schob sie sich von der Wand. Die Rollen unter ihrem Sitz glitten nahezu geräuschlos über den Parkettboden. Kasidy stand auf und trat zum Fenster des kleinen Raumes. Er diente ihr als Büro, wurde aber zum Gästezimmer, wann immer Besucher über Nacht blieben. Gerahmte Fotografien von Verwandten, Freunden und besonderen Orten zierten die Wände, und das Sofa an der linken Wand ließ sich zu einem bequemen Bett umfunktionieren.
Am Fenster angekommen, schob sie die weinfarbenen Vorhänge beiseite und sah nach draußen. Kaum öffnete sie es, wehte ihr ein warmer Luftzug entgegen und brachte die bittersüßen Düfte des Herbstes mit. In der Ferne, auf den steilen Hängen der Kendraprovinz, paradierten die Skelette entkleideter Bäume über das gelb werdende Gras, auf dem das Rot, Ocker und Gold gefallener Blätter ruhte. Erst vor drei Wochen war der Himmel plötzlich blass geworden, als stünde der Winter unmittelbar bevor. Doch seit einigen Tagen schien des Sommers Himmelblau auf Rückkehr aus zu sein, und die höheren Temperaturen brachten einen kleinen Aufschub, bis der Schnee das Land bald wieder bedecken würde.
Kasidy konzentrierte sich auf die Aussicht hinter dem Haus, zwang die Gedanken an Utopia Planitia beiseite. Rechts konnte sie den gewundenen Fluss Yolja auf seinem Weg gen Süden erkennen. Flache Täler und dichte Wälder lagen noch vor ihm, bis er das türkisfarbene Wasser des Ozeans Korvale erreichte. Links des Hauses stand ein Anbau, den Kasidy in den vergangenen sechs Monaten hatte errichten lassen, architektonische Frucht ihrer kreativen Energie. Die überdimensionierte Scheune beherbergte inzwischen die Rettungskapsel, die Nog vor einer ganzen Weile für planetenbasierte Notfälle modifiziert hatte. Nog war ein guter Freund. Als Kasidy noch schwanger und allein gewesen war, hatte ihn die Sorge geplagt, der hiesige Transporter könne ausfallen und Kasidy müsse die paar Kilometer bis zum Dorf Adarak zu Fuß zurücklegen. Sechs Jahre war das nun schon her. Damals war Ben noch nicht von seinem mysteriösen Ausflug ins bajoranische Wurmloch zurückgekehrt.
Ben.
Schon der Gedanke an ihn tat weh.
Nein, nicht nur weh. Über ein Jahr war ihr Ehemann nun schon fort, und noch immer weckte er in ihr eine komplexe Mischung von Emotionen. Kasidy entsann sich lebhaft seines letzten Besuchs – und wie sie ihm die Tür aufgehalten und ihn hinausgebeten hatte. Jener Abend hatte ihre Eheprobleme nicht gelöst, er war der Anfang ihrer Scheidung geworden. Emotional hatten sie sich allerdings schon Monate, wenn nicht Jahre vorher voneinander getrennt.
Nicht Jahre, korrigierte sie sich erneut. Während ihrer Schwangerschaft hatte sie auf Ben gewartet und der Vision vertraut, die sie kurz nach Ende des Dominion-Kriegs erhalten hatte. Ihr Gatte war ihr erschienen, hatte aus dem Wurmloch – Ben und die gläubigen Bajoraner nannten es den Himmlischen Tempel – heraus zu ihr gesprochen und gesagt, er werde eines Tages zu ihr zurückkehren.
So war es auch gekommen. Just als sie Rebecca zur Welt gebracht hatte, war Ben durch die Tür des Klosters Shikina getreten, als wäre er nur kurz auf einem Ausflug gewesen. Zu dritt – als Mutter, Vater, Kind – waren sie dann in ihr Haus vor Adarak gezogen, auf Bens Land. Ben hatte das Haus entworfen, Kasidy und Jake es während seiner Abwesenheit gebaut.
Und jahrelang war alles gut gewesen. Rebecca wuchs und gedieh prächtig. Obwohl sie für die Angehörigen der Ohalu-Sekte der Wegbereiter war – Vorbotin eines neuen Zeitalters der Erkenntnis für das bajoranische Volk –, respektierte man die Privatsphäre der Familie. Kasidy und Ben führten ein ruhiges Leben und zogen ihre Tochter groß.
Natürlich wollte die Sternenflotte Ben zurück. Man offerierte ihm einen Admiralsposten, doch anstatt ihn anzunehmen, zog sich Ben vollends aus dem aktiven Dienst zurück. Auch Kasidy ließ ihren Beruf ruhen. Aus der Ferne beaufsichtigte sie zwar nach wie vor die Arbeit ihres Frachters Xhosa, das Alltagsgeschäft übergab sie aber an ihren Ersten Maat Wayne Sheppard.
Jene Tage daheim in Kendra waren Tage einfacher, aber zutiefst befriedigender Freuden. Nun, da Bens Aufmerksamkeit nicht ständig den Pflichten der Befehlskette galt und Kasidy nicht wochenlang auf Frachtflügen war, fühlte sie sich ihrem Mann näher denn je. Und die Gefühle, die ihre Tochter in ihr weckte, waren noch unglaublicher. Nie hatte sie sich jemandem so verbunden gefühlt wie Rebecca.
Glockenklares Gelächter riss Kas so plötzlich aus ihren Gedanken, als seien sie das Stichwort dafür gewesen. Im ersten Moment interpretierte ihr Hirn es als Schrei fehl, und ein eiskalter Schauer zog über ihren Rücken. Schreie dieser Art hatten sie zwei Jahre zuvor bis in ihre Träume verfolgt. Damals war Rebecca von einem religiösen Fanatiker entführt worden. Bis zu ihrer Rettung war Kasidy des Nachts aus Albträumen aufgeschreckt, den eingebildeten Widerhall der Schreie ihrer Tochter im Ohr.
Diese Tochter kam nun um die Ecke des Hauses gerannt. Rebecca steckte in pinkfarbener Kleidung, und ihre dünnen kleinen Beine trugen sie zuversichtlich an den einstmals farbenfrohen Blumenbeeten entlang, die Mutter und Tochter im Frühjahr angelegt hatten. Hinter Rebecca folgte Jasmine Tey, die junge Malayin, die Kas und Ben nach der Entführung eingestellt hatten. Offiziell half Tey einige Tage die Woche im Haus mit, doch ihre Ausbildung im Bereich der Sicherheit gab Kas und Ben – inzwischen wohl nur Kas – ein zusätzliches gutes Gefühl. Tey beschützte ihre Tochter. Wann immer Rebecca zur Schule ging oder Kas sich anderen Dingen widmen musste, kam Tey zum Zug. An diesem Morgen hatte Kas sich ein paar Stunden um den Flug- und Frachtplan der Xhosa gekümmert. Da sie am Nachmittag noch nach Adarak wollte, blieb Tey bis zum Abend.
Rebecca lief voller Übermut, und ihr breites Lächeln enthüllte die Stelle, wo sie kürzlich zwei Schneidezähne verloren hatte. Für ein fünfeinhalbjähriges Menschenmädchen war Rebecca ein wenig klein, davon abgesehen aber vollkommen normal entwickelt, und in ihrem Gesicht spiegelten sich Züge beider Elternteile. Sie hatte die tiefdunkle Haut ihres Vaters und die weiche Haut der Mutter, Bens durchbohrenden Blick und Selbstsicherheit und Kas’ hohe Wangenknochen und schmale Nase. Sie lächelte mit den Lippen ihres Vaters und hatte das Lachen ihrer Mutter.
Als sie das Fenster passierte, winkte sie Kasidy zu, ohne aufzublicken oder anzuhalten. »Hi, Mommy«, quietschte sie fröhlich.
Kasidy hatte gar nicht bemerkt, dass Rebecca sie gesehen hatte. Situationen wie diese – wenn das Kind auf Details und Erfahrungen reagierte, die es nicht bewusst wahrgenommen haben konnte – waren früher leichter zu ignorieren gewesen. Sie traten schon seit Säuglingstagen gelegentlich auf. Nächtliches Geschrei, das abbrach, sobald Kasidy die Augen öffnete – als spürte Rebecca irgendwie, dass die Mutter kam, sich um Nahrung, eine frische Windel oder anderes zu kümmern, das Schuld an den Tränen war.
Tey eilte Rebecca hinterher, sah zum Fenster und winkte ebenfalls. »Hi, Ms. Yates.« Die eben erst dreißig gewordene, schlanke und herzliche Frau wirkte nicht sonderlich robust. Ihre Ausbildung und ihre Erfahrung als Gesetzeshüterin sprachen aber eine andere Sprache. Jasmine Tey verstand sich auf den Personenschutz, war Meisterin an diversen Waffen und beherrschte unterschiedlichste Kampftechniken – sogar klingonische. Im Grunde war sie eine beeindruckende Sicherheitstruppe im Körper einer einzigen Frau. Als Rebecca von dem Ohalu-Extremisten entführt worden war, hatte Tey gerade eine fünfjährige Anstellung als Leibwache der bajoranischen Premierministerin Asarem Wadeen gekündigt. Asarem schlug vor, Tey zur Rettung Rebeccas einzusetzen, und Tey erwies sich als Zünglein an der Waage.
Rebecca liebte »Tantchen Jasmine«, seit sie sie kannte. Und Tey schien die Zuneigung zu erwidern. An den Tagen, da sie zum Haus kam, waren sie und das Kind keine Minute getrennt, spielten, lasen oder tollten im Freien herum.
Tey holte Rebecca gerade ein. Kasidy sah sie die Kleine an der Hüfte packen, woraufhin Rebecca laut losprustete und beide zu Boden plumpsten. Die ungezügelte Freude ihrer Tochter zauberte auch Kasidy ein Lächeln aufs Gesicht.
Doch der Flugplan der Xhosa wartete. Kasidy wandte sich ab, und prompt verging das Lächeln – denn auf der Komm-Konsole prangte nach wie vor das Bild Utopia Planitias. Sie hatte die Konsole ausschalten wollen, offensichtlich aber nur das Standbild aktiviert. Schnell durchquerte sie das Büro und berührte die richtige Taste. Der Monitor zeigte sich gnädig und wurde schwarz.
Du bist närrisch, sagte sie sich. Unter normalen Umständen hätte sie schlicht um die Toten des Zwischenfalls getrauert. Doch der Schmerz, der auch nun wieder in ihr aufstieg, entstammte einer konkreteren Quelle als dem zufälligen Ableben ihr unbekannter Personen. Alle Wege führten zurück zu Ben. Vor etwa fünfzehn Jahren, nach der Zerstörung der U.S.S. Saratoga durch die Borg, hatte die Sternenflotte ihn, den einstigen Ersten Offizier der Saratoga, nach Utopia Planitia versetzt. Knapp drei Jahre hatte Ben dort verbracht, bevor er das Kommando über Deep Space 9 erhielt.
Kasidy sah auf den dunklen Monitor und hatte doch die geschundene Außenhülle der Werft vor Augen. Eigentlich durfte es sie nicht mehr kümmern, dass Ben dort vor mehr als einem Jahrzehnt Dienst geschoben hatte. Schließlich hatte er Bajor voriges Jahr den Rücken gekehrt, befehligte inzwischen die U.S.S. Robinson. Soweit sie wusste, patrouillierte das Schiff der Galaxy-Klasse im Sierra-Sektor an der romulanischen Grenze, weit weg vom Mars und Utopia Planitia.
Trotzdem: Das hätte er sein können. Die Nachrichten verrieten nicht, welches Schiff die Explosion der Werft aufgezeichnet hatte und prompt von den Trümmern getroffen worden war, von daher konnte es sich tatsächlich um die Robinson handeln. Doch das war irrationales, furchtgetriebenes Denken. Kasidy mühte sich, es zu ignorieren.
Sie griff hinter sich und zog den Sitz erneut vor die Konsole. Dann rief sie eine Nachricht auf, die seit zwei Monaten in ihrem Speicher lag. Sie hatte sie schon oft löschen wollen, sie aber mindestens genauso oft abgespielt und versucht, die Worte zu verstehen und zu akzeptieren, die sie immer wieder aufs Neue zerstörten.
Ben erschien auf dem Display, kurzes schwarzes Haar auf dem Kopf und das Kinn frisch rasiert. So oft sie sich die Aufzeichnung auch ansah, so oft staunte sie über seinen bartlosen Anblick. Er war seit über zehn Jahren Bartträger, seit sie ihn kannte, und war es auch noch an dem Abend gewesen, da er zum letzten Mal ihr Haus verlassen hatte.
»Kasidy, hier ist Ben«, sagte er. Kasidy sah ein schwach beleuchtetes Zimmer hinter ihm, vermutlich seine Kabine auf der Robinson. Am linken Bildrand waren Streifen aus Sternenlicht zu sehen. Das Schiff reiste also auf Warp. »In ein paar Wochen ist mein Aufbruch schon ein ganzes Jahr her. Ich weiß, dass ich dir wehgetan habe – auf eine vielleicht unverzeihliche Weise.«
Vielleicht unverzeihlich, hallte die Formulierung in ihr wider, die ihr in den vergangenen zwei Monaten eine Hoffnung gewesen war. Vielleicht unverzeihlich. Wenn er Nachsicht für eine – wie auch immer geartete – Möglichkeit hielt, bedeutete das dann nicht, dass er ihre Freundschaft wollte? Warum sonst sollte er ihre Absolution erhoffen?
»Nein«, sagte sie laut und in die Aufzeichnung hinein. In den ersten drei Monaten hatte sie ihre Trennung als schlichten Streit empfunden – als großen Streit, keine Frage, aber als etwas, das sich mit der Zeit würde besprechen und aus der Welt schaffen lassen. Zu keinem Zeitpunkt war er ihr binnen jener zwölf Wochen wie das Ende ihrer Ehe vorgekommen. Selbst ein halbes Jahr später, als die Tiefe und Schwere ihrer Trennung schlicht nicht mehr ignorierbar war, hatte sie noch erwartet, Ben trete eines Tages einfach durch die Eingangstür ihres Hauses und nähme sie in die Arme.
»Ja, ich liebe dich, Kas«, redete der aufgezeichnete Ben in ihrer Gegenwart weiter. »Immer noch. Vermutlich werde ich dich nie nicht lieben. Und eben weil ich dich und unsere wunderschöne Rebecca liebe, musste ich gehen.«
Die Worte klangen verdächtig nach einer Ausrede. Ich liebe dich, deshalb musste ich gehen. Behaupteten das nicht verantwortungslose Eltern, die ihre Familien im Stich ließen? Ohne mich seid ihr besser dran. Neue Wut wallte in ihr auf.
»Du glaubst nicht an die bajoranischen Propheten, Kasidy«, fuhr Ben fort, »nicht so wie ich. Das weiß ich. Aber ich habe mit ihnen gesprochen, mit ihnen existiert, und sie haben mich während meines Kampfes um die Rettung des bajoranischen Volkes begleitet. Das bedaure ich nicht. Das kann ich nicht bedauern.
Allerdings bedaure ich, welche Folgen meine Beziehung zu den Propheten für uns hatte … für dich und Rebecca. Bevor wir heirateten, sagte ich dir, laut der Propheten stünde mir nichts als Kummer bevor, wenn ich mein Leben mit dir verbrächte. Du hast gesagt, das klänge wie eine Drohung. Aber es war keine.
Es war ein Geschenk.«
Noch ehe sie richtig merkte, was sie tat, ließ Kasidy die Faust auf die Komm-Konsole sausen. Bens Aufzeichnung hielt an, und ihr war, als müsse sie die Faust als Nächstes tief in den Monitor rammen. »Ein Geschenk«, zischte sie dem Abbild ihres Gatten entgegen, als könne er sie hören.
Kasidy verstand, warum er die Worte der Wurmlochwesen positiv interpretierte. Schließlich hatte sie seiner Erklärung schon oft gelauscht. Sie verstand es allerdings nicht aufgrund seiner Aussage, sondern aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung. Ihrer wiederholten Erfahrung. Ben hatte sie schon früher verlassen, wann immer die Wurmlochwesen ihn darum baten. Ungeachtet seiner Familie.
Sie entsann sich des Schocks, als er nach dem Krieg von Bajor verschwand und später vor ihr erschien und verkündete, er könne nicht mit ihr heimreisen – irgendwann, das schwöre er, aber noch nicht. Er sei der Abgesandte der Propheten und müsse noch viel für sie tun. Damals hatte sie die Situation akzeptiert, denn alles war besser als sein Tod, und sie konnte ohnehin nichts unternehmen. Doch die acht Monate Schwangerschaft ohne ihn waren hart gewesen.
Sie entsann sich auch der Zeit, da Ben eigene Visionen aus dem Wurmloch erhalten hatte und Bajor von einem Föderationsbeitritt abgehalten hatte. Er hatte sogar medizinische Unterstützung verweigert, obwohl die Visionen lebensbedrohlich wurden. Besessen von dem Bestreben, den Plan der Wurmlochwesen vollends zu verstehen, bewies Ben eindrücklich, dass ihm das Wohl des bajoranischen Volkes wichtiger war als seine Anwesenheit in Kasidys und Jakes Leben. Ben verfolgte sein gefährliches Ziel unerbittlich, obwohl sein Tod eine klaffende Lücke hinterlassen würde. Erst als er das Bewusstsein verlor, hatte Jake intervenieren und sein Ableben im letzten Moment verhindern können.
Dennoch war Ben gewillt, auch Jakes Leben dem großen Ganzen zu opfern. Als sich eines der Wurmlochwesen gewaltsam Kira Nerys’ Körper ermächtigt hatte und ein Widersacher der Wesen in Jake eingefahren war, fochten beide Entitäten einen Kampf aus, der die Existenz beider Personen und der gesamten Raumstation DS9 gefährdete. Ben war damals in der Lage gewesen, den Konflikt zu beenden, gar zu vermeiden, unterließ dies aber, obwohl ein Sieg Jakes Tod hätte bedeuten können. Jake verzieh seinem Vater, nachdem Kai Winn den Kampf zu einem vorzeitigen Ende gezwungen hatte – einem Unentschieden, das vermutlich Jakes und Nerys’ Leben rettete. Auch Kasidy fand schließlich die Kraft, über das Ereignis hinwegzugehen.
Nein, Ben hatte sich ihr gegenüber noch nie zum Abgesandten der Propheten erklären müssen. Dafür hatten ihr seine Taten jahrelang zu deutlich gezeigt, wo seine Prioritäten lagen.
Doch nicht nur die Anwesenheit der Wurmlochwesen bestimmte Bens Leben, auch ihre Abwesenheit beeinflusste ihn. Vor acht Jahren, als Jadzia gestorben und das Wurmloch kollabiert war, war Ben von den Wesen abgeschnitten worden. Er hatte Jake genommen und war zur Erde zurückgereist. Er hatte Deep Space 9 hinter sich gelassen, seine Pflichten gegenüber der Sternenflotte, seine Freunde – und Kasidy. Damals war Kas nicht auf der Station gewesen, sondern auf Frachtreise mit der Xhosa. Dass er weggezogen war, erfuhr sie erst nach ihrer Rückkehr. Ben hatte ihr eine Nachricht hinterlassen – sie lag vermutlich noch immer irgendwo auf einem isolinearen Chip gespeichert –, sich entschuldigt und sein Tun zu rechtfertigen versucht, aber er hatte sie auch beschworen, ihn nicht zu kontaktieren, bis – falls – er ins bajoranische System zurückkehrte. So abrupt und so unpersönlich endete damals die ernste romantische Beziehung, die sie mit dem Mann geführt hatte, den sie liebte. Sie hatte nichts dagegen unternehmen können.
»Ich bin eine Närrin«, sagte sie, als spräche sie zu ihm. Wie konnte es sie nur überraschen, dass er nicht in ihr Haus auf Bajor zurückkehrte, wo er seine Familie doch so eindeutig dem »Willen der Propheten« unterordnete?
»Ich hätte damit rechnen müssen.«
Kasidy ließ sich gegen die Rückenlehne ihres Stuhls sinken, einen tiefen Seufzer auf den Lippen. Wie so oft waren ihre Gedanken und Empfindungen ein wirrer Strudel. Sie war wütend – auf Ben und auf sich selbst. Zugleich erfüllte sie eine tiefe Trauer, und ihr Verstand suchte krampfhaft nach einem Weg, den Schaden auszugleichen, der ihrer Familie widerfahren war.
Doch so oft sie auch auf Bens erstarrtes Antlitz auf dem Komm-Bildschirm blickte, so sehr musste sie sich einer weiteren Empfindung ergeben. Einer, vor der sie absolut machtlos war. Der Liebe. Sie kannte Ben seit über zehn Jahren, war fast so lange seine Partnerin gewesen und wusste noch sehr genau, warum sie es geworden war. Nie zuvor war sie einem Mann mit solcher Willensstärke begegnet, jemandem mit derart sicherem Gespür für richtig und falsch, jemand so Entschlossenem. Ben hatte den schrecklichen Verlust Jennifers, seiner ersten Frau, überwunden, um sich Kasidy zu öffnen, mit ihr zu lachen, sie mit seinen Kochkünsten zu erfreuen, ihr seine Leidenschaft für Baseball zu vermitteln und ihrer beider Leben auf eine Weise zu verschmelzen, die größtmögliches Glück verhieß. Sie hatten sehr viel Zeit miteinander verbracht, insbesondere nach seiner Rückkehr aus dem Wurmloch, und der Großteil davon war gute, erfüllte Zeit gewesen.
Der Großteil, dachte sie nun, aber nicht alles. Äußerlichkeiten waren in ihre Ehe eingedrungen, hatten Ben aus dem Haus gezerrt und in erschreckende, mitunter sogar riskante Situationen gezwungen. Rückblickend begriff Kas, dass jede Einzelne dieser Situationen ein kleines Stück von ihm verändert hatte. Die Einwohner des kleinen Dorfes Sidau waren während eines brutalen Massakers gestorben. Die Aszendenten und die wahnsinnige Iliana Ghemor hatten Deep Space 9 und die Bajoraner angegriffen. Endalla war zum Schauplatz einer fürchterlichen, den lokalen Raum bedrohenden Gefahr geworden.
Danach waren die Katastrophen noch näher an Bens Haustür gerückt. Audj und Calan, enge Freunde von Kas und ihm, waren bei einem Hausbrand ums Leben gekommen, drei Jahre war das inzwischen her. Elias Vaughn hatte bei der Borginvasion schwere Hirnverletzungen erlitten und lag seitdem im Koma. Bens Vater war gestorben.
Und Rebecca war entführt worden. Kasidy konnte nicht sämtliche ihrer Eheprobleme auf jene Zeit zurückführen, doch als seine Tochter in Lebensgefahr geraten war, hatte sich Ben stärker denn je isoliert – was wiederum dazu führte, dass Kasidy sich ihm fern fühlte. Als er dann zur Sternenflotte gegangen war, um beim Kampf gegen die Borg zu helfen – ein Entschluss, den sie nachvollziehen konnte, aber nicht mochte –, hatte sie gehofft, nach seiner Rückkehr ganz neu zu beginnen. Klar hatte sie sich um sein Wohlergehen gesorgt, während er fort gewesen war, doch nie – kein einziges Mal – hatte sie geglaubt, er komme nicht wieder.
Kasidy beugte sich wieder vor und aktivierte die Aufzeichnung neu. Bens Lippen bewegten sich, und er sagte die Worte, die sie schon so oft gehört hatte, dass sie sie vermutlich auswendig konnte. Dennoch wollte sie sie noch einmal hören. Sie musste es.
»Die Propheten existieren anders als wir, erfahren Zeit anders«, sagte er. »So erging es auch mir, als ich bei ihnen im Himmlischen Tempel war, Kas. Ich kenne es aus erster Hand. Die Propheten leben nicht linear, aber sie leben vor allem auch dauernd. Deshalb gelingen ihnen all diese Prophezeiungen, deshalb kennen sie die Zukunft: Sie leben in dem, was wir Zukunft nennen – und in der Vergangenheit und der Gegenwart. Sie sind sich zu jeder Zeit sämtlicher Momente ihrer Existenzspanne bewusst. Sie sehen sogar mögliche Momente in zahllosen möglichen Zeitlinien.«
Einmal mehr kam das Kasidy äußerst phantastisch vor. Sie konnte sich eine Existenz, wie Ben sie da beschrieb, kaum vorstellen. Trotzdem glaubte sie ihm.
»Ich glaube, besser kann ich es nicht beschreiben. Ich habe es selbst erlebt, Kasidy, und auch wenn ich mich nicht an Details erinnere – an die Zukunft, die meiner Gegenwart und meiner Vergangenheit absolut gleichwertig war –, weiß ich noch gut, wie überwältigend die Erfahrung war. Ich entsinne mich ihrer Natur … ihrer Echtheit.
Als die Propheten mir sagten, ich würde nur Kummer erfahren, wenn ich mein Leben mit dir verbrächte, drohten sie mir nicht. Sie sagten mir bloß, was sie gesehen hatten … was sie in diesem Moment sahen. Sie sahen uns heiraten, und sie sahen mein Leben voller Kummer. Aber sie sahen auch eine Existenz, in der ich mein Leben nicht mit dir teilte und nicht nur Kummer erfuhr.«
Ihre Sicht verschwamm. Tränen stiegen ihr in die Augen, denn sie wusste, was nun kam.
»Kas, ich könnte für dich und unsere Liebe unfassbar viel ertragen. Aber hier geht es nicht um mich und meine Wünsche. Hier geht es um deine Rettung. Um Rebeccas. Bliebe ich bei euch, erführe ich nichts als Kummer, und irgendwann griffe dieser Kummer auf euch über. Euch würde Schlimmes widerfahren, dir und Rebecca. Denn das wäre mein größter Kummer.«
Ben zählte einige der Schicksalsschläge auf, die sich ereignet hatten, bevor er gegangen war. Kasidys Wangen wurden feucht. Sie glaubte nicht an die bajoranischen Prophezeiungen und die Göttlichkeit der Wesen, die im Wurmloch lebten, doch trotz allem, was geschehen war, glaubte sie ihrem Mann. Sie glaubte ihm, dass er sie noch immer liebte.
»Der Kummer kam näher und näher, wurde immer schwerer«, erklärte er ihr. »Ich konnte nicht zulassen, dass du und Rebecca in Gefahr gerieten. Es war schon schlimm genug, dass wir sie einmal fast verloren hätten.
All das habe ich dir nie gesagt, weil ich weiß, dass du nicht an die Propheten glaubst und ihre Vorhersagen nicht als Wahrheit akzeptierst. Doch genau das sind sie: Wahrheiten. Sie werden wahr, falls ich ihren Rat nicht befolge.
Ich liebe dich, Kasidy. Und trotz allem, was ich dir angetan habe, liebst du mich vermutlich auch noch. Das ist okay, schätze ich – auf die Weise, in der ich auch Jennifer noch liebe. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, Jen weit genug ziehen zu lassen, um mich in dich zu verlieben. Und ich glaube, es ist okay, wenn auch du mich ziehen lässt. Ich will, dass du wieder lieben kannst, wenn du so weit bist.
Ich schicke dir diese Nachricht, weil ich glaube, dass sie dir helfen wird – heute und, wie ich hoffe, auch morgen. Ich hoffe, du zeigst sie auch Rebecca, wenn sie alt genug ist, all dies zu erfahren.«
Kasidys Hand schwebte über der Konsole, bereit, die Aufnahme abzubrechen. Sie wollte nicht hören, was als Nächstes kam, wusste aber, dass sie es hören musste, einmal mehr. Wenn sie je weiterziehen wollte, musste sie alles hören.
»Kurz bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, ist ein Antrag zur Auflösung unserer Ehe ans Gericht in Adarak gegangen. Das war vielleicht das Schwerste, das ich je tun musste. Aber es ist das Beste für dich.
Ich liebe dich. Und es tut mir leid.«
Auf dem Monitor berührte Ben eine Taste. Die Nachricht endete, und das Sternenflottenemblem erschien. Einige Minuten lang ließ Kasidy ihren Tränen freien Lauf. Sie liebte Ben und hasste ihn gleichermaßen. Er glaubte der Warnung – oder Drohung – der Wurmlochwesen, aber hatte er irgendwie versucht, sie zu verifizieren? Hatte er die Wesen ersucht, ihre Vorhersage zu ändern? Hatte er wirklich alles in seiner Macht Stehende unternommen, um seine Familie intakt zu halten?
Kasidy deaktivierte die Komm-Konsole. Nicht zum ersten Mal überlegte sie, in was für einem Dilemma Ben steckte: Blieb er bei Frau und Kind, riskierte er ihren Tod. Blieb er nicht, musste er ohne sie sein. Was würde sie, Kasidy Yates, tun, stünde sie an seiner Stelle?
Und was mache ich jetzt? Vor zwei Monaten, als die Nachricht eingetroffen war, hatte sie das Gericht in Adarak kontaktiert. Dort lag tatsächlich ein Antrag zur Auflösung ihrer Ehe vor. Sie musste ihn nur unterzeichnen.
»Vielleicht wird es Zeit dafür«, murmelte sie – und erwog zum allerersten Mal, der Bitte ihres Mannes zu entsprechen. Monatelang hatte sie gehofft, Ben käme zurück zu ihr, und als er nicht kam, verwandte sie zahllose Stunden auf die Frage, wie sie ihn dazu überreden konnte. »Vielleicht muss ich einfach nur loslassen.«
Kasidy nickte langsam. Die Idee war wie ein Kleid, das sie nun anprobierte. Das Ende ihrer Ehe? War sie stark genug, die Liebe ihres Lebens zu verlieren? Sie wusste es nicht. Und wie sie es auch drehte und wendete, hatte Bens Flucht doch mindestens eine Folge, die sie nie akzeptieren würde.
Seit vierzehn Monaten hielt Kasidy die Wahrheit vor ihrer Tochter geheim. Rebecca hatte gewusst, dass ihr Vater ein Raumschiff kommandierte, um die Föderation vor den Borg zu beschützen, und Kas erklärte ihr sein Fehlen nach wie vor auf diese Weise. Die Sternenflotte, so sagte sie, brauche Ben noch immer auf der Brücke – was nicht gelogen war. Eines Tages würde er zu ihnen zurückkehren – das war gelogen. Oder? Oft saßen sie und Rebecca beisammen und betrachteten Holovids der Familie, und Ben erschien in jedem Einzelnen. Kasidy wollte nicht, dass Rebecca ihren Vater vergaß und glaubte, er sorge sich nicht länger um sie.
Sie schaltete die Komm-Konsole wieder ein. Ja, sie würde Ben die Scheidung gewähren, die er angeleiert hatte, aber dafür würde er ihr etwas geben müssen – für Rebecca. Ben zufolge ging es in der Vorhersage der Wurmlochwesen um sein Leben mit Kasidy; von seiner Tochter hatten die Wesen nicht gesprochen. Falls Ben nicht länger Kasidys Gatte sein wollte, konnte er das haben. Aber sie würde ihm nicht gestatten, nicht mehr Rebeccas Vater zu sein.
Kasidy gab einige Befehle ein. Sie wollte eine gemeinsame Freundin um Hilfe bitten, die vielleicht zu Ben durchdrang und ihn an seine Elternpflichten erinnerte. An seine Beziehung zu Rebecca. Und sie wollte sichergehen, dass Ben nicht bei Utopia Planitia gewesen war. Sie glaubte, sie kannte jemanden, der beides konnte.
Das Logo des bajoranischen Komm-Netzes erschien auf dem Monitor. »Releketh-Provinz«, sagte Kasidy. »Kloster Vanadwan. Ich möchte Vedek Kira Nerys sprechen.«
2
Captain Benjamin Sisko sah von seinem persönlichen Padd auf, als das Türsignal seines Quartiers ertönte. Er saß auf dem Sofa zwischen den zwei Außenfenstern und überlegte kurz, sich einfach ruhig zu verhalten. Zwar trug er noch seine Uniform, doch der Tag war lang gewesen, das Licht in der Kabine bereits gedimmt. Die Lektüre hatte ihm ein Gefühl des Alleinseins vermittelt, wie es ein Mann in einer Rettungskapsel empfinden mochte, einziger Überlebender einer gewaltigen Schiffskatastrophe. Jemand, der lebte und doch allem Leben fern war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!