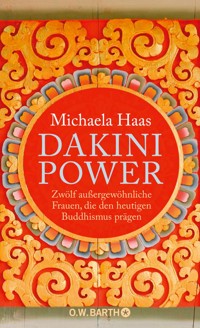7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Neue Forschungen zum posttraumatischen Wachstum eröffnen eine revolutionäre und überraschende Sicht auf das Thema Trauma. Menschen können auch nach schwersten Krisen Weisheit und Kraft schöpfen, um sich ihr Leben wieder neu aufzubauen. Mit den richtigen Strategien sind sie sogar in der Lage, an den Krisen innerlich zu wachsen und ihre Erfahrung an andere weiterzugeben. Michaela Haas erklärt das Phänomen anhand von zwölf eindrucksvollen Porträts. Sie interviewte unter anderem die Menschenrechtslegende Maya Angelou, die erfolgreiche Autistin Temple Grandin, den Auschwitz-Überlebenden Coco Schumann und trommelte mit Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen Die aufbauenden Erkenntnisse dieser von Schicksalsschlägen gezeichneten Menschen werden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, und sie zeigen: Diese Fähigkeiten stecken in uns allen! Wie wir sie aktivieren können, zeigt Michaela Haas zusätzlich durch effektive Übungen zum Aufbau von Resilienz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Michaela Haas
Stark wie ein Phönix
Wie wir unsere Resilienzkräfte entwickeln und in Krisen über uns hinauswachsen
Aus dem Englischen von Michaela Haas
Knaur e-books
Über dieses Buch
Neue Forschungen zum posttraumatischen Wachstum eröffnen eine revolutionäre und überraschende Sicht auf das Thema Trauma. Menschen können auch nach schwersten Krisen Weisheit und Kraft schöpfen, um sich ihr Leben wieder neu aufzubauen. Mit den richtigen Strategien sind sie sogar in der Lage, an den Krisen innerlich zu wachsen und ihre Erfahrung an andere weiterzugeben.
Michaela Haas erklärt das Phänomen anhand von zwölf eindrucksvollen Porträts. Sie interviewte unter anderem die Menschenrechtslegende Maya Angelou, die erfolgreiche Autistin Temple Grandin, den Auschwitz-Überlebenden Coco Schumann und trommelte mit Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen.
Die aufbauenden Erkenntnisse dieser von Schicksalsschlägen gezeichneten Menschen werden durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, und sie zeigen: Diese Fähigkeiten stecken in uns allen! Wie wir sie aktivieren können, zeigt Michaela Haas zusätzlich durch effektive Übungen zum Aufbau von Resilienz.
Inhaltsübersicht
Für meinen Großvater und alle,
die wie er Krücken als Sprungfedern benutzen
Einleitung
Den Gegenwind zum Auftrieb nutzen
»Nur im Dunkeln kann man die Sterne sehen.«
Martin Luther King
Der Übeltäter, der mich zu Boden zwang, hat nicht einmal einen Namen: ein winziger, unsichtbarer Virus. Und doch war er mächtig genug, mich niederzustrecken und mir meine Lebenskraft und meinen Lebenswillen zu rauben.
Nachdem ich zwei Semester in Nepal und Nordindien studiert hatte, brach ich zusammen. Und stand so schnell nicht wieder auf. Innerhalb von Wochen wurde aus der athletischen Weltreisenden eine bettlägerige Kranke, deren Körper fast jegliche Nahrung verweigerte. Im Spiegel starrte mir eine spindeldürre Frau mit gelbstichigem Gesicht entgegen, die ich nicht wiedererkannte. Wer war diese Fremde, die nun meinen Körper bewohnte?
Ich hielt mich für resilient und stark, wollte mich nicht so leicht geschlagen geben. Zu sehr genoss ich das Reisen durch Asien, die wundersamen Abende in den Tempeln mit den tibetischen Yogis, die farbenfrohen Straßenfeste, die Herausforderung, mich allein in dieser wirbelnden, exotischen Welt zurechtzufinden und das Studium zu beenden, für das ich mich eingeschrieben hatte. Ich hatte mir mit Ende 20 eine Auszeit von meinem hektischen Reporterbüro bei der Süddeutschen Zeitung gegönnt, um nach Nepal und Indien zu reisen und meine Doktorarbeit in buddhistischer Philosophie fertigzustellen. Das wollte ich nicht einfach so aufgeben, aber nach zwei Semestern war ich am Ende meiner Kräfte. Ich spürte: Rien ne va plus.
Gelähmt von einer bleiernen Erschöpfung, kehrte ich nach Frankreich zurück, wo mein Mann zu jener Zeit lebte. Ich hoffte, mit Hilfe meiner Freunde und Ärzte wieder auf die Beine zu kommen. Aber die Ärzte konnten mir kaum helfen. Die Diagnosen, mit denen sie probehalber um sich warfen, jagten mir gehörige Schrecken ein – HIV? Multiple Sklerose? Gehirntumor?
Denken Sie an die schlimmste Magengrippe, die Sie je hatten, und multiplizieren Sie den Zustand mit acht Monaten. Ich konnte kaum Essen bei mir behalten. Einfachste Aktivitäten, die ich für selbstverständlich gehalten hatte, etwa ein kurzer Ausflug zum Supermarkt, schienen mehr Kraft zu erfordern als nur ein halbes Jahr zuvor der Aufstieg in das Gebiet des Mount Everest. An schlechten Tagen konnte ich keine zusammenhängenden Sätze sprechen, und mir fielen die Namen meiner engsten Freunde nicht ein. Wie war es nur möglich, dass aus dieser aktiven Weltreisenden innerhalb von wenigen Monaten eine Invalidin geworden war?
Am Anfang kümmerten sich alle rührend um mich, aber als die Krankheit nicht besser wurde und sich über Wochen, dann Monate und schließlich den Rest des Jahres hinzog, suchten die meisten das Weite, auch mein Mann. Sie konnten einfach nicht begreifen, dass diese junge, lebhafte Frau plötzlich wie eine bettlägerige Seniorin versorgt werden musste. Ich konnte es ja auch nicht.
Ich sah mein ganzes Leben den Bach runtergehen – meine Gesundheit, meine Karriere, die Sachen, die mir Spaß gemacht hatten, und schließlich auch meine Ehe, meine Freundschaften, meine Träume. Alles stürzte vor meinen Augen in einen tiefen Abgrund, aus dem ich es nicht mehr retten konnte.
Verglichen mit den Untiefen menschlichen Elends, die ich in Entwicklungsländern und Slums gesehen hatte, erschienen mir meine Nöte trivial. Mein Schmerz hatte kein Recht, sich so in den Vordergrund zu schieben. Und doch: Ich wurde von Wogen der Hoffnungslosigkeit überwältigt, die mich nach unten zogen. Ich fühlte mich unglaublich schwach und klein.
Wie konnte ich wieder auf die Beine kommen, nicht nur physisch, sondern auch psychisch und emotional?
Seit der Zeit, als ich mit meinem Großvater aufgewachsen war, der sich trotz seiner Kinderlähmung eine große Familie und ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut hatte, habe ich mich gefragt: Wie ist es möglich, dass manche Menschen durch Krisen stärker werden?
In den beiden Jahrzehnten als Reporterin habe ich mit vielen Überlebenden von großen und kleinen Tragödien gesprochen und auch da über die enormen Unterschiede gestaunt: Warum brechen manche Menschen zusammen, während andere erst in der Katastrophenzone zu wahrer Größe auflaufen? Was macht den Unterschied aus?
Als ich selbst krank wurde, brannten mir diese Fragen auf der Seele.
Die Feuerprobe
Seit der Antike ist der Phönix das Symbol für die Fähigkeit, sich aus der Asche wieder zu erheben. Der mystische Vogel verbrennt in der Glut der Morgenröte, aber in der Asche bleibt ein Glimmer, der nie verlischt und aus dem erneut Leben entsteht. Damit schwingt er sich zu neuen Höhen auf.
Einige der modernen Phönixe haben internationale Schlagzeilen gemacht:
An ihrem 16. Geburtstag hielt Malala Yousafzai ihre erste öffentliche Rede seit dem Attentat, bei dem ihr ein maskierter Taliban-Terrorist in den Kopf geschossen und sie schwer verletzt hatte. Vor 500 jungen Aktivisten erneuerte Malala bei den Vereinten Nationen ihren Schwur, für die Ausbildung von Mädchen zu kämpfen. »Die Terroristen dachten, sie würden meine Ziele ändern und meinen Ehrgeiz auslöschen, aber in meinem Leben hat sich nichts geändert, nur das: Schwäche, Furcht und Hoffnungslosigkeit starben. Stärke, Kraft und Mut wurden geboren.«
Als Nelson Mandela seinen Amtseid als Präsident von Südafrika ablegte, lud er einen der ehemaligen Gefängniswärter ein, in der ersten Reihe zu sitzen. Der Mann hatte dem System geholfen, Mandela für 27 Jahre hinter Gitter zu sperren, aber sogar im Gefängnis weigerte sich Mandela zu hassen. Er lebte die Worte, die er seiner Frau Winnie aus dem Gefängnis schrieb: »Schwierigkeiten brechen manche Menschen – und machen andere erst zu Menschen.«
Weniger als vier Wochen nachdem der 13 Jahre alten Bethany Hamilton beim Surfen vor Kauai von einem Tigerhai ein Arm abgerissen wurde, stand sie wieder auf dem Surfbrett. Seither nimmt sie einarmig an internationalen Surfwettkämpfen teil. »Man darf der Behinderung nicht die Kontrolle über das eigene Leben geben«, sagt sie. »Die Einstellung ist alles. Es gibt keine Grenzen.« [1]
Dies ist ein Buch über Frauen und Männer, die schwere Prüfungen überstanden: chronische Krankheiten, Verlust, Krebs, Unfälle, Auschwitz. Sie stellten sich diesen Herausforderungen nicht nur, sondern wuchsen und reiften daran. Wenige von uns werden von Terroristen oder Haien attackiert, aber wir alle sehen uns vor Herausforderungen gestellt. Es sind ja nicht nur die großen, schlagzeilenträchtigen Tsunamis, die Menschen aus der Bahn werfen, sondern oft die »alltäglichen« Katastrophen: die Scheidung, eine Operation, der Arbeitsplatzverlust. Wie also können wir unsere Widerstandskraft stärken, uns für Krisen wappnen und uns nach Tiefschlägen wieder aufrappeln?
Ich dachte am Anfang, es gäbe nur einige wenige Überflieger, fast übermenschliche Superhelden, die aus Niederlagen Triumphe machten – wie Malala und Mandela, die von der ganzen Welt bewundert werden. Dass diese Ausnahmeerscheinungen bei der Verteilung positiver Eigenschaften eine Überdosis Mut und Mitgefühl bekommen haben, steht außer Frage. Aber sie sind nicht aus einem ganz anderen Stoff gestrickt als Sie und ich. Resilienz ist ein zutiefst menschlicher Wesenszug. Wir Menschen sind gleichzeitig extrem verwundbar und außerordentlich zäh.
Die revolutionäre Wissenschaft des posttraumatischen Wachstums
Resilienz ist in. Estée Lauder verkauft »Resilience Lift Extreme Makeup«, die Haare kann man mit »Resilience Shampoo« stärken, und Hanes produziert »Resilience-Feinstrumpfhosen«. Mehr als einmal habe ich mir gewünscht, ich könnte mir mit Resilienz den Kopf waschen oder mir durch die richtige Strumpfhose einfach eine resiliente Form verpassen!
Das Wort »Resilienz« stammt vom lateinischen resilire ab, also »abprallen« oder »zurückspringen«. Der Begriff bezeichnet gemeinhin unsere innere Widerstandskraft, widrige Ereignisse an uns abprallen zu lassen und aus Krisen wieder in unsere alte Form »zurückzuspringen«, wie ein Gummiband. Aber in meinen Gesprächen mit Menschen, die Krisen überstanden, habe ich gelernt, dass dieses Bild in die Irre führt. Die Teflon-Haut, an der wir die Widrigkeiten des Lebens einfach abperlen lassen, gibt es nur in Hollywood, nicht im wirklichen Leben. In Wahrheit reißt uns der Verlust eines geliebten Menschen ein Loch ins Herz, und unsere Kämpfe haben uns gebrandmarkt und verwandelt. In diesem Buch geht es deshalb nicht darum, wie man Widrigkeiten an sich abprallen lässt, sondern wie man ihre Wucht zur Veränderung nutzt.
Die meisten Menschen haben von posttraumatischen Belastungen gehört, also den vielschichtigen Symptomen, wiederkehrenden Ängsten und Erinnerungen, die Überlebende noch lange nach dem Trauma aus dem Hinterhalt überfallen. Aber die wenigsten Nicht-Mediziner kennen die Forschung zum posttraumatischen Wachstum. Auf den ersten Blick wirkt es paradox, die Worte »Trauma« und »Wachsen« miteinander in einen Satz zu stellen, denn wir sehen die beiden üblicherweise nicht als Geschwister, die Hand in Hand gehen.
Dem renommierten Psychologen Richard Tedeschi zufolge berichten mehr als die Hälfte aller Menschen, denen ein Schicksalsschlag widerfahren ist, sie hätten ihr Leben danach zum Positiven verändert. Dies passiert nicht sofort, nicht leicht und selten von allein. Wir müssen uns diese positiven Veränderungen erarbeiten, und wir brauchen dazu die richtigen Strategien und Unterstützung.
Die wegweisende Wissenschaft des posttraumatischen Wachstums ist neu und wird stetig durch neue Studien und Erkenntnisse erweitert. Der Psychologe Stephen Joseph ist nicht der Einzige, der denkt, der Forschungszweig sei einer »der aufregendsten aller neueren Fortschritte in der klinischen Psychologie, denn er verspricht, unser Denken über Traumata radikal zu ändern – insbesondere die Vorstellung, ein Trauma habe unweigerlich ein beschädigtes und beeinträchtigtes Leben zur Folge«. [2]
Eine Krise ist eine Weggabelung. Was wir als Nächstes tun, zählt: weitermarschieren oder zurückrudern, die Hürde angehen oder weglaufen, kriechen oder springen. Wir können unsere Augen verschließen oder hinsehen, aufgeben oder einen neuen Anlauf nehmen, uns verschließen oder aufbrechen.
Das Dilemma kann vernichtend sein oder das Sprungbrett für einen neuen Anfang. Vielleicht beides.
Krise als Wendepunkt
Mein Körper ist seit meiner Nepal-Reise ein unzuverlässiger Gefährte, der mich immer wieder im Stich lässt. Mein Immunsystem ist aus den Fugen geraten, teilweise irreparabel. Nun geht es darum, mein seelisches Immunsystem zu stärken.
Die Grundfrage ist nicht, ob man leidet, sondern wie wir mit Leid umgehen. »Es geht darum, wie wir mit dem Leiden arbeiten, damit es zum Herzenserwachen führt und zum Überwinden gewohnheitsmäßiger Perspektiven und von Taten, die Leiden fortsetzen«, sagt die buddhistische Lehrerin Pema Chödrön. »Wie nutzen wir dieses Leid so, dass es unser Wesen und das der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, wirklich transformiert? Wie können wir aufhören, vor dem Schmerz zu flüchten und dagegen in einer Weise zu rebellieren, die uns und andere zerstört?« [3]
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich darauf endgültige Antworten hätte. Ich habe es geschrieben, weil mich diese Fragen interessieren. Deshalb habe ich mich auf die Reise gemacht, besonders resiliente Menschen zu fragen, woher sie die Stärke nehmen, dem Leben die Stirn zu bieten.
Um ihre Tricks zu erfahren, interviewte ich die Menschenrechtsikone Maya Angelou, trommelte mit dem Def-Leppard-Schlagzeuger Rick Allen, fütterte Welpen mit der ehemaligen Kriegsgefangenen Rhonda Cornum, besuchte die autistische Tierforscherin Temple Grandin, ging zu meinem ersten Baseballspiel mit dem genetischen Wunderkind Meggie Zahneis und wühlte mich mit dem berühmten Jazzgitarristen Coco Schumann, der in Auschwitz um sein Leben gespielt hat, durch Berge von Erinnerungen. Ich feuerte gelähmte Surfer am Strand von Santa Monica an, nahm am Resilienz-Bootcamp der amerikanischen Armee in Philadelphia teil und besuchte die Labore der Experten, die die Wissenschaft des posttraumatischen Wachstums in Charlotte, North Carolina, begründet haben. Ich meditierte mit tibetischen Yogis im nordindischen Himalaja, lernte von dem buddhistischen Lehrer Roshi Bernie Glassman, wie wir Schauplätze des Horrors in Stätten der Heilung verwandeln können, und fragte den kanadischen Physiker Alain Beauregard, wie er dazu kam, seinen Krebs im Endstadium als »größtes Geschenk meines Lebens« zu bezeichnen.
Sie alle sind inspirierende Vorbilder und Pioniere in einem wachsenden Wissenschaftszweig von Psychotherapeuten, Forschern und Ärzten, die versuchen zu ermitteln, was genau Menschen in Krisen über sich hinauswachsen lässt. Vielleicht werden Sie sich in einigen dieser Geschichten wiederfinden und sich von der Weisheit und der Lebensklugheit der Porträtierten infizieren lassen. Woher haben sie den Mut genommen? Ihre alte Welt lag in Scherben. Trotz aller Schwierigkeiten haben sie überlebt.
Menschen zu begegnen, die nach einem Zusammenbruch den Durchbruch schafften, hat mich verändert. Sie wurden von Schicksalsschlägen getroffen, die man eigentlich nicht ertragen kann, und doch hielten sie durch. Sie hätten vernichtet werden können, aber sie wuchsen.
Ich dachte anfangs, sie hätten trotz der Widrigkeiten Erfolg, aber dann verstand ich, dass sie den Gegenwind als Auftrieb nutzten. Wie die doppelamputierte, paralympische Sprinterin Aimee Mullins sagt: »Die Menschen wollen immer mit mir über das Überwinden von Schwierigkeiten reden. Diese Formulierung klang für mich nie ganz richtig. Darin steckt die Idee, dass Erfolg oder Glück darin besteht, aus einer herausfordernden Erfahrung unbeschadet und unverändert herauszukommen, als hinge der Erfolg in meinem Leben von meiner Fähigkeit ab, den vermeintlichen Tücken meines Lebens auf Prothesen auszuweichen. Aber Fakt ist: Wir sind verändert. Wir sind natürlich gebrandmarkt von einer Herausforderung, egal ob sie körperlicher oder emotionaler Natur ist. Ich halte das für eine gute Sache. Widrigkeiten sind keine Hindernisse, die wir umkurven müssen, damit wir unser Leben leben können. Sie sind Teil unseres Lebens. Wie ein Schatten. Manchmal sehe ich viel davon, manchmal weniger, aber sie begleiten mich immer. Die Frage ist nicht, ob wir Widrigkeiten begegnen, sondern wie.« [4]
Dies ist der Ansatz von Stark wie ein Phönix. Das Buch präsentiert einen provozierenden Perspektivenwechsel: den Aufruf, die Fallen und Tücken des Lebens nicht bloß als Unheil zu sehen, sondern als Dünger für Wachstum.
Ich hoffe, dieses Buch eröffnet Ihnen einen neuen Blick auf Schmerz. Einen neuen Lebenssinn. Einen erstarkten Optimismus. Denn eine resiliente Haltung bereitet uns nicht nur auf besonders schwierige Zeiten vor, die gleichen Eigenschaften helfen uns auch im Alltag, mit dem griesgrämigen Chef und den lärmenden Nachbarn fertigzuwerden. Am besten trainieren wir das Kurshalten auf ruhiger See, damit wir dann Segel setzen und Fahrt aufnehmen können, wenn der Gegenwind richtig bläst.
Diese Lebensgeschichten zu recherchieren hatte einen konkreten Sinn und Zweck für mich: herauszufinden, was uns und andere vor unnötigem Leid schützt; Strategien zu praktizieren, die uns helfen einzugreifen, wenn unser Leben aus den Fugen gerät. Und nicht nur den Heilungsprozess zu fördern, sondern die Krise als Wendepunkt für eine neue Kursrichtung zu nehmen.
Wir sind stärker, als wir denken
Wir Menschen sind darauf programmiert, das Unerträgliche zu ertragen. Wenn Psychologen Verlust, Trauer oder Trauma studieren, dann neigen sie dazu, sich den Patienten zu widmen, die am meisten leiden. Das verzerrt den Blick auf die Realität, denn die meisten Menschen bewältigen selbst katastrophale Ereignisse erstaunlich gut. Mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der es geschafft hat, gänzlich unvernarbt durchs Leben zu gleiten, ohne einen geliebten Menschen zu verlieren, ohne eine schwere Krankheit oder lebensbedrohliche Ereignisse durchzumachen. Wir sind damit nicht allein.
Ich habe für dieses Buch nicht nur mit Trauma-Überlebenden gesprochen, sondern auch mit den Koryphäen auf dem Gebiet der Traumaforschung: renommierten Psychologen, Psychiatern und Therapeuten. An dieser Schnittstelle von westlicher Psychologie, asiatischer Weisheit und militärischer Härte beginnt unsere Forschungsreise. Wir werden Krisen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten: körperlichen, mentalen, psychologischen, emotionalen und spirituellen Aspekten. Sie werden Menschen treffen, die sich dem Schmerz aus scheinbar gegensätzlichen Richtungen annäherten: Soldaten, Zenmeister, Entertainer. Und doch haben sie mehr gemeinsam, als man ihnen auf den ersten Blick ansieht. Oft haben ihnen ganz ähnliche Strategien geholfen.
Viele dieser Menschen haben mich enorm beeindruckt. Richard Tedeschi zufolge berichten bis zu 90 Prozent der Trauma-Überlebenden, sie hätten mindestens einen Aspekt des posttraumatischen Wachstums erlebt, etwa eine neue Lust am Leben, eine emotionale Reifung oder tiefere Beziehungen mit anderen Menschen – und zwar nicht trotz der posttraumatischen Belastung, sondern durch sie und oft gleichzeitig mit ihr. Genau das interessiert mich.
Wie also gelingt es so vielen Menschen, aus dem Schlimmsten das Beste zu machen? Auf den folgenden Seiten erkunden wir einige der Strategien, die uns helfen, das Leben mit Stärke anzugehen. Unsere Erziehung spielt eine Rolle, genetische Faktoren, Ressourcen, unsere sozialen Fähigkeiten und unser Lebenssinn. Einige dieser Faktoren entziehen sich unserem Einfluss. Wir haben keine Kontrolle über die Flut und die Ebbe des Leidens, aber wir können das Wichtigste kontrollieren: wie wir damit umgehen.
Das »Resilienz-Make-up«
Viele Menschen wünschen sich einen undurchdringbaren Superman-Panzer, einen schusssicheren Ganzkörperanzug für das Leben, der gegen Schmerz und Leid imprägniert ist. Die Phönixe erzählen eine ganz andere Geschichte: Um sich zu neuen Höhen aufzuschwingen, mussten sie durchs Feuer gehen. Erst nach dieser Feuerprobe, nachdem sie das Leiden annahmen und ihm ins Antlitz sahen, begann sich ihr Leben zum Positiven zu verändern.
Wie wir sehen werden, entsteht posttraumatisches Wachstum gerade nicht durch das Rambo-Motto »Zähne zusammenbeißen und durch«. Der einsame Cowboy, der es für ein Zeichen von Schwäche hält, um Hilfe zu bitten, gehört in Wahrheit zur Hochrisikogruppe für posttraumatische Belastungen. Die Narben hinter einem lächelnden Gesicht zu verstecken verringert den Schmerz auch nicht. Wachstum entsteht ganz im Gegenteil daraus, dass wir uns erlauben, verwundbar zu sein, und die Wunden angemessen versorgen.
Der christliche Theologe Thomas Merton schreibt: »In der Tat, die Wahrheit, die viele Menschen nie verstehen, bis es zu spät ist, lautet: Je mehr man versucht, das Leiden zu vermeiden, desto mehr leidet man, denn kleinere und unwesentlichere Dinge beginnen einen zu quälen (…) Wer am meisten versucht, Leiden zu vermeiden, ist am Ende derjenige, der am meisten leidet.« [5]
Akzeptanz, Offenheit, Toleranz, Optimismus, Geduld, Achtsamkeit, Mitgefühl, Mut und Versöhnlichkeit sind Teil einer resilienten Haltung. Es sind Qualitäten, die wir trainieren können. Vielleicht gibt es also doch ein »Resilienz-Make-up«. Nur ist es in keinem Laden zu kaufen.
I WIE WIR WACHSEN
Strategien für Resilienz und posttraumatisches Wachstum
Hallo Schmerz, da haben wir einander wohl unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich derart mit deiner Nuklearkraft überwältigst, wenn du aufdrehst, und du so unbeirrt darauf beharrst, einen Logenplatz in meinem Leben zu haben. Aber du hast auch meine Beharrlichkeit unterschätzt. Nun täusch dich mal nicht darin, wie zäh ich bin.
Mit freundlichen Grüßen,
Nicht Unterzukriegen
1. »Schlimmer als sterben«
Die Armeeärztin Rhonda Cornum wurde im Irak gefangen genommen. Nach ihrer Freilassung hat sie der ganzen Armee eine Lektion in Optimismus verordnet. [6]
»Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen.«
Albus Dumbledore
Als Rhonda Cornum zu sich kam, war es stockfinster und einen Moment lang atemlos still. Bin ich am Leben?, fragte sie sich.
Dann sah sie das Feuer.
Flammen plus Benzintank gleich Explosionsgefahr. Kommandos aus ihrem Überlebenstraining ratterten ihr durch den Kopf, und sie zwängte sich aus dem Hubschrauberwrack. Nur weg von den schwelenden Trümmern und den zerfetzten Körpern ihrer fünf Kameraden.
An diesem kühlen Nachmittag des 27. Februar 1991 war Dr. Rhonda Cornum in einem Black-Hawk-Hubschrauber über der irakischen Wüste abgeschossen worden. Als Armeeärztin der »Operation Wüstensturm« hatte die damals 36 Jahre alte Chirurgin den Auftrag, einen verwundeten Soldaten aus dem Feindgebiet zu retten, doch der Hubschrauber war aus einem Hinterhalt unter Beschuss geraten.
Sie blickte auf und direkt in die Gewehrläufe von fünf irakischen Soldaten. Einer von ihnen beugte sich herunter und griff nach ihrem Arm. Die Berührung ließ in ihr einen Schmerz explodieren, der so heftig war, dass ihr sofort zwei Dinge klarwurden: Tot war sie nicht, aber schwer verletzt.
Ihre Geiselnehmer nahmen ihr die Armeeausrüstung ab, die 9-mm-Beretta, die Splitterschutzweste. Die Iraker schauten verdutzt drein, als sie ihr den Helm abzogen und hüftlanges braunes Haar zum Vorschein kam. Nervöse Befehle flatterten hin und her. Rhonda verstand kein Wort, aber die Verblüffung der Iraker wirbelte über den Wüstensand wie eine Sturmböe. Sie hatten eine Frau gefangen!
Die Soldaten führten sie zu einem Bunker, und ein Kommandant bombardierte sie mit Fragen in geradebrechtem Englisch: »Wer bist du? Was machst du hier?« Dann schleppten sie Rhonda wieder nach draußen, neben jemanden, den sie kannte: Sergeant Troy Dunlap. Also hatte doch noch jemand den Hubschrauberabsturz überlebt! Die Erleichterung darüber währte nur so lange, bis die Wächter beiden Gefangenen mit einer Handbewegung befahlen, sich auf den Boden zu knien. Rhonda spürte die Mündung einer Pistole im Nacken. Eine Stimme rief auf Englisch: »Erschießt sie!«
»Kein schlechter Abgang«
Kriegshelden gibt es in allen Formaten. Dieser ist einen Meter 65 groß und wiegt knapp 50 Kilo, ein zähes, zierliches Persönchen. Rhondas blaue Augen schießen Blitze, wenn sie sich an die gefährlichsten Minuten ihres Lebens erinnert.
Was ging ihr durch den Kopf, als sie sich zu ihrer eigenen Hinrichtung niederkniete?
»Ich habe mich darauf konzentriert, dass das kein schlechter Abschied ist.«
In der Wüste exekutiert zu werden ist kein schlechter Abgang?
»Nein, tatsächlich nicht. Im Vergleich zum Tod der meisten Menschen ist es sogar recht gut«, sagt sie mit einem gelassenen Lächeln. »Man fürchtet sich vielleicht 30 Sekunden lang, aber dann spürt man nichts mehr. Wochen- oder monatelang Schmerzen zu haben und zu leiden, das ist doch viel schlimmer. Ich dachte mir: Ich hatte ein großartiges Leben, und wenigstens wird es nicht weh tun.«
Ihr Großvater hatte ihr eingeprägt: »Es gibt Schlimmeres als zu sterben, nämlich in Schande zu leben.« Nun würde sie in Ehre sterben, im Dienst ihres Vaterlandes.
Aber der Schuss wurde nie abgefeuert. Sonst könnte Rhonda jetzt nicht auf dem Sofa ihres Bauernhofs in Kentucky gemütlich die Beine hochlegen, während sie erzählt, was als Nächstes passierte.
Sie wurde auf die Ladefläche eines Lastwagens geworfen. Ihre gebrochenen Arme baumelten nutzlos in schrägen Winkeln an ihren Seiten. Eine Kugel steckte in ihrer Schulter, und der Blutverlust betäubte sie. Ihr linkes Auge war so mit Dreck und Blut verkrustet, dass sie damit nichts sehen konnte, und sie konnte ihr rechtes Knie nicht belasten.
Nach einigen Kilometern auf der Piste zum Gefängnis spürte sie plötzlich, wie ihr Bewacher seine Lippen auf ihren Mund presste, während seine Hände am Reißverschluss ihres Fliegeranzugs zerrten.
»Ich glaub’s einfach nicht!«, dachte sie, mehr verdutzt als schockiert. »Ich bin blutbesudelt und voller Dreck, vermutlich rieche ich auch nicht besonders gut. Wie kann er das nur machen?« Sie schüttelte ihren Kopf, wand sich und protestierte – »Nein! Nein! Nein!« –, aber sie konnte die Arme nicht heben, um ihn wegzustoßen. Sie überlegte, ihn zu beißen, doch vielleicht würde ihn das nur wütend und alles schlimmer machen? Also hielt sie still. Als er ihren Kopf in seinen Schoss drücken wollte, konnte sie einen lauten Schmerzensschrei nicht unterdrücken. Er hielt inne. Rhonda wurde klar, dass seine irakischen Kameraden in der Kabine des Lastwagens nichts von seinem Vergewaltigungsversuch mitbekommen sollten. Er zog eine Decke über ihren Kopf, um ihre Laute zu ersticken.
Hilflos wie ein junger Spatz
In den nächsten Tagen wurde sie zwischen verschiedenen Bunkern hin- und hergefahren. Sie war in einer jener Situationen, mit denen sie noch nie hatte umgehen können: Sie hatte keinerlei Kontrolle. Wegen der gebrochenen Arme konnte sie ihre Hände nicht benutzen, sich nicht selbst ernähren. Wenn sie auf die Toilette wollte, musste sie ihre Wärter bitten, sie aus dem Fliegeroverall zu schälen, zum Klo zu führen und ihren Schlüpfer herabzuziehen. Die Wärter mussten sie waschen, ihr die Zähne putzen und ihr jeden Bissen in den Mund schieben wie einem jungen Spatz. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfuhr sie, was es bedeutet, vollkommen hilflos und ausgeliefert zu sein.
Zum Glück fand die Irak-Offensive ein rasches Ende. Während Rhonda die eingeritzten Striche ihres Vorgängers an der Zellenwand zählte und sich fragte, wie viele sie wohl hinzufügen würde, verhandelte die amerikanische Regierung über ihre Freilassung. Rhonda erfuhr erst später, dass die Armee plante, das Gefängnis zu stürmen, falls die Verhandlungen scheiterten. Das Vertrauen in ihre Kameraden verließ sie nie: »Ich wusste, dass sie mich nicht einfach im Stich lassen.«
Acht Tage nach ihrer Festnahme wurde sie vom Roten Kreuz nach Hause gebracht. In einem viel zu großen kanariengelben Overall, in den die Iraker sie gesteckt hatten, verließ sie das Flugzeug. Sie balancierte vorsichtig auf ihrem unverletzten Bein, die Arme notdürftig geschient. General Norman Schwarzkopf begrüßte sie als Erster, und sie versuchte vergeblich, den Gipsarm zum Salut hochzureißen. »Wie fühlen Sie sich?«, rief ein Reporter, und sie antwortete mit dem Kampfschrei ihrer Truppe: »Airborne!« Für Rhonda war das »der optimistischste, kampfeslustigste Weg zu sagen: Ich bin froh, zu Hause zu sein, aber bereit zurückzukehren, wenn es nötig ist.« [7]
Rhonda war eine von nur zwei weiblichen amerikanischen Kriegsgefangenen im ersten Irakkrieg und wurde als Heldin bejubelt. Von den 23 freigelassenen Gefangenen eroberte besonders Rhonda die Herzen der Menschen, vielleicht weil die Diskrepanz zwischen ihrer Körpergröße, der Schwere ihrer Verletzungen und ihrem überdimensionierten Optimismus so enorm groß war.
Ihre Erlebnisse in der Wüste waren eine Tour de Force durch fast alle Situationen, die in psychiatrischen Leitfäden als Ursachen für posttraumatische Belastungsstörungen aufgelistet sind: Gefechtseinsatz, Vergewaltigung, körperliche Angriffe, Bedrohung mit einer Waffe. [8]
Nach ihrer Freilassung begannen Armeepsychologen, Reporter und Freunde, sie auszuforschen. Wie schwer waren ihre seelischen Verletzungen? Würde sie das Trauma überwinden?
Rhonda wischt alle Sorgen mit einer verächtlichen Handbewegung beiseite. »Ich sehe es nicht als Trauma. Ich nenne es einen unglücklichen Unfall«, erklärt sie. »Wir tun zwei Dinge, die nicht hilfreich sind. Erstens sagen wir den Leuten, sie seien Trauma-Überlebende, und dann sagen wir ihnen, dass sie von der Erfahrung wohl beschädigt worden sind. Und Menschen versuchen in der Regel, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.«
Eine bessere Ärztin, eine bessere Chefin, ein besserer Mensch
Auf Fragen von Reportern und Freunden, wie die Kriegserlebnisse sie verändert hätten, fiel ihr nur Positives ein: »Ich bin eine bessere Ärztin, eine bessere Kommandeurin, wahrscheinlich ein besserer Mensch geworden.« Sie hatte von Haus aus eine robuste Konstitution und nie zuvor erfahren, wie es ist, auf andere angewiesen zu sein. »Jetzt kann ich meine bettlägerigen Patienten viel besser verstehen. Ich schätze meine Freundschaften viel mehr. Ich vergesse keinen Geburtstag mehr, weil mir all diese Dinge viel kostbarer geworden sind.«
Vor allem die Nahtod-Erfahrung nach dem Hubschrauberabsturz hat sie nachhaltig geprägt. »Ich verstand das als Entscheidung, das Leben wieder in meinen Körper zu lassen.« Die Ärztin, die sich immer auf die physischen Aspekte des Lebens konzentriert hatte, sah sich nun plötzlich offen dafür, »zumindest die Möglichkeit einer spirituellen Dimension zu erwägen«.
Alle fragten, welchen Schaden sie genommen habe, »aber ich fand keinen«. Ihr Mann Kory, Arzt bei der Luftwaffe, wurde sogar zu einer psychiatrischen Evaluierung einbestellt, weil er sich so verdächtig normal verhielt. Schließlich wissen die Armee-Psychologen, dass Menschen, die es gewohnt sind, sich zusammenzureißen, manchmal erst nach Monaten oder Jahren von einem unverarbeiteten Trauma eingeholt werden. Kory aber sagt, er habe einen Blick auf sein »Frauchen« geworfen und gewusst, dass es ihr gut gehe.
In den frühen 90er-Jahren gab es den Begriff »posttraumatisches Wachstum« noch nicht. Erst zehn Jahre später stieß Rhonda auf einen Artikel über die Arbeit von Richard Tedeschi und hatte plötzlich einen Namen für ihre Erfahrung.
Die amerikanische Regierung schätzt, dass sechs bis 30 Prozent ihrer Soldaten und Soldatinnen in Kriegsgebieten anhaltenden posttraumatischen Stress erfahren. [9] Rhonda sieht das Glas als halb voll: 70 bis 94 Prozent bewältigen die Erfahrung gut. »Jeder hat von posttraumatischen Belastungsstörungen gehört, aber keiner von posttraumatischem Wachstum!« Das zu ändern und mehr Menschen die Möglichkeit zu vermitteln, selbst lebensbedrohliche Situationen gut durchzustehen, ist die neue Mission von Rhonda Cornum.
Froh, gelähmt zu sein
Um das Paradox des posttraumatischen Wachstums besser zu verstehen, mache ich mich auf den Weg zu Richard Tedeschi und Lawrence Calhoun, jenen beiden Psychologen, die den Begriff geprägt haben. Ob sie wohl eine Erklärung dafür haben, warum sich Rhonda Cornum seit der Gefangenschaft für einen besseren Menschen hält? Die Universität von North Carolina (UNC) in Charlotte ist das Kernzentrum der neuen Forschung. Es ist für posttraumatisches Wachstum, was die NASA für die Weltraumfahrt ist: Tedeschi und Calhoun haben kein neues Universum geschaffen, aber neue Wege gefunden, es zu erkunden.
Die Psychologie-Fakultät residiert in einem modernen Glas-Stahl-Würfel mit Blick auf einen Teich und fette Enten, die die Universitätsstraße in Zeitlupe überqueren und darauf vertrauen, dass die hupenden Autos schon rechtzeitig bremsen werden.
Als ich in Tedeschis und Calhouns monatlicher Fakultätssitzung eintreffe, meckern die Studenten gerade über einen konkurrierenden Wissenschaftler, der die Existenz des posttraumatischen Wachstums abstreitet. »Man muss mit den Menschen sprechen, die es erlebt haben!«, ruft Tedeschi leidenschaftlich.
Genau das tut er seit drei Jahrzehnten. So leitet er unter anderem seit 25 Jahren eine Gruppe für trauernde Eltern. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer mit einer vertrauenerweckenden, ruhigen Stimme, ein kleingewachsener, drahtiger Mann mit einer grauen Strubbelbürste statt einer Frisur.
Die Psychologen Tedeschi und Calhoun haben keine interessante Theorie entwickelt, um sie dann mit Studien zu untermauern. Es war andersherum: Sie berieten Trauma-Überlebende, anfänglich trauernde Eltern, dann Menschen, die ihren Lebenspartner verloren hatten, Schwerverletzte, Krebspatienten, Kriegsveteranen und Gefangene. Wieder und wieder hörten sie eine überraschende Einsicht: Die Menschen waren nicht froh darüber, was ihnen widerfahren war, aber sie fanden, sie hatten aus der Erfahrung Wertvolles gelernt, und diese Lektionen veränderten ihr Leben zum Besseren. Sie wurden bessere Eltern, bessere Partner, mitfühlendere Freunde; sie fanden einen neuen Sinn im Leben.
Ein Patient sagte: »Ich bin wirklich froh, dass ich gelähmt bin.«
»Tatsächlich?«, fragte Tedeschi ungläubig zurück.
Ein Patient nach dem anderen berichtete, dass er das Erlebte am Anfang als Unglück gesehen, aber später erkannt habe: »Ich bin ein besserer Mensch als früher. Ich glaube nicht, dass sich mein Leben so zum Besseren verändert hätte, wenn mir das nicht passiert wäre. Also, alles zusammengenommen hat es sich für mich zum Positiven entwickelt.«
Wie kamen sie zu dieser Erkenntnis?
Eine Störung oder ein Ausdruck von Menschlichkeit?
Bei unserem Gespräch stellt Tedeschi als Erstes die gängige Traumadefinition auf den Kopf.
Das amerikanische Standardhandbuch für psychische Störungen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) definiert Trauma auf bekannte Weise: als Erlebnis, das »mit tatsächlichem oder angedrohtem Tod oder schwerer Verletzung« einhergeht. [10] Als potenziell traumatisierende Erlebnisse nennt das Handbuch: Krieg, Angriff, Geiselnahme, terroristische Anschläge, Katastrophen, schwere Unfälle, sexuellen Missbrauch und lebensbedrohliche Krankheiten.
Es diagnostiziert posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) als psychische Störungen. Tedeschi dagegen schlägt vor, diese sogenannten Störungen »einfach als Ausdruck unserer Menschlichkeit zu sehen«. Trauma bedeutet wörtlich »Wunde«. Wir sind verwundet. »Wenn jemand mit 80 Sachen gegen eine Wand fährt, hat er viele gebrochene Knochen. Sagen wir dann, da liege eine ›Knochenbruch-Störung‹ vor? Diese Person ist verletzt«, sagt Tedeschi. »Genauso ist es mit Trauma-Überlebenden: Sie wurden verletzt. Psychisch verletzt, vielleicht moralisch verletzt. Sie sind nicht gestört, sondern durch das Erlebte verwundet. Das ergibt für mich mehr Sinn.« [11]
Mit diesem Verständnis schafft er das Stigma aus der Welt, das viele Trauma-Überlebende mit dem Etikett »Störung« verbinden. Tedeschis Haltung erinnert mich an den Psychiater und Holocaust-Überlebenden Viktor Frankl, der fand: »In einer abnormalen Situation ist eine abnormale Reaktion eben das normale Verhalten.« [12]
Nach Gesprächen mit Tausenden von Klienten wartet Tedeschi mit einer Definition auf, die sich fundamental von der im Handbuch unterscheidet: »Wir definieren Trauma nicht so sehr über das Ereignis an sich, sondern über die emotionale und psychologische Auswirkung auf die Menschen. Wir schauen vor allem auf Ereignisse, die Menschen in ihren Kernüberzeugungen erschüttern. Die Welt gerät aus den Fugen. Man beginnt, in Frage zu stellen, was für ein Mensch man ist, welches Leben man lebt und welche Zukunft einem bevorsteht. Es ist also nicht zwingend etwas, was Menschen körperlich verwundet oder wo der Tod im Spiel ist. Alle diese Dinge können sicher traumatisch sein, aber uns interessiert eher, wie sich ein Erlebnis auf einen Menschen in Bezug auf seine Denkprozesse und Überzeugungen auswirkt.«
Seine Herangehensweise leuchtet mir ein. Wenn ich an meine eigenen Traumata denke, dann stammen die tiefsten Wunden nicht von Gewalt oder Todesnähe. Ich überlebte als Achtjährige einen lebensgefährlich schweren Radunfall mit einem Schädelbasisbruch und später einen aggressiven nächtlichen Angriff am Ufer des Ganges, als ich allein durch Indien reiste. Nach beiden Erlebnissen ließ der Schock innerhalb von einigen Wochen nach, die Wunden verheilten. Aber die Entdeckung, dass sich mein Lebenspartner, dem ich zutiefst vertraute, als notorischer Betrüger entpuppte, der seine Affären hinter charmanten Lügen verbarg, schockierte mich so nachhaltig, dass ich darüber jahrelang nicht hinwegkam. Da ging es nicht um den physischen Tod, aber um den Tod meiner Beziehung, meines Vertrauens, meiner heilen Welt.
Trauma liegt im Herzen des Betrachters
Tedeschi erzählt mir von einem Klienten mit einer schweren Krebserkrankung, die wohl zu seinem Tod führen wird. Mit seiner Krankheit komme er zurecht, betont der Mann, aber das traumatischste Ereignis seines Lebens sei seine Scheidung. »Er hat fast nie das Bedürfnis, über den Krebs zu sprechen«, sagt Tedeschi, »aber er will immer über die Scheidung reden. Die Scheidung hat seine Welt nachhaltig verändert und zerstört. Trauma liegt im Herzen des Betrachters, desjenigen, der es erlebt.«
Manche Menschen sehen eine Scheidung als Erlösung, Krebs als Herausforderung, der sie sich stellen, und für einige Soldaten ist der Kriegseinsatz eine der aufregendsten Ereignisse ihres Lebens. Andere können all diese Erlebnisse als traumatisch empfinden. Jeder Mensch hat seinen eigenen Pegel für Pein. Eine universelle Messlatte für das Unerträgliche hat noch keiner erfunden. Ein Soldat zischte hinter vorgehaltener Hand, Rhonda Cornum sei ja »nicht einmal gefoltert« worden! Kein Wunder, dass sie so eloquent über Resilienz dozieren könne! Aber, Sergeant, um als Autorität akzeptiert zu werden, wie lange muss sie gefoltert worden sein? Und wie schwer? Trauma ist kein Wettbewerb. Und keinem von uns steht es zu, über das Trauma eines anderen zu urteilen.
Tedeschi spricht fast unterschiedslos von »Trauma«, »schweren Stressfaktoren« und »Krise«. Wenn man Trauma gar so weit fasst, erlebt dann nicht fast jeder von uns mal ein Trauma? »Fast jeder erfährt schreckliche Dinge im Leben«, sagt er, »aber nicht jeder erfährt eine Erschütterung seines Glaubensgefüges, und manche Menschen werden nicht traumatisiert. Sie haben, aus welchem Grund auch immer, eine Sicht auf das Leben, die durch diese schrecklichen Erlebnisse nicht von Grund auf erschüttert wird.«
Ich verstehe diesen Unterschied, als Tedeschi über den Verlust der eigenen Eltern spricht. »Es gehört zum Lebensverständnis der meisten Menschen, dass alte Leute sterben. Es ist also keine große Überraschung, wenn die Mutter mit 85 das Zeitliche segnet. Man ist traurig, man vermisst sie, und es ist eine emotional schwierige Erfahrung, aber niemand sagt: ›Ich kann einfach nicht fassen, dass das passiert ist! Das ergibt keinen Sinn!‹ Es ist ein großer Unterschied, ob man seine Oma oder sein Kind beerdigt. Auch wenn man beide sehr geliebt hat, das eigene Kind zu verlieren stellt eine natürliche Ordnung auf den Kopf, die wir für gesetzt halten.«
Tedeschis Perspektive erhellt, warum Rhonda Cornum von ihrer Gefangenschaft nicht traumatisiert wurde, obwohl ihr Wüstenerlebnis perfekt in das Trauma-Textbuch passt. Die Tortur war zwar erniedrigend, dramatisch und lebensgefährlich, aber sie hob ihre Welt nicht aus den Angeln.
Paradies im Land des Bourbon
Ich wollte Rhonda Cornum treffen, weil ich herausfinden musste, wie sie die Gefangenschaft überstehen konnte, ohne zusammenzubrechen. Was half ihr? Wie ging sie mit den körperlichen Schmerzen um? Ich war auch ein wenig skeptisch, dass jemand solche Ereignisse wirklich völlig unbeschadet übersteht. Vielleicht spielte sie das der Öffentlichkeit nur vor, weil sie besonders tough erscheinen wollte?
Ich besuche sie in ihrem Bauernhof in Paris, Kentucky. »Die Wahrheit Gottes besteht alle Prüfungen«, verspricht das Schild vor der winzigen Backsteinkirche auf dem Weg. Als ich ankomme, hat Rhonda gerade ihre 61 Kühe gefüttert. Sie springt in grünen Gummistiefeln aus einem Pick-up. Statt einer Begrüßung und einem Händedruck eilt sie winkend vorbei und ruft, sie müsse noch schnell eine Hundeleine holen. Sie trägt ausgewaschene Jeans, eine ausrangierte Armeejacke und einen leuchtend pinkfarbenen Sweater. Ihr Hof ist ein Paradies! Die burgdicken Steinmauern von 1810 umschließen eine gemütliche Küche und ein Wohnzimmer, in dem die Katze Dakota auf dem Sofa schnurrt. Vor den Sprossenfenstern galoppieren Vollblüter um den idyllischen Privatsee. Rhondas ausgelassene Gordon-Setter-Welpen betteln fiepend um Streicheleinheiten. Bis ich die Farm wieder verlasse, bin ich bis zum Bauchnabel mit Schlamm und Welpenkot bedeckt.
Rhonda lebt hier allein und versorgt die Kühe, Pferde, Truthähne, Kühe, Hunde und Katzen selbst, nur ein Teilzeit-Stallbursche hilft. Ihr Mann Kory befehligt ein Militärkrankenhaus in Mississippi, aber sie hat beide Namen auf das 160-Liter-Bourbon-Fass neben dem Eingang schnitzen lassen. Wir sind hier im Land des Bourbons (die Gemeinde heißt wirklich so). Zwei Gewehre hängen über den schweren Holztüren, Gemälde von Jagdszenen mit Pferden und Hunden sind die einzige Dekoration. Sogar die Tischlampe ist eine Setter-Statue.
Rhonda ist Brigadegeneralin im Unruhestand. Als Direktorin der Beratungsfirma TechWerks und Professorin für Militär- und Notfallmedizin an der Uniformed Services-Universität für Gesundheitswissenschaften wird sie vor allem als Resilienzexpertin angefragt. In den letzten Jahren ihrer Armeekarriere initiierte sie das »Comprehensive Soldier Fitness Program« (CSF), das alle amerikanischen Soldaten darin trainieren soll, so resilient, tough und anpassungsfähig wie Rhonda zu werden. Mehrmals im Monat verlässt sie ihren Hof, um ihr Resilienztraining zu präsentieren.
Kernkompetenzen: Rhondas Resilienz-Curriculum
Die Kernkompetenzen, die Rhonda vermittelt, basieren auf den Erkenntnissen der kognitiven Verhaltenstherapie:
realistischer Optimismus
effektive Problemlösung
Anpassungsvermögen
positive Bewältigungsstrategien
Selbstbeherrschung
enge Beziehungen und soziale Unterstützung
körperliche Gesundheit, Fitness und Schlaf
die Fähigkeit, auch unter Druck ruhig, präsent und engagiert zu bleiben
niedriges Stressniveau und erhöhtes psychisches Wohlbefinden
verbesserte Konzentration und Engagement
Wir werden uns in den nächsten Kapiteln einige dieser Kompetenzen genauer ansehen.
Welche Strategien funktionierten für Rhonda in der Gefangenschaft? Nach dem Hubschrauberabsturz flackerte Schmerz auf, wenn ihre gebrochenen Arme bewegt wurden, aber wenn sie ruhig lag, fand sie den Schmerz trotz der Schusswunde und des verletzten Knies erträglich. Als Chirurgin hatte sie sich oft darüber gewundert, wie unterschiedlich ihre Patienten mit Schmerz umgingen. Sie ist davon überzeugt, dass wir Schmerz auch mit Willenskraft kontrollieren können. [13] »Reiß dich zusammen! Lass dich nicht unterkriegen!«, befahl sie sich selbst immer wieder. Sie klammerte sich an diese Worte wie an einen mentalen Rettungsanker, als sie von ihren Wärtern herumgeschubst wurde.
Übernehmen Sie die Kontrolle
Eine traumatische Erfahrung entreißt uns die Kontrolle über das, was uns gehört: vielleicht unseren Körper, unsere Freiheit oder unsere Würde. Ein einziger Telefonanruf, eine unerwartete Diagnose oder ein unachtsamer Fahrer kann auf einen Schlag unsere ganze Existenz vernichten. Gerade weil ein Trauma uns oft ohnmächtig zurücklässt, hilft es, die Kontrolle wieder an uns zu ziehen. »Das Trauma löst beim Opfer ein Gefühl der Ohnmacht und des Kontrollverlustes aus. Für die Genesung ist es daher von grundlegender Bedeutung, dass der Patient seine Stärke und die Kontrolle über sich und sein Leben wiedererlangt«, bestätigt die Trauma-Expertin Judith L. Herman. [14]
Manche Gefangene stehen jeden Morgen um vier Uhr auf, um ihre Gebete zu sprechen. Auschwitz-Überlebende berichten, sie hätten sich im Lager jeden Morgen penibel rasiert, obwohl sie das zu Hause selten taten. Und ich kenne Kollegen mit Multipler Sklerose oder chronischer Müdigkeit, die sich selbst ein tägliches Pensum an Recherche oder Schreiben auferlegen, an das sie sich fast sklavisch halten. Jedes, wirklich jedes noch so kleine Quentchen an Kontrolle, das wir ausüben, kann uns helfen, das Dickicht zu lichten. Wenn wir wie Rhonda im Irak wenig oder gar keine Kontrolle über eine Situation haben, können und müssen wir uns auf das besinnen, was wir beherrschen können: unseren Verstand. »Sie können kontrollieren, was du isst und was du tust«, sagt Rhonda, »aber wir können kontrollieren, was wir denken.«
Sie ist davon überzeugt, dass unsere Einstellung unsere Schmerzerfahrung entscheidend beeinflusst: »Ich habe in meinem Kopf einfach einen neuen Normalzustand eingestellt, und dann musste ich nicht mehr darüber nachdenken, bis etwas Neues passierte. Zum Beispiel haben meine Arme jedes Mal weh getan, wenn der Lastwagen über ein Schlagloch holperte. Also habe ich eine neue Schmerzschwelle definiert, und weiter ging’s.« Als Ärztin weiß sie, dass sich Schmerz verschlimmert, wenn wir uns auf ihn fokussieren. Deshalb nutzte sie die endlosen Stunden im Bunker, um irakische Vokabeln auswendig zu lernen und in Gedanken neue Ställe für ihre Pferde zu entwerfen.
Mit ihrer charakteristischen Fähigkeit, sich auf das Positive zu konzentrieren, zieht sie Bilanz: »Ich war schwerverletzt, aber ich wusste, die Wunden werden wieder heilen. Der Absturz war so verheerend, dass ich ihn nicht hätte überleben sollen, und ich betrachtete jede Minute Leben als Geschenk. Es war gerade genug Glück, mich daran festzuhalten. Ich schwor mir, da lebend rauszukommen.« [15] Wenn sie über die Gefangenschaft spricht, klingt sie unglaublich rational: »Es gab nur eine Alternative dazu, und zwar den Tod. Da war mir die Gefangenschaft lieber.«
Bevor sie zu dem schicksalsträchtigen Hubschraubereinsatz aufbrach, hing ein Schild vor ihrer Hilfsstation in der Wüste, auf dem stand: »Leiden ist dumm, aber Jammern ist dümmer.«
Sogar der sexuelle Angriff, versichert sie mir, »war keine große Sache. Alle zehn Sekunden wird eine Frau in Amerika bedroht. Es ist also völlig irrelevant, wenn alle zehn Jahre einmal eine Frau im Krieg attackiert wird. Das gehört als Soldatin zum Berufsrisiko und ist sicher kein Grund, Frauen nicht an die Front zu schicken.« Sie könne nur für sich sprechen, nicht für andere Gewaltopfer, sagt Rhonda und verdreht die Augen, weil sie von Journalisten und Kollegen immer wieder auf den Angriff angesprochen wird: »Leute, regt euch wieder ab!«
Kann denn jemand wirklich aus so hartem Holz geschnitzt sein? Wenn ich in einem Loch im Irak feststeckte, als Gefangene mit gebrochenen Armen und Wärtern, die meine Hilflosigkeit ausnutzen, hätte ich garantiert panische Angst. Ich habe meine Fassung schon wegen weniger verloren. Viel weniger.
Wenn mir Rhonda Cornum nur Durchhalteparolen andrehen will, bin ich daran nicht interessiert. Ich habe das versucht, und es hat nicht funktioniert. Auch weiß ich, dass Menschen viel zu oft nur Stärke markieren, während sie eigentlich Hilfe brauchen. Da muss mehr dran sein. Andererseits spreche ich ja gerade deshalb mit Rhonda, weil ich erfahren möchte, wie ich selbst und andere Menschen Krisensituationen besser bewältigen können. Vielleicht kann Rhonda dabei helfen, eines der ewigen Rätsel von Traumata zu lösen: Wann muss man sich mit aller Kraft am Riemen reißen, und wann wird das kontraproduktiv?
Gleichzeitig finde ich es erfrischend und ermutigend, dass eine Frau der Erwartung trotzt, sie müsse an einem sexuellen Angriff zerbrechen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Organisationen, die sich für die Überlebenden von sexueller Gewalt einsetzen, und fand es immer besonders qualvoll, dass die Mädchen und Frauen vor allem in Asien und Afrika zusätzlich zu der Gewalt auch noch das Stigma aushalten müssen. Sexuelle Gewalt gilt immer als Schuld der Frauen, und viele von ihnen werden dafür von ihren Familien verstoßen. Sehr häufig halten sie sich selbst für beschmutzt. Vor diesem Hintergrund empfinde ich es als Erleichterung, dass ich zum ersten Mal eine Frau ganz ohne Scham über einen sexuellen Angriff sprechen höre.
Die sexuelle Gewalt gegen Rhonda wurde oft als Argument ins Feld geführt, Frauen nicht an die Front zu lassen. [16] Rhonda hat dazu eine klare Meinung: »Ein Gefecht hat nichts mit Hormonen zu tun.« Dass ihre Kollegen Frauen grundsätzlich für schwächer hielten, wäre ihr beinahe zum Verhängnis geworden. Ihre Stimme klingt belustigt, wenn sie sich an die letzten Momente erinnert, bevor ihr Hubschrauber abgeschossen wurde. Sobald ihnen klarwurde, dass sie in feindliches Feuer geflogen waren, warfen sich die Soldaten auf Rhonda, die einzige Soldatin. »Das war gut gemeint, aber kontraproduktiv, weil die Kugeln von unten kamen. Ich habe sie also mit meinem Körper vor den Kugeln beschützt.«
Hauptsache Überleben
Rhonda wirkt alles andere als kalt oder abgebrüht. Sie gießt aufmerksam Tee nach und reißt Witze, ist warmherzig und gastfreundlich.
Im Krieg versuchte Rhonda, nicht an ihre damals 13 Jahre alte Tochter Regan und ihren Mann Kory zu denken. »Ich habe die Familie in eine Schublade gesteckt. Das mag nicht gesund sein, aber es hilft, wenn man ein Thema wegsperren kann.« Ihre Fähigkeit, sich auf ihr Überleben zu konzentrieren, ist eine Überlebensstrategie, die für sie funktionierte. Es wäre weit schlimmer für sie gewesen, wenn ihre Tochter oder ihr Mann in einem fremden Land in Gefahr geraten wären, »denn ich hätte rein gar nichts tun können. Ich hätte hilflos dasitzen und warten müssen. Aber in meiner Lage gab es einiges, was ich tun konnte, nämlich stark, stolz und selbstbewusst zu bleiben.«
Ich verstehe: In einer Krise ist unsere oberste Priorität zu überleben, vor allem als Soldat, aber das gilt auch für andere, etwa für Gefängnisinsassen, Unfallopfer oder Opfer häuslicher Gewalt. Wir tun, was auch immer nötig ist, um zu überleben, und dabei hilft es, effektive Bewältigungsstrategien zu kennen.
Entwerfen Sie einen psychologischen Überlebensplan
Rhonda Cornum war immer schon eine unverbesserliche Optimistin. Einer ihrer Lieblingssprüche lautet: »Egal wie schlimm es ist, es kann nur besser werden!« Sie nennt diese Taktik Teil ihres »psychologischen Überlebensplans«. Wann immer sie in eine kritische Situation gerät, versucht sie, sich »den schlimmsten, den besten und den wahrscheinlichsten Fall« vorzustellen. Vor ihrem Kriegseinsatz dachte Rhonda bewusst über den schlimmstmöglichen Ausgang ihres Einsatzes nach: Tod. »Also muss das, was passiert, besser sein oder wenigstens nicht schlimmer.« [17]
Der Psychologe Martin Seligman von der Universität von Pennsylvania nennt diese Methode »die Dinge relativieren«, [18] ein Drei-Schritte-Modell, das Katastrophendenken durchkreuzen soll. Das Ziel ist, Perspektive zu gewinnen, damit wir Risiken richtig einschätzen, aber von drohenden Gefahren nicht gelähmt werden. Viele von uns (ich eingeschlossen) malen sich katastrophale Wendungen aus und rechnen damit, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Naiv darauf zu hoffen, alles werde sich schon fügen, ist genauso trügerisch. Wir müssen einen Mittelweg beschreiten und uns bewusst die Möglichkeit eines realistischen, positiven Ausgangs vor Augen halten.
Rhonda Cornum hatte diese Techniken nicht gelernt. Tatsächlich hatte sie überhaupt kein psychologisches oder praktisches Training, das sie auf die Gefangenschaft vorbereitet hätte. Als Frau hätte sie sich ohnehin nicht an den Gefechten beteiligen dürfen. (Theoretisch war sie eine Ärztin mit der Aufgabe, einen abgeschossenen Piloten zu retten, aber in Wahrheit hatte sie schon bei einem früheren Flug sechs irakische Soldaten mit der Pistole in Schach gehalten.)
Rhonda erinnerte sich daran, was ihr Mann ihr von seinem Überlebenstraining bei der Luftwaffe erzählt und was sie in Hollywoodfilmen gesehen hatte: Gib nur deinen Namen und Rang, aber keine Informationen preis. Mit dieser Strategie fuhr sie erfolgreicher als einige ihrer Kollegen, die ihre Bewacher mit Anti-Saddam-Hussein-Sprüchen provozierten und dafür geschlagen und gefoltert wurden. Rhonda blieb höflich, zuvorkommend und zuversichtlich. All die Jahrzehnte antrainierter Selbstbeherrschung hatten sich gelohnt.
Erkennen und meistern Sie Ihre Wirkungskraft
Rhondas Zuversicht ist ein frappierendes Beispiel für Eigeneffizienz. [19] Die Resilienzexpertin Ann Masten von der Universität von Minnesota definiert diese Eigenschaft als »Überzeugung, dass wir effektiv sind, dass wir unsere Situation in den Griff bekommen und die Probleme lösen können. Wenn wir glauben, dass wir es schaffen können, motiviert uns das, aufzustehen und zu handeln. Haben wir damit Erfolg, untermauert der Erfolg wiederum unser Selbstvertrauen. Schau, ich kann's! Das Feedback belohnt den Versuch. Dieses Motivationssystem ist enorm wichtig. Es ist der Motor, der unser Handeln antreibt.« Menschen mit hoher Eigeneffizienz geben nicht auf und probieren neue Wege, bis sie eine Lösung gefunden haben.
Henry Ford sagte: »Ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht – in jedem Fall hast du recht.«
Sind also aus dem Absturz im Irak gar keine Blessuren zurückgeblieben? Rhonda hat physische Narben, und die Arthritis in ihrer rechten Schulter hat sich so verschlimmert, dass sie möglicherweise ein Ersatzgelenk braucht. »Es tut weh, wenn ich mein Shirt ausziehe, und ich schaffe nicht mehr so viele Liegestütze, aber ich bin gerade einen Marathon gelaufen.«
Die Gefangenschaft hielt sie auch nicht davon ab, sich für einen erneuten Einsatz zu melden. Sie wäre gerne als oberste Armeeärztin 2006 nach Afghanistan gegangen, doch aus politischen Gründen musste ein Deutscher den Job bekommen.
»Egal ob man mit einem Gefechtseinsatz, einer Scheidung, Krebs oder einem Autounfall konfrontiert ist – wie man mit solchen Herausforderungen umgeht, unterscheidet sich nicht sehr«, sagt sie. »In diesem Sinne waren die Ereignisse im Irak nicht anders. Ich habe all diese Dinge immer schon praktiziert, mein ganzes Leben lang. So lebe ich eben.«
Sie zitiert ein Motto, das sie seit Universitätszeiten begleitet: »Die größten Menschen der Zeitgeschichte sind diejenigen, die einen Nachteil in einen Vorteil verwandeln.«
Aha, jetzt kommen wir zum Kern. Wie genau verwandeln wir einen Nachteil?
Rhonda brauchte fast zwei Jahrzehnte und Begegnungen mit renommierten Psychologen wie Richard Tedeschi und Martin Seligman, um zu begreifen, dass ihre Lebensstrategien Methoden sind, die man sich antrainieren kann.
Wie wir Hilflosigkeit verlernen
Martin Seligman stieß in den 60er-Jahren auf das Konzept der »erlernten Hilflosigkeit«, als er Hunden Stromstöße verpasste. [20] Eine Gruppe von Hunden konnte die Schocks beenden, indem sie einen Hebel drückten, eine andere Gruppe nicht. Der Clou war: Wenn man die Hunde, die die Stromstöße nicht verhindern konnten, später in eine Situation brachte, in der sie den Stromstößen durch einen Sprung über eine Hürde entkommen konnten, blieben die meisten stoisch sitzen. Sie ertrugen die Stromschläge ganze 50 Sekunden lang, obwohl sie einen Ausweg hatten. Man würde denken, jeder, der Schmerzen entfliehen kann, würde keine Sekunde zögern, oder? Die meisten Hunde, die zum ersten Mal in dem Käfig saßen, sprangen sofort heraus. Aber wenn die Hunde einmal gelernt hatten, dass sie den Stromstößen ohnmächtig ausgeliefert waren, ließen sich die meisten selbst durch Leckerli nicht aus dem Käfig locken. Sie mussten aus dem Käfig getragen werden, und zwar nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal, bis sie begriffen, dass sie dem Schmerz entfliehen konnten.
Ähnliche Experimente wurden mit Ratten, Mäusen, Küchenschaben und schließlich mit Menschen wiederholt, und die Ergebnisse ähnelten sich frappierend. Wenn Menschen und Tiere einmal gelernt hatten, dass sie gegen ein unangenehmes Geräusch oder einen leichten Schock nichts ausrichten können, gaben die meisten auf, obwohl sie später den Stress leicht hätten beenden können. Nun hatten Psychologen plötzlich eine Erklärung, warum zum Beispiel Gewaltopfer eine gefährliche Situation nicht verließen. Nicht nur das: Die Menschen, die die Schocks als unausweichlich hinnahmen, zeigten schwächere Immunreaktionen. Erlernte Hilflosigkeit macht buchstäblich krank.
Ein Drittel der Menschen allerdings war immer resilient, unabhängig von den Umständen. Sie suchten immer nach einem Ausweg. Als diese Teilnehmer interviewt wurden, wurde schnell klar, dass der Unterschied in ihrer Denkweise lag.
Optimisten wie Rhonda denken: »Ich komme da raus, das dauert nicht ewig, und ich kann meinen Teil dazu beitragen.« Sie konzentrieren sich auf die Aufgabe, die vor ihnen liegt, und suchen nach einem Nutzen, den sie aus der Not ziehen können.