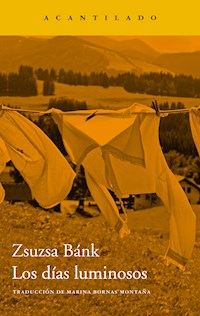9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Seinen letzten Sommer verbringt der Vater am Balaton, in Ungarn, der alten Heimat. Noch einmal sitzt er in seinem Paradiesgarten vor dem Sommerhaus, noch einmal steigt er zum Schwimmen in den See. Aber die Rückreise erfolgt im Rettungshubschrauber und Krankenwagen, das Ziel eine Klinik in Frankfurt am Main, wo nichts mehr gegen den Krebs unternommen werden kann. Es ist der heiße Sommer des Jahres 2018, und die Tochter setzt sich ans Krankenbett. Mit Dankbarkeit erinnert sie sich an die gemeinsamen Jahre, mit Verzweiflung denkt sie an das Kommende. Sie registriert, was verloren geht und was gerettet werden kann, was zu tun und was zu schaffen ist. Wie verändert sich jetzt das Gefüge der Familie, und wie verändert sie sich selbst? Was geschieht mit uns im Jahr des Abschieds und was im Jahr danach? In ihrem eindrucksvollen Erinnerungsbuch »Sterben im Sommer« erzählt Zsuzsa Bánk davon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zsuzsa Bánk
Sterben im Sommer
Über dieses Buch
Seinen letzten Sommer verbringt der Vater am Balaton, in Ungarn, der alten Heimat. Noch einmal sitzt er in seinem Paradiesgarten unter der Akazie, noch einmal steigt er zum Schwimmen in den See. Aber die Rückreise erfolgt im Rettungshubschrauber und Krankenwagen, das Ziel eine Klinik in Frankfurt am Main, wo nichts mehr gegen den Krebs unternommen werden kann. Es sind die heißesten Tage des Sommers, und die Tochter setzt sich ans Krankenbett.
Mit Dankbarkeit erinnert sie sich an die gemeinsamen Jahre, mit Verzweiflung denkt sie an das Kommende. Sie registriert, was verloren geht und was gerettet werden kann, was zu tun und was zu schaffen ist. Wie verändert sich jetzt das Gefüge der Familie, und wie verändert sie sich selbst? Was geschieht mit uns im Jahr des Abschieds und was im Jahr danach?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Zsuzsa Bánk, geboren 1965 und gelernte Buchhändlerin, lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main. Gleich ihr erster Roman »Der Schwimmer« war ein großer Erfolg und wurde mit fünf Literaturpreisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen ihre Romane »Die hellen Tage« und »Schlafen werden wir später«.
Zsuzsa Bánks Vater László, geboren 1933 in Hidasnémeti, Ungarn, starb im September 2018.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Der Sommer wirft …
Wir stehen still …
Bevor ich mit …
Wir fahren die …
In Balatonfüred hatte …
Täglich rufen wir …
Wie kann ein …
Der Krankentransport des …
Früher sind in …
Mir macht Angst …
Mein Vater schläft …
Ich fange an …
Ich hatte ein …
Wieder ein verrückt …
Klingt es vermessen …
Wir wollen dankbar …
Mein Vater ist …
Eine Freundin durchleidet …
Sein glückliches Gesicht …
Die Mitarbeiterin des …
Die Zeit zu …
Als ich am …
Der Anruf kommt …
Ein gutes Ende? …
Unvorstellbar, dass es …
Ich dachte immer …
Wir sitzen im …
Ob er schon …
Ich fand immer …
Alles, was unser …
Wir sichten Papiere …
Jeden Morgen mache …
Vor fünf Jahren …
Wir bestellen Kränze …
Auf der letzten Sommerreise …
Wir kaufen ein …
Der Pfarrer wird …
Wofür schäme ich …
Wir suchen das …
Jeden Morgen versuche …
Wir lernten viel …
Die Trauerfeier ist …
Die Friedhofsgänge danach …
Mindestens einmal im …
Auch mit Herbstbeginn …
Wir sind drei …
Es ist fast einfacher …
Meine Mutter lässt …
An meiner Laufstrecke …
Der erste Tag …
Zwei Freundinnen haben …
Seit dem ersten …
Sonntag darauf besuchen …
Irgendwann werden die …
Wie es mir …
Mitte November, das …
Ich wache am …
Ende Januar, halb …
Am Telefon eröffnet …
Januarabend, dunkelblauer Himmel …
Es wird März …
Im Briefkasten meiner …
Für den Sommer buche …
Frühlingsbeginn, aber meine …
Im November hatte …
Meine Freundin, mit …
Karfreitag, Ostersamstag mit …
Im Juni bringen sie …
Erwähne ich, wir …
Das Paradiesgartenhaus, das …
Auf dem Weg …
Im Sommerhaus packen …
Heute, jetzt, in …
Ein Bild werde …
Danksagung
Der Sommer wirft sein stärkstes Gelb auf uns, aber wir reden vom Winter. Auf der Fahrt nach Südosten, Würzburg, Regensburg, Passau, Wien, dann Ungarn, Sopron, Sárvár, erzählt meine Mutter vom Winter, es ist schweißtreibend heiß, aber sie erzählt von Eis und Schnee im Januar 1973, als meinen Eltern in ihrer kleinen Frankfurter Wohnung am Telefon ein Telegramm diktiert worden war. Ein Telegramm aus Ungarn, in ungarischer Sprache aufgesetzt, vom deutschen Telegrafenamt vorgelesen, in neutralem Ton, ohne Wertung, ohne Deutung und Wissen, Buchstabe für Buchstabe, weil die Wörter keinen Sinn ergaben, nicht für ein deutsches Ohr. Mein Vater hatte den Hörer abgenommen, Zettel und Stift bereitgelegt und wiederholte jeden Buchstaben, meine Mutter schaute voller Angst zu ihm, weil sie ahnte, vielleicht schon wusste, was jetzt kommen würde, weil es nicht unerwartet war, sondern etwas, auf das ihre Befürchtungen seit Wochen zuliefen. Mein Vater hatte angefangen aufzuschreiben, setzte den Stift aber schnell ab. Die ersten vier Buchstaben des Wortes reichten aus, um es vollständig zu begreifen, sein Ausmaß sofort zu erkennen: m-e-g-h. Mehr war nicht nötig, um zu wissen, wie sich das ganze Wort zusammenfügte, wie es beschaffen war und auf was es hindrängte, was es sagen wollte und uns allen überbringen würde, »meghalt« – ist gestorben.
Meine Mutter erinnert sich, wie sie die lange dunkle Reise in ihr Heimatdorf antrat, das sie sechzehn Jahre zuvor während des Ungarnaufstands Hals über Kopf verlassen hatte. Freunde hatten ihr geraten, mit der Abreise nicht zu zögern, mit dieser Fahrt ins Ungewisse, in all ihre Unwägbarkeiten, also nahm sie den Nachtzug von Frankfurt nach Wien, ging am Morgen für ihr Visum zu Ibusz, dem staatlichen ungarischen Fremdenverkehrsbüro, der Anlaufstelle aller, die im Kalten Krieg von West nach Ost, von Österreich nach Ungarn reisten, also in die Richtung, in die sonst niemand wollte, gegen den Strom. An diesen düsteren, klirrkalten Winter erinnert sich meine Mutter, an seine dunklen Eistage und hellen Schneenächte, während die Sonne auf unser Auto knallt und die Felder ringsum verdorren, an ihre Mischung aus Trauer, Lähmung und nervöser Angst, es nicht zu schaffen, nicht rechtzeitig zur Beerdigung zu kommen, um ihren Vater ein letztes Mal zu sehen, wenn auch tot.
In diesem Dorf sitzen wir dann einen Tag später, vor dem Haus meiner Tante und Cousine, im Garten, mit Blick auf die nahen Weinhänge, umgeben von Oleander und Kirschbäumen, die ihre Früchte schon abgeworfen haben, in einem Paradiesgarten, in dem die Erinnerung an diesen Winter 1973 unvergänglich bleibt. Meine Cousine erzählt, dass sie damals glaubte, jetzt sei das Ende der Welt gekommen, das vége a világnak. Sie hatte die Gardinen am Fenster beiseite geschoben, dicke Schneeflocken fielen, ihren Vater sah sie in Hut und Mantel mit finsterer Miene durchs Schneetreiben gehen, langsamer als sonst, zögernd wegen der Nachricht, die er für sie hatte, und sie wusste, das Weltende war da, jetzt ist es gekommen, Großvater ist gestorben und hat unser Weltende eingeläutet.
Obwohl wir in Ungarn den hell leuchtenden Sommer gesucht haben, finden wir auch diesmal Krankheit und Tod, dieses sich fest umschlingende Paar, es drängt sich auf, und man wird es nicht los, wie eine Klette haftet es, klebt an einem, es will dazugehören und tanzt mit, krallt sich fest, löst sich nicht aus seiner Umarmung. Jeder hat seine Geschichte von Krankheit und Tod, jeder hat seine Verluste, seine schwarzverästelten Bilder, die nicht verblassen. Die Toten sind nie tot, sie gehören in die ersten Sätze einer Begegnung, eines Gesprächs, sie sitzen in den Gärten, an den Tischen, vor den Suppenschüsseln, den Körben mit dem aufgeschnittenen weißen Brot, und befehlen, so, nun redet von mir, lasst nicht nach, hört nicht auf, von mir zu reden. Die Wunde ist verheilt, aber die Narbe meldet sich zurück, hier unter dem Kirschbaum, unter der Akazie, wann immer sie Lust hat und findet, jetzt wäre der Augenblick, jetzt wäre es wieder an der Zeit. Meine Mutter weint nach all diesen Jahren noch um ihren Vater, meine Cousine und ich, wir weinen nach all diesen Jahren noch um unseren Großvater, der Schmerz ist nur in etwas Alltägliches übergegangen, er verteilt sich auf alle, die sich um den Tisch versammeln, jeder nimmt ein Stück davon und schluckt es mit Brot und Suppe herunter.
Ich bin aufgebrochen, um meinen kranken Vater in seinen Ungarnsommer zu fahren. Ihn im Dorf abzusetzen, vielleicht an den Balaton mitzunehmen. Ihn noch einmal diesen Walnussbaumsommer spüren zu lassen, einmal noch im Café am Kisfaludy-Strand ein gekühltes Soproni für ihn zu bestellen und mit ihm aufs weite Blau zu schauen. Aber seit wir angekommen sind, geht es ihm schlechter, jede Nacht bangen wir. Ein Fieber hat ihn überfallen, es will nicht weichen, die Klinik zu Hause sagt mir am Telefon, er muss sofort behandelt werden. Meine Cousine verbietet mir, ihn in ein ungarisches Krankenhaus zu bringen, niemand hilft dort, sagt sie, die Menschen sterben in der Notaufnahme, also fahren wir nach Eisenstadt, auf österreichischer Seite das nächstgelegene Krankenhaus. Nicht weit von hier ist mein Vater vor mehr als sechzig Jahren über die Grenze geflohen.
Wir warten in Eisenstadt bis zum Abend, aber es wird kein Bett frei, er soll in eine andere Klinik nach Niederösterreich, die Ambulanz wird ihn bringen. Zum Abschied sage ich, in ein paar Tagen hole ich dich ab, wir sitzen am Balaton und bestellen zwei Soproni, ich spiele Zuversicht, lege Normalität in meine Stimme und lasse die Angst nicht zu, ich lasse nicht zu, dass sie meine Wörter anfasst, sie bindet, eintrübt und lähmt, seit einiger Zeit habe ich Übung darin, die Dinge herunterzuspielen, ihre Grausamkeiten wegzuschieben und zu übergehen, ihnen die Spitze zu nehmen. Doch das Fieber hält uns in Atem, an allen folgenden Tagen wird es gegen Mittag verschwinden, aber am Abend zurückkehren und steigen, immerzu warte ich auf einen Anruf, auf die Klinik, die Ärztin, die Krankenschwester, auf meine Cousine im Paradiesgarten, meine Mutter in ihrem Sommerhaus zwei Straßen weiter, meinen Bruder in Berlin, sie alle gehören zum Reigen aus Furcht und Anspannung, zu unserem Netzwerk der Sorge. Während meine Kinder in den Balaton springen und sich beim Wasserpolo austoben, den Ball mit ihren Fäusten in den Himmel jagen, stehe ich am Ufer und nehme die Anrufe entgegen, bei jedem Klingeln saust Angst in meine Kehle, in diesem gleißenden Sommer mit all seinen verlässlichen Vergnügungen und Schmeicheleien habe ich angefangen, mit dem Schlimmsten zu rechnen.
Einen großen Sommer wollten wir, vielleicht den letzten. Tage, die sorgenfrei, vielleicht sogar schmerzfrei wären. Tage, an denen der Krebs ruht. Schläft, nicht aufwacht. Einfach durchschläft. Sich nicht rührt. Sich höchstens auf die andere Seite dreht – und dann weiterschläft. Ja, der Sommer ist groß, wie er hier immer groß ist, die Grillen zirpen mit Hingabe, die Temperatur klettert jeden Morgen hoch, und die Wälder rauschen lauter, sobald ein Wind aufkommt. Die Straßen, die schmalen, endlosen Asphaltadern, gehören am Abend allein mir, wenn ich vom Krankenhaus zum Dorf oder weiter vom Dorf an den Balaton fahre. Ich fahre dreitausend Kilometer diesen Sommer. Ich kaufe Vignetten, ich reise von Land zu Land, von Grenze zu Grenze, Slowakei, Österreich, Ungarn, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, ich wechsle die Sprachen, Ungarisch, Deutsch, Englisch, ich komme durcheinander. Mein Vater wandert von Krankenhaus zu Krankenhaus, durch eine Folge aus Stationen. Am Ufer von Balatonfüred, wo ich gerade im Badeanzug unter einer heißen Sonne stehe, erreicht mich seine Ärztin, mein Vater muss operiert werden, in wenigen Minuten wird er mit dem Helikopter ins nächste Krankenhaus gebracht, eine Stunde nördlich von Wien. Während meine Kinder beim Wasserball kreischen, winken, springen, die Wasseroberfläche ohrfeigen, kopfüber hinabtauchen und Handstand üben, steigt irgendwo hinter Bratislava ein Hubschrauber mit meinem Vater in die Luft. Ich lege meine Hände zusammen und schicke meine Gebete über den blauen See.
Neu ist es nicht, auch nicht überraschend, Krankheit und Tod gehörten in Ungarn immer dazu, seit ich denken kann, seit wir die Sommer hier verbracht haben, waren sie hier zu Hause. Nur dass wir jetzt die Hauptfiguren sind, nicht die anderen. In jedem Jahr, auf das wir zurückblicken, musste jemand gehen, in jedem Jahr mussten wir von jemandem Abschied nehmen, jemanden hergeben und loslassen. Krankheit und Tod waren die ungebetenen Gäste, klopften an, setzten sich an unseren Tisch, aßen von unseren Tellern. Die Menschen starben in ihrer Küche, ihrem Bett, bei der Gartenarbeit, der Feldarbeit, beim Kirschenpflücken, beim Schweinefüttern, auf dem Weg zur Kirche, zum Wirtshaus, auf dem Fahrrad, dem Moped, beim Laufen, Spielen und Toben. Eigentlich nie im Krankenhaus. Das Sterben war nicht ausgelagert, es geschah unter Zeugen. Nicht nur die Alten starben, auch die Jungen, die Kinder starben, die Säuglinge. Die ärztliche Versorgung war mangelhaft, Medikamente gab es zu wenige. Meine Cousine erzählt an einem dieser lauen Abende, dass nur sie und ihre Brüder gegen Polio geimpft wurden, nur sie und die Kinder des Dorfarztes. Den Impfstoff hatte meine Mutter von ihrem ersten in Deutschland verdienten Geld gekauft und mit der Post geschickt.
Immer haben mich meine Eltern so selbstverständlich, mühelos auf ihre leichte Art umgeben – dass es in den vergangenen Jahren jeden Tag hätte vorbei sein können, habe ich nie zu ernst genommen, aber doch geahnt und mit ein paar abseits liegenden, versteckten Nervenenden erspürt. Deshalb bin ich im Jahr zuvor nach Ungarn gereist, um sie in ihrem Sommerhaus zu besuchen, deshalb ist mein Bruder im Jahr zuvor nach Ungarn gereist, um sie in ihrem Sommerhaus zu besuchen, mit unserem Vater an den Balaton zu fahren und weit hinauszuschwimmen. Für so eine jó úszás, wie man an den Ufern sagt, so ein gutes Schwimmen, ein gutes Stück Schwimmen, ein ordentliches Stück Wasser, Kraulen und Tauchen, Sich-auf-den-Rücken-Drehen, den Himmel abtasten und dann Weiterkraulen, eine gute, lange Schwimmerei durch See und Himmel, Wasser und Luft. Man kann es nicht vollständig übersetzen, im Ungarischen klingt etwas mit, das keine Übersetzung fassen kann, »gut« für »jó« ist zu wenig, zu klein, zu mager. Diese jó úszás ist das Kernstück des ungarischen Sommers, die Mitte des Sommers, der Punkt, auf den alles zulaufen soll. Man springt in den See und schwimmt weit hinter die letzte Abgrenzung, hinter die Boote der Rettungsschwimmer. Es ist mehr als schwimmen, es ist eine Art, sich von den Dingen zu entfernen, nicht bloß vom Strand und seinem Treiben, sondern von allen Dingen, die sonst das Leben ausmachen und zusammenhalten, von der Welt, in der dieses Leben stattfindet und diese Dinge sich sammeln. Weit draußen im See, wo das Blau des Wassers nach dem Blau des Himmels greift und in Wettstreit mit ihm tritt, scheint diese Welt unerheblich, vergessen. Schon am Morgen stellt man sich deshalb die Frage, sobald man den ersten Blick auf den See wirft, um zu sehen, ob er grün, blau oder türkis ist, still oder vom Wind zerwühlt: Gibt mir der See heute so eine jó úszás?
Als ich an einem dieser Nachmittage in Balatonfüred weit hinausgeschwommen und dann aus dem Wasser gestiegen bin, hat mich jemand am Ufer, an den Treppenstufen, die in den See führen, angesprochen und anerkennend gesagt: Na, das war aber eine jó úszás! Ich habe gelacht und erwidert, ja, unbedingt, das war es, eine jó úszás! Es meint das Gefühl, es spricht das Große, Freie und Schwerelose darin an, die Stunden der Leichtigkeit im sonnenwarmen Wasser, es meint das ausgiebige Im-Wasser-Sein, das nicht enden will, für das es keine Zeit gibt. Das hatte unser Vater uns früh beigebracht: nebeneinander, miteinander im Wasser zu sein, vielleicht war es das Erste, was er meinem Bruder und mir beibrachte, nahebrachte und das uns ohne Worte, ohne Erklärungen immer auf natürliche Weise verbunden hat. Das hatte er in allen Sommern hier mit uns geübt und geteilt: die Liebe zum Wasser, das gute Schwimmen, diese großartige, phantastische Schwimmerei – diese jó úszás.
Spielt er jetzt ein verrücktes Spiel mit uns? Hat er sich vorgenommen, uns hier festzuhalten? Ein Netz aufgespannt, in dem wir uns immer wieder verfangen? Jagt er mich kreuz und quer durch dieses Land, das früher einmal seine Heimat war? Vor kurzem haben wir über sein Sterben gesprochen, er will in Ungarn begraben sein, aber wir wollen ihn in unserer Nähe wissen. Also steckt er vielleicht deshalb fest in der Mitte, auf halbem Weg, zwischen unseren beiden Welten, als habe er sich das so ausgedacht, als könne er das so beeinflussen. Er traut mir nicht, was sein Grab betrifft, meine Cousine hat er deshalb beschworen, ihr aufgetragen, dafür zu kämpfen – was im Ungarischen stärker klingt als im Deutschen, das ungarische harcolni klingt nicht nur nach kämpfen, sondern nach einer blutvergießenden Schlacht, die einem alles nehmen kann. In ihrem Paradiesgarten sage ich zu ihr, lass uns nicht kämpfen, bitte, nicht deshalb, auch ich brauche einen Ort, an dem ich meinen Vater besuchen kann, wenn er nicht mehr lebt.
Nach der Operation in Mistelbach liegt er unter Schläuchen und Hightech-Apparaten, ich stehe am Krankenbett und halte seine bebenden Hände, spreche zu ihm, auch wenn ich nicht weiß, ob er mich hören kann, überhaupt merkt, dass wir hier sind. Ich schaue zum Holzkreuz an der Wand, in meinem Kopf beginnt es zu raunen, dann nimm ihn jetzt mit und überspring den Rest, erspar ihm die Qual, bitte, ich kann es aushalten, wir werden es aushalten können. Aber der Tod wartet. Sterben passt offenbar nicht zu diesem Blau, das sich auf meiner Fahrt zurück zwischen Pannonhalma und Zirc unter die wenigen Wolken pinselt. Ich höre Stevie Nicks, eine Amerikanerin treibt mir in Ungarn die Tränen in die Augen, eine Amerikanerin lässt mich unter ungarischem Himmel in meinem deutschen Auto weinen, weil sie fragt, can I handle the seasons of my life?, und ich ihr antworten muss, no, I can’t, I just can’t handle them. Ich kann mit den Jahreszeiten meines Lebens nicht umgehen, besser: Mit dieser Jahreszeit meines Lebens kann ich nicht umgehen. Ich wiederhole für mich: Zum Sommer passt das Sterben nicht. Sterben gehört zum Winter.
Auch in den Winter 1973, als meine Mutter sich auf die Reise zum Begräbnis ihres Vaters machte. Keiner im Dorf wusste davon, keiner wusste, dass sich der eiserne Vorhang rechtzeitig für sie öffnen und sie durchschlüpfen lassen würde. Es gab kein Telefon, also auch keine Ankündigung. Sie fuhr ins Dunkle, wartete ungeduldig an eisigen Bahnsteigen, starrte auf die langsam vorrückenden Zeiger der Bahnhofsuhren. In Wien nahm sie den Zug nach Györ, in Györ den nächsten Zug, der sie in die Nähe ihres Dorfes brachte. Spät abends kam sie an. Alle Wege waren zugefroren, wie unter dickem Glas verschwunden. Den Schnee hatte man zu hohen Wänden beiseite geschoben. Kein Bus fuhr. Das nächste Haus war das ihres Bruders, sie wollte die Nacht dort verbringen, auf den Morgen warten. Aber das Tor war zugesperrt, niemand hörte ihr Klopfen. Die Kälte setzte ihr zu, der Koffer zog an ihrem Arm, sie ging vorsichtig tastend Schritt für Schritt übers Eis, langsam durch die kleine schlafende Stadt, dann die Landstraße hinab zu ihrem Dorf, unter einem großen Mond, der hell über ihr stand. Als sie in die Straße einbog, sah sie, auf dem Hof brannte noch Licht. Meine Mutter ließ den Koffer fallen, lief die letzten Schritte laut rufend. Meine Großmutter öffnete die Tür, mein Goldmädchen, arany lányom, sagte sie, ich wusste, du würdest dich von deinem Vater verabschieden, ich wusste, du würdest kommen.
Wir stehen still vor dem Paradiesgarten, meine Cousine und ich, wie zwei, die irgendwie hierhergehören und doch wieder nicht. Es hat ein wenig geregnet, von den Blättern tropft es, der Garten flüstert uns zu. Vogelheimat, Falterzuflucht, Blumenherberge – zwischen den Zweigen ein winziges Rauschen, kaum hörbar, das Grün atmet auf, die Akazie wirft ihren frischen Schatten über den Hof. Der Weinberg mit seinen abgesteckten, fein säuberlich vermessenen Rebenreihen hat sich ausgestreckt, ist nach dem Schauer an uns herangerückt, hat sich in die Länge gezogen und kurz vor dem Gartentor haltgemacht. Wir stehen Schulter an Schulter vor der Haustür mit der blätternden weißen Farbe, und ein Gefühl überfällt mich, wir werden das nicht mehr häufig tun, es wird uns nicht mehr lange begleiten, dieses Stehen im Paradiesgarten und zu den Weinhängen schauen, dieses Lustkriegen, die festen Schuhe anzuziehen und loszulaufen, über die kleinen Pfützen am Wegrand, die schnell in der sonnenwarmen Erde versickern. Unter uns führen zwei Stufen aus Stein zu Garten und Hof, in dem früher Schweine, Hühner und Gänse lebten. Gemüse wurde unter diesen Bäumen angepflanzt, im Herbst geerntet und eingemacht, Paprika, Gurken, Tomaten füllten die Speis, ein Wandgemälde, ein Stillleben in Essig und Zucker, eine Sammlung aus in Gläsern gefangenem, schwebendem Essen, die Familie lebte im Winter davon. Jetzt gibt es nur noch Rasen unter den Obstbäumen, meine Tante bestellt schon lange keinen Garten mehr, sät nichts mehr aus, beugt sich nicht mehr über Beete, um Unkraut zu zupfen und Erde aufzulockern. Keiner mästet und schlachtet hier noch Schweine oder tötet Hühner für die Suppe, schnappt sie, dreht ihnen den Hals um und rupft sie. Gurken und Tomaten kauft man jetzt einfach bei Tesco oder Spar, und im Garten wächst dafür nichts als junges, hellgrünes europäisches Gras.
Im Winter ist das Haus ohne Menschen, still und leer atmet es, schläft seinen Winterschlaf unter den Stimmen und Geräuschen, die es in seine Wände aufgenommen, unter seinem Putz gespeichert hat. Nur im Sommer sind meine Cousine und Tante hier, im Sommer öffnen sie die Fenster, stoßen die Läden auf, lassen die Gardinen flattern, nehmen die Wäsche aus dem Schrank und beziehen die Betten, füllen den Kühlschrank, stellen Stühle unter die Akazie, Gläser für Wasser und Wein auf den Tisch. Nur im Sommer beleben sie ihr altes Haus, nur im Sommer lässt meine Cousine mit ihrer dementen Mutter Budapest hinter sich, damit wir uns im Dorf treffen, damit sie den Sommer mit meinen Eltern verbringen können, zu denen auch ich für wenige Tage stoße. Cousine und Tante leben seit Jahren in Budapest, das Dorf hatte meine Cousine als junge Frau verlassen, seinen Umkreis durchbrochen, das war ihr erster Schritt als Erwachsene. Sie hatte die Straßen und Wege abgemessen und gesehen, sie sind zu eng, zu klein. Für mich ist das Haus ein Kabinett der Erinnerung, mein eigenes Heimatmuseum, meine Ungarnsommer-Gedenkstätte. Es hält eine Zeit für mich fest, an ihm lese ich auch mein Leben ab, seine Schlängelpfade durchs Gestern, eine Art Fotoalbum im Mauerwerk, aus Stein und Putz, aus Holz und Glas, aus Schichten und Rissen, Farben und Furchen.
In der ehemaligen Sommerküche steht noch die blassgrüne Kredenz meiner Großeltern, mit Stühlen, Tisch und Tagesbett im gleichen Ton. Hinter dem Glas das Porzellan, von dem ich als Kind gegessen habe, die Tasse mit dem Rosenmuster für den Grúztee, das Blechdöschen für den Kristallzucker, der nicht weiß, sondern gelblich war, und von dem ich dachte, er sei schmutzig. In der Schublade unter der Tischplatte liegt noch immer Post von meiner Mutter, geschickt von West nach Ost. Ihre regelmäßigen Berichte und Zeugnisse des Lebens in Deutschland, der anderen Hälfte ihrer geteilten Welt, die Schrift auf den Kuverts sofort erkennbar als die verschwenderisch große Schnörkelschrift meiner Mutter, Buchstaben und Wörter wie Blumengirlanden. Nicht geschrieben, sondern gemalt, mit dem Füller gepinselt, die feinen Linien vorgezeichnet und dick nachgezogen. Überlebenszeichen, Sehnsuchtsbeweise. Liebesbekundungen aus einem fremden Land. Für die fernen, weggerückten, nicht mehr berührbaren Eltern, aufgehoben in deren Küchenschublade, im Zentrum des Hauses, des Lebens, mitten unter ihnen, im Alltag zum Greifen nah, mit einem Handgriff unter die Tischplatte fühlbar, tastbar, sichtbar, da – die Sätze meiner Mutter.
Nach der Flucht 1956 gab es keine Post, ein ganzes Jahr keinen Brief, keine Karte. Meine Mutter hat es mir an einem dieser Abende auf unserem Spaziergang zum Paradiesgartenhaus erzählt. Ein Jahr lang wurden die Briefe von ihr geschrieben, zugeklebt, frankiert, abgeschickt und auf ungarischer Seite dann abgefangen. Nie erreichten sie das Dorf, die Straße, den Briefkasten am Tor, das Haus, den Küchentisch. Umgekehrt konnte kein Brief aus Ungarn nach Deutschland gelangen. 1957 war das Jahr ohne Zeichen. Ohne Satz, ohne Wort. Das Jahr des Schweigens, das Jahr der Stille. Später dann der erste Brief der Schwester, in dem sie schrieb, die Mutter habe sich damals nicht beruhigen lassen, niemand habe sie beruhigen können. Bis zu dieser Nachricht, die bald übers Radio gekommen war. Im Dezember 1956 hatte jemand vom Roten Kreuz im Flüchtlingslager angeboten, über den Sender Freies Europa persönliche Nachrichten, kurze, kleine Botschaften zu versenden. Meine Mutter hatte nur einen Satz gesprochen, der alles Wichtige enthielt, alles was gesagt und gehört werden musste, ungeschmückt, karg, gebaut aus wenigen Wörtern, diesen einen Satz, der genau so gesendet wurde: Ili, Inka und Teri haben es über die Grenze geschafft und sind in Deutschland. Im Dorf hatte der Nachbar am Ende der Straße einen Weltempfänger und tat in diesen Tagen nichts anderes als Radio zu hören. Die Tür zu schließen, das Deckenlicht auszuknipsen, die Gardinen zuzuziehen und seinen Weltempfänger aufzudrehen. Die Namen konnte er sofort zuordnen, drei junge Frauen aus dem Dorf, die er schon als Mädchen gekannt hatte, als Mädchen mit Schürzenkleidern und weißen Schleifen im Haar. Also zog er den Mantel über, setzte den Hut auf, ging die Straße hinab zu meiner Großmutter, stieß das Tor auf, setzte sich an diesen blassgrünen Tisch, der jetzt in der Sommerküche steht, legte die Hände aufs Wachstuch und gab den Satz für sie genau so wieder: Ili, Inka und Teri haben es über die Grenze geschafft und sind in Deutschland.
Meine Cousine und ich schauen zum Weinberg, fahren mit unseren Blicken den Garten ab, die Vielfalt aus Grün, seine Nuancen aus Hell und Dunkel in den Grashalmen, Blättern und Büschen, im Moos und Farn. Wäre das nicht ein Ort für dich?, frage ich meine Cousine und lasse es so leicht, so unverbindlich klingen, wie ich nur kann, als würde es zufällig in diesem Augenblick meine Gedanken streifen. Denn eigentlich frage ich ja, kannst du das Haus nicht behalten? Kannst du es nicht für mich, wegen mir behalten? Kannst du es bewahren, damit ich im Sommer zurückkehren und meiner Erinnerung nachspüren, unter dieser Akazie den Stimmen von früher lauschen kann? Denn die Stimmen sind geblieben. Die Menschen sind verschwunden, aber ihre Stimmen sind da. Ich höre sie reden und lachen, sobald ich das Haus betrete, höre ich sie – nein, anders, ich höre sie schon, wenn ich das Tor öffne und an der Hausmauer entlanggehe, ich höre meine Tante rufen, meinen Onkel schimpfen, ich höre sie in der Küche, in der Diele, im Zimmer, ich höre ihre Schritte, ihr Klappern und Lachen, ihren Schlagabtausch aus Sätzen, ihren vertraut sich mischenden Singsang des Alltags. Noch immer füllen ihre Stimmen dieses Haus, blähen die Vorhänge vor den geöffneten Fenstern und drängen hinaus zu den Zweigen und Ästen.
Meine Cousine zögert, sie wird wissen, wie viel es mir bedeutet, wie viel es für mich ist, also gibt sie mir ihr mildestes Nein, als hätte sie Angst, mir dieses Nein anzutun, mir zuzumuten, jetzt und hier ein Nein zu hören. Sie braucht die Stadt, sagt sie, zum Nein gibt sie mir eine Handvoll Sätze, ihr Nein schmückt sie aus, für mich als Erklärung, für sie zur Rechtfertigung, aber wir wissen beide schon, diese Sommer liegen hinter uns, wir verlieren sie, gerade sind wir dabei, sie zu verlieren, dieser Sommer ist der letzte seiner Art. Sie braucht das Theater, sagt sie, die Konzerte, Menschen, Cafés und Restaurants, den Puls, das Treiben der Großstadt, ihren Trubel, ihre Lust an Schwung und Bewegung. Sie kann nicht ins Dorf zurück, unter Dorfleuten leben, unter Dorfleuten mit Dorfgedankenradius. Sie wird das Haus aufgeben, fährt sie nach einer Pause fort. Ihre demente Mutter erkennt es nicht, für sie hat es keine Bedeutung mehr. In den Sommern davor hatte sie es noch erkannt, ihr Bett darin, ihr Kopfkissen, ihre Tür mit dem Türgriff, ihren Küchenstuhl mit der hohen Lehne, ihre Gardinen, ihre Nähmaschine, an der sie früher Tag für Tag Handschuhe für die nahe Handschuhfabrik genäht hatte. Als Heimat taugt es ihr nicht mehr, nicht als Erinnerungsfaden, den sie aufnehmen könnte, um daraus ihre eigenen Bilder zu spinnen. Also werde auch ich dieses Stück Erde verlieren, diese Mauern und meinen mühelosen Gang ins Gestern. Wir stehen noch immer an der Tür, haben uns nicht bewegt. Wir schauen auf den Garten, die Reihe aus Obstbäumen und Gräsern, als versuchten wir, uns jede Faser Grün einzuprägen. Für uns geht in diesen Sommertagen etwas zu Ende, die Krankheit schneidet durch unser Leben, der Tod schneidet schon durch unser Leben, etwas müssen wir loslassen, in dieser sich weiterdrehenden Welt müssen wir etwas verlassen und hergeben.
Bevor ich mit meiner Mutter zurück nach Hause fahre, bevor wir abreisen und dem Dorf den Rücken kehren, packe ich Dinge aus dem Sommerhaus meiner Eltern ein, auch so eine Zeitkapsel, auch so eine Schatulle gefüllt mit Vergangenheit. In dieser Zeitkapsel haben wir gesessen, in dieser Zeitkapsel haben wir in den letzten Wochen geredet, in dieser Zeitkapsel haben wir geweint. Einige Nächte habe ich allein in der Stille des Hauses verbracht, durchbrochen nur vom aufgebrachten Bellen der Nachbarhunde. Meine Hundebellnächte. Jedes Mal, wenn mir die Strecke zu lang wurde und ich eine Pause zwischen den Kliniken und dem Balaton gebraucht habe, wenn ich keine Kraft mehr hatte, vom Dorf noch die eine Stunde bis um See weiterzufahren. Ich habe allein in diesem Zimmer gelegen, auf den Samtblumen einer Recamière aus den 1920er Jahren, zwischen Büchervitrinen und Art-déco-Lampen, und bin vor dem Einschlafen den feinen Rissen im ockergelben Putz der Wände gefolgt, als könnten sie mich führen und leiten, habe nach dem Aufwachen mit meinem Milchkaffee auf der Terrasse gesessen und unter dem ausladenden Walnussbaum das Licht am Morgen, das Licht des anbrechenden Tages bewundert. Zu meiner Mutter habe ich gesagt, jedes Mal wenn ich hier bin, will ich etwas mitnehmen. Also packe ich die Weingläser meiner Großmutter ein, zerbrechlich feine, handgeschliffene Gläser aus ihrer Aussteuer, mit einem Muster aus Schleifen und Efeuranken, bald hundert Jahre alt, eine Karaffe, blütenweiße Tischwäsche – wie hat sie die so weiß gehalten? – , verstaue alles vorsichtig im Kofferraum und sage zu mir selbst, jetzt fängst du also an, Erinnerungsstücke zu sammeln, dich mit Symbolen zu umgeben. Jetzt beginnst du, deine Brücke zu bauen. Die eine bricht dir weg, und du baust wie in Panik die nächste, jetzt fängst du also schon an.
Bevor ich das Tor schließe und mich für dieses Jahr ins Ungefähre verabschiede, mich hinters Lenkrad setze und mich aufmache ins Ungewisse und doch Vorhersehbare, rufe ich in Berlin an. Eine Freundin meines Bruders ist vor einer Woche wegen einer Infektion ins Krankenhaus gebracht worden, zuerst in die Notaufnahme, dann schnell zur Intensivstation, offenbar wegen einer Medikamente-Unverträglichkeit. Sie ist Ende vierzig, Mutter von drei Kindern. Es ist die Nebenhandlung unserer letzten Tage und täglichen Telefonate, der seitliche Erzählstrang unseres Sommers. Es sind die Nebenfiguren, und doch füllen sie immer die letzten Sätze unserer Gespräche, die Sätze vor dem Auflegen. Gestern hatte ich nach ihr gefragt, ihr Zustand hatte sich verschlimmert. Jetzt sagt mir mein Bruder, in der Nacht ist sie gestorben. Die Frau, mit der er vor kurzem noch beim Italiener in Dahlem gesessen hatte. Lachend, trinkend, lärmend. Nächste Woche wird die Bestattung in einem Friedwald sein. Erst danach kann er den Faden zu uns wieder aufnehmen.
Wir fahren die Strecke über Wien und das Weinviertel, über die Klinik in Mistelbach, zu der sie meinen Vater mit dem Helikopter geflogen haben. Unsere letzte Station vor der Heimreise, unsere Haltestelle für den Abschied. Ein brütend heißer Tag, für den Mittag sind Unwetter und Starkregen gemeldet. Der Weg ist uns schon vertraut, ich stelle das Auto auf dem Parkdeck ab, wir gehen durch die große Eingangstür vorbei am Café, wo wir nach der Operation mit meinem Bruder gesessen und zu dritt versucht hatten, bei Kaffee und Kuchen unsere Tränen nicht zu vergießen, sie zurückzuhalten. Der Aufzug bringt uns zur Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin, ich fotografiere jeden Abzweig, jeden Pfeil und jedes Schild mit dem Handy, ich will den Weg bis zum Krankenbett Schritt für Schritt an meine Verwandten schicken, damit sie ihn mühelos finden, wenn sie am Wochenende meinen Vater besuchen. Mit Ungarisch kommen sie vermutlich nicht weit, aber lange sollen sie nicht suchen, sich nicht mit Händen und Füßen durchfragen müssen. Wieder melden wir uns über die Sprechanlage an, Familie Bánk, Grüß Gott, wir möchten zu meinem Vater, wieder springt die Tür für uns auf, wieder gehen wir durch die Schleuse, legen unsere Taschen ab, ziehen die weißen Kunststoffschürzen über den Kopf und binden sie im Rücken fest, wieder gehen wir den langen Gang hinab, diesen letzten Abschnitt eines Weges, auf dem man mit allem rechnen muss, werfen scheu einen Blick ins Zimmer, stehen wieder am Krankenbett und halten meinem Vater die Hände.
Wir reden an gegen das Delirium, in das er nach seiner Operation gerutscht ist, die Mixtur aus Narkose, schlechtem Allgemeinzustand, Medikamenten, Schock und langem