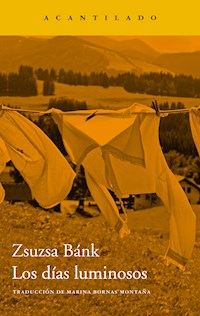9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Etwas ist zu Ende: eine Freundschaft, eine alte Liebe, eine Kindheit in der Vorstadt, eine Reise ans Meer, ein ganzes Leben. Etwas hat sich verschoben, unmerklich, und alles geht weiter, nichts wie es war. Zsuzsa Bánk erzählt von Menschen, die eines Tages einfach die Tür hinter sich ins Schloss fallen lassen. Von Larry, dem koksenden Dreizentnermann, der Gedichte schreibt, die so schön sind, dass sie niemand versteht. Von Lydia, die der Wind mitnimmt. Von Lisa, die für einen Nachmittag in das winzige italienische Bergdorf zurückkehrt, das ihre Mutter einst verließ – mitten im heißesten Sommer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Zsuzsa Bánk
Heißester Sommer
FISCHER E-Books
Inhalt
Für M.
Letzter Sonntag
Jetzt steht sie da, vielleicht anderthalb Meter vor Anna, als hätte sie Angst, näher zu kommen. Die anderen sind zur Seite getreten, bilden einen Halbkreis. Sie ahnen, daß sie nicht stören dürfen, wenden sich ab, zögernd, gehen ein, zwei Schritte, schauen in ihre Taschen, ihre Hefte, auf ihre Uhren. Nach Annas Vortrag hat sie in der Menge gestanden und gewartet, bis die anderen ihre Fragen gestellt, mit Anna gesprochen haben, hat ihnen über die Schultern geschaut, auf Annas Tisch, auf das Papier, die Stifte. Anna ist es seltsam vorgekommen, aber sie hat sich nichts dabei gedacht, sich nicht gefragt, wer sie sein könnte, weil es viele gibt, die das tun: stehenbleiben, wenn andere schon da stehen.
Sie fragt Anna: Bist du –?, und sagt Annas Namen, als ob Anna eine andere sein könnte, wo doch hier jeder weiß, wer sie ist, schon weil es auf den Plakaten auf dem Gang, an der Tür und am Podium steht. Später sagt sie, gleich habe sie gewußt, daß sie es ist, Anna, sie hätte nicht fragen müssen. Im Radio habe sie das Gespräch mit ihr gehört, am Morgen, in einem dieser neuen Magazine, als sie ihren ersten Tee getrunken habe, erklärt sie, fast, als müsse sie sich entschuldigen, dafür, daß sie hier steht und Anna anspricht. Aufgesprungen sei sie, um das Radio lauter zu drehen, die anderen seien sofort still gewesen, um zuzuhören, und dann sei sie durch die Stadt gefahren, habe auf ihre Uni, ihre Kurse verzichtet, ihre Eltern seien einverstanden gewesen, sei durch diese Halle gelaufen, durch diese große Halle, um jetzt, hier, vor Anna zu stehen. Sie fragt, also, bist du?, und sagt Annas Namen, ihren ganzen Namen, mit einer Stimme, die wenig sicher, die fast ängstlich klingt, und Anna denkt, was fällt ihr ein, was erlaubt sie sich, sie weiß doch, daß ich es bin, jeder hier weiß es, und sie sagt, ja, die bin ich, in einem Ton, der zu verstehen gibt, daß sie nicht angesprochen werden will, als sei sie für jedermann jederzeit ansprechbar.
Márti ist es, die jetzt ihren Namen sagt, den Anna schon weiß: Márti. Anna kennt ihre Eltern. Sie kennt sie gut, besonders ihre Mutter, und sie fragt, obwohl es unnötig ist, dann bist du die Tochter von –? Márti nickt, schnell, eifrig, als habe Anna sie endlich erlöst, endlich befreit, mit dem Namen ihrer Mutter, den Anna jetzt noch einmal sagt, Zsóka, langsam, als wollte sie jeden einzelnen Buchstaben klingen lassen, Zs-ó-k-a, um dann Mártis Namen zu sagen, mit einem überdeutlichen: Du bist also, als müßte sie sich dem Gedanken, daß sie es ist, für die Anna sie von Anfang an gehalten hat, doch erst annähern. Anna liegt dieser Satz auf den Lippen, vom Zeitvergehen, vom Großwerden, aber sie sagt ihn nicht.
Sie gehen einen kleinen, bleibenden Schritt aufeinander zu, oder nur Anna geht ihn, und Márti bleibt stehen. Sie umarmen sich, ungeschickt und kurz, als wüßten beide nicht, wie man sich umarmt, in solchen Momenten. Márti kämpft mit den Tränen, entschuldigt sich dafür, sucht nach einem Taschentuch, in das sie sich schneuzen kann, und Anna sagt schnell, was ihr als erstes in den Sinn kommt, vielleicht, um Mártis Suchen etwas entgegenzusetzen. Sie sagt, wir haben uns lange nicht gesehen, ich glaube, als du acht warst, warst du mit deinen Eltern bei uns, kann das sein? Ich weiß noch, wie du warst, als Mädchen, ich weiß es noch genau, auch daß du den Tee nicht hattest trinken wollen, wegen seiner Farbe. Márti schaut ungläubig, vielleicht, weil Anna sich an Dinge erinnert, die andere sofort vergessen, und über die sie redet, als seien sie entscheidend. Anna fragt, wie alt bist du, und Márti antwortet, genau zwischen einundzwanzig und zweiundzwanzig, in einem Ton, der Anna etwas entgegenhalten soll, fast auftrumpfend, als sei das die beste Antwort, die man auf Annas Frage geben kann.
Sie stehen ein bißchen verloren. Anna sagt, ich habe keine Zeit, du siehst ja, dreht sich um und deutet in die Menge, mit einer Geste, die ihr nicht gefällt, weil sie zu groß geraten ist. Márti erwidert, ja, ich sehe es, bleibt aber trotzdem stehen, rührt sich nicht, als sei das kein Grund, nicht für sie, als habe sie das Recht, das unbedingte, bei Anna, mit Anna zu sein. Sie verabreden sich für den nächsten Tag. Anna schlägt vor, sie solle ihre Eltern mitbringen, die anderen auch, am besten die ganze große Familie, und Márti sagt, das werde ich, wieder in diesem Ton, lauter, forscher, als habe sie gesiegt, einen Kampf für sich entschieden. Sie umarmen sich noch einmal, zum Abschied, etwas länger, etwas fester, ihnen gelingt ein Lachen, und Anna sagt, wie zur Belohnung, schön, daß du gekommen bist, es ist schön, dich zu sehen.
Sie treffen sich an einer der großen Straßen, die sonst mit ihrem Lärm die Stadt zerschneiden, sonntags aber kaum befahren sind. Anna sieht sie von weitem, wie sie an der verabredeten Ecke stehen, wenige Schritte hinter der Oper. Sie drehen sich suchend um, sie wissen nicht, von wo Anna kommt, sie kennen weder die Straße noch das Hotel, in dem sie übernachtet. Anna kann sich ihnen nähern, unbeobachtet, plötzlich hinter ihnen stehen, auf eine Schulter tippen, die Arme ausbreiten, als sei das die Geste, auf die alle gewartet haben, und sagen, hallo, da bin ich. Sie haben sich nicht verändert. Anna könnte nicht einmal sagen, ob sie älter geworden sind. Vielleicht sind sie schmaler, blasser auch, aber nur, wenn sie genau hinsieht.
Mártis Vater, Anna hatte ihn größer in Erinnerung. Sein Bart zeigt ein erstes Grau. Zsóka hat sich kein bißchen verändert. Nicht einmal ihr Haar trägt sie anders. Es ist immer noch so, wie sie es trug, mit fünfzehn, mit zwanzig, mit dreißig, und wie Anna es mochte, dunkel, kurz, an der Seite gescheitelt, mit einem Schwung in die Stirn gekämmt, mit dicken Strähnen, die sie mit einer schnellen Bewegung hinter die Ohren klemmt. Sie hat diesen kleinen roten Dreiecksmund, der spitz nach oben zeigt, viel redet und nie etwas Dummes sagt. Schwarz trägt sie. Das ist neu. Einen engen Rock, dazu eine Bluse, am Kragen etwas Spitze, die den Blick bis zu den Schultern zuläßt, und als sei es etwas, das Anna vergessen hat, das sie vergessen konnte, fällt ihr jetzt wieder ein, wie sehr sie alle mochte, wie sehr sie ihr gefielen, und sie begreift nicht, wie sie es zulassen konnte, daß sie nichts voneinander gehört, nichts voneinander gewußt hatten, in diesen Jahren, die Márti haben so groß werden lassen.
Márti ist eine Mischung aus Vater und Mutter, als habe man die beiden geteilt und ineinander verwoben. Sie trägt ihr dunkles Haar im Pferdeschwanz, den sie nicht im Nacken, sondern hoch oben mit einem weißen Tuch gebunden hat, so daß er ihr als Fragezeichen in den Nacken fällt. Ihre Sonnenbrille, mit Gläsern, die nicht zu dunkel sind, steckt über der Stirn im Haar. Ihre Haut ist hell, zeigt winzige braune Punkte unter den Augen, auf den Wangen. Ihr Blick ist so, als entgehe ihm nichts. Sie sehen sich an, beteuern einander, wie wenig, wie gar nicht sie sich verändert haben. Sie stehen an dieser großen Straße, auf der es still bleibt, an einem Sonntag, im März, unter einem blauen Stadthimmel, der den Frühling lockt und zum ersten Mal, seit Anna hier ist, das Grau der Fassaden verdrängt.
Blumen haben sie für Anna mitgebracht, kleine gelbe und weiße Blumen, und niemand spricht diesen Vorwurf aus, vor dem Anna Angst hatte und auf den sie alberne Antworten vorbereitet hat, der Vorwurf, warum sie sich nicht meldet, wenn sie in der Stadt ist, auf einem dieser Kongresse, die sie nicht mag und doch immer wieder besucht, warum sie nicht anruft, nach so vielen Jahren, um zu sagen, ich bin da, um zu fragen, habt ihr Zeit, wollen wir uns sehen?, und warum sie Anna erst im Radio hören müssen, zufällig, beim Frühstück, am Samstagmorgen, wenn sie bei ihrem ersten Tee sitzen, schlaftrunken, kaum wach, um zu erfahren, daß sie hier ist, nach Jahren zum ersten Mal wieder hier ist, und warum Márti dann durch die ganze Stadt fahren muß, um sie aufzusuchen und ihr zu sagen, wir wollen dich treffen, wir wollen dich sehen.
Gestern abend hat sie darüber nachgedacht, als sie ins Hotel gefahren ist, zurück vom Kongreßzentrum, mit ihren Unterlagen, ihren Zetteln und farbigen Folien, im Taxi, da sie die U-Bahn nicht erträgt, mit den endlosen Rolltreppen in die Tiefe, dem Gestank, der Hitze, den Türen, die sich in Sekundenschnelle schließen, als müßten sie etwas zerschneiden, und später, in ihrem Hotel, in dem sie kein Zimmer, sondern eine ganze Wohnung hat, mit Küche und Schlafzimmer und einem Bad mit freistehender Wanne, in die sie sich jeden Abend gelegt hat, um sich den Staub, den Schmutz abzuwaschen, von dem sie immer noch glaubt, daß er wie nichts anderes mit dieser Stadt verbunden ist.
Anna hat an Antworten gefeilt, auch später noch, als sie im Bademantel vor dem Fenster saß, vor diesem großen Fenster, das von einer Wand zur anderen reicht, von der Decke bis zum Boden, und das Haus gegenüber zeigt, das so nah steht, daß man hinüberspringen könnte, ein Haus mit abgeschlagener, dunkler Fassade, blätterndem Putz, mit braunen Fensterrahmen aus Holz, die nackte Glühbirnen in ein Rechteck setzen. Anna hat nachgedacht über lächerliche Antworten, auch heute morgen noch, in diesem Frühstücksraum ohne Fenster, in dem es jeden Morgen das gleiche gibt, weißes Brot, trockenen Käse, Marmelade in Blechdöschen, und in dem die ganze Woche eine Frau mit zwei Kindern, zwei blonden Mädchen, neben ihr gesessen hat. Anna hat keine Zeitung gelesen, nicht heute morgen. Sie hat nachgedacht, über Antworten, die sie geben könnte, die aber alle nicht erklären, warum sie sich nicht gemeldet hat.
Sie gehen in ein Café, das sich schnell von der Vergangenheit verabschiedet hat und jetzt aussieht wie alle Cafés der Welt aussehen, mit Stühlen und Tischen aus dunklem Holz, farbigen Wänden, einer langen Bar, einer Espressomaschine, die ununterbrochen gurgelt und zischt, mit einer Schiefertafel neben dem Eingang, auf die sie mit Kreide die Gerichte des Tages geschrieben haben. Márti ist nicht von Annas Seite gewichen, sie hat sich neben sie gesetzt, versäumt nichts von dem, was Anna sagt, was sie fragt. Sie erzählen sich die letzten Jahre, wie sie waren, wie es ging mit ihnen, wie sie geworden sind, was sie sind, wie sie leben, jetzt. Sie reden und fragen, bis sie den vierten Kaffee, das fünfte Wasser getrunken haben, bis ihnen schwindlig ist, die Wangen rot und heiß sind, und sie lachen müssen, über sich, darüber, wie lächerlich es ist, all das in einen Nachmittag packen zu wollen.
Sie erinnern sich an Sommer, die weit zurückliegen. Sommer, in denen es Márti noch nicht gab, Anna ein Mädchen war und Zsóka fast schon eine Frau. Seltene Sommer, die fern sind, aber von denen sie noch alles wissen, alle, die hier am Tisch sitzen, außer Márti. Und es schmerzt Anna, daran zu denken, jetzt, da einer noch eine Runde bestellt und diesen Ton anschlägt, den man anschlägt, wenn man weiß, etwas ist vorbei, etwas ist verloren. Sie erinnern sich ans Wasser, in dem sie schwammen, an sein Blau, sein Grün und Grau, je nach Tageszeit, an die Gärten, durch die sie tobten, die Kartenspiele bei Regen, vor einem großen Fenster, und an das Licht, das der Abend brachte, um ihnen zu zeigen, morgen könnt ihr wieder baden. Sie erinnern sich an ein Gefühl, das sich sofort einstellte, sobald sie sich sehen konnten, sobald einer dieser seltenen Sommer kam und sie sich nach einer langen Reise an einem Gartenzaun in die Arme fielen, und das blieb, ganz gleich wie weit sie voneinander entfernt waren.
Zsóka, sie redet wie früher. Ihre Stimme hat sich nicht verändert, nicht einmal ihr Blick, ihre Art, die Dinge so zu sagen, daß alle lachen müssen. Sie nennt Anna so, wie sie seit Jahren niemand genannt hat. Sie sagt diesen Kosenamen, den sie als Kind hatte, jedesmal wenn sie Anna anspricht, wenn sie Anna etwas fragt, und es stört Anna nicht, daß Zsóka sie so nennt, wie sie schon lange niemand genannt hat, es stört sie kein bißchen, nein, es gefällt ihr.
Sie möchten die letzte Umarmung hinauszögern, verschieben. Sie verabschieden sich lange, laufen langsam. Sie gehen zwei Schritte, bleiben stehen, reden, ihnen fallen neue Fragen ein, neue Dinge, die sie einander erzählen. Sie stehen dort, wo es zu Annas Hotel geht, an einer Straßenecke, vor einer blaßgrauen Mauer, mit Plakaten, die etwas ankündigen, das längst schon geschehen ist, und die Anna sich gemerkt, die sie sich eingeprägt hat, als alles noch gleich aussah, am ersten Tag. Die Stadt ist wie ausgestorben. Ein Obdachloser bittet um Geld, und Mártis Vater sagt zu Anna, siehst du, das hat es früher nicht gegeben, und er sagt es in einem Ton des Bedauerns, als trauere er darum, daß es all das, was es hier früher gegeben hat, heute nicht mehr gibt, und dafür anderes, das er gar nicht haben will.
Eines habe ihnen nicht gefallen, als sie Anna im Radio gehört haben, sagt Zsóka wie zum Abschluß, als wolle sie Anna das mitgeben, als wolle sie Anna nicht entlassen, ohne das noch gesagt zu haben. Auf die Frage, ob sie wiederkommen wolle, hätte sie gesagt, nein, sicher nicht, ich habe keinen Anlaß dazu, keinen Grund, und das nächste Mal, sagt Zsóka, und sie lacht dabei, solle Anna doch sagen, ja, natürlich werde ich wiederkommen, bald schon, ich muß doch Márti und ihre Eltern besuchen.
Anna wirft ihre Kleider in den Koffer, langsam, kraftlos, als wollte sie gar nicht. Sie steht am großen Fenster, ihr Blick fällt auf die Fassade gegenüber, auf eine Glühbirne, die sich grell im Fensterglas spiegelt. Es ist einer dieser Augenblicke, in denen nichts geschieht und die man trotzdem nicht vergißt, einer dieser Augenblicke, in denen man nichts tun kann, nur stehen und warten, bis er vorbeigeht. Anna trägt ihren Koffer nach unten, der Aufzug ist ausgefallen. Am Empfang verlangen sie zu viel fürs Telefon. Anna hat jeden Tag zu Hause angerufen, mehrere Male jeden Tag. Oft hat es nur ins Leere geklingelt, und jetzt verlangen sie selbst dafür Geld, für dieses Klingeln ins Leere. Es erleichtert ihr den Abschied. Das Taxi fährt sie durch die ruhige Sonntagsstadt, durch einen hellen, lauen Abend, der sagt, jetzt, da du gehst, kommt der Frühling.
Sie schreiben Briefe. Seitenlange Briefe, in denen sie sich alles erzählen. Das Wichtige, das Unwichtige. Sie beschwören ihr Treffen, immer wieder, wie einen Schatz, den sie gemeinsam geborgen haben. Zsóka schreibt: Deine Art, das Kaffeeglas mit beiden Händen zu umfassen, als wolltest Du die Hände so stillhalten, hat sich nicht verändert, und Anna schreibt: Deine Art, die Strähnen hinters Ohr zu streichen und mit einem Finger auf der Tischplatte zu kreisen, ist noch dieselbe. Sie schreiben sogar übers Wetter, sie besprechen es, das Wetter im Westen, das Wetter im Osten. Hier, bei Anna, der Sommer, der nicht kommen will, und wenn er doch kommt, nicht bleiben will, und dort, ein Sommer, der viel zu heiß ist, den sie kaum aushalten, in dieser Stadt aus Stein, mit ihren U-Bahn-Schächten, dem dichten Verkehr und den Schwimmbädern, die an heißen Tagen so überlaufen sind, daß Márti Angst davor hat, von der Menge im Becken hinabgedrängt zu werden und zu ertrinken. Sie schreiben übers Essen, was sie frühstücken, sie Eier mit Zwiebeln und Speck, dazu dunklen Tee, und Anna Obst und Kaffee, einen großen Kaffee, mit viel Milch, nicht mehr. Anna fragt, mit was sie ihre Tage füllen, mit wem sie ihre Abende verbringen. Wo sie einkaufen. Wieviel es kostet. Wie lange sie dafür arbeiten müssen. Und was sie arbeiten, was Márti lernt, an ihrer Uni.
Jeder Brief endet mit Fragen, mit vielen Fragen, und jedesmal schließen sie mit, ich bin glücklich, Euch gesehen zu haben, und, wir sind glücklich, Dich getroffen zu haben, und dann stehen ihre Namen darunter, jeder Name in einer anderen Handschrift, Mártis Name als letzter, am kleinsten, schnörkellos, fast wie in Druckschrift. Sie schicken Fotos, von Geburtstagen, Weihnachten, vom Jahreswechsel, und Anna stellt sich vor, wie es gewesen sein muß, in diesem Augenblick, und wie sie gesagt haben könnten, laßt uns ein Foto schießen, für sie. Ein Bild von Márti heftet sie an die hellblaue Wand über ihrem Schreibtisch. Márti hat ihr Haar im Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihre Sonnenbrille steckt über der Stirn. Eine Bluse trägt sie, mit kurzen Ärmeln, aus einem Stoff mit winzigen Karos, in Rosa und Weiß. Sie lächelt nicht, und trotzdem sieht sie aus, als würde sie.
Irgendwann hört es auf mit den Briefen. Anna wartet auf einen Gruß, ein Zeichen, auf eine Antwort, die aussteht, jedesmal wenn sie zum Briefkasten geht und sieht, da ist kein Kuvert, kein graues Kuvert, das sich dick und schwer anfühlt und Neues von Márti ankündigt, von Márti und ihren Eltern. Anna findet Ausreden. Sie haben zu lernen, sie haben zu arbeiten. Sie sind verreist. Sie brauchen eine Pause. Sie wissen gerade nichts zu erzählen. Ihr kommt der Gedanke, sie könnte sie verletzt haben, und sie geht ihre Briefe in Gedanken durch, um zu finden, was es sein könnte, daß sie nicht mehr schreiben läßt, auch nach Monaten nicht. Anna schickt eine Karte, von einer Reise. Ohne Frage, ohne Vorwurf, nur zwei Sätze, über die Sonne, den Fisch, die Kirchen, zwei Sätze, von denen sie glaubt, sie könnten Márti und die anderen daran erinnern, daß es sie gibt. Sie wissen lassen, daß sie wartet.
Über Umwege, auf denen die Sprache irgendwann auch auf Márti kommt, auf Márti und ihre Eltern, hört sie von ihnen. Nur zufällig. Bei einem Kaffee, einer Zigarette. Beiläufig, nebenbei und schonungslos, weil man nichts weiß von Annas Briefen, ihren letzten Sätzen. Zsóka habe einen kleinen, festen Knoten unter ihrer Haut entdeckt, an einem Vormittag, beim Baden, dort, wo sie mit der Seife über ihre Brust geglitten war, und jetzt habe sie alles über sich ergehen lassen, was man über sich ergehen lassen müsse, und ja, ihr Haar sei ausgefallen, ihr dunkles Haar, das sie an der Seite scheitelte und das ihr mit einem Schwung in die Stirn fiel. Annas erster Gedanke gilt der Bluse, die Zsóka getragen hat, an diesem Nachmittag, in dieser Stadt, in diesem Café, an die schwarze Spitze, die über dieser Brust gelegen hat, über diesem winzigen Knoten, und plötzlich schmerzt sie sogar das Schlucken, ihre Hand muß sich an etwas festhalten, an der Stuhllehne, der Tischkante, und durch ihren Kopf jagt nur noch ein Gedanke, es ist nicht so, nein.
Später stellt sich Anna immer wieder vor, wie Zsóka spricht, mit den Ärzten, wie sie ihre Hände hebt, weil das ihre Art ist, wenn sie schnell redet, wie sie das Zimmer verläßt, die Tür leise schließt, als dürfe man sie nicht lauter schließen, als gebe es eine Regel, für solche Augenblicke. Wie sie langsamer geht als sonst, vorgibt, alles sei gut, ein Lächeln zeigt, an dem etwas nicht stimmt, und wie sie mit dem Wagen durch die Stadt fahren, Zsóka auf dem Rücksitz, und wie sie durchs Fenster schaut, auf eine Stadt, in der sich alles weiterdreht, in derselben Geschwindigkeit, derselben Lautstärke, auf den Straßen, den Bürgersteigen, an den U-Bahn-Eingängen. Wie sie später im Bad sitzt, in der Badewanne, in die sie lange Wasser laufen läßt, damit die anderen nichts hören, von dem, was jetzt mit ihr geschieht, wie sie nachts im Bett liegt, wach, während die anderen schlafen, und wie sie aufsteht, um barfuß in die Küche zu gehen, durch den Kalender zu blättern, um zu sehen, um zu rechnen, wie lange noch.
Anna schreibt. Heitere Briefe, belanglose, artige. Sie schreibt, was sie in Büchern liest, sie erzählt die Geschichten nach. Sie schreibt, was im Kino läuft, und fragt jedesmal: Kennt Ihr auch? Habt Ihr auch? Gefällt Euch auch?, streicht diese Fragen dann, um sie nicht denken zu lassen, sie müßten antworten. Sie bildet sich ein, die Briefe könnten Márti und ihre Eltern wegbringen von dem, was sie umgibt, wenigstens für zwanzig Minuten, wenigstens für eine halbe Stunde, wenigstens für die Zeit, die es dauert, einen Brief vorzulesen, langsam, wie sie es tun. Nichts erscheint ihr zu albern, um darüber zu schreiben. Sie schreibt über das Freibad, das immer am ersten Mai öffnet und in dem sie schwimmt, an jedem zweiten Morgen, wenn die Bahnen noch leer sind. Über die neuen Küchenregale, die ihr zu Hause plötzlich nicht mehr gefallen haben und die sie nun auf dem Balkon streicht, mit einem hellen Rot, für ihre weiße Küche, und über den Hund der neuen Nachbarn, der abends zwei Stunden durchbellt, von sieben bis neun, und dessen Gebell so durch die Wände dringt, daß sie die Abendnachrichten nie hören kann. Sie bildet sich ein, das Gerede von Hunden und Schwimmbädern, von Regalen und Abendnachrichten könnte sie ablenken, einen Alltag beschwören, der ihnen abhanden gekommen ist, einen Alltag, in dem ein bellender Hund, ein falsches Regal die schlimmste Aufregung sind. Plötzlich erschreckt Anna der Gedanke, genau das wird sie verraten, genau das wird ihnen sagen, sie weiß es, sie sagt nur nichts.
An einem Oktobertag, der mit blasser Sonne dunkelrote Blätter zeigt, liegt ein gelber Umschlag im Briefkasten. In dieser unverschämt gelben Farbe, mit diesem brüllenden Schriftzug, ein Telegramm für Sie!, der viel zu heiter, viel zu munter klingt. Es ist ein Telegramm, dessen Text Anna schon kennt. Ein Telegramm, das sie verfolgt hat, an jedem Tag der letzten Monate. Von dem sie wußte, es würde ankommen, aber von dem sie gehofft hatte, es käme nicht so schnell. Es ist eines dieser Telegramme, die man aufsetzt, um etwas in einem einzigen Satz mitzuteilen, als dürfe man dem nichts hinzufügen, als könne man solches nur so sagen, nur in einem Satz, ohne Umschweife, knapp, kurz, mit dem Namen, der Uhrzeit, dem Datum.
Anna vergißt, ihren Mantel überzuziehen, steigt die Treppen hinab. Sie geht durch den Park, am Wasser entlang. Sie läuft im Kreis. Derselbe Park, dieselbe Brücke, dieselben Häuser, dieselben Menschen auf einer Bank. Sie geht und schaut aufs Wasser. Sie kann nicht aufhören damit. Als könnte sie dieses Gehen und Schauen festhalten, als könnte es sie schützen. Als liefe sie durch ein Zimmer, aus dem sie niemand wegschickt, ein Zimmer, durch das sie gehen darf, solange sie nur möchte. Erst spät wagt sie sich zurück, in ihre Küche, an ihren Tisch, auf dem der gelbe Umschlag liegt. Sie wartet, bis sich der Morgen im Fenster zeigt, mit seinem ersten dunklen Blau, das immer gleich aussieht, auch heute unverändert gleich aussieht.