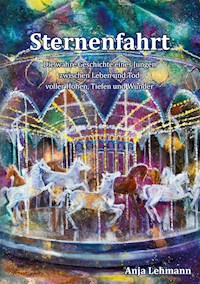
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch Sternenfahrt handelt von der wahren Geschichte eines schwer kranken Jungen, der nach einem langen Kampf mit Glück und viel liebevoller Hilfe wieder in ein ganz normales Leben zurückgefunden hat. Die Geschichte wird von seiner Mutter sehr berührend erzählt, sie gibt jedem eine Anregung, wie dankbar man für das Leben sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine tapferen Kämpfer Raphael und seine beiden Brüder David und Jon
Was auch immer passiert, diesen Sieg, diese schreckliche Zeit durchzustehen, kann Dir niemand mehr nehmen. Lieber Raphael, Deine Familie liebt Dich so, wie Du bist!
Die wahre Geschichte eines Jungen zwischen Leben und Tod voller Höhen, Tiefen und Wunder
Inhalt
Vorwort
Vorspann
Post Kaulquappe
Ende mit Schrecken
Eine neue Welt
Das Monster in der Dunkelheit
Tübingen
Ein Professor für das Herz
Die Bärenhöhle
Der längste Sommer
Plan B oder Kloß mit Soß
Der schöne Brunnen
Nürnberger Gschichten
Zigaretten light
Miriam und Helene
Entbunden und entzogen
Tübingen Reloaded
Total Parenteral
Weiße Weihnacht
Everything dies, Baby, that’s a fact
… maybe everything that died someday comes back
Die Wächter der Nacht
Die Kapelle
Zwischenspiel
Messer, Nadel, Schere, Licht
Die Geburt
Zwischen den Welten
Auf den Spuren Leonardos
Leben wie E.T. oder Dienstagsleiden
E.T.’s langer Weg nach Hause
E.T.’s Perspektive
E.T. getting lost?
Das 180° Kapitel – Wege zu einer neuen Sichtweise
Nachwort
Geführte Bilderreise
Danksagung
Medizinische Fachbegriffe
Vorwort
Früher dachte ich, Narben erzählen Geschichten, wer keine hat, hat wohl nichts erlebt. Dass man mit einer Narbe ein Buch füllen könnte, kam mir allerdings nicht in den Sinn ...
Der Grund, warum ich dieses Buch schreibe, ist, die Dankbarkeit für das Leben spürbar zu machen:
„Dankbar zu sein für all das, was man jemals gegeben hat,
und für alles, was man bekommen hat.
Für die Schönheit des Lebens
Und auch für die Schwierigkeiten.
Für alle Herausforderungen, die man gemeistert hat,
Und dafür, dass man so weit gekommen ist.
Dankbar zu sein für den eigenen Mut und das Talent
Und für die Weisheiten, die man auf der Reise lernt.
Für den Weg selbst und für die Erfahrung
Und für ein nettes Wort hier und dort.
Dankbar zu sein für die eigenen Träume und Wünsche
Und dafür, gelernt zu haben zu vertrauen.
Für die Freude und Inspiration
Und für das eigene Lebensglück.
Für die Wunder, die man erleben durfte,
Und dafür, was die Zukunft bringt.
Dankbar zu sein für all die Liebe, die man jemals empfangen hat,
Und für die Liebe, die man noch zu geben hat.
Für die Freunde, das Zuhause, die Familie
Und für die Zeit sich selber zu finden.
Für Reichtum und Einfachheit
Und für Anmut und zweite Chancen.
Für die Gelegenheiten, einen Unterschied zu machen,
Und für die Zuversicht, dass man es schaffen kann.“
(D.D. Watkins, aus dem Englischen übersetzt von Anja Lehmann-Grüner)
Vorspann
Ich komme von den zeitlosen Weiten. Alles hier ist unendlich – unendliche Liebe, unendliche Weisheit, unendliches Licht. Göttliche Musik und wunderschöne Stille. Keine Kälte, keine Hitze, nur Wohlbefinden. Ich bin. Ich bin ohne Ballast, selber aus hellem Licht, voller Energie. Ich bin einer von unvorstellbar vielen, alles ist an seinem Platz in einer perfekten Ordnung. Ich schwebe, die Weiten sind grenzenlos.
Und dann gehe ich auf die Reise und nehme nichts mit, außer meinem Licht. Es geht in absolute Dunkelheit.
Berlin, ein Hotel in Zentrumsnähe. Im Hotelzimmer reiße ich die Verpackung eines eben erworbenen Schwangerschaftstests auf und gehe damit auf die Toilette. Sekunden verstreichen, dann erscheint blass ein zweiter Strich – positiv – schon wieder schwanger. Ein paar stille Minuten habe ich für mich. Instinktiv geht meine Hand zu meinem Bauch. Ein zweites Baby, absolut geplant, aber nicht so schnell erwartet. Ob es wieder ein Junge wird so wie mein erster Sohn David, der gerade zehn Monate alt geworden ist?
Meine Schwester wartet im Zimmer und ich kann nichts verheimlichen. Ich wedle mit dem Test hin und her und rufe: „Stell dir vor, ich bin wieder schwanger!“ Sie ist auch ziemlich überrascht, aber freut sich mit mir. „Vielleicht wird es ein Mädchen, dann nenne ich sie Sophia“, sage ich, bevor wir aufbrechen, um die Stadt zu erkunden.
Ich bin happy. Meine zwei Kinder werden zusammen aufwachsen, und wenn der zeitliche Abstand nicht so groß ist, so stelle ich mir vor, können sie besser miteinander spielen. In den zehn Monaten, in denen David jetzt auf der Welt ist, habe ich mich einigermaßen daran gewöhnt, Mama zu sein. Nach unserem Umzug aufs Land habe ich erste Kontakte mit anderen Müttern geknüpft. Das Leben läuft wieder halbwegs geordnet und normal. Wir sind mitten im Hausbau und ich kann mir Zeit für meine Kinder nehmen, was ich als absoluten Luxus empfinde. Für mich war immer klar, dass David Geschwister haben soll, zumindest ein oder zwei. Außerdem kann ich mir den Wunsch erfüllen, meine Kinder die ersten Lebensjahre direkt zu begleiten, auch wenn das bedeutet, auf eine schnelle Karriere zu verzichten. Ich stelle mir vor, wieder arbeiten zu gehen, wenn das jüngste Kind im Kindergarten ist, und so kommt es mir gelegen, so schnell wieder schwanger zu sein.
Am Abend telefoniere ich mit meinem Mann Uwe. Eigentlich kann ich es kaum erwarten ihm mitzuteilen, dass er wieder Papa wird, aber irgendwie will ich es ihm persönlich sagen, und so behalte ich die Neuigkeiten für mich.
Post Kaulquappe
„Leben ist die Lust zu schaffen“
(Spitzweg)
Ich fange an zu hören und zu sehen, aber es ist nur Dunkelheit. Ich kenne keine Angst, denn ich bin noch immer himmlische Weisheit. Hier ist es angenehm warm und ich schwimme, schwimme im Wasserbad. Ich fange an, meine Beine zu strecken und mit meinen Händen zu drücken, immer wieder, leicht gegen eine Wand. Ob sie mich fühlt? Ich jedenfalls kann sie spüren und hören, ich merke ein Schuckeln und manchmal absolute Ruhe. Oh, was ist das? Oh nein, nicht schon wieder dieses laute Geräusch, das finde ich nicht so gut. Und meine Wand wird auch gedrückt…
19.12.2008
Mein Frauenarzt fährt mit dem Ultraschallkopf über meinen Bauch. Es ist das zweite vorgesehene Screening. Wir, mein Mann und ich, haben heute unseren Einjährigen dabei. „So, jetzt wissen wir auch, was es wird. Soll ich‘s Ihnen sagen?“ Der Arzt, ein gütig aussehender Mann mittleren Alters, der mich schon bei der Geburt meines ersten Sohnes begleitet hat, lächelt uns erwartungsvoll an. Mein Mann und ich nicken, wir wollen beide wissen, was da auf uns zukommt. Der Arzt teilt uns mit, dass wir wieder einen Buben bekommen. Ich bin etwas verdutzt, denn ich habe insgeheim mit einem Mädchen gerechnet. Uwe freut sich über einen zweiten Stammhalter. Ich zwinkere ihm zu und sage grinsend: „Freu dich nicht zu früh, dann müssen wir es noch mal versuchen ...“ Wir albern noch ein bisschen weiter, und eigentlich freue ich mich auch über einen zweiten Jungen. Vielleicht nenne ich ihn Patrick, denn ich wollte immer einen Sohn mit diesem Namen. Nach der wichtigsten Mitteilung des Tages wird alles andere nebenbei aufgenommen. Der Arzt erklärt uns, dass das Baby jetzt schon über 1000 Gramm wiegt, was gut für die Überlebensrate ist. Sein Herzschlag ist normal, er liegt noch in der sogenannten Steißlage, also mit den Füßen nach unten, das kann sich aber jederzeit noch ändern. Ich selber habe auch keine Bedenken, dass sich das Baby noch dreht.
Draußen an der Luft reden wir über das unvermeidliche, nahe liegende Thema, natürlich den Vornamen. Ich denke laut nach und sage, dass ich immer einen Patrick wollte, doch irgendwas in mir ist nicht überzeugt von diesem Rufnamen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ich berichte meinen Lieben, dass wir wieder einen Jungen bekommen. Die praktisch Denkenden weisen darauf hin, dass ich dann problemlos noch einmal die Sachen von David benutzen kann. Am Abend liege ich wach im Bett und streichle über meinen Kugelbauch, der allerdings nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei meiner ersten Schwangerschaft. Ich denke über einen Namen nach und plötzlich fällt mir unser Stammbuch der Familie ein, das wir damals bei der Hochzeit bekommen haben. Darin sind auch verschiedene Vornamen, meist klassische, manche ein bisschen altbacken, ich werde sie mir noch vor dem Schlafengehen durchlesen und mir ein paar Anregungen holen. Ich gehe die Namen von A bis Z durch, die Anzahl hält sich in Grenzen, aber ich erinnere mich, dass ich, während ich das Buch zuklappe, denke: „Raphael wäre auch schön.“ Bevor mir die Augen zufallen, lege ich das Buch schnell unter mein Kopfkissen und wünsche mir, ein Zeichen zu bekommen, so dass ich einen passenden Namen finde. Amnächsten Morgen klingelt das Telefon. Meine Schwester ist dran und sie sagt: „Weißt du, was ich mir gedacht habe? Raphael wäre auch schön“! Wow! Zufall oder Schicksal? Ich jedenfalls interpretiere es als klares Zeichen und für mich steht der Name sofort fest. Mein Sohn wird Raphael Patrick heißen. Glücklicherweise ist Uwe auch einverstanden und so steht der Namensgebung nichts mehr im Weg. Ich lese dann in unserem Stammbuch nach, was der Name eigentlich bedeutet und finde heraus, dass Raphael aus dem Hebräischen stammt und so viel wie „Gott heilt“ heißt. Die Bedeutung reißt mich nicht vom Hocker, aber trotzdem werde ich ihn so nennen!
Es ist laut, dann wieder leiser, ansonsten ist es immer gleich, ich schlafe viel, bewege mich möglichst wenig, ich drifte vor mich hin. Manchmal hätte ich gerne etwas mehr durch meine Nabelschnur, so muss ich mich mit dem begnügen, was es gibt. Trotzdem fühle ich mich recht wohl, wenn nur die Müdigkeit nicht wäre …
Die Menschen um mich herum meinen, ich hätte einen kleinen Bauch. Das nervt mich ziemlich. „Ja, ja“, sag ich meist nur, „bei David war‘s mehr“. Mein Baby bewegt sich auch nicht viel, ich kann im siebten Monat immer noch auf dem Bauch schlafen! Bei David war mir das schon nach der vierten Woche zu unangenehm, geschweige denn im hochschwangeren Zustand. Ich konzentriere mich auf die Vorteile, nämlich, dass ich noch sehr beweglich bin und mit meinem ersten Sohn die Welt erkunden kann. Er ist jetzt fast eineinhalb Jahre alt, fängt langsam an zu klettern und zu reden. Wir gehen jetzt einmal die Woche ins Kinderturnen und ich kann mit ihm noch die Seilbahn auf unserem Spielplatz fahren. Ich schaffe es sogar noch, ihn ein Stückchen zu tragen, wenn er nicht mehr laufen will. Ich genieße es, dass er immer selbstständiger wird. Man versteht jetzt deutlich, was er ausdrücken will, er kann gut alleine laufen, mit dem Essen ist er recht wählerisch, dafür ist er ganz heiß darauf, Bilderbücher anzuschauen. Manchmal kann man da ein bisschen tricksen, wenn er wieder gar nichts Festes zu sich nehmen will und nur nach seiner Milchflasche verlangt. Ich freue mich über meinen Sohn und ich freue mich auch auf das Baby. Ich überlege, wie es wohl aussehen wird. Ob er seinem Bruder ähnlich sieht? Vielleicht bekommt er meine Augen, die sind das Schönste an mir, ja, vielleicht wird er sie erben.
Mittlerweile ist es kalter Winter. Ich mache regelmäßig Aqua-Gymnastik für Schwangere bei der Hebamme. Einmal habe ich eine grippeähnliche Erkältung. Es sind noch knapp zwei Monate bis zum errechneten Geburtstermin und ich bekomme kaum Luft. Ich fühle mich fiebrig und habe starken Husten. Mein Immunsystem ist durch die Schwangerschaft im Keller und ich komme mir tagelang sterbenselend vor. Mein Frauenarzt meint, ein viraler Infekt zu diesem Zeitpunkt sei nicht schlecht, da bekäme das Ungeborene einen Nestschutz mit. Das Baby würde ja die Krankheit indirekt mit durchmachen und so würden sich dann auch seine Abwehrkräfte gut entwickeln. Ich finde die Erklärung sehr einleuchtend und so kann ich meinen Zustand besser ertragen.
Im letzten Schwangerschaftsmonat ist die Erkältung wieder überwunden. Es sind jetzt noch sechs Wochen bis zum errechneten Geburtstermin am 24.03.2009. Auf dem Terminkalender steht ein letztes großes Screening. Die Praxis meines Frauenarztes liegt mitten in der Nürnberger Innenstadt. Wieder EKG, wieder warten. Aber die Arztbesuche stören mich nicht, denn in der City kann man sich immer schön in ein Café setzten oder noch gemütlich durch die Geschäfte bummeln. Dass ich in den letzten Wochen vor der Geburt jeden zweiten Tag in die Praxis kommen soll, finde ich allerdings sehr ungemütlich, vor allem wegen der Fahrt und weil ich einen Babysitter für David brauche oder ihn mitnehmen muss. Der Arzt macht einen Ultraschall, bestätigt noch einmal, dass wir uns auf einen Buben freuen dürfen, sagt mir, dass mit den Herztönen alles in Ordnung ist und teilt mir mit, was ich schon vermutet habe, nämlich dass sich mein Kind immer noch in der Steißlage befindet. Er rät mir, in zwei Wochen wieder zu kommen und mich, falls sich das Baby noch nicht gedreht hat, über eine Geburt in Beckenendlage zu informieren. Trotzdem fahre ich guten Mutes wieder nach Hause, immerhin ist sonst alles in Ordnung und vielleicht entscheidet sich Raphael, sich doch noch zu drehen.
Wieder dieses Drücken. Langsam wird es mir ein bisschen ungemütlich. Das Wasser wird immer weniger, oder werde ich mehr? Soll ich mich bewegen? Aber nein, das ist mir zu anstrengend. Ich warte einfach ab, was als Nächstes passiert.
Eine Freundin, die bald ihr drittes Kind entbinden wird, empfiehlt mir „die steinerne Brücke“, eine einfache Brückenturnübung, bei der man den Po vom Boden hebt und eine Weile in dieser Stellung verharrt. Das Baby soll sich dabei so unwohl fühlen, dass es sich freiwillig dreht. Ich mache die Übung ein paar Tage, aber dann höre ich damit wieder auf. Der Frauenarzt rät von solchen Experimenten ab und auch von der Möglichkeit, das Baby drehen zu lassen. Bei meinem nächsten Termin fragt er mich, ob ich glaube, der Kleine hätte sich gedreht. Ich sage nein, ich hätte keine große Veränderung bemerkt. Er macht noch einen kurzen Ultraschall und nickt: „Die Mutter hat mal wieder recht.“ Er empfiehlt eine Überweisung an das städtische Klinikum, dort kann man die Kinder auch bei Beckenendlage auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Nur wenn die Wehen losgehen und ich einen Blasensprung haben sollte, möge ich bitte einen Krankenwagen anrufen und man sollte mich dann liegend transportieren, sonst wäre es für das Baby wegen der Nabelschnur gefährlich, die könnte sich bei einer Sturzgeburt um den Hals legen und es strangulieren. Die Notrufnummer schreibt die Arzthelferin in meinen Mutterpass, damit ich sie im Fall der Fälle habe und nicht in Panik danach suchen muss. Gut. Der Vorstellungstermin im Klinikum Nürnberg-Langwasser ist in der 38. Schwangerschaftswoche. Es gibt noch Hoffnung, dass sich Raphael dreht und ich im heimischen Krankenhaus ohne Kaiserschnitt entbinden kann. Jetzt wird es langsam ernst. Bald wird unsere Familie zu viert sein.
Ende mit Schrecken
„Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen“
(Mahatma Gandhi)
Klinikum Langwasser: Wir haben einen Termin am Vormittag um neun Uhr. Eine angenehme Uhrzeit. Uwe ist mit dabei, er hat mich gefahren und ist elegant auf den riesigen Klinikparkplatz eingezirkelt. So viele Autos, es ist schon fast alles besetzt, nur ganz hinten, von der Klinik am weitesten entfernt, ist noch ein Parkplatz frei. Was wollen die ganzen Leute im Krankenhaus? In aller Frühe?, denke ich mir. Wie es scheint, ist hier mehr Verkehr als auf einem IKEA-Parkplatz. Mein Mann flucht. Im Gegensatz zu unserem Dorfkrankenhaus muss man noch eine Weile laufen, bis man am Haupteingang ist. Im großen Rondell der Eingangshalle erblicke ich einen Früchte-Verkaufsstand, einen Krankenhausfrisör und weiter hinten eine Cafeteria. Es riecht nach Krankenhaus. Ein Gemisch aus Desinfektionsmittel, zu lange getragenen Socken und einer undefinierbaren Verzweiflung. Die Farben sind krankenhaustypisch, ein abgeschabtes Weiß gepaart mit grau-metallic. Immerhin plätschert in der Mitte ein kleiner Brunnen. Der Informationsstand ist an die Seite gequetscht, darunter ein abgelaufener Boden. Überall hängen verwirrende Schilder mit Bezeichnungen, von denen ich keine Ahnung habe. Erinnerungen an andere Krankenhäuser kommen hoch, wann immer ich dort jemanden besucht habe oder etwas gesucht habe, stand ich ratlos vor diversen Wegweisern. Das Schild zur Geburten- und Gynäkologie-Station finden wir schließlich doch ohne größere Probleme und wir folgen den Pfeilen, bis wir vor der Eingangstür stehen. Das ist kein schöner Ort, schießt es mir durch den Kopf und: Hoffentlich muss ich nicht an diesem furchtbaren Ort entbinden! Am liebsten würde ich auf der Schwelle kehrt machen, aber weglaufen steht nicht zur Option. Also treten wir ein und landen in einer Art offenem Wartezimmer mit ein paar Stühlen, einem roten Teppich und einer Kiste mit abgegriffenem Kinderspielzeug. Ich gebe meinen Mutterpass ab, erkläre der Empfangsdame, weshalb wir hier sind, woraufhin mir diese ein Formular aushändigt, das ich während der Wartezeit ausfüllen soll. Darauf sind die üblichen Fragen nach genetischen Erkrankungen in der Familiengeschichte, bekannten Allergien und eventuellen Vorerkrankungen bei Mutter und Vater. Der Bogen ist schnell ausgefüllt, es sind keine gravierenden Erbkrankheiten bekannt, nur gewöhnliche Sachen wie der Brustkrebs bei meiner Oma, eine Schilddrüsenerkrankung bei meiner Schwiegermutter und ein nebensächlicher Gendefekt, genannt Morbus Osler, den schon mein Großvater, meine Mutter und drei ihrer Geschwister mit sich herumtragen, von dem mir aber der Frauenarzt versichert hat, dass wir davon nichts Schlimmes zu erwarten hätten.
Als wir aufgerufen werden, bittet uns die Dame in ihren kleinen Raum, wo eine alte, gesichtslose Stoffpuppe bereit liegt. Sie nimmt die Puppe in ihre Hand und erklärt: „Stellen Sie sich vor, das ist Ihr Kind. Das liegt jetzt so in Ihrem Bauch“. Während sie erklärt, hält sie die Puppe mit beiden Beinen nach unten. „Bei einer solchen Steißgeburt ist es möglich, dass Komplikationen wegen der Nabelschnur, die sich um den Hals des Kindes legen könnte, auftreten. Manchmal müssen die Ärzte dann schnell eingreifen, das muss Ihnen bewusst sein. Es könnte auch sein, dass man dann mit beiden Händen reingehen muss, um das Kind zu holen“. Du liebe Güte! Das Angebot klingt nicht gerade verlockend, trotzdem ist für mich ein Kaiserschnitt die schlimmere Alternative. Ich bin entschlossen, meinen Sohn auf natürliche Weise auf die Welt zu bringen, und so geht es weiter zum Ultraschall. Wir nehmen auf den nächsten freien Holzstühlen Platz und warten, während sich noch eine andere Schwangere niedersetzt. Meine Nachbarin hat einen runden Bauch, einen richtigen schönen Schwangerschaftskugelbauch, nicht so ein kleines Mini-Bäuchlein wie ich. Bevor ich zu deprimiert werde, werden wir herein gebeten. Ein großer, schwarzhaariger Arzt mit markanten Augenringen begrüßt uns. Es ist ein Oberbayer, genau wie ich. Der Mann ist mir sympathisch, das macht die Untersuchung leichter. Er redet im heimatlichem Dialekt, während er den Ultraschall macht. Die Atmosphäre ist ganz entspannt, bis der Arzt auf einmal nichts mehr sagt, eine Kollegin zu Rate zieht und beide angestrengt auf das Bild schauen. Die zwei Ärzte suchen nach einem besseren Bild. „Was ist denn los?“, will ich schließlich wissen. Der Mann deutet auf den Bildschirm, es ist irgendetwas mit der Nabelschnur. Dann spricht er von einem „schlechten Doppler“. Drei Fragezeichen in meinem Kopf, ich habe mit Medizin nichts am Hut, obwohl es in meiner Familie viele Ärzte und Ärztinnen gibt, für mich sind das alles böhmische Dörfer. Bis ich dann doch verstehe, dauert es eine Weile. Durch die Nabelschnur wird das Baby versorgt. Über diese Verbindung fließt mein Blut zum Embryo und das sauerstoffarme Blut vom Embryo zurück. Diesen Blutfluss kann man durch einen Ultraschall mit einer sogenannten Doppleruntersuchung messen, und bei meinem Sohn kommt anscheinend zu wenig Blut an. Wobei der Doktor einräumt, dass erstens die Untersuchung schwierig ist, da man genau die Nabelschnur treffen muss, und sie zweitens recht ungenau ist und man auf alle Fälle zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachkontrollieren sollte. Ich werde also gebeten, erst ein CTG für die Herztöne machen zu lassen und dann wieder zurückzukommen.
Im kargen CTG-Raum liege ich mit einem braunen, abgewetzten Stretch-Gurt um den Bauch. Bum bum, bum bum, bum bum macht es. Das Geräusch beruhigt mich. Scheinbar geht es meinem Sohn gut, die Herztöne sind klar zu hören, auch wenn es eher ruhig als aktiv klingt. Ich mache mir noch keine großen Gedanken, denn nach meiner Erfahrung bringt es nicht viel, den Teufel schon vorher an die Wand zu malen. Erst mal abwarten, vielleicht hat sich der Doktor geirrt, denke ich. Mein Mann ist still, in sich gekehrt, trotzdem nervös, er läuft rastlos auf und ab. Ich döse ein bisschen. Endlich kommt eine Schwester, schaut auf die Herzfrequenzen, nimmt der Messmaschine den Zettel und mir den Gurt ab. „Dann dürfen Sie noch mal kurz Platz nehmen“, sagt sie freundlich. Wir setzen uns hin. Als wir wieder beidem schwarzhaarigem Arzt sind, meint er: „Na, das CTG schaug‘t ja net a mal so schlecht aus, jetzt schau mer noch mal.“ Ich bin zuversichtlich, doch als er wieder die richtige Stelle der Nabelschnur gefunden hat, schüttelt er den Kopf. “Ihr Kind ist unterversorgt. Schaun’s, der Bua is doch viel zu klein für die 38. Woche. Des sehn’s ja scho an ihrem Bauch. Da hat erna Frauenarzt geschlampert.“ Ich denke an meinen Gynäkologen und kann es nicht begreifen. Ich war mir ganz sicher, bei ihm in guten Händen zu sein. „Und jetzt?“, frage ich schließlich schon etwas unsicherer. Der Arzt schlägt vor, Sonntag erneut zu kommen, da habe er selber Dienst und dann müsse man den Kleinen notfalls holen. Mein Kopf kann keinen klaren Gedanken fassen und so mache ich sofort dicht. Eine kleine Stimme sagt mir, dass sich der Arzt vielleicht doch getäuscht hat. „Ich wollte Sonntag gerne nach München fahren, denn meine Schwester hat Geburtstag“, sage ich leise. Der Arzt schaut mich verständnislos an. „Reicht es nicht vielleicht am Montag? Dann kommen wir wieder“, höre ich mich sagen. Ein Seufzer vom Herrn Doktor: „Na guad. Dann san‘s am Montag wieder da. Aber ganz in der Früh um achte! Da bin i dann auch noch da vom Nachtdienst. “Dann bittet er mich noch meine Krankenhaustasche mitzubringen, denn wenn sich der Doppler nicht bessert, muss die Geburt eingeleitet werden. In der Akte wird später noch vermerkt, dass sich die Patientin trotz ärztlichen Rates geweigert hätte, am Wochenende wieder zu erscheinen.
Auf der Heimfahrt kann ich mich doch nicht mehr beherrschen und mir kullern die Tränen herunter. Was habe ich nur falsch gemacht, frage ich mich. Außerdem mache ich mir Gedanken um den Kleinen im meinem Bauch. Ich streichle immer wieder über den kleinen Kugelbauch, als ob es meinem Kind helfen würde.
Das Wochenende geht viel zu schnell vorbei. Wir sind am Ende doch nicht nach München gefahren, Uwe fand das zu risikoreich, und im Grunde genommen habe ich gut darauf verzichten können, denn so habe ich noch Zeit für einen schönen, gemütlichen Sonntag mit meinem Sohn David. Es klingt vielleicht komisch, aber mir fiel es damals schon schwer, nur für die Entbindung meinen großen Sohn „zurückzulassen“, wenn man das überhaupt so nennen kann. Meine Schwiegermutter war wie selbstverständlich bereit, auf ihn aufzupassen und mein Mann war ja auch daheim, aber dennoch: Der Abschied hatte mich traurig gemacht. Die Zeit mit David am Sonntag nehme ich noch einmal ganz bewusst wahr und genieße sie. Wir sind zusammen bei dem Rehgehege in unserem Dorf und füttern die Tiere mit hartem Brot. Am Abend beobachte ich mit ihm besonders lange den Mond von unserem Badezimmerfenster aus und lese ihm noch eine Geschichte mehr als sonst vor. Ich freue mich darüber, wie gut er schon zuhören kann. In seinem Zimmer über dem Gitterbett hängen Leuchtsterne, die ich jeden Abend mit der Taschenlampe anleuchte, damit sie funkelnd hell strahlen, dann singe ich ihm noch ein kleines Lied vor, und dann schläft er zufrieden ein.
Als ich für mich alleine bin, merke ich, wie angespannt ich bin. Meine Planung ist völlig durcheinander gekommen, das kann ich überhaupt nicht vertragen. Von mir aus hätte das Kind gut und gerne noch zwei, drei Wochen im Bauch bleiben können. Trotzdem hat natürlich die Gesundheit meines Kindes oberste Priorität und ich bin zu allem bereit, wenn ich dadurch ein gesundes Baby zur Welt bringen kann.
So geht es am Montagmorgen mit gemischten Gefühlen zurück ins Klinikum Langwasser. Von David haben wir uns verabschiedet und die Tasche haben wir mitgebracht. Leider ist der Doppler noch unverändert schlecht und so werde ich auf die Entbindungsstation geschickt. Der Arzt wünscht uns alles Gute und verabschiedet mich mit einem: „Des werd scho!“
Auf der Station angekommen, zeigt mir die zuständige Schwester meine Zimmerhälfte, darin natürlich ein Bett, ein kleiner Kleiderschrank und ein eigenes WC mit Dusche. Ich bin froh, dass ich Letzteres nicht mit jemand anderem teilen muss. Das gegenüberliegende Bett ist noch leer, ich hoffe, es bleibt so. Herein kommt ein sympathischer Krankenpflegeschüler mit dunklen Haaren und Brille. Er fragt etwas nervös, was ich zum Mittagessen möchte. An Essen kann ich jetzt nicht denken, so schlägt der junge Mann Vollkost vor und Vollkost wird genommen, mir ist das in dem Moment völlig egal, wer weiß, ob ich überhaupt Mittag esse? Dann geht es weiter zur Aufklärung und zur ersten Tablette, die meine Wehen einleiten soll. Immer noch wehre ich mich gegen einen Kaiserschnitt. Nachdem die Aufklärung beendet ist und ich einem „Notkaiserschnitt für alle Fälle“ noch nicht zugestimmt habe, reden mindestens zwei Ärzte auf mich ein. Am Ende haben sie ihre Unterschrift und ich meine Ruhe, und mit zwiespältigen Gefühlen schlucke ich die erste Tablette. Danach geht es zum CTG auf die Entbindungsstation, wo gerade eine andere Mutter ihr Kind zur Welt bringt. Ich liege noch ruhig auf der Liege, während im Nachbarraum laute Schreie durch die Wand dringen. Mit leichtem Grauen denke ich daran, was mir noch bevorsteht.
Man sagt mir im Voraus, dass sich eine künstliche Einleitung hinziehen kann. Manchmal kann es sogar bis zu drei Tage dauern, bis das Baby kommt. Deshalb gehen wir nach dem unauffälligen CTG erst mal in die Cafeteria und bestellen noch ein kleines Frühstück. Ich merke gar nichts, kein Ziehen, kein bisschen Bauchweh, nichts. Ich mache noch kleine Witze über das Treppensteigen, da es in der Klinik unzählig viele Treppen zum Rauf- und Runterlaufen gibt – das soll ja förderlich sein, wenn man den Geburtsvorgang beschleunigen will. Nach eineinhalb Stunden ist es Zeit für das nächste CTG und gegebenenfalls eine weitere Tablette. Wieder sind keine Wehen zu spüren und so gehen alle davon aus, dass es noch dauern kann, bis sich etwas tut. Wir beschließen deshalb, dass mein Mann zu David heimfährt und ich ihn anrufe, wenn etwas vorwärts geht. Ich nehme die nächste Tablette und spüle sie mit einem großen Schluck Wasser hinunter.
Wer stört meinen Schlaf? Hilfe, irgendetwas ist anders als sonst. Meine Wand drückt gegen mich, fast als wolle sie mich rausdrängen. Immer deutlicher, immer fester, ich glaube, ich muss hier raus ...
Ich sitze noch im CTG-Zimmer, als es zu ziehen beginnt. Kein leichtes Ziehen, sondern ein starkes, wie bei einer Wehe. „Ich glaube, die Tablette wirkt jetzt“, sage ich zu der Hebamme, die den Raum noch nicht verlassen hat. „Sehr gut“, lächelt sie mir zu, „wir machen gleich noch ein CTG.“ Zuerst aber ist Schichtwechsel, die erste Hebamme, der bemutternde Typ, geht nach Hause und es kommt eine andere junge Frau. Die hängt mich dann wieder an das Messgerät für die Herztöne, um zu schauen, ob es sich um echte oder nur gefühlte Wehen handelt. Die Geburt meines ersten Sohnes ist noch nicht lange her, damals hatte ich mit Unterbrechung 36 Stunden Wehen, war am Ende zwar kraftlos, aber wunschlos glücklich. Heute soll es, wenn es nach mir geht, schneller gehen. Der Wehenschreiber schwingt auf und nieder, es sind echte Wehen. Die Hebamme schaut genau hin, ihr gefallen die Herztöne des Kindes nicht, darum konsultiert sie den zuständigen Arzt. Ein kurzes Gespräch, beidseitiges Kopfnicken und dann die Nachricht, dass sie sofort einen Kaiserschnitt machen müssen, die Herztöne des Kleinen fallen ab. Wie bitte?! Für mich bricht eine Welt zusammen. Als ich merke, dass ich nicht um den gefürchteten Kaiserschnitt herumkomme, frage ich stammelnd nach, ob ich meinen Mann anrufen kann, damit er zurückkommt und bei der Geburt dabei sein kann. Die Hebamme meint, solange könne man noch warten. Nach dem Gespräch laufen mir die Tränen herunter, ich habe wirklich Bammel. Die Hebamme gibt mir die Thrombosestrümpfe, sieht meine Tränen und fragt, wie das Baby denn heißen soll: «Raphael Patrick», sage ich. «Wunderschön», antwortet die Hebamme und verspricht mir, dass sie gleich das Namensbändchen anfertigt.
Jetzt wird es ernst, das Baby wird auf die Welt kommen, und so streichle ich meinen Bauch auf der Toilette ein letztes Mal, danach wasche ich mir die Tränen ab und richte die verschmierte Schminke. Ich gebe mir das Versprechen, ab jetzt tapfer zu sein, komme, was wolle. Mein Mann ist rechtzeitig da. Er war gerade daheim angekommen, als sein Telefon klingelte, und drehte sofort wieder um. Jetzt begleitet er mich in den Anästhesieraum, in dem über meinem Bauch ein grünes Tuch gespannt wird. Zum Glück habe ich erst viel später durch eine Freundin erfahren, dass die Ärzte beim Kaiserschnitt nur einen kleinen Schnitt machen und den Rest, der benötigt wird, um das Baby herauszuholen, aufreißen. Meine Freundin ist selber Krankenschwester und war während ihrer Ausbildung ein Mal bei einem Kaiserschnitt dabei. Sie fand das Zuschauen so schlimm, dass sie ohnmächtig geworden ist, das einzige Mal während ihrer Ausbildung. Ich kann das gut nachvollziehen. Mein Mann steht noch neben mir, er ist aber anscheinend ziemlich blass, denn die Ärzte raten ihm dazu, draußen Platz zu nehmen und zu warten. Ich bitte ihn noch, das Baby dann zu nehmen, dann verabschiedet er sich. Ich glaube, er ist wirklich ganz froh, das Zimmer verlassen zu können. Eine Menge Ärzte und Schwestern sind jetzt meine alleinige Gesellschaft. Sie wollen eine gewöhnliche PDA legen, eine Periduralanästhesie, die mir ab dem Unterbauch die Schmerzen nehmen soll. Die Spritze wird in den Rücken gegeben, ich sitze dabei. Die Nadel ist wirklich lang, das finde ich gruselig, aber ich beiße die Zähne zusammen. Im Nachhinein kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob die Spritze überhaupt schmerzhaft war. Auf jeden Fall hat sie zu langsam gewirkt, denn als mich ein Arzt ein paar Minuten später mit einer schwarzen Klammer in den Bauch zwickt, spüre ich das sehr wohl. Ich sage, dass ich auch beim Zahnarzt immer warten müsse, bis die Narkose endlich wirkt. Das Gleiche sollen die Ärzte meiner Meinung nach auch jetzt tun, allerdings ruft der Chefarzt nur: „Wir haben keine Zeit mehr, wir machen eine Vollnarkose.” Nein!!!, schreit es in meinem Kopf. Bitte keine Vollnarkose, ich will doch meinen Jungen in die Arme nehmen können, wenn er da ist. Es hilft nichts, eine Spritze und ich bin weg. Das Letzte, was ich sehe, ist der Tubus, mit dem die Ärzte vor meinem Gesicht hin und her wedeln, um mich während der OP zu beatmen.
Ein Licht, so grell, es blendet mir in den Augen, ich kann nichts sehen. Hilfe: Ich werde herausgenommen, ich will noch nicht gehen, ich will noch nicht gehen! Jemand Fremdes nimmt mich hoch, ich schreie das erste Mal, die Luft brennt in meinen Lungen. Wo ist meine Mama nur? Ich werde gewaschen, warmes schönes Wasser auf meiner Haut. Eine Schwester wickelt mich in ein Handtuch und drückt mich einem Mann in die Arme. Papa. Endlich bekomme ich etwas zu trinken, ich bin so durstig, das kleine Fläschchen trinke ich in ein paar Zügen aus. Gut, jetzt fallen mir die Augen wieder zu, ich bin sicher auf Papas Arm.
Im Aufwachraum
Irgendwann komme ich wieder zu mir, links und rechts Betten, in denen mir unbekannte Leute liegen, die entweder noch schlafen oder aufsitzen. Was mache ich hier? Ah ja, mein Kind! Ein Pfleger kommt zu mir, ich kann kaum sprechen, lalle nur: „Wie geht es meinem Sohn?“ Der Pfleger lächelt und sagt: „Glückwunsch, Sie haben einen gesunden Jungen, dem geht es gut, er ist bei seinem Vater“. Gott sei Dank, alles gut! Jetzt freue ich mich. Der Mann gegenüber winkt mir zu, und so winke ich noch leicht benommen zurück. Ich frage nach, wie lange ich geschlafen habe. Wie lange ist mein Sohn schon auf der Welt, ohne seine Mama gesehen zu haben? Der Pfleger meint, etwa zwei Stunden, aber er würde mich gleich auf die Station schieben, da warte ja mein Kind schon. Wie bei der ersten Geburt kann ich mich nicht mehr an die Wege zwischen Kreißsaal und Zimmer beziehungsweise zwischen Aufwachraum und Zimmer erinnern. Das Erste, das ich wieder klar vor Augen habe, ist, dass mir jemand meinen kleinen Raphael auf den Arm legt. Ich schaue ihn an, halte ihn. Das Gefühl ist ganz ungewohnt. Mir fehlt die Begrüßung der normalen Geburt, der Moment, in dem man sein Kind das erste Mal erblickt und sich sofort und unwiderruflich verliebt. Bei Raphael war da diese merkwürdige Lücke. Ich halte meinen Blick auf das kleine Bündel gerichtet und denke: Das ist er jetzt also, ein kleines mickriges Kerlchen mit zwei großen runden Glupschaugen, ein bisschen wie Gollum aus Herr der Ringe. Mein Mann findet ihn total schnuckelig, aber ich fühle noch nicht viel. Die Schwester fragt, ob ich stillen will, und ich nicke ganz entschlossen. Die Schwester holt mein Baby und legt es mir an die Brust. Kaum ist Raphael angedockt, zieht er aus Leibeskräften. Die Schwester ist genauso verdutzt wie ich. Kein Vergleich zu David, der immer ein fauler Trinker war und am Ende die Flasche viel lieber wollte, weil das so bequemer war. „Dafür, dass er so klein ist, hat der aber einen ganz guten Zug drauf“, meint die Schwester. Je länger ich Raphael im Arm halte, umso mehr kommt auch das Muttergefühl. Ich bin ganz zufrieden und bin überzeugt, dass Raphael ganz schnell groß wird.
Raphael liegt neben meinem Krankenbett in seinem Säuglingsbett. An einer Seite ist eine Hasenspieluhr befestigt, die ziehe ich ihm auf und dann schläft er irgendwann ein. Ich gebe ihn absolut nicht ab. Das Krankenhaus bietet ein Rooming-in an mit der Möglichkeit, die Neugeborenen in der Nacht ins Säuglingszimmer zu geben, doch das möchte ich nicht. Der Kleine hat mich nach der Geburt sowieso entbehren müssen und ich bin froh, dass er jetzt neben mir liegt.
Raphael ist in der 38. Schwangerschaftswoche 45 Zentimeter groß und 2230 Gramm schwer auf die Welt gekommen. Trotz des geringen Gewichts muss er nicht in den Brutkasten. Ich muss darauf achten, dass er immer schön zugedeckt ist, er friert leicht. Mir selber geht es nicht so gut. Als die Narkose langsam nachlässt, merke ich die Schmerzen im Unterbauch. Ich kann mich kaum drehen, geschweige denn aus dem Bett aufstehen. Vom Intubationsschlauch habe ich Husten, und bei jedem leichten Räuspern zerreißt es mich fast. Die Schmerzen sind zweitrangig, Hauptsache, Raphael geht es gut. Dennoch bin ich noch nicht in der Stimmung, dem weiteren Bekanntenkreis die frohe Kunde mitzuteilen. So telefoniere ich nur das Nötigste mit den engsten Angehörigen und Freunden. Meine Mutter sagt, sie werde von München aus sofort kommen, darüber freue ich mich. David möchte ich in meinem Zustand noch nicht sehen, auch am nächsten Tag nicht. Er würde nicht verstehen, dass sich seine Mama kaum bewegen kann. Die erste Nacht ist furchtbar, im Nachhinein hätte ich mir lieber Schmerzmittel geben lassen sollen, aber ich bin von Natur aus skeptisch, was Medikamente anbelangt.
Der zweite Tag
Raphael trinkt weiter gut, er ist ganz ruhig und brav. Ich schließe ihn richtig ins Herz. Wir haben jetzt auch einen Zugang ins Zimmer bekommen – eine junge Türkin mit ihrer Tochter und einer Verwandten. Ich liege immer noch im Bett und beobachte, wie meine neue Zimmernachbarin aufstehen und zur Toilette gehen kann. Verdammte Operation! Das wäre anders wirklich leichter gewesen, aber sei‘s drum. Eine Schwester kommt zu mir und meint, ich müsse jetzt bitte auch langsam aufstehen. Die ersten Schritte fühlen sich an, als ob meine Gedärme auf den Boden klatschen. Wieder Zähne zusammenbeißen, aber der Weg zur Toilette ist fast nicht zu ertragen. Ich will lieber sofort ins Bett zurück, doch die Schwester treibt mich an, weiter zu laufen. „Los, Frau Lehmann, das geht schon. Man muss sich sofort wieder mobilisieren.“ Wie von Messerstichen geplagt gelange ich endlich ins Bad und darf dann wieder zurück ins Bett. Mir graut es schon vor dem nächsten Mal Aufstehen.
Da ich jetzt wieder alleine zur Toilette gehen kann, entfernt die Schwester den Blasenkatheter. Eine Erleichterung. Meine Zimmernachbarin hat ein normal großes Baby, das immerzu schreit. Die Kleine hat Hunger und saugt ihrer Mutter die Brustwarzen wund. Gegen Nachmittag trifft der erste Besuch ein, eine damals gute Freundin. Bei der Türkin kommt die ganze Familie, das Zimmer ist voll. Die Südländer bringen Essen mit, das ganze Zimmer riecht danach, aber sie bieten mir auch etwas an. Pünktlich zum Gebet wird ein mitgebrachter Gebetsteppich ausgerollt und ungläubig beobachte ich, wie die Mutter der jungen Türkin auf die Knie geht und in Richtung Mekka betet.
Ich liege tagsüber noch die meiste Zeit im Bett. Raphael hat am Säuglingsbett eine Wickelablage, worauf ich ihn im Sitzen schon wickeln kann. Wenn er trinken will, rufe ich eine Schwester, die ihn mir an die Brust hebt. Ab morgen mache ich wieder alles alleine.
Der dritte Tag
Raphael ist ein bisschen zu kalt, er muss in ein Heizbett. Die Temperatur wird jetzt ständig mit Hilfe eines überdimensionalen Fieberthermometers überwacht. Auch der Blutzuckerwert stimmt nicht ganz, weshalb Raphael immer wieder in einen der winzig kleinen, fast gläsern wirkenden blauen Füße gepikst werden muss. Der Arme, denke ich mir.
Heute kommt endlich mein großer Sohn. Ich freue mich wirklich, als er durch die Tür stolziert. Mit seinen eineinhalb Jahren kann er sich schon ganz gut verständigen und erfasst die Szene sofort. Das ist jetzt also das erwartete Baby, sein kleiner Bruder. Er macht schön ei ei, ihm gefällt der Kleine. Wir gehen aus dem Krankenzimmer, das sich langsam wieder mit der türkischen Großfamilie füllt. David guckt sich auf dem Gang alles an, meine Schwiegereltern sind als Verstärkung zum Hinterherlaufen dabei.
Ich bin auch wieder auf den Beinen, wenn auch noch ein bisschen klapprig. Als ich mit Raphael zum Stillen muss, kommen mein Mann und David mit. Wir ziehen uns ins Stillzimmer zurück, da ist es ruhiger als im Krankenzimmer. Den Abschied verkraftet mein Großer auch ganz gut, er darf mich ja morgen wieder besuchen.
In der Nacht macht die Nachtschwester mit Raphael noch den obligatorischen Hörtest, er ist völlig in Ordnung. Am letzten Tag im Krankenhaus geht es uns schon richtig gut. Nur der Blutzuckerwert macht noch ein paar Probleme, das kleine Babyfüßchen ist jetzt schon ganz blau gepunktet. Ich will langsam wirklich nach Hause, das Fiebermessen und Piksen nerven mich.
Raphael hat sein Geburtsgewicht bereits wieder erreicht, die Babys nehmen ja nach der Geburt erst einmal ab. Das ist sehr beruhigend, ich bin froh, dass er so gut trinkt. Sein Entlassungs-Strampler ist ihm immer noch viel zu groß. Ich habe ihm einen schönen Body von der Rock-Star-Baby-Kollektion mit dem Aufdruck „Wanted“ gekauft und einen süßen Strampelanzug in Größe 56. Darin versinkt er allerdings, deshalb hat mir meine Schwiegermutter jetzt Frühchenstrampler in Größe 44 besorgt, die liegen schon enger an.
Entlassungstag
Heute ist der große Tag. Raphael soll nach Hause, vorausgesetzt die Abschlussuntersuchung ergibt keine Auffälligkeiten. Mir ist ein bisschen bange, ich will sehr gerne heim, aber ich habe Sorge, dass der Arzt vielleicht doch irgendetwas findet. Vor Raphaels Untersuchung ist meine Abschlussuntersuchung, eine reine Routine, es gibt nichts Auffälliges. Ich solle nur wegen des Kaiserschnitts ein Jahr lang nicht schwanger werden. „Hab ich eh nicht vor“, antworte ich der Ärztin lächelnd.
Nun ist Raphael dran und ich bin doch nervös. Ich hatte wohl damals schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich warte darauf, dass die Kinderärztin mit ihren blonden Locken mir die Entlassung verweigert, aber sie sagt: „Alles in Ordnung, Sie dürfen mit dem Kleinen nach Hause.“ „Wirklich?! Da bin ich aber froh!“, antworte ich. Alle Reaktionen seien normal, die Herztöne, alles, was es zu tasten galt, unauffällig. Ich solle versuchen, ihn noch ein bisschen warm zu halten. Uwe holt mich ab. Ich habe schon alles zusammengepackt. Der Maxi-Cosi ist viel zu groß für Raphael, man sieht ihn gar nicht darin. Trotzdem fahren wir stolz wie Oskar heim.
Wir haben das Glück, in einem eigenen Haus im Grünen zu wohnen. Meine Schwiegereltern wohnen direkt nebenan, und wir teilen uns einen riesigen Garten. Mehr kann man sich für ein kleines Kind fast nicht erträumen, außer vielleicht noch ein paar Tiere. Immerhin, ein Hund ist schon geplant.
Wir kommen nachmittags gemütlich daheim an, David ist bei seiner Oma und wartet schon. Raphael schläft in seinem Maxi-Cosi und lässt sich durch nichts stören. Ich freue mich schon, ihm die Umgebung zu zeigen, wo er groß werden wird. Es ist ein schönes Gefühl, zwei Jungs zu haben!
Eine neue Welt
„Auch das ist Kunst und Gottes Gabe
aus ein paar sonnenhellen Tagen
sich soviel Licht ins Herz zu tragen
dass, wenn der Sommer längst vergeht
das Leuchten immer noch besteht“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Die ersten Tage und Wochen mit Raphael daheim sind richtig schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles so, wie es sein soll, und alles ist gut; unsere Familie scheint komplett zu sein. David ist wahnsinnig lieb mit seinem Bruder, er ist noch bei mir daheim, weil ich das große Glück habe, mich die ersten drei Jahre voll und ganz auf meine Kinder konzentrieren zu können. Wenn ich den kleinen Raphael also stille, bekommt David eine kleine Tüte Gummibärchen oder etwas anderes Besonderes. Raphael trinkt und schläft und wächst ganz nebenbei auch Stückchen für Stückchen. Unser Alltag als Familie läuft genauso weiter wie bisher, ein zweites Kind in dem geringen Abstand bedeutet ja auch keine gravierende Veränderung mehr – solange das Kind gesund ist, und allen Anschein nach ist alles in Ordnung. Freunde und Bekannte lächeln und witzeln zwar manchmal, weil er so klein ist, aber ich höre auch, dass er wächst. Er ist ein braves Kind, schreit nicht viel, schläft gut, macht absolut kein Problem beim Stillen, und er ist fröhlich und aktiv, wenn er wach ist. Er schaut sich mit seinem zu diesem Zeitpunkt noch blauen Augen die Welt und sein Umfeld genau an, ab und zu meint man, er lächelt schon ein bisschen.
So vergeht die Zeit und bald schon zieht es mich raus, meine Wander- und Reiselust dringt wieder durch, der Hang zum Aktionismus. Deshalb wird als erster Schritt ein Urlaub bei meiner Schwester in der Schweiz geplant. Nati ist selber Ärztin und macht ihre Facharztausbildung bei den Eidgenossen. Ihr Freund, ebenfalls Arzt, hat sich auch frei genommen und so freuen wir uns auf die Woche miteinander. Meine Schwiegereltern haben Bedenken, was die Reise mit zwei so kleinen Kindern betrifft; letztendlich sind sie aber beruhigt, als Uwe sich bereit erklärt, mich hinzufahren und wieder abzuholen. So steht der erste Urlaub vor der Tür, in ein paar Tagen ist es soweit, Raphael wird zu diesem Zeitpunkt drei Monate alt sein.
Was für ein Leben. Endlich fange ich an mich richtig wohlzufühlen. Besonders freue ich mich über den lustigen großen Jungen, der anscheinend auch zu meiner Familienherde gehört. Deshalb verzieht sich auch mein Mund so komisch und Glucks-Laute kommen heraus, wenn er auf und ab hüpft auf dem Schlafplatz. Und Mama strahlt mich an und sagt: „Du lachst ja!“ Ich spüre Kraft in mir, ich kann mich strecken und mit den Beinchen strampeln, und wenn ich genug geschlafen habe, ist diese Welt wunderschön!
Bevor wir in die Schweiz aufbrechen, haben wir noch einen Termin für die Vorsorgeuntersuchung. Ich habe mir auf Empfehlung einen Arzt in Nürnberg gesucht, bei dem ich mich gut aufgehoben fühle, und so nehme ich den längeren Anfahrtsweg gerne in Kauf.
In der Praxis angekommen fragt mich die Sprechstundenhilfe, ob ich Raphael noch stillen will, sie hätten ein abgetrenntes Eck für Säuglingsmamas. Das nehme ich gerne in Anspruch, auch wenn wir noch während des Stillens aufgerufen werden. Ich hoffe, der Doktor ist mit Raphaels Gewicht zufrieden und macht kein großes Drama aus den Perzentilen. Der Arzt nimmt sich Zeit für die Untersuchung, er macht noch einen Ultraschall von den Hüften, die bei Raphael nach der Geburt etwas auffällig waren, aber er sagt, es bestehe kein Anlass, eine Spreizhose zu tragen oder ihn breit zu wickeln. Der Doktor hat selber drei Kinder und ist absolut gelassen, was das Gewicht von Raphael angeht. Als ich ihn darauf anspreche, ob ich ihn mit einem Fläschchen zufüttern muss, meint er, dass der Kleine im Verhältnis zum Geburtsgewicht ganz normal zunehme, ich solle ihn also weiter stillen, das reiche aus.
Zufrieden und glücklich fahre ich wieder nach Hause. Raphael wächst und nimmt zu und so denkt niemand an eine schwere Krankheit. Ich habe noch einmal einen Albtraum vom Klinikum Langwasser. Darin will ich nach der Geburt aus dem Krankenhaus fliehen, mit einer riesigen Narbe am Unterbauch und nur in einem weißen Krankenhaus-Nachthemd bekleidet. Ich renne unter Schmerzen einen U-Bahn-Abgang hinunter und irgendwer vom Krankenhauspersonal ist mir dicht auf den Fersen. Dann wache ich auf und denke: nur ein Traum. Das Krankenhaus soll für mich ein für alle Mal abgehakt sein.
Der Zeitpunkt der Abreise ist gekommen, natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, ob mit den zwei kleinen Kindern auch alles gut gehen wird auf der Fahrt, die immerhin vier Stunden dauern wird. Wir sind gut vorbereitet, haben Bücher, Brotzeit und eine Spielzeugtüte für David dabei, aus der er sich jede Stunde eine Kleinigkeit nehmen darf. Wir fahren nach dem Frühstück los, es gibt kein Geschrei, ich setze mich zwischen meine beiden Söhne und rassle für den Kleinen, während sich der Größere einen Bagger aus der Tüte zieht. Wir gucken uns die Landschaft an und freuen uns über jeden Traktor, den wir sehen. David weiß mit seinen eindreiviertel Jahren jetzt schon, welcher Traktor ein John Deere, ein Fendt oder ein Deutz ist – so kann man selbst von den Kleinsten noch etwas lernen. Die Baustellen auf der Autobahn kommen uns auch gelegen. Bagger beim Schaufeln zu beobachten oder der Walze beim Rollen zuzuschauen, bietet eine herrliche Abwechslung für David. Raphael ist eingeschlafen. Er ist glücklich und zufrieden mit seinem Schnuller.
Die erste längere Pause machen wir in Bregenz, kurz hinter der Grenze. Wir setzen uns in ein McDonalds-Restaurant, da kann David ausnahmsweise Pommes frites essen und ich kann Raphael stillen und wickeln. Jetzt haben wir den größten Teil der Anreise schon hinter uns, und als alle satt sind, setzen wir zum Endspurt an. Kurz vor dem Ort, in dem Nati wohnt, ruft David: „Kran! Grüner Kran!“, und wir staunen Bauklötze, als wir einen grünen Kran erblicken. Nati und ihr Freund Basti freuen sich, als wir endlich da sind. Mein erster Besuch bei ihr in der Schweiz. Uwe hilft noch das Gepäck hochzutragen, trinkt schnell einen Kaffee und dann macht er sich auf den Heimweg. Eine Woche Luftveränderung wartet auf uns und wir sind überglücklich.
Die Tage vergehen wie im Flug. Nati hat mir ihr Schlafzimmer überlassen und die Buben schlafen erstaunlich gut. Die Ausflüge sind nach dem Geschmack der Kinder organisiert, aber wir haben auch viel Spaß auf kleinen Wanderungen oder im St. Gallener Zoo, wo man die Tiger aus nächster Nähe bestaunen kann. Manchmal gehen wir einfach nur zum Eisessen und auf den Spielplatz. Einen Tag besuchen wir meine Mutter, deren Lebensgefährte am Bodensee wohnt, ganz in der Nähe von Lindau. Es ist ein schöner Tag im Juni und meine Mutter wird mich nach Raphaels etwas herausstehenden Bauchnabel fragen und Nati wird sagen, es sei ein einfacher Nabelbruch, so etwas komme oft vor und sei absolut nichts Bedenkliches. Ich werde mit Raphael sowieso bald zur U4 gehen, in dem Alter jagt eine Vorsorgeuntersuchung die nächste. Dann werde ich den Kinderarzt nach dem Nabelbruch fragen.
David und Raphael sind total brav im Urlaub und Raphael lacht jetzt das erste Mal richtig. Eines Morgens freut er sich so sehr über die Anwesenheit seines großen Bruders, dass der kleine Bauch auf und nieder gluckst. Er trinkt nach wie vor alle drei bis vier Stunden und in der Nacht einmal, es gibt keinen Grund besorgt zu sein. Mein künftiger Schwager sagt zu mir eines Morgens: „Ein Jahr und dann hast du es geschafft, das ist doch cool“. Hätte er nur recht gehabt, aber das Schicksal wollte es anders. Als es Abschied nehmen heißt, sind wir alle ein bisschen traurig, aber bald ist die Taufe der zwei Brüder geplant, und so gehen wir davon aus, dass wir uns in vier Wochen wiedersehen.





























