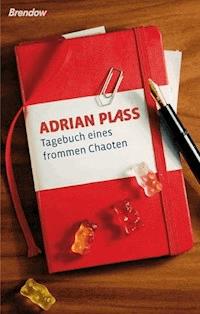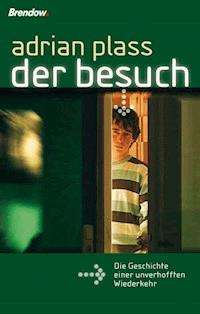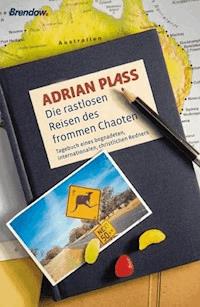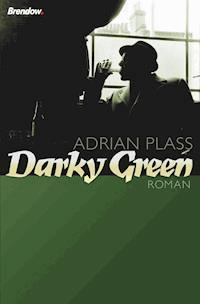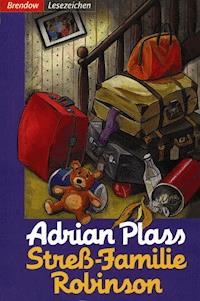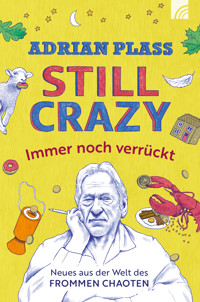
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Adrian Plass, der erfolgreiche Bestsellerautor des "Tagebuch eines frommen Chaoten", ist zurück: mit einer Auswahl von Geschichten, Gesprächen und Gedichten, die geistliche Weisheiten mit echtem englischem Humor verbinden. Mit spitzem Stift, viel Humor, Liebe und einer Prise Selbstironie greift der britische Bestsellerautor Adrian Plass aktuelle Themen auf und reflektiert sie aus der Sicht und mit der "Weisheit" des Alters. Sein Schreibstil ist unterhaltsam, voll britischem Humor, in dem Leser die Handschrift der "Tagebücher eines frommen Chaoten" wiedererkennen werden. "Still Crazy" wirkt wie das Vermächtnis eines gealterten "Chaoten", den die letzten Jahrzehnte mit all ihren Krisen und Herausforderungen weiser und noch liebevoller gemacht haben - aber auch kompromissloser und frecher. Ob es um die Paradoxien und Widersprüche des Glaubens und der Kirche geht oder um die überraschenden Segnungen des Lebens - diese Textsammlung regt zum Nachdenken an und ermutigt gleichermaßen. Ein Buch, das von einem wunderbaren Humor und einem tiefen Glauben an einen liebenden Gott geprägt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adrian Plass
Still Crazy
Immer noch verrückt
Neues aus der Welt des
Frommen Chaoten
Adrian Plass (geb. 1948) ist ein britischer Autor und Redner. Seine populärsten Bücher sind die „Tagebücher eines frommen Chaoten“ eine humorvolle, fiktive Satire auf das christliche Leben, die sich weltweit über eine Million Mal verkauft hat. Er hat vier erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau im County Durham (UK).
Die zitierten Bibelverse sind folgenden Übersetzungen entnommen:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
BasisBibel, © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Originaltitel: „Still Crazy: Love, laughter and tears from the world of the Sacred Diarist“. Die englische Ausgabe erschien 2022 bei Hodder & Stoughton, einem Unternehmen von Hachette UK. Copyright © Adrian Plass, 2022
Aus dem Englischen übersetzt von Christian Rendel
Deutsche Ausgabe:
© 2024 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Lektorat: Stefan Loß
Umschlagillustration: Billy J (Ageny Rush)
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul
Satz: Brunnen Verlag GmbH
Druck: CPI Books GmbH, Leck
ISBN Buch: 978-3-7655-2183-6
ISBN E-Book: 978-3-7655-7867-0
www.brunnen-verlag.de
Dieses Buch ist Ken und Liz gewidmet, unseren Partnern und Freunden, die mit uns durch schöne und schwere Zeiten gegangen sind und durch pandemische Dürrezeiten.
Und ebenso unserer wunderbaren Gemeinschaft in der West Auckland Vineyard Church, die uns durch diese schwierigen Zeiten eine echte Gemeinde geblieben ist.
Inhalt
Einführung
1.
Es gibt noch einiges zu sagen
2.
Weiter gehts
3.
Adrian Plass und das Sommerfestival
4.
Alle Menschen groß und klein
5.
Gesegnet sei Scargill
6.
Fragen von Leben und Tod in Zeiten der Pandemie
7.
Albernheit vergeht nicht
8.
Die Schatten der Schatten
9.
Liebe ist Grund zum Leben
Epilog
Einführung
Still Crazy – Immer noch verrückt. Also, was dieses Buch betrifft, wer genau ist da immer noch verrückt? Auf den wichtigsten Kandidaten komme ich gleich zu sprechen. Der andere bin ich. Verrückt genug, jeden Weg einzuschlagen, auf dem man womöglich Gottes Witterung aufnehmen oder gar einen Blick auf ihn erhaschen könnte, sind viele, aber vielleicht wird dieser Hang bei mir noch verstärkt durch die Art, wie ich gestrickt bin. Was ich damit meine? Zur Erklärung muss ich Ihnen zuerst ein etwas bizarres Geständnis machen.
Ich hatte schon immer Spaß daran, Dinge auf meinem Kopf zu balancieren. Das heißt, „Spaß“ ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Über die Jahre bin ich immer neugieriger darauf geworden, wie weit ich es wohl damit bringen könnte, was das Gewicht, die Höhe und die Vielfalt der balancierten Gegenstände angeht.
Was das für Dinge sind, die ich balanciere? Die Liste ist lang und wächst ständig. Darunter sind Teller, Schüsseln, Stühle, Haustiere (mit eher mäßigem Erfolg), umgedrehte Couchtische, zerbrechliche Deko-Gegenstände (womit ich beim Publikum zwar wenig Beifall, aber dafür umso größere Bestürzung ernte), große, schwere Nachschlagewerke in Stapeln unterschiedlicher Höhe, Flaschen, Holzbretter und riesige Blumentöpfe.
Warum ich das mache? Abgesehen von dem unwiderstehlichen Drang, mich in Sachen Höhe und Gewicht immer mehr zu steigern, liegt ein Schlüssel in den eben erwähnten zerbrechlichen Deko-Gegenständen. Es bereitet mir ein schwer erklärliches Vergnügen, Leute zu erschrecken und womöglich in leichte Panik zu versetzen, wenn sie ahnungslos ein Zimmer betreten und mich bei einer lautlosen, bizarren und möglicherweise katastrophale Folgen nach sich ziehenden Beschäftigung antreffen.
Eines Tages war es schließlich so weit, dass meine Frau Bridget ins Wohnzimmer kam und zwei oder drei Minuten lang mit mir redete, ohne erkennbar Notiz davon zu nehmen, dass ein umgedrehter dreibeiniger französischer Melkschemel unsicher mitten auf meinem Kopf balancierte.
Sie behauptete, es liege daran, dass sie sich an mein seltsames Verhalten so sehr gewöhnt hatte, dass so ein französischer Melkschemel kaum noch der Rede wert sei.
Das gab mir zu denken, und mir wurde klar, dass ich meinen Einsatz erhöhen musste.
Eines Morgens ein paar Tage später, als die Radiosendung beinahe zu Ende war, die Bridget sich, wie ich wusste, gerade im Wohnzimmer anhörte, setzte ich mich in der Küche auf einen Hocker und platzierte einen lächerlich großen Porzellanteller auf meinem Kopf. Mitten auf den Teller stellte ich eine entkorkte, noch zu drei Vierteln gefüllte Flasche Rotwein.
Wer je mutig oder dumm genug war, so etwas zu versuchen, weiß, dass die Fehlertoleranz unter solchen Bedingungen wahrscheinlich zu winzig ist, als dass man sie beziffern könnte. Nachdem ich für meinen Teller und meine Flasche genau die richtige, ausgewogene Position ermittelt hatte, musste ich meinen Rumpf vollkommen stillhalten, während ich mich an die furchterregende Aufgabe machte, meine beiden Hände Millimeter für Millimeter in meinen Schoß sinken zu lassen.
Danach kam es darauf an, in statuesker Reglosigkeit zu verharren, bis Bridget kam.
Minuten vergingen. Ich begann mich schon zu fragen, wie lange ich wohl noch überleben könnte, ohne mich zu bewegen oder wenigstens tief Luft zu holen, als ich aus dem Augenwinkel in Richtung des Fensters zu unserem Garten eine leichte Bewegung bemerkte. Mittels übermenschlicher Körperbeherrschung drehte ich, Zoll um hart erkämpften Zoll, meinen Rumpf herum, bis ich in den Garten schauen konnte.
Durchs Fenster beobachtete mich ein Mann. An einer seiner Hände baumelte ein Maßband. Sein Gesicht war zu einer Maske völliger Verständnislosigkeit erstarrt. Ich kannte ihn. Er hieß Tim, und wir hatten ihn gebeten, an diesem Tag vorbeizukommen und das Aufmaß für eine nötig gewordene Reparatur an unserem Gartenschuppen vorzunehmen.
Tim und ich starrten uns lange durch die Fensterscheibe an. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde, obwohl es nur ein paar Sekunden gewesen sein können. Dann wandte er sich abrupt ab und machte sich daran, mit größter Sorgfalt und Konzentration den Teil des Schuppens zu vermessen, der keiner Reparatur bedurfte.
Meine Beziehung zu Tim war danach nie wieder dieselbe. Über jenen Blickkontakt verlor keiner von uns je ein Wort, aber wann immer wir uns trafen, glaubte ich, eingegraben in seine grundehrlichen Gesichtszüge, eine Frage zu sehen, die weder unverfänglich zu stellen noch zufriedenstellend zu beantworten war. „Warum hast du mit einem riesigen Teller und einer offenen Flasche Wein auf deinem Kopf reglos in deiner Küche gesessen?“
Natürlich wäre Tim nicht allein damit gewesen, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man diese Frage formulieren könnte. Mit Bridget hätte er über dieses Thema ein angeregtes Gespräch führen können.
Ich erstatte diesen Bericht hier aus zwei Gründen. Erstens ist er wahr. Zweitens steht er beispielhaft für eine grundlegende Eigenschaft meiner Persönlichkeit – für einen schrägen Blickwinkel, der sich in meinem Glauben, meinem Schreiben, meinem öffentlichen Reden und meinen privaten Gesprächen bemerkbar macht. Ginge es ums Autofahren, so würde ich es vielleicht als ein intensives Verlangen beschreiben, die merkwürdigen, lustigen, verwirrend sinnlosen kleinen Seitenstraßen zu erkunden, für die wir im Allgemeinen nie Zeit haben.
Mein zweiter Kandidat für das Etikett „verrückt“ wäre – Gott. Ich möchte – mit all der tiefen Demut, für die ich allenthalben so sehr bewundert werde – behaupten, dass Jesus in den Geschichten, die er erzählte, und in seinem Umgang mit Menschen und mit Gruppen mit ebensolch einem schrägen Blickwinkel ausgestattet (oder soll ich sagen gesegnet?) war. Wie er Gedanken auf den Kopf stellte, wie er unerwartete Wege einschlug, auf denen nie zuvor jemand gegangen war, wie er sich weigerte, sich von den zu falschen Fakten geronnenen Annahmen und Mutmaßungen anderer einfangen zu lassen: All das sind Neigungen und Talente, mit denen ich es niemals aufnehmen könnte; aber ich kann zumindest danach streben.
Diejenigen, die die Kirche lieben, und vermutlich auch die, die das nicht tun, würden es schwierig finden, der Behauptung zu widersprechen, dass ein radikaler Perspektivenwechsel notwendig ist.
Muss man tatsächlich verrückt sein, um so etwas zu versuchen? Genau genommen nicht, aber ich bin Zeuge dafür, dass man sich im Zuge dieses Unterfangens so manchen verdatterten Blick einfängt.
Es gibt immer neue und bisweilen verblüffende Dinge zu entdecken. Bridget wies mich kürzlich darauf hin, dass die ersten Worte aus dem wohl bekanntesten Vers des Neuen Testaments, Johannes 3,16, an die unerlöste Welt gerichtet sein müssen. Eigentlich offensichtlich, oder? Vielleicht aber auch nicht.
Als ich mir mit diesem Gedanken im Hinterkopf den Rest des Verses durchlas, fiel mir noch etwas auf. Sie können selbst nachprüfen, ob das Argument schlüssig ist, aber mir kam der Gedanke: Wenn Jesus imstande war, Versuchungen nachzugeben (und ich würde sagen, wenn nicht, dann würde alles seinen Sinn verlieren), dann hat Gott seinen eingeborenen Sohn nicht nur gegeben, er hat ihn aufs Spiel gesetzt.
Viel Glück beim Kopfzerbrechen über die kosmische Logik hinter dieser Tatsache, aber ich glaube, dass es so ist. Ich habe versucht, das Flattern, das diese Entdeckung in mir auslöste, einzufangen und in einen Käfig aus Worten zu sperren. Man könnte ihn auch ein Gedicht nennen. Richtig fertig ist es noch nicht, aber das Gefühl ist da. Es geht so: Und so lade ich Sie ein, mich auf dieser Reise entlang unentdeckter Pfade und vergessener Seitenwege zu begleiten und nach diesem einen Ort, dieser einen Sache, dieser einen Person zu suchen.
Johannes 3,16 – der Vers, den wir alle zu kennen glauben
So sehr hast du die Welt geliebt,
nicht die erlöste Welt,
nicht die gute Welt,
nicht die böse Welt,
definitiv nicht die einzige Sekte, die jemals in den Himmel
kommen wird,
und schon gar nicht die Sekte, die den Himmel nur
durch die übermäßige Gnade meiner Wenigkeit erreicht,
nicht die bekleidete Welt,
nicht die nackte Welt,
nicht die hungrige Welt,
nicht der Planet der Fettsäcke.
Nein, die Welt, die du liebtest, so wie sie war,
ist immer noch die Welt, die du liebst,
so wie sie ist,
so wie wir sind.
Ich bin es,
so wie ich bin.
Also hast du (mit bedauernswerter Geschmacklosigkeit für
jemanden, der so kreativ ist) diese riesige Ansammlung
unförmiger Knollen geliebt,
einschließlich übrigens auch derer unter uns, die sich in
Grund und Boden schämen, und das zu Recht,
einschließlich ganz sicher auch derer unter uns, die sich in
Grund und Boden schämen, und das wirklich zu Unrecht,
hast du uns so sehr geliebt,
liebst du uns so sehr,
dass du alles gegeben hast und immer noch gibst, was nötig
ist, damit so viele wie möglich fröhlich oder auch ängstlich
murmelnd mit dir in Richtung Ewigkeit ziehen.
Um ehrlich zu sein, an diesem Punkt kann der Verstand
ächzend zum Stillstand kommen,
aber mein Herz tut das nicht.
Mein Herz marschiert weiter wie ein vom Regen durchnässter
Fußballer aus Liverpool,
weil ich glaube, dass ich gerade erst anfange, es zu kapieren.
Du hast die ganze unerlöste Welt so sehr geliebt,
dass du so verrückt warst, deinen einzigen, geliebten Sohn
aufs Spiel zu setzen.
Du hast ihn riskiert.
Riskiert.
Das war mir nicht klar gewesen.
Vergib mir.
Danke.
Ich danke dir sehr.
Und so lade ich Sie ein, mich auf dieser Reise entlang unentdeckter Pfade und vergessener Seitenwege zu begleiten und nach diesem einen Ort, dieser einen Sache, dieser einen Person zu suchen.
Unterwegs gibt es allerhand zu lachen. Es werden auch Tränen fließen. Vielleicht fühlt es sich manchmal ein bisschen halsbrecherisch an, aber die Risikofreude scheint ein Wesenszug Gottes zu sein. Ankommen werden wir auf jeden Fall.
1.Es gibt noch einiges zu sagen
In unserer Familie sind wir alle Fans der Traveling Wilburys. Das erste Album dieser Band nahmen wir mit in den Urlaub, als unsere Kinder noch klein waren, und nach einer Weile kannten wir die Songs alle fast auswendig. Erst viele Jahre später wurde eine Zeile aus einem der Stücke zu einem etwas nervigen Ohrwurm: „… even if you’re old and grey … you still got something to say“ („Auch, wenn du alt und grau bist … du hast immer noch etwas zu sagen“). Mit der Zeit lösten diese beiden Textfetzen eine bockige Abwehrhaltung in mir aus. Ich weiß auch, warum. Ich ging auf die siebzig zu, und obwohl mein Körper stellenweise schon deutliche Abnutzungserscheinungen zeigte, machte mir der ganze kreative Kram noch genauso viel Spaß wie eh und je oder sogar noch mehr. Einfach nur Nachdenken und Träumen gehörte schon immer zu meinen liebsten Hobbys. Diese Tatsache zu akzeptieren und darüber zu reden hat mir sehr gutgetan. Ob das, was aus diesen vielen Grübeleien hervorgegangen ist, irgendeinen Wert hat – ach, wer weiß das schon?
Warum in aller Welt sollte ich denn nichts mehr zu sagen haben, wenn ich alt und grau bin? Meine Güte! Kommt mir bloß nicht mit solchen herablassenden Andeutungen wie: Es sei ja nicht gänzlich unmöglich, dass in meinem schwachsinnigen Gebrabbel aus dem Ohrensessel der eine oder andere Gedanke zu finden sein könnte, der es Wert war, bedacht zu werden. Jetzt reden wir mal Klartext …!
Ich bin hin und wieder ausgesprochen kindisch, aber allmählich werde ich reifer. Mag sein, dass das Alter Bridget und mich eingeholt hat, aber kampflos ergeben werden wir uns nicht. Tatsächlich haben wir noch allerhand zu sagen. Also, ich jedenfalls, aber immer häufiger passieren Dinge, die mich daran hindern, meine wunderbaren Worte des Glaubens und der Weisheit weiterzugeben. Hier ist ein Beispiel.
Überschwemmungen und Jesusnachfolge
Eines Morgens hatten Bridget und ich uns darauf geeinigt, dass ich mich hinsetzen und einen Brief für meine Website schreiben sollte. Es war ein guter Tag dafür, denn sie sollte an diesem Morgen eine neue ehrenamtliche Aufgabe in unserem Gemeindecafé antreten, und ich hatte ausnahmsweise einmal nicht lauter ärgerliche liegengebliebene Kleinigkeiten im Haus zu erledigen. Um zehn Uhr setzte ich mich im Wohnzimmer an den Tisch, klappte meinen Laptop auf, öffnete eine neue Datei und nahm einen Schluck Kaffee. Es gab keinen Anlass dafür, mit irgendwelchen Verzögerungen oder Unterbrechungen zu rechnen.
Ich bin sicher, Gott würde sagen, dass er mir eine ganze Menge durchgehen lässt. Aber das tue ich bei ihm ja auch. Ich lasse ihm vieles durchgehen. Ich bin durchaus bereit – wenn auch nicht gerade froh darüber –, manche Fragen vorläufig auf sich beruhen zu lassen, wie etwa die Frage der Prädestination und des freien Willens und die Frage, warum ein allwissender und allliebender Schöpfer das menschliche Leid zulässt. Oder die Frage, warum es sein kann, dass – wie der Verfasser des ersten Johannesbriefs schrieb und wie wir auf der Weltbühne in Echtzeit beobachten können – während ich dies schreibe, der Teufel die Welt beherrschen darf.
Da sollte man doch meinen, der Allmächtige hätte meine geduldige Nachsicht in diesen Fragen belohnen können, indem er mir einen erfahrenen Engel schickte, der dafür gesorgt hätte, dass ich an diesem Vormittag zum Arbeiten kam, oder? Ich kann nur eins sagen – wenn da ein Engel war, dann muss er wohl gerade so etwas wie ein himmlisches Schnupperpraktikum gemacht haben. Ich hatte gerade mal zwei Wörter getippt, als die Katastrophe über mich hereinbrach.
Auf der anderen Seite des Tisches, an dem ich saß, stand eine hohe, schlanke Vase mit frischen Blumen. Eben noch war sie voller Wasser gewesen. Jetzt plötzlich nicht mehr. Vielleicht war ich mit dem Knie ans Tischbein gestoßen. Was auch immer die Ursache war – die Vase rutschte plötzlich von der Untertasse, auf der sie stand, und kippte schwungvoll quer über den Tisch in meine Richtung. Das Glas blieb zwar heil, aber das gesamte Wasser ergoss sich über die hölzerne Tischplatte wie ein Tsunami. Alles, was auf dem Tisch herumlag, verwandelte sich in kleine Inseln in einem Meer aus abgestandenem, nach Blumen duftendem, verfärbtem Wasser.
In höchster Panik brachte ich erst einmal meinen Laptop in Sicherheit. Dann rannte ich, so schnell es mir meine siebzig Lenze erlaubten, in die Küche und schnappte mir den Rest unserer gigantischen Küchenrolle (ich liebe diese extra-großen Küchenrollen). Sekunden später rettete ich vor allem anderen mein Handy und trocknete es ab, dicht gefolgt von ein paar bedruckten Seiten, einer pinkfarbenen Plastikdose mit USB-Sticks und meinem neuen schwarzen Brillenetui. Das Wasser war immer noch da. Es war eine Menge. Keine Übertreibung. Eine richtige Flut.
Auch durch die wiederholte Anwendung von Papierküchentüchern war das Problem nicht einmal ansatzweise in den Griff zu bekommen. Und nicht nur das, sondern da ich nichts zur Hand hatte, worin ich die durchnässten Tücher hätte entsorgen können, blieben sie einfach auf dem Tisch liegen und gaben zu meiner Verzweiflung das Wasser, das sie doch eigentlich dauerhaft hätten absorbieren sollen, wieder ab. Unter Ausstoßung einiger ausgesprochen ungezogener Wörter stapfte ich zurück in die Küche, um einen Behälter zu holen.
Ein paar Minuten voller fieberhafter Aktivität später war die Küchenrolle verbraucht, und das Ergebnis bestand in einer merkwürdigen, formlosen Masse Pappmaschee in einer großen Porzellanschüssel.
So weit, so gut. Nur stand der Tisch immer noch unter Wasser.
Ein letztes Mittel blieb. Nicht zum ersten Mal verfluchte ich den Umstand, dass wir im Erdgeschoss keine Toilette hatten. Zum Märtyrer zu werden ist immer eine Möglichkeit in einem engagierten Christenleben, aber ich verstehe nicht, warum man, bevor es dazu kommt, auch noch dauernd Treppen rauf- und runterstiefeln sollte.
Immerhin funktionierte es. Mit Toilettenpapier ließ sich die Sache schließlich beheben. Mindestens eine halbe Rolle war nötig, bis die polierte Holzoberfläche wieder völlig trocken war. Ich setzte mich neben die Schüssel, in der sich nun ein Berg durchnässter, triefender Papiertücher zu grotesker Höhe auftürmte, und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Also, alles auf Anfang.
Genau in diesem Augenblick klingelte das Telefon.
Einen Augenblick lang war ich nur eine Winzigkeit davon entfernt, mich in Basil Fawlty1 zu verwandeln. Aber es war nichts Schlimmes. Der Anruf brachte eine gute Nachricht von jemandem, den ich sehr mag. Vielleicht unterstreicht mein Missgeschick mit der Überschwemmung, so ärgerlich es war, ja nur die Tatsache, dass wir so sorgfältig planen können, wie wir wollen – was als Nächstes passiert, haben wir nie vollständig in der Hand. Und das ist zufälligerweise ziemlich genau das Thema, über das ich hatte schreiben wollen.
Bridget und ich sind uns heute in einem Punkt absolut einig, was dieses seltsame Unterfangen angeht, Nachfolger Jesu sein zu wollen. Egal, wie sorgsam, engagiert und unter Gebet wir unser Leben planen, es ist schier unmöglich, zu wissen, was Gott als Nächstes tun wird oder was wohl unser Beitrag zu seinem Wirken sein mag. In der Vergangenheit hat uns das hin und wieder entmutigt und geärgert. Vielleicht waren wir darauf aus, den Prozess des Lebens als Christen, was immer das überhaupt heißen mag, selbst voranzutreiben und zu steuern. Heute fragen wir zwar immer noch ständig danach, was eigentlich vorgeht und was unsere Rolle dabei sein könnte, aber es erwächst uns ein tiefes und wachsendes Gefühl der Befreiung aus der Entscheidung, Gott die Kontrolle zu überlassen, zumal mehr Interessantes und Unerwartetes zu passieren scheint, wenn er die Zügel in die Hand nimmt. Immerhin erzählen wir den Leuten schon seit Jahren, dass Gott unser Leben lenkt, und schaffen es sogar beinahe, daran zu glauben. Also wird es wohl Zeit, dass es wahr wird.
Eins muss ich noch loswerden. Ich fühle mich getröstet und ermutigt durch die Hingabe, mit der manche Vertreter der Christenheit ein Gebot Jesu aus dem dreizehnten Kapitel des Johannesevangeliums widerspiegeln und ausleben. Es lautet:
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander schikaniert, misshandelt und vernachlässigt, wie ich euch schikaniert, misshandelt und vernachlässigt habe, damit auch ihr euch schikaniert, misshandelt und vernachlässigt.
Okay, mag sein, dass ich das ein bisschen falsch in Erinnerung habe, aber Tatsache ist, dass wir in letzter Zeit einer Menge Christen begegnet sind, die sich mit Verletzungen und Ratlosigkeit herumschlagen, weil sie von Leuten, die eigentlich ihre Brüder und Schwestern sein sollten, ausgegrenzt, unterdrückt oder manipuliert wurden.
Das Knifflige dabei ist, dass in vielen Fällen die Urheber solcher Verletzungen wahrscheinlich in bester Absicht gehandelt haben. Wir neigen allzu leicht dazu, mit Visionen begeistert voranzustürmen, die optimistischen menschlichen Plänen entspringen, denen alle zustimmen – außer dem Heiligen Geist. Wenn wir dann aber innehalten und hinter uns schauen, kann es sein, dass wir Leichen auf dem Weg liegen sehen. Ich bin sicher, dass ich selbst diesen Fehler selbst auch schon gemacht habe. Gott sei Dank, dass er so ein warmes und wirkungsvolles Mittel bereitgestellt hat, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Gott ist sehr nett, wenn auch äußerst schwer zu verstehen, und er sucht nach Leuten, die sich mit ihm hinter den Tresen stellen. Nach all den Jahren sind wir ziemlich sicher, dass dazu nur eine einzige Qualifikation erforderlich ist: die Bereitschaft, da zu sein und zu tun, was er uns sagt.
Also stemmte ich mich der Flut entgegen, bekam den Tisch wieder trocken, mäßigte meine Schimpfwörter und schrieb meinen Text, wie ich ihn mehr oder weniger geplant hatte. Ein Friede kam über mich. Ich tat mein Bestes, ihm nicht zu misstrauen.
Und was ist mit mir?
Jetzt in unserem vorgerückten Alter haben wir gelegentlich das Gefühl, dass junge Leute aus Höflichkeit ihre Neugier zügeln, wenn es um die Frage geht, wofür in aller Welt es sich für uns lohnen könnte, morgens aus dem Bett zu steigen. Andere sind weniger höflich.
Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren als rotwangiger Jüngling von Anfang fünfzig mit dem Bus unterwegs war. Außer mir saßen noch zwei andere Leute in diesem angenehm solide gebauten öffentlichen Verkehrsmittel des späten zwanzigsten Jahrhunderts. Sie saßen auf dem Doppelsitz mir gegenüber. Der eine war ein beleidigt dreinschauender Kleiderschrank von einem jungen Mann, den ich auf neunzehn oder zwanzig schätzte. Neben ihm quetschte sich eine attraktive junge Frau ungefähr im selben Alter. Im strikt geografischen Sinne war sie offensichtlich mit dem jungen Mann zusammen, aber der gehetzte Ausdruck in ihren Augen und einige zuckende Bewegungen, die für mich so aussahen, als ob sie innerlich ihr Fluchtmanöver durchspielte, vermittelten mir den Eindruck, dass der Gedanke, gerade ganz woanders zu sein, ihr zumindest nicht unsympathisch war.
Nach einigen Minuten der Grabesstille kam der Junge wohl zu dem Schluss, es sei an der Zeit, ein Lebenszeichen von sich zu geben und die Mitbewohnerin seiner kleinen Welt mit einem geistreichen Aufblitzen seiner Schlagfertigkeit zu beglücken. Er hob den Kopf.
„Wenn isch morgen uffwach“, sagte er mit eindringlicher Melancholie, „und bin uff einma fuffzich, weißte, was isch dann mache tät?“
Sie schob sich die Haare aus dem Gesicht und ihr Gesicht weg von seinem und antwortete ohne nennenswerte Regung: „Nein, keine Ahnung. Was würdest du machen?“
„Umbringe würd isch misch.“
Das Mädchen drehte sich zu ihm um und starrte ihn einen Moment lang an. War da auf einmal etwas mehr Leben in ihrem Gesichtsausdruck? Mischte sich da eine Spur von Sehnsucht hinein? Ich glaubte, erraten zu können, was sie dachte – vielleicht sogar, welche Worte auszusprechen sie sich in diesem Moment verkniff …
„Ich wünschte, du wärst fünfzig.“
Starker Tobak, falls ich richtig lag. Aber ich konnte es ihr nachfühlen, und ich muss gestehen, dass auch die Perspektive des jungen Mannes mir nicht ganz abwegig erschien. An seiner Stelle hätte ich vielleicht in Hörweite eines Menschen, der allem Anschein nach bereits in den Höllenschlund fünfzigjähriger Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gestürzt war, meine Meinung nicht ganz so öffentlich kundgetan. Aber ich weiß noch, dass ich zu dieser Zeit in meinen Fünfzigern die Möglichkeit eines guten Lebens nach dem Überschreiten der siebzig äußerst agnostisch beurteilte. Jetzt, wo ich meinen dreiundsiebzigsten Geburtstag hinter mir habe, stelle ich fest, dass es durchaus noch vieles gibt, was mir Spaß macht. Danke der Nachfrage.
Tee zum Beispiel. Wir lieben Tee. Ehe ich fortfahre, lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen, dass ich nicht von der offenbar allgemein verbreiteten Auffassung spreche, die meisten Probleme älterer Menschen seien mit einer Tasse Tee zu lösen, und so ziemlich alle, wenn man noch einen Keks hinzugibt. Das ist nicht der Fall.
Tee ist eine der großartigsten und nachhaltigsten Schöpfungen Gottes, und auch das mit den Keksen hat er sehr gut hingekriegt. Beides haben Bridget und ich schon immer sehr genossen. Im Lauf der Jahre hat Tee uns manches Mal den Verstand und beinahe auch das Leben gerettet. Okay, Gin and Tonic in den richtigen Gläsern mit Zitronen- und Limonenscheiben oder auch ein Glas Lagavulin-Whisky, pur genossen, würden es im Zweifelsfall auch tun, aber Leute, die – wie jenes Mitglied der Traveling Wilburys, dessen Namen ich nicht genannt habe – uns reiferen Mitbürgern gegenüber eine gewisse Herablassung an den Tag legen, werden uns wohl kaum mit solch exquisiten Stöffchen bewässern, nur damit wir gesellschaftlich sediert sind.
Es stimmt, es gibt kaum etwas, das so sehr anheimelt wie der Duft von frisch aufgebrühtem Tee, aber es ist reiner Zufall, dass ANHEIMELT ein Anagramm von ALTENHEIM ist. Und wann es dafür Zeit ist, das entscheiden wir zusammen mit Gott. Vielen Dank.
Ein trauriger Begleitumstand dieser Lebensphase, den uns auch der beste Tee und die köstlichsten Kekse nicht schmackhaft machen können, sind die relativ häufigen Todesfälle unter Gleichaltrigen und, was noch beunruhigender ist, unter Freunden, Angehörigen und Prominenten, die mehrere Jahre jünger sind als wir. Den Tod anzunehmen ist eine seltsame Angelegenheit, ein vorweggenommener und unvermeidlicher Schock, wie ein Zug, der in die Endstation rollt. Ich mag das nicht.
Manche Leute behaupten ja, die Aussicht auf den Tod mache ihnen gar nichts aus. Mir geht es nicht so. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte am Leben bleiben. Ein oder zwei Mal in meinem Leben haben Freunde, die keine Christen sind, Bemerkungen gemacht wie: „Ihr Christen habt natürlich kein Problem mit dem Sterben, oder? Ihr freut euch einfach darauf, in die Herrlichkeit oder den Himmel einzugehen oder wie immer ihr das nennt.“
Besonders ein Freund machte kein Hehl aus seiner Skepsis, als ich ihn darauf hinwies, dass es Jesus im Garten Gethsemane offensichtlich vor den grässlichen Ereignissen graute, die ihm noch bevorstanden. „Ich bin verzweifelt und voller Todesangst“, sagte er sogar. Und er flehte Gott an, wenn es möglich sei, diesem ganzen Albtraum mit der Kreuzigung entfliehen zu dürfen. Wenn irgendjemand imstande gewesen sein müsste, sich die „Herrlichkeit“ vorzustellen, dann war das doch Jesus, oder?
Mein Freund war konsterniert. Er kenne sich gut in der Bibel aus, sagte er, aber daran könne er sich nicht erinnern. Er wollte nachschlagen und der Sache auf den Grund gehen. Ich weiß bis heute nicht, ob er das je getan hat.
Erstaunlich vielen Gläubigen und den meisten Nichtgläubigen will eine Aussage einfach nicht in den Kopf gehen, die sich einfach anhört, es aber niemals ist.
Gott wurde Mensch.
Der Mensch Jesus kannte alle Schwächen und Stärken, Freuden und Tragödien eines wahren Menschen. Und zugleich kannte er auf für uns größtenteils unerklärliche Weise auch die Erfahrung, der wahre Gott zu sein, der in diesem wahren Menschen wohnte.
Sonnenklar, was? Aber so ist es. Und deshalb war er hin- und hergerissen. Und deshalb sind wir das auch. Wir erben die Bürde und den Segen. Nirgendwo ist die Rede davon, dass wir eine Wahl hätten.
Mit meiner menschlichen Begrenztheit kann ich mir nicht vorstellen, wie ich ohne den Geist, der in mir zu sein scheint, der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft begegnen sollte. Ich bin höchst interessiert am Himmel, was immer das am Ende sein mag, solange dazu nicht gehört, für die nächsten zehn Millionen Jahre unaufhörlich „Shine, Jesus, Shine“ singen zu müssen. Gleichzeitig liebe ich diese Welt und mein Leben und möchte sie festhalten, solange es menschenmöglich (oder geistlich möglich) ist.
Hier ist ein Gedicht, das ich vor einigen Jahren schrieb, als ich mir die ehrgeizige Frage stellte, wie die Kombination von Mensch und Gott sich im Bewusstsein des Menschen namens Jesus angefühlt haben mag. Es heißt „Was aber wird aus mir?“.
Ja, er wird wieder auferstehen.
Aber was wird aus mir?
Wenn auch der Tod auf schwarzen Schwingen niedergeht,
um mich zu holen,
Und gezackte Schatten auf die Maiglöckchen wirft,
Auf milchig monderhellte Meere,
Sonnenaufgangsherrlichkeit,
Sonnenuntergangsflammen,
Pfirsiche und Perlen an den Himmeln Galiläas,
Die Kühle einer Frauenhand,
Kinderaugen,
Das Scheuern groben Holzes auf der Haut,
Licht im Blick der Menschen, die durch ein
Glaubenswunder sehen,
Hören, gehen, sprechen konnten,
Entdeckten, dass die Schrunden ihrer Haut verschwunden
sind, die Glieder unverletzt und rein.
Sabbatspaziergänge, die sich durch hügelige Weizenfelder
schlängeln,
Das Plaudern und das Lachen meiner Freunde
In ihrer süßen Unbedarftheit.
Der Duft der Fische auf dem Feuer,
Der Ruf zum Essen;
Alte Geschichten an der Feuerstelle;
Ein guter Wein;
Ein Kuss;
Das liebe, weise Lächeln meiner Mutter;
Die Tränen derer, die mich so sehr liebten,
Weil ich sanft und doch unerbittlich ihre Sünde fortnahm.
Und ich, werde ich wieder auferstehen?
Oh ja, der Menschensohn muss auferstehn und wieder
leben.
Was aber wird aus mir?
Was ist mit mir?
Ich erinnere mich nicht mehr so genau
Es ist nicht lustig, wenn jemand älter wird und mehr und mehr sein Gedächtnis verliert. Bridgets Vater (und als Folge davon auch ihre Mutter) litten in seinen letzten Jahren unter seiner einsetzenden schweren Demenz. Bridget und ich sind bisher davon verschont geblieben, aber jede Woche ergeben sich mehrere Male die lächerlichsten Gespräche zwischen uns, die einem qualvoll verschlungenen Pfad durcheinandergeratener Erinnerungen folgen und irgendwann unweigerlich an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr wissen, was wir uns ursprünglich eigentlich in Erinnerung rufen wollten. Wie wäre es mit einer kleinen Kostprobe dieser zeitraubenden verbalen Exkursionen? Bitte sehr.
A: Mit wem hast du eigentlich vorhin telefoniert?
B: Was? Ach, das war – oh nein! Jetzt habe ich den Namen vergessen! Die junge Frau aus – du weißt schon – dieser Stadt. Wie hieß sie noch? Die Stadt, wo wir vor – wo immer das auch war.
A: Du meinst die Stadt vor Bromley?
B: Nein, nein! Noch vorher. Wo wir dieses Dingsda hatten – nun sag schon! –, wo wir immerzu Ärger hatten mit all den –
A: Ach soooo! Du meinst die Frau, von der wir immer gesagt haben, dass sie aussieht wie – wie hieß noch diese Frau, die uns erst so sympathisch war und dann nicht mehr, weil sie – ach, was hatte sie noch getan? Sie hatte sich irgendetwas zuschulden kommen lassen. Stand sogar in den Zeitungen. Das musst du doch noch wissen. Sie hat in dieser Serie mitgespielt.
B: Welcher Serie?
A: Ach komm! Du weißt doch – diese Serie. Die am Anfang in – wo spielte sie noch? Blackpool war es nicht. Die andere Stadt.
B: Ach ja! Da, wo wir damals an so einem verregneten Nachmittag halt gemacht und uns diesen Film angeschaut haben – ach, jetzt komm schon! Den Film mit diesem Typen – so ein langer Lulatsch, hat irgendwas am linken Bein. Du hast immer gesagt, er sieht genauso aus wie der Manager von – aaah!
A: Nein, warte mal, du denkst gerade an – Dingsbums.
B: Dingsbums?
A: Na, den Freund von deinem Vater. Sie kannten sich schon seit Ewigkeiten. Er fuhr so einen – du weißt schon – so einen großen, dicken, wie heißt das noch – so ein Riesending.
B: Ach ja! Der wohnte in der – Moment. Zwei Straßen von deiner entfernt – so eine große, breite Straße mit –
A: Genau! König – König-Sowieso-Straße – so hieß doch auch der Anwalt von dem Bruder deines alten Freundes. Komm schon! Du weißt, wen ich meine. So ein dünner, sehr ernster Typ, mit – so einem Ding im Gesicht. Wollte montags immer nichts essen. Ach nein – jetzt ist es weg.
Pause.
A: Also, mit wem hast du denn nun gerade eben telefoniert?
B: Was? Ach, keinen Schimmer.
Auf Gott warten?
Christen werden mit widersprüchlichen Imperativen überhäuft wie mit Konfetti bei einer Scheidung. Wir sollen Ruhe halten; wir sollen aufopferungsvoll arbeiten. Wir sollen nicht zweifeln, aber Zweifel ist ein wesentlicher Aspekt des Glaubens. Demut ist gut, aber sie kann auch eine verarmte Verwandte des Stolzes sein. In Christus sind wir frei, aber dieses dürfen wir nicht tun, und jenes auch nicht, und schon gar nichts, was auch nur annähernd nach dem aussieht, wobei ich dich gerade erwischt habe. Der Himmel ist ganz bestimmt nicht da oben über uns in der Luft, aber wir glauben auch ziemlich sicher zu wissen, dass er nicht südlich von Neuseeland im Pazifik liegt, also wo ist er denn nun? Wir müssen akzeptieren, dass Adam und Eva wirkliche, lebendige Menschen waren, aber nur in einem mythischen Sinne. Die gute Nachricht ist, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes in Christus; die schlechte Nachricht ist, dass das für uns nicht gilt, wenn wir Ziegenböcke sind, denn dann sind unsere Aussichten für die Ewigkeit eher trüb.
Natürlich wissen wir alle, dass die Wirklichkeit selten einfach ist. Mehrere Dinge können ganz zu Recht wahr sein, obwohl sie einander zu widersprechen scheinen. Das macht ja das Leben und den Glauben und die Person Jesu so faszinierend, und es ist auch der Grund, warum wir Vorsicht und Rücksicht walten lassen müssen, wenn wir die verwickelten Fäden des realen Lebens auseinandersortieren und anderen weitergeben.
Los, streng dich an, aber warte unbedingt erst auf Gott? Es gibt noch eine andere Wahlmöglichkeit zwischen solchen falschen Gegensätzen.
Diese ganze Sache mit dem Christsein beschäftigt mich nun schon seit vielen Jahren. Wenn ich auf diese Jahre zurückblicke, sehe ich viele Dinge, die mich faszinieren. Eines davon ist der Gedanke, eine Beziehung zu Gott zu haben.
Damals, als ich mich auf diese merkwürdige Reise des Glaubens machte, herrschte eine klare und durchaus nicht unausgesprochene Erwartung, vom ersten Tag an eine enge und beglückende, vertraute Nähe zu Gott zu erleben, die für den Rest meines Lebens anhalten würde. Ich wollte, dass es so war, und ich verkündete lautstark, dass es so sei, aber in Wirklichkeit war es nicht so. Natürlich kann ich nur für mich sprechen, aber ich weiß heute, dass ich ein unvollendetes Werk war und bin und dass ich am Anfang wahrscheinlich nicht die leiseste Ahnung davon haben konnte, worauf ich mich da eingelassen hatte.
Über die Jahre hat mich die tiefe Hoffnung getragen, dasselbe bedingungslose „Ja“, das einst einem Verbrecher an einem Kreuz zugesprochen wurde, sei auch mir zugesprochen worden von diesem Jesus, der, soweit ich es als verwirrter Sechzehnjähriger damals ermessen konnte, vielleicht wirklich die Macht hatte, unmögliche Träume wahr werden zu lassen.
Diese Hoffnung ist die Hand, an der mich Gott mein Leben lang unbeirrbar festgehalten hat. Aber vor sechsunddreißig Jahren wurde ein anderer Gang eingelegt. Es begann damit, dass ich inmitten eines abgrundtiefen Versagens zu meiner Verblüffung herausfand, dass Gott nett ist und dass er mich mag. Auf das Mögen kommt es an. Haben Sie etwa Lust auf eine Beziehung, die nur daraus besteht, dass jemand Sie liebt, obwohl er überhaupt nichts Liebenswertes an Ihnen erkennen kann? Das wäre doch keine echte Beziehung, oder? In so einer Beziehung würde man sich nicht anlächeln und Witze machen und ein paar Tränen miteinander weinen. Es wäre eine Beziehung ohne Tiefgang. Es würde keinen Spaß machen. Und auch wenn ich eine bestimmte Form von „Spaß“ nicht leiden kann, weil ihr oft der Humor fehlt – nun, ganz ohne Spaß geht es doch nicht, oder?
Ab und zu widersprechen Leute meiner Aussage, Gott sei „nett“. Das Wort sei zu blass, finden sie. Zu dünn. Gott sei doch viel, viel mehr als das. Sollten wir nicht aus Respekt und Dankbarkeit für das, was er getan hat, in einem ehrfürchtigeren Ton von ihm sprechen? Nun, manchmal ist das angebracht, aber je mehr ich entdecke, wie charmant Gott ist und wie einfallsreich er sich um mich kümmert, desto mehr ist es mir ein Bedürfnis, den Leuten aus tiefstem Herzen zu sagen: „Weißt du, du wirst ihn wirklich mögen, so nett ist er.“
In den letzten zehn Jahren war der Schöpfer des Universums sehr freundlich zu mir. In meinem Leben und meinem Verständnis von mir selbst hat es Veränderungen gegeben, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Außerdem habe ich eine neue, ziemlich aufregende Ahnung davon gewonnen, wie der Heilige Geist in dieser Welt Dinge tut, wenn wir nur aufhören, Sachen anzubieten, die wir nicht haben, und uns stattdessen darauf einlassen, Teil von Plänen zu werden, die wir nicht in Gang gesetzt haben, auch wenn wir uns dabei ein wenig (oder auch sehr) herabgesetzt fühlen. Glauben Sie mir, diese Herabsetzung wird von Zeit zu Zeit nicht ausbleiben.
Vor einer Weile waren Bridget und ich als Referenten auf einer Wochenendtagung. Am Freitagabend stellten wir uns vor und gaben eine kleine Einführung. Aber als wir schließlich zu Bett gingen, war ich nicht sehr optimistisch im Blick auf das restliche Wochenende. Das ist nichts Ungewöhnliches, wie ich gleich hinzufügen muss. In früheren Jahren, als ich noch mehr von mir selbst eingenommen war als jetzt, war ich viel zuversichtlicher. Die Leute lachen immer gerne, und das war mein Ding. Menschen zum Lachen bringen kann jeder, wenn es sein Ding ist. In letzter Zeit haben Bridget und ich uns auf einen Modus für solche Wochenenden geeinigt, der eher auf Lehre und Inspiration abzielt als auf Unterhaltung. Auch wenn wir immer noch unser Bestes tun, um die Leute, zu denen wir sprechen, zum Lachen zu bringen. Wir achten jetzt sehr darauf, Gott nicht ins Gehege zu kommen, damit den Leuten wirklich geholfen werden kann. Die Schwierigkeit für uns besteht allerdings darin, dass dann eben Gott am Steuer ist und wir, auch bei sorgfältigster Planung, nie genau wissen, was er tun wird.
An jenem Freitagabend bat ich Gott, mir einen Traum zu schenken, um mir bei der übrigen Tagung zu helfen. Ob er mein Gebet beantwortet hat? Wer kann das so genau sagen? Ich weiß nur, dass in meinen Träumen in jener Nacht drei verschiedene Leute deutlich dasselbe Wort aussprachen.
Enttäuschung.
Sicher weiß ich nur, dass, nachdem ich das am Samstagmorgen erwähnt hatte, eine Reihe von Leuten zu uns kamen und uns baten, im Zusammenhang mit eben diesem Problem mit ihnen zu beten.
Die Wahrheit ist, dass es eine Menge davon gibt. Enttäuschung, meine ich. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der sich schon einmal gefragt hat, warum die überschwänglichen Verheißungen der Bekehrung sich nie so ganz erfüllt haben. Für manche läuft es wunderbar. So, wie wenn man einen neuen Mantel anzieht. Man schlüpft hinein und kann loslegen. Die Glücklichen. Was ich damit sagen will: Gib nicht auf. Ich genieße es sehr, dass jetzt etwas anfängt, das sich tatsächlich wie eine echte Beziehung zu Gott anfühlt. Es ist eine Zuneigung. Mehr als eine Zuneigung. Es brauchte so lange, um sich zu entwickeln. Manchmal ist es zerbrechlich, und ich habe Angst. Hin und wieder ist es stark, besonders, wenn ich es nicht zu sehr analysiere.
Merken Sie sich das: Es gibt nur ein Zeugnis, das es wert ist, der Welt präsentiert zu werden. Nämlich ganz einfach die Wahrheit. Wo immer wir stehen, was immer mit uns passiert oder nicht passiert, wie viel oder wie wenig auch unsere Erfahrung mit der anderer Leute übereinstimmt, egal an welchem Punkt des Spektrums zwischen Elend und Freude wir uns befinden – wir müssen es aussprechen und darauf warten, dass die Liebe uns aufweckt, uns nährt und uns lehrt, was eine Beziehung zu Gott tatsächlich bedeuten könnte.
Schnellfeuer-Interview
Hin und wieder werde ich um einen Beitrag zu einem Zeitschriftenartikel gebeten, bei dem mehrere Autoren gemeinsam schreiben. Einer dieser Beiträge war ein „Schnellfeuer-Interview“. Kurze Antworten auf kurze Fragen. Ich weiß, als ich noch jünger war, hätte ich mehr Zeit damit verbracht, über solche Aufgaben nachzudenken. Heutzutage gehe ich mit Fragen wie diesen ziemlich ungefiltert um. Hier ist das, was ich dazu geschrieben habe, nur leicht überarbeitet, damit es zumindest einen Anschein von Sinn ergibt. Ich hoffe es zumindest.
Beschreiben Sie sich selbst mit drei Worten.
Gut, schlecht, hässlich.
Welcher Charakterzug stört Sie am meisten an sich selbst?
Übermäßiger Einsatz meines Talents zur Selbstdarstellung.
Welche besonders falsche Vorstellung machen sich Leute von Ihnen?
Dass ich eine gewisse abscheuliche Art von Spaß genieße. Ich muss demütig gestehen, dass ich wahrscheinlich jedes lebende Wesen töten würde, um diese Art von Spaß zu vermeiden.
High Church oder Low Church?
Die Höhe ist mir egal, solange es dort nur keine sorgfältig organisierte Spontaneität gibt.
Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag lang Erzbischof von Canterbury wären?
Mir einen Tag frei nehmen.
Was wollten Sie als kleiner Junge werden?
Erwachsen. Und mit Hayley Mills verheiratet.
Was war der schlimmste Job, den Sie je gemacht haben?
Der einzige echte Job, der mir einfällt, war die Arbeit in einer Fleischfabrik, als ich sechzehn war. Gruselig aus diversen Gründen, die ich hier nicht erwähnen möchte. Fragen Sie nicht. Lassen wir diese schmerzlichen Erinnerungen hinter uns und wenden uns lieber ein paar blöden Witzen aus der Arbeitswelt zu.
Postkartenfabrik. Darüber gibt’s nichts nach Hause zu schreiben. Arbeit für eine Kidnapperbande. Sie mussten mich nach vierzehn Tagen gehen lassen. Job bei einer Kläranlage. Zuerst schien es ein großes Geschäft zu sein, aber nach einer Weile war es nur noch heiße Luft.
Was würden Sie heute machen, wenn Sie kein Christ wären?
Mir allmählich leise Sorgen darüber machen, dass ich biblisch gesehen tot bin.
Wie trinken Sie Ihren Tee?
In England.
Verraten Sie uns ein Geheimnis …