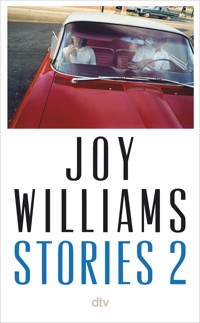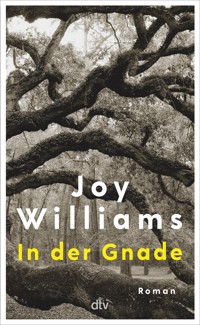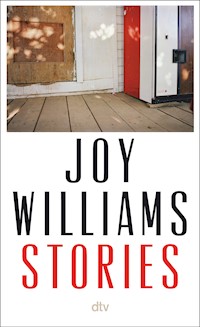
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Joy Williams ist ein Geschenk.« Bernd Ulrich, Die ZEIT »Carls Haut war so rein wie die eines Babys, und er roch rein, wenn auch etwas merkwürdig, nach Cold Cream und Sellerie.« Seite für Seite, Satz für Satz führen uns diese dreizehn Geschichten ins Unvorhersehbare hinein, verzweigen sich in die Tiefe wie Romane: unverwechselbar im Ton, beunruhigend und komisch zugleich. Seit Langem feiert man Joy Williams als eine der Großen der amerikanischen Literatur. Dieser Band beweist ihre absolute Meisterschaft. »Unmöglich, schon beim ersten Lesen all die dunklen, überbordenden Geheimnisse dieser Literatur zu erfassen. Doch mir fehlt der Mut, die Geschichten ein zweites Mal zu lesen.« Bret Easton Ellis »Joy Williams ist einfach ein Wunder.« Raymond Carver »Joy Williams' Prosa erinnert mich daran, wie glücklich ich mich schätzen darf, ein amerikanischer Schriftsteller zu sein.« Don DeLillo »Eine der besten Schriftstellerinnen Amerikas.« Jonathan Franzen »Weltliteratur. Joy Williams wäre durchaus eine Kandidatin für den Literaturnobelpreis.« Denis Scheck »Ein amerikanischer Thomas Bernhard, aber als Frau. Etwas Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen.« Xaver von Cranach, SPIEGEL »Unheimlich wie ein Urwald, auf morbide Weise anziehend und von einer kühlen, schroffen Klarheit nehmen die Storys von Joy Williams mit fast schon obszöner Grandezza für sich ein.« Meike Feßmann, Süddeutsche Zeitung »Eine spektakuläre literarische Entdeckung: Diese Geschichten sind Alptraumgrotesken vom Feinsten.« Thea Dorn, ZDF: Das Literarische Quartett »Das beste Buch des Frühlings ist kein Roman, sondern versammelt Erzählungen: die der Amerikanerin Joy Williams, einer Meisterin der Seltsamkeit.« Mara Delius, Litarische Welt »Liest man Williams' teuflische Kurzgeschichten, ist die Hölle nie weit.« Wieland Freund, Welt am Sonntag Übersetzt von Brigitte Jakobeit und Melanie Walz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Eine Nacht lang erkunden zwei zehnjährige Mädchen einen Zug mit Restaurant, Bar und Zauberbühne und lernen dabei sich selbst und ihr künftiges Leben kennen.… Eine junge Frau, ratlos, plötzlich schlaflos, wird von der Faszination für eine nächtliche Radiosendung erfasst, in der, so glaubt sie, alle Fragen ihres Lebens gelöst werden könnten. Von der Gesellschaft geächtet, schließen sich die Mütter mehrerer verurteilter Mörder zu einem Außenseiterclub zusammen. Seite für Seite, Satz für Satz führen uns diese dreizehn Geschichten ins Unvorhersehbare hinein, verzweigen sich in die Tiefe wie Romane: unverwechselbar im Ton, beunruhigend und komisch zugleich.
Joy Williams
Stories
Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit und Melanie Walz
LIEBE
Jones, der Prediger, hat sein Leben lang geliebt. Er staunt selbst darüber, denn soweit er es beurteilen kann, hat es nie jemandem genützt, auch wenn es gewürdigt wurde, was selten der Fall war. Jones’ Liebe ist viel zu offensichtlich und weckt Gleichgültigkeit. Er ähnelt einem Tier in einem Wanderzirkus, das aufgrund einer Missbildung ein lebenswichtiges Organ außen auf der Haut trägt, peinlich und bedauernswert, etwas, das verborgen bleiben und schon gar nicht beim Arbeiten gesehen werden sollte. Jetzt sitzt er auf dem Bett neben seiner Frau in einem Krankenhaus fünfzehn Meilen von zu Hause entfernt. Sie wurde für verschiedene Untersuchungen hierher überwiesen. Sie ist so schwach, so müde. Irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Blut. Ihre Arme sind dort, wo ihr in die Venen gestochen wurde, von blauen Flecken übersät. Auch ihre Hüfte ist an der Stelle, wo Knochenmarkproben entnommen wurden, verfärbt und geschwollen. Das Ganze ist beängstigend. Die Ärzte sind ernst und klug und beantworten seine Fragen so, dass er sich hoffnungslos schwerhörig vorkommt. Man hat ihm erklärt, dass es so etwas wie eine Blutkrankheit eigentlich nicht gibt, weil Blut kein lebendes Gewebe sei, sondern ein passives Vehikel für den Transport von Nahrung, Sauerstoff und Abbauprodukten. Man hat ihm außerdem erklärt, dass Anomalien der Blutkörperchen, wie sie bei seiner Frau offenbar vorliegen, als Symptome anderer Erkrankungen im Körper zu verstehen seien. Auf seine Bitte hat man ihm Dias und Schaubilder von gesunden und krankhaften Blutzellen gezeigt, die für Jones aussehen wie Canapés. Die Ärzte sprechen (weil er darauf besteht) von Leukozytose, Myelozyten und Megaloblasten. Nichts davon trägt der Liebe Rechnung, die er für seine Frau empfindet! Er sitzt neben ihr in diesem halbdunklen angenehmen Raum, trägt einen grauen Anzug und sein Kollar, denn danach muss er noch andere Gemeindemitglieder besuchen, die hier Patienten sind. Dieser Teil des Krankenhauses gleicht einem Motel. Die Patienten dürfen ihre Alltagskleidung tragen. Die Zimmer sind mit Schreibtisch, einem Teppich und einer bunten Tagesdecke ausgestattet. Jones wünschte nichts sehnlicher, als mit seiner Frau auf Reisen zu sein und am Abend, diesem Abend, in einem Motel zu übernachten. Eine Schwester kommt mit einem kleinen Pappbecher voller Pillen herein. Drei Pillen, oder eher Kapseln, die nicht für seine Frau sind, sondern für ihr Blut. Es ist der kleinste Pappbecher, den Jones je gesehen hat. In diesem Krankenhaus scheint jede Perspektive, jedes Zeit- und Raumgefühl verloren zu gehen. Als Jones sich zum Beispiel umdreht, um seiner Frau auf den Kopf zu küssen, streifen seine Lippen nur Luft.
Jones und seine Frau haben ein Kind, eine Tochter, die ihrerseits ein Kind hat, ein Mädchen, das vor sechs Monaten auf die Welt kam. Jones’ Tochter ist den Sternen verfallen und beruft sich, wie er als Erster zugeben würde, mehr auf den Himmel, als er es je getan hat. Allerdings hat ihr das nichts als Kummer und Verwirrung eingebracht. Sie hat ihren Mann verlassen und das Baby bei Jones abgegeben. Auch ihren Hund hat sie ihm vermacht. Sie will nach Mexiko, wo sie bald einen Nervenzusammenbruch in den Bergen erleiden wird. Jones ahnt nichts davon, aber seine Tochter hat es in den Sternen gesehen und will aufbrechen, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Jones erklärt sich sofort bereit, für das Baby und den Hund zu sorgen, denn das scheint das Einzige, was seine Tochter von ihm braucht. Der Geburtstag des Kindes ist der Stellung der Planeten und den Bedingungen der Häuser, Quadranten und Gradzahlen unterworfen. Sein Symbol ist ein Reiter auf einem ungesattelten Pferd. Für Jones ist das ein schöner Gedanke. Er zeugt von Kühnheit. Außerdem bedeutet es Glück. Jones steckt seiner Tochter etwas Geld in ein Fach ihres Koffers und fährt sie zum Flughafen. Die Maschine rollt die Startbahn entlang. Jones winkt, ihrer aller Glück in den Armen haltend.
Eines Nachmittags war Jones nach Hause gekommen und hatte seine Frau weinend im Garten vorgefunden. Sie hatte Blumen in Töpfe umgepflanzt, bevor der erste Frost kam. Stirn und Mund waren mit Erde verschmiert. Ihre leichte Kleidung fühlte sich so schwer an. Der ganze Körper tat ihr weh von dem Gewicht. Jeder Atemzug war ein Stein, den sie schlucken musste. Sie weinte und weinte in der schwachen Herbstsonne. Jones sah die Adern an ihrem Hals pulsieren. »Ich sterbe«, sagte sie. »Es wird Monate dauern.« Doch nachdem er sie ins Haus gebracht hatte, behauptete sie, es gehe ihr besser, und machte ihnen beiden Tee, während Jones die restlichen Pflanzen eintopfte und in den Keller hinuntertrug. Sie lag auf dem Sofa, und Jones setzte sich zu ihr. Sie unterhielten sich leise. Tatsächlich flüsterten sie fast, als wären sie an einem öffentlichen Ort, umgeben von Fremden, und nicht allein bei sich zu Hause. »Machen wir einen Ausflug«, sagte Jones. Seine Frau war einverstanden.
Gemeinsam fahren sie durch kleine Ortschaften, Meile um Meile, sogar bis in den nächsten Staat hinein. Seine Frau will nicht anhalten. Sie kaufen Sandwiches und Milchshakes und essen im Auto. Jones fährt. Sie müssen tanken. Seine Frau sitzt nah bei ihm, die Augen geschlossen, den Kopf an den Sitz gelehnt. Er sieht die Adern an ihrem Hals weiterschlagen. Da ist ein schreckliches Geräusch irgendwo, fast hörbar. Jones presst ihre kalte Hand an seine Lippen. Er stellt sich vor, dass tief in der Dunkelheit seiner Frau etwas außer Kontrolle gerät, etwas Wahnsinniges. »Zwing mich bitte nicht, ins Krankenhaus zu gehen«, beschwört sie ihn. Aber natürlich wird sie dorthin gehen. Der Moment war bereits eingetreten.
Jones schreibt seiner Tochter. Am Morgen hat er einen kurzen Brief von ihr bekommen, in dem sie ihm mitteilte, wo sie zu erreichen sei. Die ausländische Briefmarke war so groß, dass sie fast Jones’ Adresse verdeckte. Sie erwähnte weder ihre Mutter noch ihr Kind, was Jones leicht beunruhigt. Sein Leben scheint in seiner Existenz so unabhängig wie das seines Gottes, beinahe unwirklich. Seine Tochter hat ihm von der Stadt erzählt, in der sie lebt. Sie hat nicht vor, lange dort zu bleiben. Sie will reisen. Sie möchte genau herausfinden, was sie eigentlich will, und dann wird sie zurückkommen. Die Stadt ist arm, aber interessant, außerdem sind dort viele Amerikaner in ihrem Alter. Direkt am Strand gibt es einen Zoo. Fast alle Städte da, egal wie groß, haben einen kleinen Zoo. In den Käfigen sind hauptsächlich Adler und Falken. Und was soll Jones darauf antworten? Er schreibt: Alles bestens hier. Wir verbrennen das Holz vom alten Apfelbaum im Kamin, es riecht herrlich. Ist die Kleine schon gegen Polio geimpft? Pass auf dich auf. Jones verwendet diese Phrase ständig, oft in völlig unpassenden Situationen, zum Beispiel wenn er Pfeifenreiniger kauft oder durch Mautstellen fährt: Passen Sie auf sich auf. Zerstreut, wie er ist, schreibt er über den Rand des Papiers auf die Unterlage und muss von vorn anfangen. Er wird den Brief auf dem Weg ins Krankenhaus einwerfen. Seit drei Tagen machen sie nun schon Röntgenaufnahmen, aber die Bilder sind verschwommen. Sie können sie nicht deuten. Inzwischen liegt seine Frau in einem richtigen Krankenbett mit hohen Seitengittern. Er sitzt bei ihr, während sie zu Abend isst. Sie bittet ihn, ihr gutes Nachthemd nach Hause mitzunehmen und mit Ivory-Seife zu waschen. Inzwischen darf sie gar nichts mehr, nicht mal ein paar Sachen auswaschen. Sie müssen aufpassen.
Jones fährt eine Landstraße entlang. Es schneit zum ersten Mal in diesem Jahr, und er möchte den Schnee seiner Enkelin zeigen, die in einem gepolsterten Kindersitz neben ihm thront. Ihr Kopf ist fast auf einer Höhe mit seinem, und sie betrachtet ernst, manchmal lächelnd, die Landschaft. Sie folgen der schmalen Straße, die sich zwischen Feldern und dunklen Kiefernwäldern dahinschlängelt. Alles ist weiß und sauber. Den ganzen Nachmittag hat es geschneit, und es schneit immer noch, aber nur ganz leicht. Dicke Schneeflocken fallen vereinzelt an die Windschutzscheibe. Manchmal greift die Kleine danach. Manchmal strampelt sie kurz und stößt einen Freudenschrei aus. Ihre Besorgungen haben sie erledigt. Jones hat Milch, Lebensmittel und zwei gelbe Rosen gekauft, die eingewickelt in Seiden- und Zeitungspapier hinten im kalten Kofferraum liegen. Samstags muss er zwei kaufen, weil der Blumenladen am Sonntag geschlossen hat. Das macht er nicht gern, aber es geht nicht anders. Die Rosen halten sich nicht gut. Eine wird er seiner Frau heute Abend schenken. Die andere wird er in Zuckerwasser packen und im Kühlschrank aufbewahren. Er kann nur hoffen, dass die Knospe bis Sonntag geschlossen bleibt, wenn er sie in die schreckliche Hitze des Krankenhauses bringt. Die Kleine schaukelt gegen die Gurte ihres Kindersitzes. Mit gespitzten Lippen betrachtet sie aufmerksam die Felder und Bäume. Sie ist warm angezogen und trägt eine orangefarbene Strickmütze, die dreiundzwanzig Jahre alt ist, so alt wie ihre Mutter. Jones hat die Mütze neulich erst gefunden. Auf einer Seite ist sie fast zu Rosa verblasst. Irgendwann muss sie mal zu lange in der Sonne gelegen haben. Beim Fahren fühlt sich Jones geradezu beschwingt. Der Schnee ist herrlich. Alles ist weiß. Jones ist ein gebildeter Mann. Er hat Melville gelesen, der behauptet, Weiß sei die farblose Allfarbe der Gottlosigkeit, vor der wir zurückschrecken. Jones glaubt das nicht. Er sieht im Schnee etwas Heiliges, eine Verheißung. Er hofft, seine Frau weiß, dass es schneit, auch wenn ein Vorhang sie vom Fenster trennt. Da sieht Jones etwas über den Schnee laufen, einen Teil des Schnees selbst. Obwohl Jones langsam fährt, nimmt er den Fuß ganz vom Gaspedal. »Schau mal, Schatz, ein Schneeschuhhase.« Beim Klang seiner Stimme öffnet das kleine Mädchen den Mund und kneift die Augen in stummem Entzücken zusammen. Der Hase ist prächtig. Und so schnell! Er gleitet um unsichtbare Hindernisse, wie ein Wesen aus einem freundlichen Traum, fliegt über den Graben, die Pfoten wie Paddel, leicht gelblich, von der Farbe rohen Holzes. »Schau mal, Liebes«, ruft Jones, »wie groß er ist!« Doch plötzlich ist der Hase gekrümmt und stürzt, rund wie eine Kugel, Pfoten und Kopf eng an den Körper gepresst. Er landet auf der Straße und schlittert kopfüber noch ein Stück weiter. Das Auto kann ihm ausweichen. Verblüfft bremst Jones und hält an, öffnet die Tür und geht zu dem Tier zurück. Seine Enkelin dreht sich um, so gut sie kann, und schaut ihm nach. Es scheint, als wäre das Tier nie lebendig gewesen. Der Kopf ist an mehreren Stellen zertrümmert. Jones bückt sich, um das Fell zu streicheln, richtet sich aber unverrichteter Dinge wieder auf. Ein Mann kommt aus dem Wald und schwenkt ein Gewehr. Er nickt Jones zu und hebt den Hasen an den Ohren hoch. Als er sich entfernt, schleifen die Beine des Tiers über den Boden. Auf dem Schnee schimmern kleine Kristallflecken. Jones geht zum Auto zurück. Er will sich entschuldigen, weiß aber nicht, wofür. Sein Leben ist der Apologetik gewidmet. Das ist sein Beruf. Seine Themen sind Rechtfertigung und Reue. Er hat stets richtig gehandelt, aber es hat nie zu etwas geführt. »Ach, Liebes«, sagt er zu seiner Enkelin. Sie lächelt ihn an und zeigt ihren Zahn. Am Abend, nachdem er sie gefüttert hat, liest Jones ihr eine Geschichte vor. Sie schläft und schnauft im Schlaf, aber Jones erzählt ihr die Geschichte von al Boraq, dem milchweißen Ross Mohammeds, das mit einem einzigen Schritt aus dem Blickfeld der Menschheit verschwinden konnte.
Jones sieht eine Reihe von Platten durch, alle noch unausgepackt in Zellophan. Die Hüllen sind schlicht und voller Text. Namen, Instrumente und Orchester werden ganz selbstverständlich genannt. Er würde ihre Bedeutung gern anerkennen, weil er weiß, dass sie Wert haben, kennt sich aber nicht damit aus. Seine Tochter hat ihm die Platten mitgebracht. Sie sind das Geschenk eines älteren Mannes, eines Professors, mit dem sie eine Affäre hatte. Jones schmerzt das natürlich. Seine Tochter erzählt ihm von den Männern, mit denen sie zusammen war, jetzt aber nichts mehr zu schaffen hat. Woher kamen diese Männer? Wo hatten sie gewartet, und warum sind sie verschwunden? Jones erinnert sich, wie seine Tochter ihm als kleines Mädchen beim Laubharken half. Jahrelang nahm sie am ersten April Tabak aus seinem Humidor und füllte ihn mit Cornflakes. Jones ist voller Reue und Verwunderung. Beim letzten Treffen mit seiner Tochter vor wenigen Wochen war sie dünn und nervös gewesen, hatte sich vor lauter Nervosität mit den Fingern die Augenbrauen fast ganz ausgerupft. Und die Wimpern. Ihre Lider waren geschwollen und weiß, wie Blumenzwiebeln. Die Fingernägel grob abgekaut, einige bis aufs Fleisch. Sie war hart und unnahbar, wollte nur die Reise antreten, für die sie schon ein Ticket hatte. Was soll er tun? Er sucht seine Tochter im Gesicht des Babys, aber da ist sie nicht. Alles besteht zugleich fort und beginnt von Neuem, aber mit Träumen verhält es sich anders. Träume lassen sich nicht wieder zum Leben erwecken. Jones packt eine der Platten aus, bläst den Staub von der Nadel und spielt sie ab. Draußen ist es dunkel. Das Pfarrhaus liegt abgeschieden, in der Nähe gibt es nur ein paar Scheunen. Der Fluss ist nicht zu sehen. Die Musik ist Bruckners Te Deum. Wunderschön. Gott gewidmet. Er spielt die andere Seite. Eine Frau, Kathleen Ferrier, singt auf Deutsch. Die Musik überwältigt ihn. Kindertotenlieder. Er macht sich nicht die Mühe, die Übersetzung nachzuschlagen. Die Musik genügt ihm.
Im Krankenhaus harrt seine Frau ihrer Verwandlung, von einer Frau, der Frau, die er liebt, in einen bloßen Zustand. Ihr Blut bewegt sich auf so rätselhaften Bahnen wie die Sternbilder. Sie steht unter Beobachtung und Beschuss, und sie hat Jones verlassen. Wie eine Schwimmerin, die darauf wartet, mit dem Ertrinken voranzukommen. Jones steht am Ufer. In Mexiko geht seine Tochter mit zwei Männern am Strand entlang. Sie spielt ein Stück, das zu ihrem Leben geworden ist. Jones steht auf dem Berggipfel. Die Kleine weint, und Jones nimmt sie aus der Krippe, um sie zu wickeln. Der Hund kratzt an der Tür. Jones lässt ihn hinaus. Dann macht er es sich mit dem Kind bequem und lauscht der Platte. Die Kleine zappelt unruhig auf seinem Schoß. Sie hat die Augen eines Fohlens, marineblau. In wenigen Wochen hat sie sich angewöhnt, alles von Jones zu erwarten. Er legt sie in eine Ecke des Sofas und geht zu der kleinen Spielzeugkiste, wo er einen Bären, ein paar Rasseln und Bälle aufbewahrt. Dann öffnet er die Tür, und der Hund kommt sofort herein. Sein dichtes Fell ist kalt und duftet nach Eis. Er beschnuppert die Kleine, und sie quietscht.
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen
Jones sucht einen hellen Ball aus und schiebt ihn sanft seiner Enkelin zu.
Es ist Sonntagmorgen, Jones steht auf der Kanzel. Die Kirche ist sehr alt, der angrenzende Friedhof noch älter. Inzwischen ist er ein historisches Wahrzeichen, in dem seit dem Ersten Weltkrieg niemand mehr bestattet wurde. Nicht weit entfernt gibt es einen neuen Friedhof, den die Familien jetzt nutzen. Die Gräber sind nicht mit Steinen markiert, sondern mit kleinen Tafeln, und nach jeder Beerdigung legen Arbeiter sofort Rollrasen über das neue Grab, damit kein Dreck herumliegt, nicht mal für kurze Zeit. Zum heutigen Gottesdienst sind achtundsiebzig Erwachsene, elf Kinder und der Jugendchor erschienen. Jones zählt sie während der Kollekte. Laut der Gemeindeliste gibt es 350 Mitglieder, doch soweit er es beurteilen kann, sind heute alle anwesend. An diesem Sonntag tauft er seine Enkelin. Mit einer der Frauen hat er verabredet, sie zu halten und am Ende des ersten Lieds zum Taufbecken zu bringen. Das kleine Mädchen sieht bezaubernd aus in seinem weißen Spitzenkleidchen. Jones hat ihr feines Haar sorgfältig gekämmt und es mit Wasser in Locken gelegt, aber inzwischen ist es trocken und steht ab wie der Kamm eines Eisvogels. Das Kleid hat Jones bei Mammoth Mart gekauft, einem riesigen Laden, auf dessen Dach ein großer metallener Elefant in Latzhose tanzt. Er kommt sich albern vor, es dort gekauft zu haben, aber er war in mehreren Geschäften, und dort hatten sie einfach das hübscheste. Er segnet das kleine Mädchen mit Wasser aus der Silberschale und sagt: Wir werden nicht gerettet, weil wir es verdienen. Wir werden gerettet, weil man uns liebt. Die Zeremonie dauert nicht lange. Das Mädchen, das Jones neugierig ansieht, wird in die Kinderkrippe gebracht. Jones beginnt mit der Predigt. Er kann sich nicht erinnern, wann er sie geschrieben hat, aber da liegt sie, ordentlich getippt, vor ihm. Unrecht ist nicht, was wir tun, sondern unrecht ist, was wir werden. Ein fragwürdiger Satz, findet er, spricht aber weiter. Seit vierunddreißig Jahren predigt er. Er ist ausgemergelt vom Glauben. Aber seine Frau hat nur 2,3 Millionen rote Blutkörperchen. Es reicht nicht! Sie kriegt nicht genug Sauerstoff! Jones hält seine Predigt. Er hat verloren, wonach er gesucht hat. Irgendwann hat er es bestimmt gewusst. Die Gemeinde wiegt sich wie die Flügel eines Rochens im Wasser. Es ist Sonntag, für Patienten ein Feiertag. Die Ärzte kommen nicht zur Visite. Es gibt keine Untersuchungen, keine Diagnosen. Jones würde gern von der Kanzel steigen und weggehen, in den Winter hinaus, wo er seine Worte in den Boden lesen würde. Wieso kann er sich nicht an sein Leben erinnern! Er kommt zum Ende, setzt sich, steht auf, um das Abendmahl zu reichen. Winzige Brotwürfel liegen in einer schlaffen Pyramide vor ihm. Sie werden dargereicht und empfangen. Jones nimmt sein Stückchen, das er zuvor selbst von einem geschnittenen, angereicherten Brotlaib gehackt hat. Es ist ganz trocken, fast böse. Schon beim Gedanken daran wird ihm jetzt übel. Er kaut und kaut, doch es bleibt ihm hartnäckig im Mund liegen wie ein Muskel.
Jones wartet im Eingangsbereich, um zu erfahren, wie die Operation seiner Frau verlaufen ist. Gab es je eine Zeit vor dieser ständigen Angst? Er wäre ja schon dankbar, wenn er nur die Angst wiederhaben könnte, aber sie ist ihm schon lange in jähen Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Tatsachen verloren gegangen. Die Kleine sitzt auf seinen Knien und spielt mit Jones’ Krawatte. Heute Morgen ist sie früh aufgewacht, wollte ihren Orangensaft und hat ihn dann mit ernster Miene sofort wieder erbrochen. Jetzt allerdings, während sie mit den Fingern Jones’ Krawatte erforscht, scheint es ihr gut zu gehen. Immer wenn er sie ansieht, schenkt sie ihm ein strahlendes Lächeln. Fast den ganzen Tag hat er grimmig das Haus geputzt, Bettwäsche und die Seiten der vielen in den Zimmern hängenden Kalender gewechselt, Dinge, die er schon vor einer Woche hätte erledigen sollen. Er hat Staub gewischt und gesaugt, seine Hemden gebügelt. Er hat sämtliche Babysachen gewaschen, weiche kleine Schlafsäcke und -anzüge und Kleidchen, die ihm in den Händen steif froren, sobald er nach draußen trat. Jetzt wartet er und schaut auf die Uhr. Der Tumor sei genau so groß, hat man ihm gesagt, so groß wie das Ziffernblatt seiner Uhr.
Jones hat die Kleine auf dem Schoß und füttert sie. Das Abendessen ist langwierig und kompliziert. Erst muss er ihr ihre Vitamine geben, danach mit einer Pipette flüssiges Aspirin, weil sie erkältet ist. Darauf folgen ein Fläschchen Milch, 250 Milliliter, und eine Portion Gemüsebrei. Dann gibt er ihr etwas Zeit zum Verdauen. Auf seiner Hüfte wandert sie durch die Räume des großen Hauses, während Jones die Lichter aus- und einschaltet. Schließlich geht er zum Tisch zurück und gibt ihr noch etwas Milch, ein halbes Gläschen püriertes Huhn und ein paar Löffelchen Nachtisch, meistens Fruchtpastete, Obstkuchen oder Pudding. Die Kleine mag alles gleichermaßen. Sie ist brav. Isst schnell und sauber. Manchmal grabscht sie nach dem Löffel, dreht ihn um und schiebt sich das falsche Ende in den Mund. Natürlich gibt es nichts, was man nicht falsch machen kann. Jones vergöttert das Mädchen. Er schnuppert an ihrem warmen Kopf. Ihre Geburt ist ein schwerer Fehler, eine Abstraktion. Ehelich geboren, aber nicht aus Liebe. Er setzt sie in den Laufstall und versorgt den Hund, füllt eine Schale mit Wasser und eine zweite mit Trockenfutter. Der Hund frisst sehr zivilisiert. Ein wenig Trockenfutter, dann etwas Wasser, Trockenfutter und wieder Wasser. Als er fertig ist, sind die Schalen sauber, wie abgewaschen. Jones denkt jetzt an sein eigenes Abendessen. Er öffnet den Kühlschrank. Die Frauen aus der Gemeinde haben ihm Brownies, Wildfleisch, Käse und Apfelkompott gebracht, Truthahnpastete, Schweinekoteletts, Steak, Schellfisch und Frühstücksfleisch. Ein strahlendes Licht fällt auf das ganze Essen. Es ist so viel und muss aufgebraucht werden. Um die Einstichlöcher einer Dose Hundefutter hat sich eine Kruste gebildet. Da ist ein durchsichtiger, zugetackerter Beutel mit Hühnerlebern. Unglücklich betrachtet Jones die Kondenstropfen auf Packungen und Flaschen, die Fettperlen auf dem kalten Eintopf. Er setzt sich. Das Zimmer ist voller Lampen und Kabel. Er denkt an seine Frau, deren atmender Körper an Schläuchen hängt, und beginnt zu zittern. Alle Gegenstände hier sind ratlos angesichts solchen Kummers.
Inzwischen ist fast Weihnachten, und Jones geht unten am Fluss entlang, umrundet ein verlassenes Haus. Der Hund pflügt sich mühsam durch den Schnee und schnappt danach. An den Ästen hängen Blätter aus Eis, und als Jones stehen bleibt, streckt die Kleine die Hand aus und bewegt ihren Mund, weil sie es gern haben möchte, das Eis, den Ast, alles. In ein paar Tagen kommt seine Frau nach Hause, rechtzeitig zu Weihnachten. Jones hat bereits den Baum aufgestellt und die Dekoration vom Dachboden geholt. Er wird ihn erst herrichten, wenn sie zurück ist. Er möchte unbedingt, dass das Öffnen der Schachteln mit dem alten Schmuck ein schönes Ereignis wird. In der Vergangenheit haben sie das beide immer sehr genossen. Jones wird mit Sicherheit eine Christbaumkugel fallen lassen, das passiert ihm jedes Jahr. Mit seiner kleinen Gefährtin stapft er durch den Schnee. Sie baumelt in einer Schulterschlinge, die Beine um seine Hüfte geklemmt. Ernst betrachten sie das verfallende Haus. Früher hat darin ein Arzt gewohnt und seine Sprechzimmer gehabt, doch lange vor Jones’ Zeit war dieser Arzt, ein hochangesehener Mensch, vertrieben worden, weil ein Mädchen ihn beschuldigt hatte, sie geschwängert zu haben. Man erzählt sich, der Arzt habe dazu nur gesagt: »Ach ja?« Das empörte die Leute und die Eltern des Mädchens, die darauf bestanden, dass er das Kind sofort nach der Geburt zu sich nähme. Er tat es und kümmerte sich rührend um das Kind, obwohl seine Praxis ruiniert war und niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben wollte. Ein Jahr später sagte das Mädchen die Wahrheit – dass der richtige Vater ein junger Student sei, den sie jetzt heiraten würde. Sie wollten das Kind wiederhaben, und der Arzt gab ihnen die Kleine bereitwillig zurück. Natürlich ist das eine alte, bedeutsame Geschichte. Jones hat sie immer geschätzt, aber inzwischen ärgert ihn die Passivität des Mannes. Die Krankheit seiner Frau hat für Jones alles verändert. Er wird die Dinge weiter hinnehmen, doch er wird nicht mehr klein beigeben. Für Jones ist jetzt mit Sicherheit alles anders.
Aus Versicherungsgründen wird Jones’ Frau im Rollstuhl zum Wagen gebracht. Sie ist dünn und wunderschön. Jones ist dankbar und verwirrt. Er verspürt den verrückten Wunsch, dem Krankenpfleger ein Trinkgeld zu geben. Sind wirklich so viele Jahre vergangen? Ist das nicht seine Frau, seine Liebe, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat? Fängt nicht jetzt erst alles an? In Mexiko schlendert seine Tochter gleichgültig durch ein Juweliergeschäft, wo sie ein kleines silbernes Ei in die Hand nimmt. Es öffnet sich an einem Scharnier, und im Inneren sind zwei Figuren, eine Braut und ein Bräutigam. Jones legt seiner Frau das kleine Mädchen in den Arm. Am Anfang ist es verängstigt, weil es sich nicht an diesen Menschen erinnert, und streckt wimmernd die Hand nach Jones aus. Aber die sanfte Stimme seiner Frau besänftigt die Kleine schon bald, und auf der Fahrt schläft sie in ihren Armen ein. Jones hat alles sorgfältig für die Heimkehr seiner Frau vorbereitet. Das Haus ist sauber und ordentlich. Seit Tagen hat er sich auf einen Teil des Hauses beschränkt, damit möglichst wenig Unordnung entsteht. Jones hilft seiner Frau die Stufen zur Tür hinauf. Zusammen betreten sie die strahlenden Räume.
DER KLEINE WINTER
Sie war am Flughafen und wartete auf den Aufruf ihres Flugs, als eine Frau zu einem Telefon nicht weit von ihrem Sitzplatz kam. Die Frau stand dort, wählte und begann nach einer Weile in ausdruckslosem, gekränktem Tonfall zu sprechen. Natürlich konnte Gloria nicht alles verstehen, hörte die Frau aber sagen: »Falls mit dem Flugzeug was passiert, bist du hoffentlich zufrieden.« Die Frau sprach monoton und mitleidlos. Sie war groß und ungepflegt und sah aus wie der Inbegriff eines Menschen, der seit Kurzem nicht mehr geliebt wird. Trotzdem versuchte man am anderen Ende der Leitung noch, sie zu besänftigen. Verblüffend deutlich hörte Gloria sie den Satz über das Flugzeug mehrmals wiederholen. Dann knallte die Frau den Hörer hin, stieg in die wartende Maschine und ließ sich in einen Sitz der ersten Klasse fallen. Gloria ging nach hinten durch und setzte sich ruhig hin. Sie dachte, dass jeder Mensch jeden Augenblick kurz vor der Ewigkeit steht und die Wege, diese Welt zu verlassen, zahllos und oft unvorhersehbar sind. Etwas in der Art dachte sie eine Weile, dann bestellte sie sich einen Drink.
Das Flugzeug stieß durch die Wolken, und der Drink rief ihr in Erinnerung, wie sie als Kind gern am Kragen ihrer Kleider gekaut hatte. Das kam ihr beim ersten Drink des Tages nicht immer in den Sinn, aber schon oft. Dann dachte sie an die Wüste, die sie hinter sich ließ, und wie sehr sie ihr gefiel. Früher hatte ihr das Meer gefallen, und sie hatte gedacht, ohne das Meer nicht leben zu können, doch inzwischen fehlte es ihr so gut wie gar nicht mehr.
Das Flugzeug hielt Kurs. Gloria bestellte sich noch einen Drink und rechnete nicht länger damit, dass die Frau es in die Luft sprengen wollte. Jetzt begann sie, an ihre Pläne zu denken. Sie wollte Jean besuchen, eine Freundin, die gerade eine schwere Zeit durchmachte – die vierte Scheidung, aber Jean hatte viel Energie –, allerdings nur für ein, zwei Tage. Jean hatte eine Tochter namens Gwendal. Gloria hatte die beiden seit Jahren nicht gesehen und würde Gwendal wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen. Danach würde sie einfach herumfahren, bis es so weit war. Vielleicht würde sie sich einen Hund kaufen. Sie hatte schon mehrere Hunde gehabt, aber es war nie gut gegangen. Das war das Dumme an Haustieren, man weiß, dass ihnen irgendwann etwas Furchtbares zustößt und es kein gutes Ende nehmen wird. Zwei ihrer Hunde waren überfahren worden, einer war epileptisch gewesen, und bei einem anderen wurde schon früh ein Hüftgelenksfehler diagnostiziert. Tierärzte hatten bei Glorias Hunden nie viel ausgerichtet, so wie Ärzte jetzt bei Gloria nicht viel ausrichteten. Sie dachte oft über Ärzte nach, obwohl sie nie mehr zu einem gehen würde. Unter den gegebenen Umständen sollte sie sich wohl keinen Hund zulegen, wollte es aber irgendwie. Soll der Hund doch zur Abwechslung mal nicht schlappmachen, dachte sie.
Am Flughafen mietete Gloria einen Wagen. Sie beschloss, bis zu Jeans Stadt zu fahren und sich ein Motelzimmer etwas außerhalb zu nehmen. Jean redete viel. Ein Tag mit Jean würde reichen. Ein Tag und eine Nacht wären mehr als genug. Ganz in der Nähe des Ortes gab es ein Kloster, in dem die Mönche Hunde aufzogen. Vielleicht würde sie da ihren Hund finden. Sie würde gleich morgen früh zum Kloster fahren und dann den restlichen Tag mit Jean verbringen. Aber das war schon alles. Weiter hatte sie nicht gedacht.
Es war ein bewölkter Tag und der Verkehr ziemlich dicht. Das flach abfallende Land links und rechts vom Highway war grün und still. Die Landschaft kam ihr etwas wehmütig vor, Obelisken und Friedhöfe, dichte, kraftlose Wälder, Nadelbäume, die vom Wipfel her verdorrten. Natürlich gab es heutzutage kaum noch eine Gegend, in der man gern leben würde. Parallel zum Highway verlief eine kurvenreiche alte Straße, und Gloria bog ab und fuhr dort entlang, bis sie eine Ansammlung von Holzhäuschen erreichte. Sie waren weiß und hatten kleine Veranden, aber die Rezeption befand sich in einem Bauwerk, das einem Tipi nachempfunden war. Es gab auch eine verfallene Minigolfanlage und einen hölzernen Turm, von dessen Plattform man Ausblick in drei verschiedene Bundesstaaten hatte. Doch der Turm stand schief, und das Geländer, das sich optimistisch hinaufwand, war geborsten und verbogen, und schon nach den ersten fünf Stufen verhinderte eine rostige Kette den weiteren Aufstieg. Gloria mochte solche Orte.
Im Tipi stand eine Frau in Kittelschürze hinter einem rosafarbenen Resopaltresen. Vor einem der Fenster hing ein gläserner Kolibri, überzogen von einer fettigen Staubschicht. Gloria konnte den Hackbraten im Ofen riechen. Die Frau hatte rote Backen und weiße Haare und begrüßte Gloria überschwänglich, doch kaum hatte Gloria für ihr Häuschen bezahlt, wurde die Frau mürrisch. Sie bedachte Gloria mit einem finsteren Blick, als wäre sie bereits mit dem Bettzeug, der Lampe und dem Wasserfallbild abgehauen.
Der Schlüssel, den Gloria bekommen hatte, funktionierte nicht. Er passte ins Schlüsselloch und ließ sich auch drehen, aber die Tür öffnete er nicht. Sie ging wieder zur Rezeption, und ein kleiner Hund mit kurzen Beinen und puscheligem Schwanz trottete neben ihr her. Im Tipi sagte Gloria: »Ich krieg irgendwie die Tür nicht auf.« Der Bratengeruch war inzwischen betäubend. Die Frau war alt, kam aber schnell hinter dem Tresen hervor.
Der Hund stand mitten auf der Wendeschleife vor den Häusern.
»Ist das Ihr Hund?«, fragte Gloria.
»Nie gesehen«, sagte die Frau. »Ganz bestimmt nicht. Geh nach Hause!«, schrie sie den Hund an. Sie drehte den Schlüssel im Schloss von Glorias Haus um und trat dann mit ihrem Turnschuh fest gegen die Tür. Die Tür flog auf. Die Frau stapfte zu ihrem Büro zurück. »Geh nach Hause!«, schrie sie den Hund noch mal an.
Gloria machte sich einen Drink ohne Eis in einem Pappbecher und rief Jean an.
»Ich freu mich schon so auf dich«, sagte Jean. »Wie geht es dir?«
»Ganz gut«, antwortete Gloria.
»Erzähl.«
»Wirklich«, sagte Gloria.
»Ich freu mich ja so auf dich«, sagte Jean. »Ich hab eine höllische Zeit hinter mir. Ich weiß, das klingt albern.«
»Wie geht es Gwendal?«
»Sie konnte Chuck sowieso nie leiden. Sie ist doch Lukes Kind. Ist aber kein bisschen wie Luke. Du kennst sie ja.«
Gloria erinnerte sich kaum an das Kind, das inzwischen fast zehn sein musste. Sie nippte an ihrem Pappbecher und sah durch das Fliegengitter den Hund, der über den verwahrlosten Golfplatz auf das Tal dahinter blickte.
»Ich weiß nicht, wie ich immer an solche gerate«, sagte Jean. Sie sprach von ihrem letzten Mann.
»Ich komme morgen zum Mittagessen«, meinte Gloria.
»So spät erst! Na gut, dann nehmen wir was mit zu Bill und essen bei ihm. Du kennst ihn ja noch gar nicht, oder? Ich möchte, dass du ihn kennenlernst.«
Bill war Jeans erster Ex-Mann. Sie hatte sich gerade ein Haus in dem Ort gekauft, wo zwei ihrer alten und ihr neuer Ex-Mann wohnten. Gloria wusste, dass ihr ein ziemlich anstrengender Tag bevorstand. Jean beschrieb ihr noch den Weg, und Gloria legte auf und machte sich einen neuen Drink. Sie ging hinaus auf die Veranda. Über den Bergen hatten sich dunkle Wolken zusammengeballt. In der Ferne, hinter den Bäumen, donnerte unsichtbar der Verkehr vorbei. In der Ortschaft unten im Tal sah man winzige, harte Lichter in der zunehmenden Dunkelheit. Das Licht hatte sich verändert und schwand allmählich, aber es war noch ziemlich hell. So war das mit dem Licht. Wenn man draußen war, während es dunkler wurde, konnte man eine Zeitlang immer noch genug sehen.
Am Vormittag wachte sie mit schrecklichen Kopfschmerzen auf. Sie sollte nicht trinken, aber was machte das schon? Gar nichts machte es. Sie nahm ihre Tabletten. Manchmal dachte sie, dass es ihr nichts genützt hatte, älter zu werden. Vierzig war sie jetzt. Sie lag in dem muffigen Häuschen. Alles schien völlig klar. Dann schien es wieder ungewiss. Sie zog sich an und ging zur Rezeption, wo sie für eine zweite Nacht bezahlte. Die Frau nahm das Geld und sah Gloria besorgt an, als verabschiede sie sich innerlich bereits von der Fußmatte mit Willkommensgruß, die sie erst kürzlich gekauft hatte, und dem alten Rohrsessel mit dem Kissen.
Es begann zu regnen. Die Straße zum Kloster bestand aus Schotter und schlängelte sich einen Berg hinauf. Unterwegs Obstgärten, Felder mit jungem Mais … auf alles prasselte der Regen wie wild. Gloria fuhr vorsichtig, konnte die Straße kaum ausmachen. Sie stellte sich vor, es würde da draußen schneien, kein Regen, sondern Schnee, der alles zudeckte. Sie stellte sich vor, wie sie dann dächte: Es war schon dunkel, aber es schneite noch – eine Zeile wie aus einer Geschichte. So eine Zeile ist schön, dachte sie. Als sie klein war, hatten sie an einem Ort gelebt, wo zuerst immer der »kleine Winter« kam. So nannten es alle. Es gab den »kleinen Winter«, danach noch einmal schöne Tage, manchmal Wochen. Und dann kam der große Winter. Inzwischen hatte sie die Klosteranlage erreicht, Gebäude aus Holz mit Türmchen und Minaretten. Jemand hatte Birken gepflanzt. Sie parkte vor einem Schild mit der Aufschrift Information/Souvenirs und rannte vom Wagen zur Tür. Beim Eintreten lachte sie und schüttelte sich das Wasser aus den Haaren.