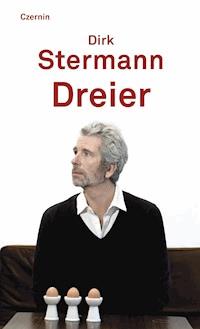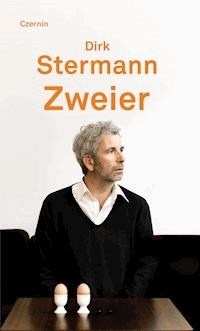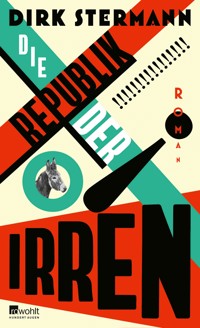8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Nr. 1-Bestseller "6 Österreicher unter den ersten 5": Der neue Roman von Dirk Stermann Stoß im Himmel – in dieser Wiener Gasse wohnt Stermanns Freund Rudi Gluske friedlich vor sichhin. Bis er erleben muss, dass ein versehentlich vertauschtes Schnitzel existenzbedrohende Folgen haben kann und sogar Allah und die Politik auf den Plan ruft. Doch zum Glück hat er seine wortgewaltige Freundin Laetitia, deren schlagkräftigen Ururgroßvater und Stermann selbst an der Seite − sowie eine ganz besondere biologische Waffe seines Vaters ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Dirk Stermann hat ein Herz für Kämpfer. Vor allem dann, wenn sie gegen ihren Willen in den Kampf getrieben werden oder sich mit übermächtigen Gegnern anlegen. So wie sein Freund Rudi GlIuske, der sich wegen eines Missgeschicks an einer Wiener Schule plötzlich mit fanatischen Moslems und piefigen Patrioten herumschlagen muss. So wie dessen Schwester Rosa, die sich an den USA nicht nur für ihr bevorstehendes Ableben rächt. So wie sein Vater Ludger, der niemand Geringeren als die deutsche Bundeswehr im Visier hat. Backgammon und die Résistance, Kettenraucher und Gottesmänner, Crémant und Falafel, Wien und die Weiten der Prärie, Stermann und der ORF: Sie alle sind Teil dieser deutsch-österreichisch-französisch-amerikanischen Familiengeschichte mit vielen couragierten Menschen und voller Skurrilitäten.
»Der fröhliche Melancholiker Stermann ist ein Meister des Absurden.« Süddeutsche Zeitung
Der Autor
Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Moderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch zahlreiche Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weithin bekannt. Sein Roman 6 Österreicher unter den ersten 5 stand wochenlang auf Platz 1 der österreichischen Bestsellerliste, auf der sich auch Stoß im Himmel platzierte.
www.stermann-grissemann.at
Von Dirk Stermann ist in unserem Hause bereits erschienen:
6 Österreicher unter den ersten 5
DIRK STERMANN
Stoß im Himmel
Der Schnitzelkrieg der Kulturen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die Romanhandlung ist auch dort, wo sie an realen Schauplätzen spielt, an reale Umstände anknüpft und reale Personen einbezieht, ausnahmslos fiktiv.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage August 2014
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013 / Ullstein Verlag
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Titelabbildung: © Gerald von Foris
ISBN 978-3-8437-0579-0
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Where men may not be dancin’,
though the wheels may dance all day;
And men may not be smokin’,
but only chimneys may.
Gilbert Keith Chesterton
Intro
August 2012. New Ulm, Sleepy Eye, Mankato, Magnolia, Kanaranzi. Am Straßenrand eine Armee toter Waschbären. Daneben eine Welt voller Getreidespeicher und Wassertürme. Zwischen Sioux Falls und Sioux City über den Big Sioux River. Rechts geht es nach Fargo, North Dakota, wo in meiner Vorstellung Männer in Häckslern enden – kopfüber.
Immer weiter geradeaus. Ich will mir den Weg anschauen, den sie genommen hat, damals, im Winter 2011 – jetzt, im Sommer darauf. The end of my world, hat Rosa über diese Gegend geschrieben. Ich fahre auf der 90 Interstate, ihr hinterher. Mit 65 mph, etwas mehr als 100 km/h, langsamer als mein Schatten.
Zwischen Humboldt und Canistota fahren Häuser auf Rädern und sechs gelbe Leihlaster von Penske. Da ziehen viele um, wahrscheinlich weg von hier. Mit Recht. Um der inneren Leere etwas anderes entgegenzusetzen als diese äußere hier. Die gelben Laster verschwimmen mit der tiefstehenden Sonne und den Weizenfeldern zu einer gelben Fläche. Vielleicht ist Rosa damals im Winter auch hinter solchen Umzugswagen hergefahren. Penske, Penske, Gluske.
Strichgerade Straßen. Man könnte auch mit Lenkradsperre fahren. Hunderte von Harleyfahrern, alle auf dem Weg zum jährlichen Treffen nach Sturgis. Die Frauen auf den Rücksitzen dehnen schon einmal ihre Vaginas. Bald werden sie auf Bierflaschen reiten müssen, während die Bärtigen dazu biertrinkend Unverständliches grölen. Eine halbe Million Motorradfahrer treffen sich jährlich im August in diesem 6000-Seelen-Nest. Ohne Motorradhelm fahren sie, natürlich. Dafür mit Tüchern oder Stahlhelmen auf dem Kopf. Hier sieht man mehr deutsche Weltkriegshelme als bei der Wehrmachtsausstellung.
Die meisten von ihnen tragen Ohrstöpsel. Der Krach ist für die anderen gedacht. An den Tankstellen können die Biker Kappen mit dem Aufdruck BigCockCounty kaufen.
Manche haben während der Fahrt eine Zigarette im Mund. Der Fahrtwind macht jeden Zug unmöglich. Zu dumm zum Rauchen.
Eine riesige Werbetafel: Visit Worlds Only Corn Palace. Ein Palast aus Getreide – seit 1921 steht das Gebäude, ein hausgewordenes Erntedank, hier im Corn Belt der USA.
Plötzlich schwarzer Himmel. Blitze. Gott macht Fotos fürs Archiv. Tornado Country, der Herr spielt mit seinem flachen Land. Die Prärie lockt Schlechtwetterfronten an wie das Licht die Motten. Hier hält den Sturm nichts auf. Vom Norden Kanadas nimmt er Anlauf, schießt über die Ebene und bläht sich immer weiter auf, bis er alles über den beiden Dakotas ausgießt. Starkstrom aus dunklen Wolken. North und South Dakota sind ein El Dorado für Blitzforscher und Tornadofreunde.
Durch Aurora County biege ich ab auf den Highway 281. Stickney hat 334 Einwohner, verkündet ein Schild am Ortseingang. Trotz 30 mph Geschwindigkeitsbegrenzung ist man nach Sekunden schon nicht mehr da. In Corsica, dem Nachbarort, leben doppelt so viele Menschen, und es gibt laut Schild über 65 Geschäftsleute. Wahrscheinlich 66.
Ich nähere mich Platte, South Dakota, und damit den Schoenhuts. Platte, Charles Mix County. 1367 Einwohner. Auf dem Wasserturm steht: It’s possible in Platte. Vor einer der elf Kirchen befindet sich ein Schild: God does not keep us from lifes storms. He walks with us through them.
Rosa Gluske hätte gesagt: »Gott hat einen Gehfehler.« Aber ich habe auch noch nie eine Familie kennengelernt, die so sturmzerzaust war wie die wunderbaren Gluskes. Von ihnen handelt diese Geschichte. So, wie ich sie aufgeschrieben habe nach diesem ereignisreichen Sommer, nachdem ich alles geordnet habe: Rosas Briefe, die Notizen, die ich mir gemacht habe nach den Gesprächen mit Rudi und Laetitia, und den merkwürdigen »Roman« von Paul Maria Suess.
Ich erinnere mich, dass ich gerade ein Ei im Glas aß, als ich ihren Bruder Rudi Gluske zum ersten Mal traf. Ein weiches Ei im Glas – später hätte ich mich das nicht mehr ohne weiteres getraut.
Ich
Ich hatte Ferien. Willkommen Österreich machte Pause. Ich hatte nichts geplant und wollte einen ganzen Sommer lang in Wien bleiben, zum ersten Mal seit Jahren. Ich hatte immer gehört, wie ruhig und entspannt es hier im Sommer sei. Wie ungrantig die Stadt dann sei, wie gut ihr die Hitze stehe. Ich sollte schnell merken, dass es ganz und gar nicht entspannt werden würde.
Ich stieg in der Kettenbrückengasse in die U4. Aus einem der Zeitungsständer am Eingang der von Otto Wagner entworfenen Station hatte ich mir eine Gratiszeitung genommen. Ich las im Stehen:
Gen zeigt: Hitler mit Afrikanern verwandt.
In Liverpool wurde John Lennons Toilette versteigert.
Ein Schwein hat 3377 Fans auf Twitter und eine Haushaltshilfe 41 Nägel im Körper.
Ein Kätzchen kommt mit vier Ohren zur Welt – besser folgen tut die süße »Luntik« aus Wladiwostok aber auch nicht.
Nordkorea zahlt Schulden mit Ginseng.
Ich war auf dem Weg in die »Sztuhlbein Brötchenstube« in der Schwertgasse im ersten Bezirk. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Monat mein Stammcafé zu wechseln. Jetzt, im Juni 2012, war es das »Sztuhlbein«.
Eine Durchsage: »Bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz bei Bedarf Frauen mit Kin…«
Das Band riss ab. Frauen mit Kinn sollte ich also meinen Platz überlassen. Ich las weiter in der Zeitung:
Idee des Tages? Schachtel-Designer Erik Askin will durch eine neue Form von Zigarettenschachteln das Rauchen unattraktiver machen. Die neue Form mache das Transportieren der Schachteln unpraktischer.
Neben mir saß ein Volksschulkind. Es las auch das Umsonstblatt, war aber auf einer anderen Seite als ich: »U10 Kids Station«. Ich blätterte hin. Das war kein weiter Weg, denn die Zeitung hatte nur wenige Seiten. Man konnte sie zwischen zwei U-Bahnstationen auslesen, wenn man wollte.
Die Kinderseite war graphisch albern gestaltet. Bunte Buchstaben mit Tiergesichtern. Das K von »Kids« war ein Känguru, das I ein Igel, das S ein Stachelschwein. Es gab eine Witzzeichnung: Zwei Hunde gehen durch die Wüste, und der eine Hund sagt: »Wenn nicht bald ein Baum kommt, mach ich in die Hose.«
Das Mädchen war Brillenträgerin. Sie nahm die Brille ab, zog ein Brillenputztuch aus der Tasche und wischte sich damit über die Augen. Ich hatte noch nie einen Menschen gesehen, der sich die Augen putzt. War aber bei der Feinstaubbelastung in den Städten keine dumme Idee.
Die »Lesecke« in der U10 Kids Station war sehr überschaubar. Sie bestand aus einem kurzen Text: Superknut. Ich las ihn zwischen Kettenbrückengasse und Karlsplatz.
Superknut
Unruhe. Gebannt starren alle auf die Türe. Wachsende Unruhe. Man hört Schritte hinter der Türe. Größte große Unruhe. Die Klinke bewegt sich. Die Türe öffnet sich. Grenzenloser Jubel.
»Jetzt macht mal halblang. Ich bin’s doch nur«, seufzt Knut. Aber seine Eltern und die vier Großeltern und die dicken Tanten jubeln ihm zu. Durchs offene Fenster fliegt ein Schwarm Vögel in die Wohnung.
»Guckt mal, Amseln«, sagt Knut, aber alle haben nur Augen für ihn. Er trinkt ein Glas Milch, und alle applaudieren.
»Mann, das ist doch nur Milch«, murrt Knut, aber alle sind begeistert. Seine Schwester Irma hat beim Kinderyoga fliegen gelernt und zeigt es voller Stolz, aber weil Knut sich gerade jetzt am Kinn kratzt, jubeln alle nur ihm zu.
»Schaut, wie er sich kratzt. Am Kinn, der Knut. Bravo, Bravao, Bravinski!« Alle, auch die brasilianische und die russische Tante, klatschen in die Hände, während Irma resigniert wieder landet.
R. G. (Morgen geht’s weiter.)
Ich stieg am Karlsplatz aus und ging am Musikverein mit seinem berühmten Goldenen Saal vorbei und am Hotel Imperial zum Ring. Es war Viertel nach neun, die Luft war klar, und Wien sah aus, als stünde ein Schönheitswettbewerb an, bei dem sich die Stadt einiges ausrechnete.
Ich schlenderte quer durch den ersten Bezirk, am Café Schwarzenberg, der Walfischgasse und dem Haus der Musik vorbei, über die Seilerstätte und die Himmelpfortgasse. Vor dem Café Frauenhuber saßen drei Damen und spielten Karten. Die Kärntner Straße ging ich hinauf, über den Stephansplatz, den Graben und die Tuchlauben zu den Neun Chören der Engel und dann über den Judenplatz zur Schwertgasse.
Im »Sztuhlbein« schimpfte ein Israeli, wir seien alle Antisemiten, weil sich jemand darüber beschwert hatte, dass er rauchte. Er sah aus, als sei er schon einmal gestorben, Er war kugelrund, hatte eine Stoppelglatze, ein lächerlich weißes Gebiss und fleischige Lippen, die immer feucht waren, so als würde er sie immer wieder mit Schmalz einreiben. Er erinnerte mich an meinen russischen Freund Aleksey, den ich am Naschmarkt kennengelernt habe. Wir standen damals nebeneinander bei »Prof. Falafel« und warteten auf die ganz frischen Falafeln, die Gözde, mein Lieblingsfalafelverkäufer, gerade für uns zubereitete. Am Naschmarkt war eine Art Falafelkrieg ausgebrochen. »Dr. Falafel« hatte dort zwei Stände, mit großartigen Falafeln. Eine Großfamilie aus Israel betrieb sie. Sie waren Marktführer, bis »Prof. Falafel« eröffnete, eine jordanisch-ägyptische Großfamilie, für die Gözde arbeitete. Ein lukullischer Nahostkonflikt.
Mit seinen dicken Fingern bediente sich Aleksey aus einem 500-Gramm-Schälchen mit Humus. Seine ganze Hand war voll klebrigem Kichererbsenpüree und Sesampaste. Er sei Geschäftsmann, sagte er. Als er bemerkte, dass ich Deutscher war, erzählte er mir, er sei 1989 Handelsattaché der UdSSR in West-Berlin gewesen. Die amerikanischen Kollegen hätten ihn damals gewarnt: »Ihr müsst aufpassen«, sagten die Amerikaner. »Euer Gorbatschow, auf den müsst ihr aufpassen!«
Aleksey fuhr jetzt direkt mit der Zunge in den Humus. »Natürlich«, schmatzte er, »die Amis hatten Angst, dass sich was verändert. Für sie persönlich. Jeder von den Offizieren hatte in Berlin eine Villa, voll eingerichtet, vom Schirmständer bis zum Klopapierhalter. Das hat alles die Bundesrepublik bezahlt. Die Amerikaner haben schön blöd geschaut, als das vorbei war. Von wegen: ›Mr Gorbatschow, tear down this wall.‹ Einen Scheiß wollten die. Die hätten eher mitgeholfen, die Mauer noch ein bisschen höher zu bauen. Phantastische Villen waren das – Grunewald, Wannsee … Vom Feinsten!«
Was genau für eine Sorte Geschäftsmann er war, habe ich nie herausgefunden. »Mal mehr Import, mal mehr Export – je nachdem«, hatte er mir einmal erklärt.
Aber ich wusste: Falls einmal eine wirkliche Krise ausbrechen sollte, war es wichtig, Leute wie Aleksey zu kennen. Inmitten der größten Hungersnot wüsste er immer, wo es ein gutes Kalbsschnitzel gäbe. Er lebte in einer 400-Quadratmeter-Wohnung am Kohlmarkt, »aber ganz spartanisch eingerichtet«, wie er jammernd meinte. »Ich habe nichts und brauche nichts«, sagte er.
Er hatte vielleicht nichts, doch davon reichlich. Aleksey war ein spendabler Freund, hielt sich aber an ein Gebot des Modezopfes Karl Lagerfeld: »Ja, ich werfe mein Geld zum Fenster hinaus; aber ich schaue genau nach, wo es hinfällt!«
Im »Sztuhlbein« bimmelte eine Fahrradklingel – ein angenehmer Klingelton. Am Nebentisch hielt sich ein kleiner junger Mann mit feuerroten Haaren bis zum Arsch das Handy ans Ohr.
»Säckchen?«, hörte ich ihn sagen. Wie einer Doku über Headbangen in Irland entsprungen sah er aus. Vor ihm auf dem Kaffeehaustisch stand ein Laptop. Ich konnte von meinem Platz aus den Bildschirm sehen. Superknut stand da. Und weiter:
Knutt verdreht die Augen, deshalb bemerkt niemand, dass seine fünf Tage alte Cousine Mia die Worte »Konfektionsgröße Mammut« ruft.
»Nein, wie er die Augen verdreht, der Knut! Bravo, Bravao, Bravinski!«
Die fünf Tage alte Mia resigniert und beschließt, so lange stumm zu bleiben, bis ihr ein Kleid der Konfektionsgröße Mammut passt wie angegossen.
R. G. (Morgen geht’s weiter.)
Er legte auf, und ich fragte ihn, ob er R. G. sei. Ich hätte in der U-Bahn gerade von Superknut gelesen, und ich wüsste schon, dass man das nicht tue, aber ich hätte ihm auf den Bildschirm geschaut und gesehen, dass er gerade an einer Fortsetzung schriebe.
»Ja. Ich heiße Rudi Gluske«, sagte er. Er war auch Deutscher, das weichere Wienerisch hatte seine Aussprache aber schon geschmeidiger gemacht.
»Dirk Stermann«, erwiderte ich.
»Guten Tag, Dirk Stermann.«
»Guten Tag, Rudi Gluske«, sagte ich. Später meinte Laetitia einmal, Rudi habe ein Herz aus Butter. Das spürte ich schon bei unserer ersten Begegnung.
Vor dem Café stand ein weißer Mini mit ungarischem Nummernschild. Am Steuer saß eine junge Frau. Das Verdeck des Cabriolets war heruntergeklappt. In unglaublicher Lautstärke dröhnte plötzlich Ostblock-Techno durch die geöffnete Tür. Die Fensterscheiben vibrierten. Als sollte die ganze Gasse, wenn nicht der ganze Bezirk beschallt werden.
»Das ist so eine Art Györ-Scooter«, schrie Rudi mir herüber. »Ungarische Foltermusik. Man wünscht sich eiserne Vorhänge vorm eigenen Ohr!«
Die junge Frau blickte selbstsicher aus ihrem Cabrio zu uns ins Café. Als wisse sie, dass sie die Herrscherin des Krachs war, und sei auch noch stolz darauf.
»Meine Nachbarin!«, brüllte Rudi weiter, um den Lärm zu übertönen. »Die blöde Kuh arbeitet in der ungarischen Botschaft. Und ihre Botschaft ist, dass sie die Lärmhoheit hat über uns. Meine Freundin sagt, sie sei eine Lärmfotze!«
Die Lärmfotze lächelte und fuhr rückwärts gegen die Einbahnstraße aus der Schwertgasse.
Die Schwertgasse geht von der Wipplingerstraße ab. Am Ende der Gasse steht die aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche »Maria am Gestade«, an deren Außenfassade ein steinernes Porträt des Dichters Heinrich Suso Waldeck hängt. Darunter steht:
Der ich meiner so müd und am Vergehen bin
Mich verlangt nach Dir Du ewiger Anbeginn
Jemand hatte Ayatollah, kumm eini neben das Kirchenportal gesprayt.
Das Polnische Institut am Tiefen Graben befindet sich bei der Stiege am Gestade. Auf der anderen Seite der Wipplingerstraße liegt der Judenplatz mit dem Lessing-Denkmal und der Holocaust-Mahntafel. Hier steht das »Haus der bürgerlichen Schneider«, die prachtvolle »Böhmische Hofkanzlei« und auch die Gastgewerbefachschule der Wiener Gastwirte.
Von dort kam Laetitia jetzt ins »Sztuhlbein«. Sie ging nicht, nein, sie wirbelte herein. Ihre kurzen, dünnen, blonden Haare wollten in jede Richtung, als sei Laetitia viel zu schnell unterwegs für jede Art von Frisur. Sie war sehr klein, trug aber flache Schuhe. Knapp über eins fünfzig, schätzte ich. Eine stolze Zwergin. Sie war wütend. Ihre vollen Lippen schienen die Nasenspitze zu berühren. Beim Tauchen würde sie sich die Nase nicht zuhalten müssen.
»Ein Faschist!«, schimpfte sie. »Soll er sich seine Nazilaibchen selber machen. Ich koch nicht in Reih und Glied, alors!« Sie umarmte Rudi stürmisch, und sein Herz aus Butter zerfloss offensichtlich.
Laetitia wollte Köchin werden. Sie war gerade im ersten Lehrjahr und ärgerte sich über den autoritären Ton, der in der Schule herrschte.
»Sie verwechseln die Küche mit der Fremdenlegion. Wenn ich angeschrien werden will, sag ich’s Ihnen schon. Ich will kochen, nicht Krieg führen, mon Dieu! Wenn ich eine Kartoffel wär, ich würde mich nicht von Ihnen schälen lassen. Wenn ich ein Hummer wär, ich würd Sie mitreißen in den Topf mit dem kochenden Wasser! Und wenn ich in die öden Laibchen Koriander geben will, dann tu ich das! Und wenn ich Senfkörner hineingebe, dann, weil es besser ist als der Mampf aus tausend Jahren! Sollen sie doch alle im Gleichschritt kochen und brav sein. Zappa hat gesagt, je langweiliger ein Kind ist, desto mehr Komplimente bekommen die Eltern!«
Laetitia bestellte sich ein Glas Sekt. Frau Sztuhlbein, die Wirtin, brachte es ihr. Es beruhigte sie nur unwesentlich:
»Und wenn ich Albondigas machen will, dann mach ich das. Muskat, Knoblauch, Rotwein, Eier, Chiliöl. Oder griechisch: Oregano, Piment, schwarze Oliven, Parmesan. Verstehst du? Mit Faschiertem steht dir die ganze Welt offen. Elsässer Fleischschnecken, ägyptisch mit Koriander – weißt du, wie gut? Mit Zimt und Baharat und Pinienkernen für die Füllung, mit einer Joghurt-Minze-Sauce oder Ingwer, Kreuzkümmel, süßer Paprika. Alles ist möglich, aber wir?« Sie machte ihren Ausbilder nach. »Rindsfaschiertes, Salz, Pfeffer, Brösel, Zwiebel, Petersil. Rindsfaschiertes, Salz, Pfeffer, Brösel, Zwiebel, Petersil. Aus! Faschistenfaschiertes. Die Laibchen werden in die goldgelbe Uniform gezwängt. Seit zwei Wochen! Ich werde zwischen den immer gleichen Laibchen zur Kochhospitalistin!«
»Säckchen«, sagte Rudi liebevoll und strich ihr durchs Haar.
Laetitia kam aus Auxerre im Burgund. Rudi und sie hatten sich dort kennengelernt. Sie hatte einen Auftritt als Sängerin im »Le Silex« gehabt, einem kleinen Club der mittelalterlichen Stadt. »Capitaine des mots« hatte sie sich genannt – Kapitänin der Worte. Ihr regionaler Hit damals hieß Je préfère vous écrire. Der Song lief ausschließlich auf Radyonne, einem alternativen Studentensender, und war die punkige Coverversion eines Musikstücks für Kinder.
»Liebe braucht Bewegung«, hatte sie kurz vorher ihrem damaligen Freund gesagt und sich wegbewegt, hin zu dem rothaarigen Deutschen, der kleiner war als sie an diesem Abend. Sie trug Highheels, und Rudi war der erste Mann, den sie überragte. Laetitia sprach damals kein Wort Deutsch, Rudi nur rudimentär Französisch. Sie studierte Literatur in Auxerre, sang in Clubs und verdiente sich ihr Geld als Schleusenwärterin. Sie arbeitete wechselweise an der Écluse Mailly-la-Ville oder der Écluse Ravereau, zwei idyllischen kleinen Schleusen an der Yonne mit kleinen steinernen Schleusenhäuschen, hübsch bepflanzt, und mit großen Obstbäumen, unter denen sie sitzen und lesen konnte, wenn nichts zu tun war. Viel gab es nicht zu tun. Der Canal de Nivernais war keineswegs überlaufen. Das Burgund war ohnehin gemächlicher als das Mittelmeer.
Das alte Herz Frankreichs. Hier war sie aufgewachsen, bei ihrem Ururgroßvater in Mailly-le-Château. Die Yonne macht in Mailly eine 180-Grad-Kurve. Hoch am Steilufer über dem Fluss thront das Château, das Mailly seinen Namen gegeben hat. 500 Einwohner leben hier mit Blick ins Tal der Yonne, die hier »sehenswert mäandriert«, wie es in einem Handbuch für Hausbootfahrer heißt. Es gibt einen steilen Weg mit zahlreichen Stufen aus brüchigem Schieferstein, der nahe der Brücke zwischen den Häusern hindurch nach oben führt.
»In Mailly-le-Château ist mein Großgroßgroßvater geboren. So klein und aufregend wie der Hoden einer Amsel. Sagt man das so?«
Rudi zuckte mit den Schultern. »Eher nicht«, sagte er.
»Egal. Bei uns ist’s nicht chic. Alles ist da, ohne Behauptung. Weil eigentlich nichts da ist. Die Boulangerie hat mittwochs geschlossen. Der Supermarkt auch. Der Coop in Lucy-sur-Yonne hat mittwochs auch geschlossen. Und die Bar Tabac. Auch die Épicerie. Alles hat geschlossen. Die Post, die Boucherie, die Charcuterie. Alles zu. Ein Installateur hat geöffnet. Eigentlich. Aber er hat auch meistens zu. Da komm ich her. Hier die müde Yonne, dort der Kanal. Ich komm aus einem komplett zerschleusten Land! Völlig verschleust! Und wundervoll!«
Als Schleusenwärterin wartete Laetitia, bis ein Boot in der 20 Meter langen Schleuse war. Dann drehte die kleine, junge Frau die eiserne Kurbel, die die Mechanik aus dem 19. Jahrhundert in Gang setzte, und das massive hölzerne Schleusentor öffnete oder schloss sich. Das Wasser lief aus, und das jeweilige Schiff senkte sich um drei oder vier Meter, oder das Wasser kam hinein, und das Schiff hob sich. Dreimal pro Schleusung musste sie all ihre Kraft aufwenden, um die Kurbel zu bedienen. Sie hatte schmale Arme, war aber sehr stark. Nach der Schleusung wünschte sie den Leuten auf dem Boot lächelnd eine gute Fahrt, legte sich neben die mit Stiefmütterchen bepflanzten Blumenkübel in einen alten Liegestuhl und las. Auf einem Tisch stand Honig, den sie für sieben Euro pro Glas an Touristen verkaufte. Darunter, im Schatten, eine Flasche Wein und ein Krug mit Wasser.
»Viele Engländer, Deutsche und Holländer fahren mit dem Hausboot. Auch Franzosen. Weil du hier glücklich sein kannst. Weil du plötzlich calme wirst. Egal, was die Welt vorher mit dir angestellt hat. Du fährst mit acht km/h ganz langsam durch die Felder. Trauerweiden machen Schatten, Fischotter und Reiher begleiten dich, und auf den Weiden siehst du die glücklichen Kühe des Burgund. Weiße Kühe, Charolais nennt man die Rasse. Sehr süß und vollkommen zufrieden.«
Ich las später nach, was die weißen Kühe so besonders macht. Im lebenden Zustand zeichnen sie sich durch ihre scheu-neugierige Art und eine gewisse robust-urtümliche Optik aus, im gekocht-gegrillten Zustand durch ihre Schmackhaftigkeit und Zartheit, lobte ein Reiseführer.
Laetitia war nach der Schule für kurze Zeit in Paris gewesen und hatte dort im 10. Arrondissement in der Boutique »Eva Tralala« gearbeitet, später dann in einem von Westafrikanern geführten Schönheitssalon mit dem schönen Namen »Jesus Cosmetiques«. Aber nachdem ihr Ururgroßvater betrunken mit einem Motorrad verunglückt war, zog sie zurück ins Burgund, um ihn zu pflegen.
Rudi war von Anfang an verliebt in sie. Als er sie in Auxerre auf der Bühne des »Le Silex« sah, die Haare zerzaust, als habe sie gerade wilden Sex gehabt, die Konzentriertheit ihres Körpers, ihre Kraft und ihre braunen Knopfaugen, zerfloss er, als habe er sein Butterherz in die Sonne gelegt. Sie strahlte.
Rudi war von Wien aus aufgebrochen, noch bevor seine Schwester Rosa krank wurde und nachdem seine Großmutter beerdigt worden war. Das war im Sommer 2010. Er hatte keine Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Er und seine Schwester hatten sich bei der Beerdigung gestritten. Sie hatte eine Stange Flirt ins offene Grab ihrer an Lungenkrebs gestorbenen Großmutter geworfen. Und eine Stange Smart und eine rote Marlboro. Rudi hatte das nicht gefallen. Er stellte sich vor, dass die Wiener Großmutter jetzt auch in der Ewigkeit nicht vom Rauchen loskäme. Die letzten Wochen, in denen sie langsam erstickt war, waren furchtbar gewesen. Aber Rosa hatte behauptet, es sei ihre Entscheidung gewesen, zu rauchen, und nicht die Entscheidung der Zigarette, geraucht zu werden.
»Erinnerst du dich nicht an das Lied, das sie mit uns gesungen hat, als wir nach Mamas Tod zu ihr kamen?« Rosa begann zu singen:. »›Bei Prag verlor ich auf der Streife das Bein durch einen Schuss, da griff ich erst nach meiner Pfeife und dann nach meinem Fuß!‹ Die Wien-Oma wollte rauchen. Willst du ihr das im Himmel jetzt verbieten, Rudi?«
Er war wütend gewesen und hatte sie am Zentralfriedhof im warmen Septemberwind stehenlassen. Bei ihren letzten lebenden Verwandten, den Schoenhuts aus South Dakota, die extra angereist waren. Gary, Gail, Gertrud, Glen, Gus, George, Geraldine, Gwendolyn, Greg, Gracie, Georgia und Gabriel. Die Geschwister ihrer Mutter Gretchen und deren Kinder.
Nach dem Tod von Ludger, Rudis und Rosas Vater, war Gretchen mit den Kindern in Düsseldorf geblieben. Als Rosa sechs Jahre alt war und Rudi vier, verdrehte sich Gretchen ihr Knie. Sie fuhr mit den Kindern ins Florence-Nightingale-Krankenhaus nach Kaiserswerth. Beim routinemäßigen Röntgen sah man Schatten auf der Lunge. Zwei Wochen später war sie tot. Die Kinder kamen zur Wien-Oma in die große Altbauwohnung Stoß im Himmel 3.
Hilde Blaha, wie die Wien-Oma eigentlich hieß, war 17, als sie 1945 in Wien einen amerikanischen Soldaten kennenlernte: Garth Schoenhut aus Platte, einem Dorf am Missouri in South Dakota. Sie zog mit ihm auf die Farm seiner Eltern und bekam sieben Kinder, deren Vornamen in Familientradition der Schoenhuts alle mit G begannen.
Platte hatte 1000 Einwohner und 11 Kirchen, 1 Saloon, 1 Bäckerei, 1 Motel. Die Farm lag außerhalb des Ortes. Menschenleeres Land. Ein paar Weiße, wenige Indianer.
Meriwether Lewis und William Clark waren 1804 zu einer Expedition aufgebrochen. Von Camp Dubois aus, in der Nähe von St. Louis, fuhren sie mit 33 Männern in drei Booten nach Westen in damals unbekanntes Land. Im September erreichten sie die Great Plains im heutigen South Dakota – für sie ein Paradies mit unerschöpflichen Nahrungsquellen. Bisons, Hirsche, Biber. Lewis und Clark waren die ersten Weißen, die Kontakt mit Indianern hatten. 50 Jahre später war die Hälfte aller Indianer tot, wegen Mumps oder Masern. Stolze Krieger starben an Kinderkrankheiten.
Die Farm der Schoenhuts: Wenn man am Horizont eine Staubwolke sah, konnte man langsam mit dem Kaffeekochen beginnen, weil der Besuch noch eine Weile bis zur Farm brauchen würde. Hier lebte Hilde, die rauchende Europäerin. »Rauchen ist nicht notwendig, aber Menschen sind auch nicht notwendig«, meinte sie. »Ich komm aus einer Familie von Tabaktrinkern. ›Tabaksaufen‹ haben die Leut früher gesagt. Die Sauferei des Nebels.« Hilde blies den Rauch aus, und der Raum wurde zu einem nebligen London. »Nass rauchen. Mit unglaublicher Begierde den Rauch einzuschlürfen – was für eine Wonne. Schau, Gretchen«, sagte sie zu ihrer Jüngsten, die auf ihrem Schoß saß und vom Qualm umarmt wurde.
Jahre später saßen Rosa und Rudi auf ihrem Schoß. Die Zigarette brannte noch immer in ihrem Mund. »Hörst du, wie es ganz leicht knistert, wenn du sie anzündest? Als würde ein ganz ein kleiner Kamin entfacht. Mein eigener Hilde-Schlot muss dampfen. Genussvoll und bedächtig wollen wir rauchen, damit die Hofburg nicht wieder Feuer fängt!«
1668 war ein ganzer Trakt der Wiener Hofburg abgebrannt, 1834 ein großer Teil von Wiener Neustadt in Schutt und Asche gelegt worden. In beiden Fällen war unvorsichtiger Tabakrauch der Grund gewesen.
»Na ja, um die Hofburg tut’s mir leid. Aber Wiener Neustadt? Das war das Beste, was man mit dem öden Kaff anstellen konnte. Ich kenne Wiener Neustadt, und ich kenne die Provinz. Ich habe in Platte gelebt. Wir hatten Aufkleber an den Autos, auf denen stand: This is not the end of the world but it’s fucking close! Wenn ich in Platte mit eurem Großvater im Saloon war, spuckte er seinen Kautabak in die Spucknäpfe am Boden. Aus drei Metern Entfernung traf er haargenau hinein. Ein brauner dünner Strahl Kautabak zischte exakt ins Ziel. Euer Großvater konnte spucken! Es war eine Hetz. Und ich passte auf, dass der Saloon nicht abbrannte und die klitzekleine Stadt. Ich häng am Leben, wisst ihr?«
1633 war Konstantinopel abgebrannt, woraufhin 25 000 Raucher hingerichtet wurden. »Kopf ab! Das waren Anti-Raucher-Kampagnen, die es in sich hatten!«, sagte die Wien-Oma. »Aber in unserer Familie konnte man uns mit Enthauptungen nicht beeindrucken. Wir haben alle geraucht. Meine Großmutter rauchte schon. Also eure Ururoma. Schaut einmal!«
Die Wien-Oma suchte in ihrem Wohnzimmerschrank eine Schuhkiste. Darin lag ein Taschentuch mit Spitzen und einem eingestickten Spruch. »Das gehörte ihr. Ihr Schneuztuch. Könnt ihr das lesen?« Die Schrift war verschnörkelt. Hilde las es Rudi und Rosa vor:
»Ist das lieb? Früher hieß die Austria Tabak ›Österreichische Tabakregie‹. Das hat mir immer gut gefallen. Der österreichische Tabakregisseur. Wir alle Schauspieler in einem großartigen Tschickstück, eine brennende Tragödie, eine rauchende Komödie. Unsere Bühne ein riesiger Aschenbecher. Schon die dicke Maria Theresia hat das Tabakmonopol eingeführt. Früher haben die Leute selber ihren Tabak angebaut, aber das hat sie verboten, weil’s zu einträglich war für unsere geschäftstüchtige Kaiserin. Und Joseph II. hat die Kriegskrüppel mit Verschleißteilen versorgt, der Sozi unter den Fürsten. So lang gibt’s das schon, dass Behinderte bei Trafiken bevorzugt werden. Weil ich hier oben in meinem Kopf nicht ganz richtig bin, bekomm ich in meiner Trafik immer als Erste meine Tschick, egal, wie lang die Schlange ist!«
Hilde war patriotische Raucherin. Eine Großtante von ihr hatte im Klagenfurter Werk gearbeitet. »Über 600 Arbeiter. 1897 hat sie dort gearbeitet. 17 Millionen Zigarren und 33 Millionen Zigaretten in einem Jahr haben sie damals hergestellt. Ist das nicht unglaublich?«
Weder Rosa noch Rudi konnten sich unter diesen Zahlen etwas vorstellen, aber beide nickten ehrfurchtsvoll.
»Und zum Vergleich, Kinder, um euch den Triumphzug der österreichischen Zigarette vor Augen zu führen: Was glaubt ihr, wie viele Zigaretten wurden 2005 in Linz und Hainburg hergestellt, bevor die britischen Räuber sich die Austria Tabak für an apple and an egg unter die schmutzigen Nägel gerissen haben? Was schätzt ihr?«
»Ich weiß nicht. Sehr viele?«, riet Rosa.
»Kluges Mädchen«, sagte die Wien-Oma. »Sehr viele. Nämlich 36 Milliarden. Da staunt’s ihr beiden, was? 36 Milliarden Zigaretten in einem Jahr für so ein kleines Land wie Österreich. Ist das nicht großartig? Ich hab 2005 aber auch wirklich sehr viel geraucht!«
Wieder nickten beide.
Die Schließung der letzten österreichischen Zigarettenproduktion in Hainburg 2011 hatte Hilde Schoenhut, geborene Blaha, nicht mehr erlebt.
Garth brachte ihr auf der Farm in Platte das Autofahren bei, das Schießen und das Branden der Rinder. Sie hatten nur 50 Rinder, aber für jemanden, der in Wien im 1. Bezirk aufgewachsen war und nur Hunde, Katzen und Tauben kannte, bedeutete das was. Oft sah sie wochenlang niemanden außer ihrer Familie. Vielleicht hatte sie deshalb so viele Kinder bekommen, damit was los war daheim. South Dakota ist so groß wie Deutschland, hat aber nur 800 000 Einwohner. Es gab damals nur ein einziges chinesisches Restaurant im ganzen Staat, und zum nächsten Kino fuhr man sechs Stunden mit dem Auto.
Die Kinder gingen in Platte zur Highschool und in Vermillion aufs College. Hilde liebte ihren wettergegerbten Mann, aber sehnte sich zurück nach Wien. Als Garth 1984 bei einem Tornado von einem Eisenträger erschlagen wurde, der wiederum von einem Blitz getroffen worden war, so dass die Todesursache unsicher war – war er an den Schädelverletzungen gestorben oder am Stromschlag? –, verkündete Hilde ihre Heimkehr nach Österreich. Die Kinder waren groß genug.
Gretchen, die Jüngste, brach ihr Biochemiestudium an der Universität von South Dakota ab und begleitete sie nach Europa. Hilde zog in den 1. Bezirk in den Stoß im Himmel 3. Sie war wieder daheim. Die Stadt hatte sich verändert. Gott sei Dank. Die graue Nachkriegs-Ostblock-Tristesse war aufpoliert worden.
»Man könnte Wien inzwischen fast für eine westliche Metropole halten. Ich war fast 40 Jahre in Amerika, aber eigentlich war ich nie weg«, sagte sie zu ihren Enkeln, als sie im Sommer 1992 in der »Aida« saßen und Punschkrapfen aßen. »Wisst ihr eigentlich, dass Amerika so heißt, wie es heißt, weil der Kartograph Martin Waldseemüller aus Freiburg im Breisgau den neu entdeckten Erdteil nach Amerigo Vespucci benannte?«
Während sie noch am Punschkrapfen kaute, zündete sie sich eine Flirt an. In Amerika hatte sie ausschließlich Marlboro geraucht, weil es dort weder Flirt noch Smart zu kaufen gab; keine Produkte von Austria Tabak. Dann nahm sie einen Schluck von ihrer Melange. Auf ihrer Oberlippe hatte sich ein kleines Milchschaumbärtchen gebildet, in dem Teigbrösel schwammen. Dazu hing ihr nun lässig die Zigarette im Mund.
»Waldseemüller war ein Fleischhauersohn. Vor 500 Jahren. Er war wie berauscht von den Berichten Vespuccis. Die Frauen in dem neuen Land seien nackte, üppige Augenweiden und so lüstern, dass sie Männern den Saft von einem gewissen Kraut zu trinken gäben. Sobald sie dieses zu sich genommen hätten, blähte sich ihre männliche Rute auf. So steht’s bei Vespucci.«
»Was heißt lüstern?«, fragte Rudi, damals drei Jahre alt.
Die fünfjährige Rosa grinste. »Das sind Lampen. Teure Lampen. Wie im Schloss.«
Die Wien-Oma lachte hustend Rauch aus und bekam kaum Luft. Verschluckte sich. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie schnappte nach Luft, aber es kam keine. Es dauerte, bis sie sich gefangen hatte.
Rudi hatte ihr mit großen Augen ängstlich dabei zugesehen. »Du wirst an den Zigaretten sterben«, sagte er.
»Ach was, so ein gesunder Lungenkrebs wirft mich nicht um«, sagte Hilde und zündete sich an der Flirt, die sie während des Anfalls in den Aschenbecher gelegt hatte, eine neue an. »Der Krebs besorgt dir nur ein früheres Rendezvous mit Gott, aber verabredet bist du so oder so mit ihm.« Sie nahm Rosa an der Hand, und beide lachten und sangen zusammen das Knallerballer-Lied, das Hilde den Enkeln beigebracht hatte:
Schneider, süßer Herzenswaller!
Rooch nich solchen Knallerballer!
Heut noch riechen meine Kleider,
sehr nach jestern, lieber Schneider!
Nach der Beerdigung seiner Großmutter fuhr Rudi vom Zentralfriedhof in den 1. Bezirk und packte seine Tasche. Es war August 2010. Er war 20 Jahre alt. Seine Großmutter hatte Rosa und ihm Geld und die Wohnung Stoß im Himmel 3 vererbt. 10 000 Euro hatte er nun und keinen Plan. Rosa und seine Oma hatten bis kurz vor deren Tod regelmäßig im Raucherraum des Allgemeinen Krankenhauses gesessen – die Wien-Oma schon unter großen Schmerzen und atemlos. Wegen der Lungenentzündungsgefahr blieb das Fenster zu. Die Luft war aus dem Rauch verschwunden. Kein Quentchen Sauerstoff war im Raum. Noch drei Tage vor ihrem Tod saßen Rosa und die Wien-Oma da und redeten. Rudi hatte sie angefleht, vernünftig zu sein. Aber die Oma lächelte ihn nur müde an, und Rosa sabotierte seine Versuche mit Lungentorpedos der Marke Gauloises Blondes.
Jetzt lag Hilde unter der Erde mit ihren Stangen Flirt, Smart und Marlboro. Ein Flirt mit dem Teufel. Als sein Vater starb, war Rudi noch ein Baby. Als Gretchen starb, war er mit drei Jahren immer noch zu klein, um Erinnerungen zu haben. Die sterbende Wien-Oma hatte er jedoch sehr bewusst erlebt.
Er war erschöpft. Traurig und erschöpft. Rosa würde nach Düsseldorf gehen, in die Heimatstadt ihres Vaters, und bei Andreas Gursky Fotografie studieren – dann wäre er ganz allein. Sie hatte schon ein Semester an der Universität für Angewandte Kunst in Wien studiert und eine Serie mit Tieren gemacht. Eine Tierarmee. Sie hatte kleine Stahlhelme hergestellt und sie Wellensittichen aufgesetzt, Sperlingen und Spatzen, aber auch Katzen und Hunden. Soweit die Tiere es zuließen, hat sie ihnen auch feldgrüne Uniformen genäht und angezogen. Dann fotografierte sie die Tiere, als seien sie in einer Schlacht. Vegetevolution – the animal spring hatte sie die Serie genannt. Gursky gefiel’s – sie würde an die Kunstakademie gehen, und er wäre ganz allein in Wien.
Rudi nahm die Tasche und das Geld und fuhr zum Westbahnhof. Er kaufte sich ein Interrailticket. Es war ein kühler, klarer Sommertag. Am Bahnhof waren andere Rucksackreisende in seinem Alter. Ein Tiroler stand neben ihm am Gleis. Für zwei Wochen wollte er auf Interrail fahren – Abenteuer! Neben ihm stand ein deutlich älterer Mann, ebenfalls mit Rucksack. »Mein Vater«, erklärte der junge Tiroler. »Wir fahren zu zweit. Sicher ist sicher. Man weiß ja nicht!« Der Alte nickte ihm zu.
»Na dann, tolle Abenteuer mit deinem Vater«, sagte Rudi und stieg ein.
Hütteldorf. Der Wiener Wald. Er schlief ein.
Nach dem Konzert im »Le Silex« schlenderten Rudi und Laetitia zusammen mit Tulip durch die engen Gassen mit den windschiefen Fachwerkhäusern zum Quai de la Republique. Sie hatte ihre Highheels ausgezogen und trug sie in der Hand. Zwei kleine Menschen inmitten großer Gefühle.
»I like your red thatch. Your hair. It is impressing. You must pay attention, when you go cycling. That your hair will not come into the spokes, the wheels.«
Laetitia lachte. Tulip, ihr französischer Hirtenhund, humpelte zwischen ihnen. Seine Krallen waren herausgerissen worden, weil er damit Gänse attackiert hatte. Tulip hatte ursprünglich Odile Dhuicq gehört, der Nachbarin ihres Ururgroßvaters, die einen Bauernhof führte, der für seine Gänsestopfleber bekannt war. Die Vogelgrippe und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen hatten sie beinahe ruiniert. Sie wollte den hinkenden und gänsejagenden Hund erschießen, also kümmerte sich Laetitia um Tulip. An ihrer Wohnungstür in Mailly-le-Château hing jetzt ein Warnschild: Attention au chien bizarre! Bizarr war Tulip in der Tat. Er roch nach Pansen und Andouillette, der Kalbsdarmwurst, um die man Auxerre und Burgund auf der halben Welt beneidet.
An einer Weide begrüßte Laetitia die Kühe mit Namen. »Claudette, Adelais, Ginette, Lilou, darf ich euch vorstellen?«
»Rudi«, sagte Rudi.
»Rudi«, wiederholte sie. »Kühe mit Namen geben mehr Milch, wusstest du das? Man hat das herausgefunden. Bei Kühen, die einen Namen tragen, liegt der Ertrag um 258 Liter pro Jahr höher als bei namenlosen Tieren. Ich heiße Laetitia.«
»Laetitia«, wiederholte er.
Später saßen sie an der Yonne und schauten auf die Hausboote, die vor Anker lagen. Die Schleusen waren über Nacht geschlossen, auf dem Fluss und im Kanal herrschte Ruhe. Sie flocht ihm die Haare zu einem Zopf und küsste ihn. Tulip kam mit seiner Schnauze zwischen sie und leckte ihnen übers Gesicht. Der Pansengeruch trübte kurz die Szene. Laetitias Haare standen in alle Richtungen. Sie drückte Rudi auf den Boden der Quaimauer. Er war erstaunt über ihre Kraft. Er verirrte sich in die Landschaft ihres Gesichts. Und es gefiel ihm, sich in ihr zu verirren. In dieser Nacht in Auxerre wurden seine rote Mähne und ihr dünnes, blondes Haar zu einer Frisur.
Laetitias Eltern waren nach Vietnam gegangen, als sie 15 war. Auf Phu Quoc hatten sie ein kleines Hotel am Strand eröffnet. Leider wurden dort immer wieder Touristen von der Strömung erfasst und ertranken. Schlechte PR – wenig Gäste, wenig Geld.
Sie zog zu Ulysse Hervé, ihrem Ururgroßvater. 101 war er, als sie 2006 in sein Haus kam. Ulysse war Sozialist. Er hatte als Bub noch den legendären französischen Sozialistenführer Jean Jaurès gesehen.
Er musterte Rudi streng, als sie sich das erste Mal in Mailly-le-Château begegneten.
»Er ist Deutscher?«, fragte Ulysse.
»Er ist in Deutschland geboren, lebt in Wien, und seine Mutter war Amerikanerin.« Laetitias Haare waren vollkommen verfilzt, weil sie gerade miteinander schliefen, als der Alte anklopfte.
»Er ist sehr klein«, sagte Ulysse. »Sehr klein und Deutscher. Aber wie ich sehe, ist er unten stark!« Ulysse lachte, und Laetitia zog die Decke über den nackten, rothaarigen Mann in ihrem Bett.
»Rotes Schamhaar?«, fuhr Ulysse fort. »Wenn er nackt auf der Straße steht, halten die Autos an, weil sie denken, die Ampel zeigt rot!« Ulysse bekam einen Lachanfall und musste sich an der Tür festhalten. Tulip sprang begeistert an ihm hoch.
»Die deutschen Sozialisten, pah, welche Schlappschwänze«, sagte Ulysse, als er sich wieder gefangen hatte. »Reden nur, tun nichts. Bevor deutsche Sozialisten einen Bahnhof besetzen, lösen sie vorher eine Bahnsteigkarte. Am Ende sagen sie: ›Liberté? Fraternité? Egal!‹.«
Er ging kurz aus dem Zimmer und kam mit einer Flasche Crémant und drei Gläsern zurück. Ulysse Hervé war Sozialist und liebte Crémant de Bourgogne. Der Crémant hatte seinen Namen von der Creme, dem Schaum, der sich beim Einschenken bildet. Acht Millionen Flaschen Crémant lagern in Bailly in einem Bergstollen, und Ulysse Hervé sah aus, als lagerten sie dort nur für ihn.
»Trink, mein Schatz! Und der Rote soll auch trinken. Santé! Am 1. Mai werden wir deinen kleinen Freund hissen, jetzt soll er trinken, der Deutsche. Die Deutschen finden schwer ein Mittelmaß – entweder zu schlapp oder zu streng. Oh, diese Sozialisten aus dem Osten. Ich war in Karl-Marx-Stadt, heute heißt es Chemnitz – haben sie Marx auch umbenannt in Chemnitz? Rotkäppchensekt musste ich trinken, was für Kinder. Gebrüder-Grimm-Gesöff, wer soll so etwas trinken?«
Man wollte den Sozialismus zerstören, das wurde Ulysse klar, als er den ersten Rotkäppchensekt trank. Rotkäppchensekt und Spreegurken – das war alles? Dafür sollte man in die neue Zeit ziehen? Er kam damals zurück nach Lucy-sur-Yonne und erklärte den Genossen, dass sogar die Nazis besser getrunken hätten.
»Wer seinem Gaumen keine Freude gönnt, kann mir am Arsch vorbeigehen, ich furz ihm in sein Arbeiter- und Bauerngesicht. Voilà!« Ulysse öffnete eine zweite Flasche, diesmal Rosé. »Was wollten wir? Besser leben. Verteilen, was da ist. Und wer das nicht kapiert, dem nehmen wir es weg. So simpel ist das. Aber ihren Sekt, den können sie dem bösen Wolf geben, hab ich mir damals gedacht. Von dem nehm ich nicht einen Schluck. Den möchte ich nicht teilen. Pah! Den sollten sie behalten, diese konterrevolutionären Arschnasen!«
Ein Salonkommunist ohne Salon war er. Ulysse hatte noch eigenhändig Frachtschiffe auf der Yonne gegen den Strom bis nach Clamecy gezogen, weil die Pferde im Ersten Weltkrieg gebraucht wurden. Alleine hatte er ein mit Chablis beladenes Boot gezogen. Auf dem Treppelweg hatte er sich Meter um Meter vorgekämpft, das Tau um den Bauch gewickelt, 30 Kilometer flussaufwärts, 1917, da war er zwölf Jahre alt. Und in Clamecy am Nivernais hatte er den Flößern geholfen. Oberhalb des Wehrs bei der Schleuse wurden Baumstämme gesammelt, bis der Fluss kilometerlang ein einziges Holzlager war. »Es war kein Wasser mehr zu sehen, so viel Holz war da. Dann begannen wir, aus den Stämmen Flöße zusammenzubinden. Bis zu 72 Meter lange Flöße. Neun Tagesreisen über die Yonne und die Seine bis nach Paris haben wir sie geschwemmt.« Ulysse krempelte sein Hemd hoch und zeigte eine Tätowierung. Das Wappen der St.-Nicolas-Bruderschaft, der Bruderschaft der Flößer: zwei schräg gekreuzte blaue Flößerhaken.
Rudi hatte von all dem wenig verstanden, denn Ulysse sprach Französisch. Laetitia übersetzte. Sie liebte ihren Ururgroßvater, der so stark wie ein 60-Jähriger schien – wie ein 60-Jähriger, der stark wie ein Baum war. Natürlich war er im Zweiten Weltkrieg in der Résistance gewesen. Er hatte die Deutschen aus der Höhle in Bailly gesprengt, wo sie Waffen bauen wollten. Es war seine Höhle, seine Crémant-Höhle – da kannte er keinen Spaß, als Sozialist, Franzose und Trinker. Die St.-Nicolas-Bruderschaft hatte die Deutschen aus dem Tal geschossen.
»Sagt man ›furchteinflößend‹?«, hatte Laetitia gefragt, nachdem sie erst ein paar Wochen im Goethe-Institut Deutsch lernte. Sie war ein unglaubliches Sprachgenie. Während Rudi Französisch sprach wie ein Neandertaler, fragte sie bereits nach Feinheiten. »Sie waren Furchteinflößer, die Männer von St. Nicolas«, schwärmte Laetitia. »Ulysse und die starken Jungs. Da hatten die Nazis pas de chance!«
Nach dem Krieg arbeitete Ulysse am Canal du Nivernais. Er hob die Fahrrinne aus, verstärkte den Uferschutz und reparierte die alten Schleusen. Daneben war er gewählter sozialistischer Deputierter in Lucy-sur-Yonne, der größeren Schwester von Mailly-le-Château.
Ein Bruder von Laetitias Vater lebte auch mit im Haus, Louis Hervé. Louis hatte das Down-Syndrom. Nach einem Schlaganfall war außerdem seine rechte Gesichtshälfte gelähmt. Louis bewachte das Kriegerdenkmal in der Mitte des kleinen Hauptplatzes mit der Inschrift:
1914–1918
Lucy-sur-Yonne, ses enfants, morts pour la France.
Die Namen der gefallenen Kinder von Lucy-sur-Yonne standen dort. Damals war auch irgendein Louis Hervé unter den Toten. Deshalb fühlte Louis sich verantwortlich. Tag und Nacht versuchte er dort auszuharren. Sobald er eingeschlafen war, trug Ulysse ihn nach Hause ins Bett. Jede Nacht.
Ulysse hatte Bärenkräfte. Rudi ging manchmal mit ihm ins Holz und half ihm beim Fällen und Zerschneiden. Es war unheimlich. Ulysse konnte halbe Bäume alleine stapeln, ohne Hilfsgeräte, mit bloßer Muskelkraft. Stämme, die 200 oder 300 Kilo wogen. Der Mann war deutlich über 100, aber körperlich in weit besserem Zustand als der mehr als 80 Jahre jüngere Liebhaber seiner Ururenkelin.
Während sie arbeiteten, schimpfte Ulysse auf die Banken. Die City of London wollte er mit der Bruderschaft besuchen gehen. Banker waren für ihn schlimmer als die Nazis in der Höhle von Bailly, weil sie bereits gewonnen hatten. »Die Nazis hatten Gesichter. Aber wie sehen internationale Geldströme aus? Das Kapital hat uns besiegt, weil wir nicht wachsam waren. Wir hätten sie mit Gewalt stoppen müssen. Abknallen, aufhängen, wenn sie nicht zuhören. Wir waren human – und was ist das Ergebnis? Die Untoten zählen das Geld, das uns allen gehören müsste!«
In den 70er Jahren hatte Ulysse bei Texas Oil gearbeitet. Das hatte Rudi von Laetitia erfahren. Er war überrascht. »Wie kann das sein? Er war Kommunist und schon damals viel zu alt dafür!«
»Er hat in Nigeria für Texas Oil nach Öl gesucht. Im Dschungel. Alle 50 Meter Probierbohrungen.«
»Probebohrungen. Ich fass es nicht, wie phantastisch du Deutsch sprichst. Das ist wie ein Wunder. Wir sollten Zeitungen und das Fernsehen anrufen, dich ausstopfen lassen und im Goethe-Institut ausstellen. Die beste Deutschschülerin der Geschichte: Laetitia Hervé.«
»Mit deinen vielen Haaren lass ich mich ausstopfen. Dann bist du immer in meiner Nähe. Okay, darauf lass ich mich ein, Monsieur. Ja, alle 50 Meter Probebohrungen, alle 100 Meter Dynamit. So haben sie sich durchs Land gearbeitet. Mein starker Ulysse hatte dort furchtbare Angst. Kannst du dir das vorstellen? Ulysse und Angst? Er fürchtete sich, wenn er im Dunkeln zum Pinkeln aus dem Zelt musste. Er pinkelte ins Schwarze, ins Nichts. Und das schwarze Nichts machte unheimliche Geräusche. Das war furchtbar für ihn.«
»Trank er Sekt im Urwald?«
»Natürlich«, lachte sie. »Kannst du dir vorstellen, dass er sonst dort gewesen wäre?«
»Aber ich versteh das trotzdem nicht«, sagte Rudi. »Er als Linker in einer erzkapitalistischen Ausbeuterfirma? Im Wald ruft er jeden Tag die Revolution aus, aber vor 30 Jahren hat er noch mit Mitte 70 dem Klassenfeind den Arsch geputzt? Texas Oil ist ja nicht gerade Amnesty International.«
Sie lachte. »Alle geologischen Informationen aus seinen Bohrungen gab er weiter an eine Gruppe von schwarzen Studenten aus Lagos. ›Your oil is your oil‹, sagte er. Aber das Pinkeln, das machte ihm Angst.«
»Und die Amis?«
»Die waren ihm egal. Die bezahlten ihn, und er machte seine Arbeit, so what? Die Weitergabe an die Nigerianer war ein Extra, eine Zusatzschicht, die er Texas Oil nicht verrechnete.«
Als Rudi in seinem Hilfsfranzösisch am nächsten Tag mit Ulysse im Wald über Nigeria und Texas Oil sprechen wollte, winkte der alte, starke Mann direkt ab. »Eine Riesenscheiße haben die mit dem Öl gemacht. 1983 haben sie eine Militärdiktatur begonnen. Dafür soll ich gezittert haben beim Pissen? In ständiger Furcht, dass mir ein Löwe den Sack abbeißt? Für eine Militärjunta beißt mir ein krankes Nilpferd in die Eier? Hast du schon mal gesehen, was die für Zähne haben? Ich will nie mehr zwischen wilden Tieren pinkeln. Nie mehr. Nicht mal für die Revolution.«
Rudi fragte sich damals, ob Ulysse noch Sex hatte. Tage später sah er Odile Dhuicq aus seinem Schlafzimmer kommen. Odile war 73. Aber Ulysse mochte scheinbar deutlich jüngere Frauen.
Ich
Ich fuhr in der U4. Ein arabischer und ein dänischer Diplomat saßen mir gegenüber, offenbar auf dem Weg zur UNO-City.
»Er will, dass seine Frau verschleiert geht und nicht nackt«, sagte der Araber.
»Nackt? Sie geht nackt herum?«, fragte der Däne.
»Nicht wirklich nackt. Aber wenn sie nicht verschleiert geht, ist sie für ihn nackt.«
»Sie sind Saudi?«
»Ja.«
»Ich habe gehört, dass in Riad Gotteskrieger nicht mehr eingesperrt werden. Die Saudis geben ihnen jetzt Kunstunterricht, schenken ihnen ein Auto und lassen sie eine Braut aussuchen, um sie zu läutern. Resozialisierung für Al-Kaida-Kämpfer. Sehr liberal. Die haben Erdbeerlimonade im Kühlschrank und bekommen gebratene Wachteln zum Mittagessen. Ein Schwimmbad gibt’s und sogar Rasen, mitten in der Wüste. Die einzige Bedingung, um in dieses Paradies zu kommen: Du musst radikal sein. Dann gibt’s Brainwash-Programme mit Kunsttherapie und Aggressionsbewältigung. Wenn man entlassen wird, gibt’s eine kostenlose Wohnung, dort in Hayar – so heißt das Viertel. Ein Schlafzimmer rosarot und goldfarben gestrichen mit einem Kingsize-Bett und einer Braut darin, verschleiert oder nackt. Und zusätzlich noch 33 000 Dollar! Großherzigkeit gegenüber den Tätern soll deren Hass und Rachsucht besiegen. Als ich das gelesen hab, wollt ich mich gleich anwerben lassen.«
»Ich kenn das Projekt«, sagte der Saudi. »Die makellose Erfolgsbilanz der ersten Zeit ist inzwischen ein bisschen getrübt. Neun Absolventen aus Hayar wurden mittlerweile wieder verhaftet. Und im Januar haben zwei weitere ehemalige Häftlinge im Internet verkündet, sie hätten die Al-Kaida-Führung im Jemen übernommen.«
Ich dachte mir, dass die Weltwirtschaftskrise tatsächlich existent sein musste, wenn Saudis mit der U-Bahn fuhren.
In der Gratiszeitung las ich:
Gericht nimmt Kind weg – wegen Karies.
Pfarrer vergisst aufs Brautpaar! Dechant versetzt Festgesellschaft in Wien-Floridsdorf. Beinahe-Eheleute sind jetzt sauer auf Priester: Kirchenaustritt.
Mutter rettet totes Baby.
19 Kandidaten bluten – Zwiebelmassaker bei SAT1-Kochshow.
Ich blätterte um.
Superknut
Knuts Schwester Irma sagt: »Ich habe heute von der Königin von Jordanien einen Kuss auf die Stirn und Salz aus dem Toten Meer geschenkt bekommen, weil ich sie aus der Donau gerettet habe. Sie ist aus einem Ausflugsdampfer gefallen und kann nicht schwimmen, wahrscheinlich weil sie nur das Tote Meer gewohnt ist, da drin kann man ja Zeitung lesen. Ihr Mann, der König Abdullah, hat sich sehr gefreut, weil er seine schöne Frau sehr liebhat, und er hat mir einen Palast in Amman geschenkt, wo wir …«
»Kannst du mal ruhig sein? Knut möchte vielleicht etwas sagen«, rufen ihre Eltern, ohne sie anzusehen.
»Nö, eigentlich nicht. Toll, das mit der Königin«, sagt Knut und nickt seiner Schwester anerkennend zu.
»Ach, paperlapapapao«, meint die brasilianische Tante. Alle nennen sie Großtante, weil sie über 1,90 m ist und an beiden Ohren Warzen hat, groß wie Weintrauben.
»Ja, paperlapapanski«, stimmt ihr die russische Tante zu. Sie heißt Größttante, weil sie über 2 Meter groß ist und eine Warze in der Pupille hat, so groß wie eine Mandarine. »Königin, na wenn schon. Aber Knut, beiß doch noch mal ab von der Tortinski!«
Und Knut beißt in die Mangokokostorte, die seine brasilianische Tante ihm zu Ehren gebacken hat, obwohl heute ja eigentlich der Geburtstag seiner Schwester Irma ist.
»Und wie sie ihm schmeckt, die Tortao«, ist die brasilianische Tante entzückt und wackelt mit den Weintraubenwarzenohren.
Und alle singen: »Hoch soll er leben, hoch soll er leben, drei Mal Knut!« Auch seine Schwester Irma singt mit, allerdings leise. Plötzlich sitzt Knut, wie auch immer, bei allen vier Großeltern auf dem Schoß, und alle geben ihm gleichzeitig einen Kuss auf die Stirn, und zwar auf die gleiche Stelle.
»Das gibt’s ja nicht. Ist das ein Trick? Wie könnt ihr mich denn alle gleichzeitig auf genau dieselbe Stelle küssen?«, fragt Knut verdutzt und kräuselt die Stirn.
»Gesehen, wie er die Stirn kräuselt? Klasse, was?« Knuts Eltern sind stolz wie Knut auf Knut. Das sagen sie so, wenn was besonders viel oder besonders gut ist: »Das ist ja toll wie Knut« oder »hoch wie Knut« oder »schlau wie Knut« oder »voll Knut«. Als Baby schiss er in die Windel? Haste nicht gesehen, wurden alle Omas, Opas und größten Großtanten dieser Welt angerufen. »Kackao?« »Kackinski?« »Bravao!« »Bravinski!«
R. G. (Morgen geht’s weiter.)
Es waren die Superknut-Folgen der letzten beiden Tage. Am Morgen war ich wie immer im »Sztuhlbein« frühstücken gewesen. Rudi war mit Tulip da. Der Hund roch tatsächlich unangenehm nach Pansen, aber wie er so krallenlos in dem kleinen Café herumhumpelte, schloss ich ihn gleich ins Herz.
Rudi saß mit dem Laptop da und schrieb den morgigen Superknut. Herr Sztuhlbein, der Wirt, stellte Tulip eine Schale mit Wasser unter den Tisch.
»Das ist gemein, dass er an ihrem Geburtstag eine Torte bekommt, sie aber nicht«, sagte ich.
»Find ich auch«, sagte Rudi. Heute hatte er die Haare zu einem Zopf gebunden.
»Und? Davon kann man leben?«, fragte ich und nickte zum Laptop hin.