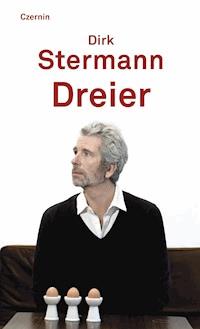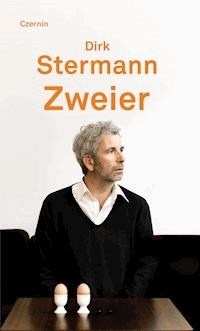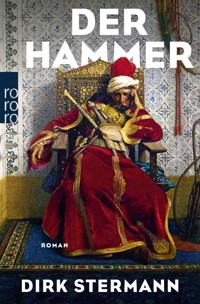9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Claude ist anders als andere Dreizehnjährige; da muss man gar nicht erst seine Faszination für die Geschichte der Todesstrafe in Wien kennen. Sein Vater ist Posaunenlehrer, die Mutter Ethnologin, und das so engagiert, dass eines Tages ein echter Indio in die Wohnung zieht. Eilig wird eine Mauer hochgezogen: Auf der einen Seite wohnt die Mutter mit Claudes Bruder und dem neuen Liebhaber, auf der anderen Claude und sein Vater. Der hat aber schnell auch eine Neue (Flötistin, Veganerin, Deutsche). Bald sind beide Eltern ausgezogen, Claude bleibt allein zurück, warum auch nicht? Überhaupt soll er weniger rumjammern, findet seine dicke Großmutter, und auch einmal an andere denken. Bleibt nur noch Taxifahrer Dirko aus der Nachbarwohnung, der ihn täglich in das Elitegymnasium fährt, wo Claude regelmäßig von den Reichenkindern vermöbelt wird. Dirko kommt aus Serbien, hat eine Hütte an der Donau und eine Schublade voller falscher Ausweise. Er ist mal Däne, mal Armenier und kann Geschichten erzählen ohne Ende. Von schmerzhaften Insektenstichen, schmutzigen Kriegsverbrechen und winzigen Glasfröschchen, deren Herz man schlagen sieht. Irgendwann lernt Claude an seiner neuen Schule auf einem alten Donaufrachtschiff ein Mädchen kennen. Liebe erwacht. Claude und Minako machen sich daran, ihre eigene Familie zu gründen, dabei sind sie beide doch noch so jung. Ob das ohne Schmerzen abgeht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dirk Stermann
Der Junge bekommt das Gute zuletzt
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Claude ist anders als andere Dreizehnjährige; da muss man gar nicht erst seine Faszination für die Geschichte der Todesstrafe in Wien kennen. Sein Vater ist Posaunenlehrer, die Mutter Ethnologin, und das so engagiert, dass eines Tages ein echter Indio in die Wohnung zieht. Eilig wird eine Mauer hochgezogen: Auf der einen Seite wohnt die Mutter mit Claudes Bruder und dem neuen Liebhaber, auf der anderen Claude und sein Vater. Der hat aber schnell auch eine Neue (Flötistin, Veganerin, Deutsche). Bald sind beide Eltern ausgezogen, Claude bleibt allein zurück, warum auch nicht? Überhaupt soll er weniger rumjammern, findet seine dicke Großmutter, und auch einmal an andere denken.
Bleibt nur noch Taxifahrer Dirko aus der Nachbarwohnung, der ihn täglich in das Elitegymnasium fährt, wo Claude regelmäßig von den Reichenkindern vermöbelt wird. Dirko kommt aus Serbien, hat eine Hütte an der Donau und eine Schublade voller falscher Ausweise. Er ist mal Däne, mal Armenier und kann Geschichten erzählen ohne Ende. Von schmerzhaften Insektenstichen, schmutzigen Kriegsverbrechen und winzigen Glasfröschchen, deren Herz man schlagen sieht.
Irgendwann lernt Claude an seiner neuen Schule auf einem alten Donaufrachtschiff ein Mädchen kennen. Liebe erwacht. Claude und Minako machen sich daran, ihre eigene Familie zu gründen, dabei sind sie beide doch noch so jung. Ob das ohne Schmerzen abgeht?
Über Dirk Stermann
Dirk Stermann genießt in Deutschland Bekanntheit als Schauspieler, Radio- und TV-Moderator; in seiner Wahlheimat Österreich «zählt er wohl zu den beliebtesten Deutschen» (Focus), da er dort seit vielen Jahren mit seinem Kompagnon Christoph Grissemann die bekannteste Talkshow moderiert und ein Bestsellerautor ist: Sein Roman «Sechs Österreicher unter den ersten fünf» verkaufte sich über 150000-mal.
Es ist heute schlecht und wird nun täglich schlechter werden – bis das Schlimmste kommt.
ARTHUR SCHOPENHAUER
0.0
An meinem vierzehnten Geburtstag hörte ich, wie die Wohnungstür aufgesperrt wurde. Ich erschrak. Da standen die drei Chinesen. Aber der Reihe nach.
1.0
Leicht, flüchtig, fast fruchtig. Als ob ein winziger Funke ein einziges Haar auf dem Arm ansengen würde.
Blutbienen, Furchenbienen
«Mein Vater, dein Großvater. Er hat bei einem Arbeitsunfall ein Bein verloren. Also wirklich verloren. Es sollte ihm im Spital angenäht werden, man konnte es aber nicht finden. Sie hatten es in den Kofferraum geschmissen, hieß es. Aber im Kofferraum war nur eine alte, rostfleckige Decke. Und ein Wagenheber. Das Bein deines Großvaters nicht. Weinst du?»
«Komm zur Sache, Papa.»
«Deshalb schaute er sich später immer um. Er hat sein Bein gesucht. Jemand hatte es verlegt, ein Kollege. Wir wissen es nicht. Irgendwo liegt das Bein deines Großvaters. Das linke. Du kennst die Maschinen, die Pappkartons zerkleinern? Da war er hineingeraten. In Rohrbach. Bei uns in Hühnergeschrei gab es so was nicht. Das waren Schmerzen! Obwohl, der Körper sendet da Hilfe aus, irgendeine Chemie, die dich das alles aushalten lässt.»
«Meinst du mich? Willst du mich trösten, Papa?»
«Dich? Nein, glaube ich nicht. Da geht’s ja um richtigen körperlichen Schmerz. Bei dir, das ist ja nur Trauer, also, nur. Ich weiß schon, gut, du bist sehr traurig. Das Bein deines Großvaters war mein Lehrer.»
«Das hast du uns schon erzählt, Papa, mehr als ein Mal. Opa hat Akkordeon gespielt und beim Spielen deinen Oberschenkel an seinen gebunden. So hast du Rhythmus gelernt.»
«Richtig, Claude. So hab ich Rhythmus gelernt. Weißt du, wie merkwürdig das war, als im Hausflur nur mehr fünf Schuhe standen? Meine, Omas und seiner.»
Papa biss in das Mohnweckerl. An seinen Lippen klebten Mohnsamen und Eigelb.
«Um was geht’s, Papa?»
«Ich musste so lachen, als dein Großvater danach das erste Mal mit uns schwimmen war. Mit der fleischfarbenen Prothese. Das war zu komisch. Er stieg die Leiter aus dem Schwimmbad hinauf, und das Wasser schoss links und rechts aus seiner Prothese. Wie bei einem Auto, das man aus einem Fluss zieht, wo es dann aus den Fenstern und dem Motor rausläuft. Als er starb, hat deine Großmutter den Bestatter gefragt, ob es einen günstigeren Sarg für Einbeinige gäbe. Gab es aber nicht.»
«Papa?»
«Sieh mal, deine Mutter ist Ethnologin. Da muss man doch sagen, gut, mit diesem Straßenmusiker, mit dem hat sie sich einen Traum erfüllt. Ein peruanischer Straßenmusiker. Sie ist im Panflötenparadies. Besser, als wenn sie sich einen Pantomimen genommen hätte, oder? Claude? Stell dir vor. Lieber so einen Poncho-Compañero als einen Kerl, der nur so tut, als täte er was, stimmt’s?»
Papa lachte. Ich sah, dass auch an seinem Schneidezahn Eigelb klebte.
«Claude, wir haben uns das so überlegt. Wir behalten die Wohnung, ziehen aber eine Wand ein. Drüben ist Lateinamerika, bei uns ist Österreich. Broni kommt rüber zu den Inkas, und du bleibst bei mir. So haben wir uns das gedacht. Deine Mutter ist ja nicht komplett weg, wie Großvaters Bein, sie ist hinter einer provisorischen Wand. Wände und Mauern sind nicht für die Ewigkeit gebaut, frag die Berliner.»
«Und die Chinesen, Papa?»
«Welche Chinesen, Claude? Außerdem ist das bei denen aus touristischen Gründen. Ich war mal mit dem Bruckner Orchester dort. Da ist nichts, Claude. Gar nichts. Wär da nicht die Mauer, wär da überhaupt nichts. Kein Tourist wüsste, wohin er schauen soll. Die brauchen die Mauer, die Chinesen. Aber wir brauchen keine Touristen. Wir beide haben uns. Und hinter der Wand sind Broni, deine Mutter und der Mayahengst. Besser als so ein Marionettenspieler. Kennst du die? Wo man Panik kriegt, dass sich die Scheißschnüre verheddern, und dann schaut man kurz zu und wünscht sich, dass die Scheißschnüre sich für immer verknoten?»
«Wieso wohnt Bronislaw bei Mama?»
«Frag deine Mutter. Sie hat das entschieden.»
«Wollte sie nicht, dass ich auch drüben wohne?»
«Nein, Claude. Außerdem müssen wir die Sachen aufteilen. Sie haben den Fernseher und wir das Klavier.»
«Wo ist Bronislaw?»
«Broni ist schon drüben. Er hat dein altes Zimmer. Ich habe deine Sachen ins Ethnokammerl gegeben. Die Masken hat sie mit rübergenommen. Die kann sie sich ja anziehen, beim Ethnosex.»
«Das Zimmer ist winzig, Papa.»
«Dadrin hat sie ihre Diplomarbeit geschrieben. Ist doch ein gutes Zeichen für deine Schulkarriere.»
«Mama hat fünfzehn Jahre an ihrer Diplomarbeit geschrieben.»
«Dann nimm halt Bronis Zimmer. Langweil mich nicht schon am ersten Tag, Claude. Ich weiß, wie lang sie gebraucht hat. Bemüh dich ein bisschen, ein interessanter Mitbewohner zu sein, ja?»
«Ich bin nicht dein Mitbewohner, ich bin dein Sohn. Ich find auch nicht alles brüllend komisch, was du witzig meinst, Papa.»
Papa nahm einen Schluck Kaffee. Vielleicht würde sich das Eigelb ja so vom Zahnschmelz lösen.
«Noch was, Claude. Mama möchte das jetzt am Anfang mal so durchziehen. Also ihn und die Situation. Ich hab ihr gesagt, dass wir sie in Ruhe lassen. Bis sich alles eingespielt hat. Für dich heißt das, tu so, als wär sie verreist. Als wär unsere Wohnung geschrumpft, nebenan wohnt irgendwer, den wir nur nerven, falls das Haus brennt. Natürlich kannst du sie grüßen, wenn du sie und Broni im Haus triffst oder auf der Straße. Aber es gilt, die beiden sind für dich nicht da. Klar wär es besser, sie könnte sich eine eigene Wohnung leisten. Wir wissen beide, dass das keine optimale Lösung ist, aber gut, machen wir das Beste draus. Okay, Claude?»
«Und du, Papa? Ist dir das egal mit dem anderen Mann? Seit wann weißt du das? Was sagt Mama? Ich will zu ihr.»
«Du nervst. Nein, du kannst nicht zu deiner Mutter. Sei nicht kindisch, du bist bald fünfzehn.»
«Ich werde in vier Monaten vierzehn.»
«Jetzt schau nicht wie ein Narr. Deine Mutter hat uns verlassen. So was passiert. Du hast Glück. Stell dir vor, du wärst Jeside im Islamischen Staat oder Jesidin. Sei froh, Claude. Ich mein, es gibt Tunten da unten, die haben Angst vor jedem Stein, der in der Wüste liegt. Dass er aufgehoben wird, und schon fliegt er ihnen an den Schädel. Du wohnst in Wien, du bist weiß, du bist jung, du bist Mitteleuropäer. Du könntest eins von einer Million Flüchtlingskindern in einem Flüchtlingslager in Afrika sein, dem eine Million Fliegen im Auge sitzt. Oder du könntest eine der einen Million Fliegen sein, die sich um einen Platz in der Augenflüssigkeit eines Kindes mit allen anderen Fliegen streitet.»
Papa blickte auf die Uhr. Mama hatte sie ihm zur Geburt von Broni geschenkt.
«Herrgott noch mal, du musst zur Schule. Lass den Serben nicht warten!»
Seit einigen Wochen fuhr Dirko Dumic mich jeden Tag zur Schule. Smbat Smbatjan. Res Moos. Storm Pontoppidan. Dirk van Quaquebeke. Dass mein Vater an diesem Morgen mit mir frühstückte, war ungewöhnlich. Normalerweise unterrichtete er während der Woche in Linz. Wolfgang Raupenstrauch.
«Raupenstrauch? Was ist denn das für ein Name?», hatte Dirko gesagt, als wir uns im Aufzug kennenlernten. Er stieg im sechsten Stock zu. Wir wohnen im achten. Ohne Terrasse, aber mit Blick, sagt mein Vater.
«Interessierst du dich für Raupen und Insekten? Für kleine Tiere?», hatte Dirko mich damals gefragt.
«Nicht sehr.»
«Ich dachte, wegen deinem Namen. Frösche?»
«Nein.»
«Lohnt sich aber. Ich war in Costa Rica. Ich hab dort für einen Schweizer gearbeitet, ein Taxiunternehmen an der Karibikküste. Er spielte Karten, ich fuhr mit seinem Wagen durch den Regenwald. Jassen in der Karibik. Lauter Schweizer Auswanderer. Käsefondue im Tropenregen. Die meisten Schweizer sind dümmer als Kapuzineräffchen. Aber sogar im Urwald haben sie kleine Kübel auf dem Tisch, für den Müll beim Essen. Musst du zur Schule?»
Ich nickte. Wir stiegen aus dem Lift. Ich bemerkte, dass er hinkte. Er sprach mit einem merkwürdigen Akzent, ein bisschen wie der bosnische Hausmeister im Theresianum, aber so, als käme der aus Bern oder Eriwan oder Kopenhagen.
«Ich kann dich fahren», sagte er. «Am Hohen Markt steht mein Taxi.»
«Ich hab kein Geld», sagte ich.
«Ich auch nicht», sagte er. «Dirko!» Er gab mir seine Hand.
«Claude», sagte ich.
«Wie Kleidung auf Englisch?»
«Nein, meine Mutter ist Ethnologin. Sie hat mich nach Claude Lévi-Strauss benannt. Der war auch Ethnologe.»
«Lévi-Strauss, hm? Weißt du, wie man die roten Erdbeerfrösche auch nennt? Blue Jeans Frogs. Wegen der Beine. Blaue Beine. Ich werd dich Blue Jeans nennen, ist dir das recht?»
Ich zuckte mit den Schultern. Sein graues Haar sah aus wie ein Helm. Ich hatte noch niemals zuvor so dichtes Haar gesehen. Der Ansatz begann in der Mitte der Stirn. Über den Augen hingen Brauen mit mehr Volumen, als mein Vater Haare auf dem gesamten Kopf hatte. Wie eine alte Vogelscheuche, die aufgeplatzt ist. Überall graues Stroh. Wie unser Bundespräsident sah er aus. Drahthaar. Mit so was ging man nicht zum Friseur, sondern zum Steinmetz. Leonid Breschnew, Heinz Fischer, Dirko Dumic. Augenbrauen wie Büsche und Haare wie dichte Hecken. Dirko kratzte sich, und es klang, als würde er einen Besen streicheln.
Wir waren am Hohen Markt angekommen, wo sein Wagen stand. Er stieg ein und öffnete von innen die Beifahrertür.
«Setz dich zu mir nach vorne. Wenn ich jetzt sage, musst du die Handbremse ziehen, gut?»
«Wieso, was soll das?»
«Kann sein, dass ich bremsen muss und nicht kann. Dann kommst du und rettest uns.»
Ich dachte, er macht einen Witz. Aber schon gleich bei der Ampel beim Würstelstand schrie er: «JETZT, Blue Jeans!»
Ich riss die Handbremse hoch. Wir hielten abrupt. Mit beiden Händen fuhr er sich unter den rechten Oberschenkel und massierte ihn.
«MS. Keine Sorge. Ist ein Automatic. Ich brauch eh nur einen Fuß. Und, dem Herrn sei es gepfiffen, das rechte Bein ist mein gutes. Oder sagen wir, von zwei Nieten das bessere. Auf einer Skala von eins bis zehn kriegt mein linkes Bein eine Eins, das Arbeitsbein immerhin eine Zwei.»
An seinem Rückspiegel baumelten zwei CDs. Das Licht der Wintersonne fing sich darin.
«So dekorieren die Indios ihre Hütten. Also, die Indios, die ich kenne. CDs blinken hübsch, auch ohne Strom. Warst du schon mal im Dschungel?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Da hab ich das Kreuzworttier gesehen. In echt. Drei Buchstaben?»
«Ara?» Meine Großmutter war manische Kreuzworträtslerin. Vor kurzem hatte sie gesagt:
«Kopfbedeckung mit drei Buchstaben. Mit H. Hupe? Nein, passt nicht.»
Da machten sich alle Sorgen um ihren Kopf. Ich fand’s eigentlich komisch. «Schreib enger, dann passt’s», hatte ich vorgeschlagen.
Wir standen noch immer an der Ampel an der Ecke Hoher Markt, Marc-Aurel-Straße. Obwohl Rot war, bog Armin Thurnher mit seinem Fahrrad ab. Er ist der Chef vom Falter. Es gibt Bilder von mir, wo ich als Baby den Falter lese.
«Wohnt ihr Raupenstrauchs schon lang hier?», fragte Dirko. Sein merkwürdiger Akzent faszinierte mich. Ich hatte zusammen mit meiner Mutter den Film gesehen, in dem ein schwarzer Matrose David-Bowie-Songs auf Portugiesisch singt, und ungefähr so sprach Dirko meinen Familiennamen aus. Portugiesisch, mit finnisch-serbischem Akzent, aber Deutsch. Als hätte man die ganzen Sprachen in einen Mixer geworfen.
«Ja, ich immer schon.»
«Ich bin grad erst eingezogen», sagte er. «Spannende Gegend.»
«Geht so. Viele Touristen.»
«Aber worauf laufen sie, die Touristen?» Er sah mich an. «Auf den Resten des ehemaligen Römerlagers. Unter uns sind die Grundmauern römischer Offiziershäuser. Und fünfhundert Jahre lang war das hier die wichtigste Hinrichtungsstätte Wiens. Hier war früher die Schranne, das Gerichtsgebäude. Die hatten eine eigene Kapelle, kennst du die Geschichte?»
Nein. Ich kannte die Geschichte nicht. Meine Mutter interessierte sich für alles außer dem, was in ihrer Nähe lag, und mein Vater für nichts außer dem, was für sein eigenes Wohlergehen von Belang war. Ich hatte nicht gewusst, dass die Kapelle Zur Todesangst Christi hieß, und es war mir neu, dass vor meinem Haus Enthauptungen und Vierteilungen stattgefunden hatten und dass genau da, wo heute der Würstelstand steht, der Pranger und der Galgen waren.
«So etwas muss man wissen», sagte Dirko. «Es ist wichtig, zu wissen, wo man herkommt und was geschehen ist. Glaub mir, ich würde wahrscheinlich noch immer friedlich in Belgrad leben, wenn die Leute dort das auch wüssten. Man kann nicht tun, als wäre nichts. Alles ist für immer, verstehst du? Alles, was du siehst, hörst und tust, bleibt. Es hilft nichts, nachher die Augen zu schließen oder die Ohren zuzuhalten oder die Hände in die Hose zu stecken. Als ob man einfach die Zeit totschlagen könnte, ohne die Ewigkeit zu verletzen. Was Menschen Übles tun, das überdauert sie.»
Ich war skeptisch. Was sollte das Wissen nützen? Aber ab diesem Tag fuhr Dirko mich regelmäßig zur Schule, und er nutzte die Fahrten, um mich abzufragen. Mein persönliches Fach: Hinrichtungen in Wien. Ich wurde mit der Zeit richtig gut.
«Am Tabor, Blue Jeans?»
«Warte, nichts sagen. Hinrichtungen durch Ertränken auf der Brücke? Der Verurteilte wurde in einen Sack eingenäht, und dann schmiss man ihn in den Fluss. Manchmal haben sie ihn auch ohne Sack ins Wasser geworfen und mit einer Stange unter die Wasseroberfläche gedrückt.»
«Sehr gut! Du bist ein schlauer kleiner Kerl.»
«Das ist nicht schlau, Dirko. Ich hab’s auswendig gelernt, das ist ja noch keine Gedankenleistung.»
«Red nicht wie ein Klugscheißer, konzentrier dich. Gänseweide?»
«Heißt die heute Weißgerberlände?»
«Ja, im dritten Bezirk. Willst du mich ablenken, oder was? Also, Gänseweide?»
«Hinrichtungen in der Regel durch Verbrennen.»
«Prima. Wer?»
«Was?»
«Wer wurde verbrannt?»
«Juden, Wiedertäufer, Hexen. Erst wurden sie geköpft und dann verbrannt.»
«Nur die oder noch andere?»
«Ich weiß nicht, was du meinst.»
«Gab’s nicht noch, sagen wir, tierisch geile Typen, die sie geköpft und verbrannt haben?»
«Ach so», rief ich erleichtert. «Klar. Sodomiten. Zum Beispiel sechzehnhunderteinundsechzig einen Schneider aus Traiskirchen, der mit einem Huhn geschlafen hat, und elf Jahre später einen Mann aus dem Waldviertel. Er teilte sein Schicksal mit seinem Pferd.»
«Bravo, Claude. Du bist schon ein richtiger Hinrichtungsexperte. Das mit dem Pferd wusste ich gar nicht. Die beiden waren ein Paar? Kommt daher Paarhufer? Kennst du den Witz? Frau schreibt Inserat. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal?» Er lachte. Plötzlich schrie er. «JETZT!»
Im letzten Moment riss ich an der Handbremse. Vor uns wurde ein Mann ohne Beine in einem Rollstuhl über die Straße geschoben. Sein Körper war seltsam klein, wie der eines Kindes. Das Gesicht völlig verbrannt, als hätte man ihn aus einem Waldbrand gezogen. Dunkelrot und geschwollen sah er aus, Hautfetzen hingen herunter, Bläschen schlug seine Haut. Er trug eine Perücke, die aussah wie die von Limahl, dem Sänger von Kajagoogoo. Meine Eltern haben eine Achtziger-Kiste, in der steht die Platte. Too Shy. Merkwürdig meliert war die Perücke. Die Augen des Mannes waren blutunterlaufen und schienen aus dem verbrannten Kopf zu quellen.
Mit diesen Augen starrte er uns an. Als wäre ein Körperwelten-Plakat lebendig geworden. Es war wirklich knapp gewesen. Handbremsen sind für plötzliche Bremsungen nicht geeignet.
«Jesus Maria», sagte Dirko.
«Du solltest nicht Auto fahren mit dieser Scheißkrankheit», schrie ich.
«Ich bin Taxifahrer. Da ist es eben notwendig, dass man Auto fährt. Denk mal darüber nach, Claude. Weiter geht’s. Was ist ein Würgegalgen und wo ist der Galgenhof?»
«Wir hätten ihn beinahe erwischt. Einen Behinderten!»
«Quatsch, wir hätten seine schöne nichtbehinderte Begleitung auch erwischt. Aber du hast das gut gemacht. Willst du Beitaxler werden? Wie bei einer Rallye? Du sagst mir an, wo ich fahren soll, und wenn mein Bein Pause macht, springt dein Bein ein. Wie klingt das?»
«Ich bin dreizehn. Ich darf gerade mal Rad fahren und zu Fuß gehen.»
«Stimmt. Du musst noch wachsen, Claude. Wachsen. Unten und oben.»
Er tippte mir an die Stirn. «Wann war die letzte Vollstreckung der Todesstrafe nach österreichischem Recht?»
«Neunzehnhundertfünfzig», murmelte ich. «Der Raubmörder Trnka wurde gehängt, er wollte Radioapparate stehlen und hat zwei ältere Frauen ermordet.»
«Wer war der Scharfrichter?»
«Ein Kinogehilfe, der schon im Ständestaat Scharfrichter bei Hinrichtungen auf dem Würgegalgen gewesen war.»
Er schlug mir anerkennend auf die Schulter. Wir fuhren auf dem Kopfsteinpflaster an der Spanischen Hofreitschule und am Palais Pallavicini vorbei.
Vor der Albertina sagte Dirko: «Schweinemarkt. Hieß früher so. Merk dir: Hinrichtung durch Erhängen. Hier stand das Augustinerkloster, die Mönche haben sich durch den Lärm bei den Hinrichtungen in ihrer Andacht gestört gefühlt, die ganzen Schaulustigen. Arme Mönche.»
In der Mitte des Platzes, an dem ich wohne, steht der Vermählungsbrunnen, auch Josephsbrunnen genannt. Er ist der Hochzeit von Joseph und Maria gewidmet. Dirko sagte, die waren verheiratet, obwohl Joseph wusste, dass sie mit Gott was hat.
«Wie dein Vater», sagte mein südamerikanisch-serbisch-Schweizer Dänenfreund.
Aber das ist anders. Als ich wie Jesus in der Krippe war, lebte meine Mutter noch monogam. Da hatte sie keinen Gott neben meinem Vater. Ich musste grinsen. Mein Vater hat mit Gott nur in der Vorstellung von Leuten etwas zu tun, die nicht an Gott glauben. Mit seiner Halbglatze und der gebeugten Haltung, dem Spitzbauch. Wenn Gott so aussähe wie Wolfgang Raupenstrauch, na bravo. Dann hätte man keine prachtvollen Kirchen zu seinen Ehren gebaut, sondern Garagen. Oder Abstellkammern; Abstellkammern passen noch besser.
Mein Vater kommt aus einem winzigen Ort in Oberösterreich. Hühnergeschrei im Tal der Kleinen Mühl. Heagschroa sagte meine Großmutter im Dialekt. Sechsundsechzig Einwohner. Eine davon hieß bis vor kurzem noch Raupenstrauch. Eine Freiwillige Feuerwehr mit eigener Feuerwehrkapelle. Eine Asphalt-Eisstock-Bahn, ein Gasthaus, ein Auto- und Landmaschinenhändler, der ein Wasserkraftwerk betreibt, das jährlich sechshundertfünfzigtausend Kilowatt Strom erzeugt. Wieso ich das weiß? Weil es sonst so wenig über Hühnergeschrei zu wissen gibt. Mein Großvater arbeitete früher für den Landmaschinenhändler, dann pendelte er bis nach Linz, um bei der VOEST zu arbeiten, am Ende landete er beim Billa in Rohrbach, wo sein Bein in die Kartonpresse kam. Seine Mutter, meine Urgroßmutter, war im Krieg gefallen. Sie war eine Überzeugte, wie es hieß, schnitt sich die Haare kurz, besorgte sich in Aigen-Schlägl einen Stahlhelm und zog in den letzten Wochen des Krieges den Amerikanern entgegen. Sie wurde irgendwann am Inn erschossen.
Der Kriegerinnenwitwer-Großvater spielte Akkordeon und band sein Bein an das meines Vaters, und so lernte mein Vater Rhythmus. Eine der Familiengeschichten, die mein Vater zu wiederholen nicht müde wird. Deshalb wurde er musikalisch, deshalb kam mein Vater zu den St. Florianer Sängerknaben, deshalb studierte er Musik, und deshalb ist er heute Posaunenlehrer am Institut für Blechbläser und Schlagwerk an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Er spielt Ventilposaune, wie fast alle in Mitteleuropa. Mahlers Zweite, Dvořáks Neunte, Vier ernste Gesänge von Brahms. Die Lieblingsstücke meines Vaters. Man sagt, er sei ein Kraftposaunist. Er klingt wie Joseph Alessi und Zoltan Kiss, sagt man. Ohne sie ganz zu erreichen.
Blockflöte, Tenorhorn, Posaune. So kam er zu seinem Instrument. Studium in Wien. Bruckners Etude für das tiefe Blech, damit hatte er sich am Konservatorium beworben. Selbstbewusst, weil er gerade den dritten Platz bei prima la musica gewonnen hatte und den zweiten bei Musica Juventutis. Linkisch war er, bäuerlich. Ein Tölpel vom Land.
«Wie Bruckner, als der nach Wien kam», sagt er selbst von sich. «Gustav Mahler hat ihn ein zufälliges Genie genannt, halb Gott, halb Trottel.»
Und Bruckner war ja auch St. Florianer Sängerknabe gewesen.
«Ein Landei, ein devoter Orgelknecht. Er betete täglich und war völkischer Antisemit, wie Wagner», dozierte mein Vater. Bruckner himmelte Wagner an, fuhr nach Bayreuth, Wagner machte ihn betrunken und setzte ihn in den nächsten Zug zurück nach Österreich. «Wagner, der kleine Giftzwerg.»
Bruckner war ein lebenslang Einsamer, verliebte sich in jede Achtzehnjährige, die ihm begegnete, und schrieb ihr Heiratsanträge. Immer erfolglos. Kein Wunder, bis zu achtundsechzig Jahre Altersunterschied lagen zwischen ihm und seinen Auserwählten.
«Ehrlich, welche junge Frau legt sich gern auf einen stinkenden Greis, dem die Haare aus den Ohren schießen und dessen Schwanz nicht mehr gehorcht, weder beim Pinkeln noch beim Vögeln», sagte Papa.
Bruckner trug, sagte Papa weiter, aus Angst vor unwillkürlichem Samenerguss ein wasserdichtes Unterkleid, wenn er sich in öffentlicher Gesellschaft befand. Er hatte furchtbare Panik vor feuchten Tagträumen.
«Jedes Mädchen, das er sah, machte ihn nass, den Irren.» Papa schüttelte verächtlich den Kopf. «Er zeigte sich Mädchen auch nackt», sagte er.
«Und geizig war er. Er ließ anfragen, ob er in Linz die Reste der Henkersmahlzeiten gratis bekommen könne, die von den Verurteilten nicht aufgegessen worden waren. Und nach so einem ist die Universität benannt, an der dein Vater arbeitet. Fang an, dir Sorgen zu machen, Claude. So etwas färbt ab. Wie der Künstler Flaz, der seinen Hund ‹Hitler› genannt hat. Als Kunstaktion. Aber stell dir vor, Claude. Wie alt wird so ein Hund? Fünfzehn? Du rufst fünfzehn Jahre lang mehrmals am Tag: Hitler! Brav, Hitler. Komm her, Hitler, Platz, Hitler! Glaubst du nicht, dass das Spuren hinterlässt? Vielleicht macht Bruckner das mit uns auch an der Uni. Geniale Musik, aber ein Narr. Ein hundsbegabter Narr. Er litt unter Zählzwang! Er fing Krebse, klebte ihnen brennende Wachskerzen auf den Panzer und ließ sie mitten in der Nacht auf dem Gottesacker umherlaufen. Auf dem Friedhof. Um die Bauern zu schocken.»
«Das ist doch eine gute Idee», sagte ich.
«Ja, stimmt. Du hast recht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Deine Mutter hält Bruckner für reines Blechgedröhne mit sich ewig wiederholender Ladehemmung. Es geht bis kurz vor den Orgasmus, Pause. Wieder. Erotik, die Musik richtet sich auf: Pause. Wasserdichtes Unterkleid. Ladehemmung.»
Später, nachdem die Wand unsere Wohnung schon trennte, sagte Papa einmal, die Hände vorm Gesicht, betrunken weinend: «Jeden Freitag esse ich mit deiner Mutter zu Abend. Nur wir zwei. Und wir reden über uns. Legen alle Karten auf den Tisch. Was stört dich an mir, fragt sie. Was stört dich an mir, frage ich. Am Tag vor dem Inkaschwein sagte sie: Mich stört nichts an dir. Nur finde ich, dass du die Tomaten falsch schneidest. Du schneidest sie in runde Scheiben, ich mag das nicht. Ich halbiere sie und viertel sie dann. Ich kann diese Scheiben nicht essen. Und sonst? Hab ich deine Mutter gefragt. Gibt es sonst etwas? Nein, hat sie gesagt. Sonst stört mich nichts.»
Bruckners Etude für das tiefe Blech war die große Prüfung seines Lebens. Er spielte ohne Ladehemmung und bestand. Er wurde aufgenommen am Musikkonservatorium in der Johannesgasse, betrank sich im Alt Wien, am Nebentisch saß eine dunkelhaarige Studentin in einem großmaschigen beigen Pullover.
«Deine Mutter trug nichts drunter», erzählte mein Vater. «Sie lebte damals in ihrer Ethnologenwelt, gedanklich war sie nackt in Melanesien, und innerhalb von Sekunden sah ich mich nackt neben ihr, nur ohne all die Wilden an unserer Seite.»
Meine Mutter heißt Ruth. Sie hat Augenbrauen wie Frida Kahlo. Wenn ich sie vermisse, schau ich in den Spiegel, nur auf die Partie über den Augen.
«Du hast die Augenbrauen deiner Mutter», sagt mein Vater, und ich antworte: «Nein, ich habe meine eigenen.»
Aber es stimmt. Mama und ich sind über den Augen Zwillinge.
Meine Mutter sieht aus wie eine arabische Terroristin, findet mein Vater. «Meine Nahostbraut», nennt er sie. Nannte er sie. Heute weiß ich nicht, wie er sie nennt.
Umm sagte ich als Kind zu ihr. Das gefiel ihr. Fernweh in der Häuslichkeit. Ich glaube, dass mein Vater das ins Spiel gebracht hat. Der Muttertitel seiner Nahostbraut. Als sie in Istanbul in Beyoğlu die anatolischen Frauen in ihrem Alltag beobachtete, unterschrieb sie ihre Briefe mit Anne, dem türkischen Wort für Mutter. Ich erinnere mich, dass mein Vater ihr am Flughafen ein Güle güle, gülüm hinterherrief, wenn sie durch die Absperrung ging. Gehe in Frieden, meine Rose. Güle güle, sevgilim. Gehe in Frieden, meine Liebe.
Damals schien alles gut zu sein. Mein Bruder war so klein, dass sie ihn mitnahm nach Istanbul. Ich ging schon zur Schule und blieb mit Herrn Raupenstrauch in Wien. Aber eigentlich lebte ich in diesen beiden Jahren bei meiner Inneren Oma, die so heißt, weil sie auch im ersten Bezirk, in der Inneren Stadt wohnt. In der Gölsdorfgasse am Rudolfsplatz, dem Zentrum des alten Tuchviertels. Im Haus meiner Großmutter befindet sich ein Institutsraum der Theaterwissenschaft. Eine Kindertheaterprofessorin war hier im Jahr meiner Geburt aus dem Fenster gesprungen.
Unten ging in genau dem Moment eine Gruppe aus dem angrenzenden Montessori-Kindergarten vorbei. Sie knallte neben den Zwergen auf den Asphalt. «Zu performatives Kindertheater, wenn du mich fragst», sagt meine Oma jedes Mal, wenn sie über diesen Selbstmord spricht.
Sie ist stolzdick. So nennt sie das. Fettwüchsig sagt mein Vater. Fettwüchsig und überernährt. In jedem Dezember verkündet sie als Neujahrsvorsatz: «Mehr Heide!» Und sie setzt das konsequent um. Heide Camesina ist die dickste Großmutter Wiens, da bin ich mir sicher. Wie meine dünne Nahostmama mit ihrer blassen, aufgepumpten eigenen Mutter verwandt sein soll, bleibt ein Familienrätsel. Jeder Unterarm meiner Oma wiegt mehr als meine zierliche Mutter. Seit Papas Spitzbauch wächst, glaube ich eher, dass er mit seiner Schwiegermutter genetisch verwandt ist.
Die Innere Oma hat einen Balkon mit einem Naschbeet. Dort wachsen Erdbeeren. Und irgendwann wuchsen auch Erdbeeren auf dem Steinboden ihrer Terrasse.
«Die hat der Wind gepflanzt», erklärte sie mir schmatzend. So war es mit meinem Vater vielleicht auch. Irgendwann flog ein Samenkorn meiner Oma von Wien nach Hühnergeschrei, und aus dem wurde mein Vater. Oder ein Ei. Papa hat auch helle Haut, wie die Innere Oma. Bronislaw und ich kommen nach unserer Mutter. Sobald morgens im Zimmer das Licht eingeschaltet wird, werden wir braun. Während Papa sich im Sommer auch nachts eincremen muss.
Papa war in diesen zwei Jahren mit seiner Posaune in Linz und Mama mit Broni in Istanbul. Fünf Tage die Woche unterrichtete Papa oberösterreichische Jungbauern und Stahlarbeiter in der Posaune.
Ich lag in der Gölsdorfgasse im Gästezimmer der Inneren Oma auf dem Boden. Meine blaue Kinderplastikposaune neben mir, an der Wand eine Postkarte meiner Mutter mit der Hagia Sophia oder mit orientalischen Eseln. Kuss und ich sehne mich nach dir, Claude! Anne.
Ich lag dort alleine. Wahrscheinlich habe ich damals schon für heute geübt. Ich lag auf dem Boden, gleichmäßig, wie Papa es mir beigebracht hatte. Gleichmäßig auf dem Boden liegen. Die Innere Oma aß sich ihrem eigenen Platzen entgegen, und ich lag gleichmäßig auf dem Boden. Ich war sechs oder sieben und übte die Zwerchfellatmung. Papa war nicht da, aber sein Übungsplan. Ich weiß nicht, ob alle Posaunisten ihre Kinder zu Posaunisten erziehen, mein Vater, der Posaunenlehrer, tat es.
Es ist ziemlich leicht, die Zwerchfellatmung zu üben. Du legst dich auf den Rücken und platzierst die Unterschenkel rechtwinklig auf einen stehenden Stuhl. Dein Körper muss gleichmäßig auf dem Boden liegen, und die Arme werden nach oben gestreckt. In dieser Position atmet man normalerweise automatisch mit der Zwerchfellatmung. Der Brustkorb und die Schultern dürfen sich in dieser Position nicht heben. Gute Posaunisten beherrschen auch die Zirkulationsatmung. Sie können, ohne zu unterbrechen, einen konstanten Ton spielen, und das für eine sehr, sehr lange Zeit.
«Der ewige Ton», sagt Papa, ein Meister der Zirkulationsatmung. Der Trick besteht darin, durch die Nase zu atmen und gleichzeitig durch das Zusammendrücken der Backen den Ton zu halten. Ich habe mir die Zirkulationsatmung beigebracht, indem ich durch einen Strohhalm in ein halb mit Wasser gefülltes Glas blies. Ich habe, während ich durch die Nase einatmete und mit den Backen Druck ausübte, versucht, gleichmäßig den Druck und den Rhythmus beizubehalten. Dann habe ich es lange und gleichmäßig blubbern lassen. Deshalb kann ich heute auch so lange schmerzerfüllt schreien. Ein Meister des herzzerreißenden, zirkulationsatmenden Schreies.
Mama war weg. Nebenan, aber weg. Auf der anderen Seite der Wand aus Pressplatten. Ich konnte hören, wie sie mit Bronislaw sprach. Wie sie ging. Ihre Schritte. Wenn ich mein Ohr ganz dicht an die Wand hielt, konnte ich sie atmen hören. Meine schöne Mutter.
«Du, mein Arabischer Frühling», hatte Papa noch vor kurzem zu ihr gesagt. Vor einem oder zwei Jahren. Bevor der Arabische Frühling zum ewigen Winter wurde, bevor Mama auf die Panflöte des Wilden setzte, wie Papa es formulierte, als er noch mit mir sprach.
«Wie gut, dass unsere Wohnung auch früher schon zwei Wohnungen war», sagte Papa. «Dass wir zwei Eingänge haben.» Ich musste ihm helfen, die Wand einzuziehen.
«Früher war hier auch eine Wand, wir stellen eigentlich nur den alten Zustand wieder her», sagte er. «Ich hab früher auch nicht mit deiner Mutter zusammengewohnt, ich kannte Ruth früher nicht, auch da stellen wir nur einen alten Zustand wieder her.»
«Mich gab es früher auch nicht. Wollen wir den