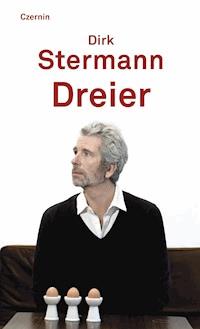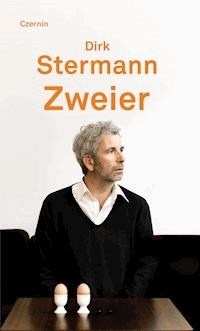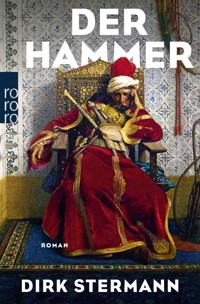10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dirk Stermanns Roman «Sechs Österreicher unter den ersten fünf», der sich allein in Österreich über hundertfünfzigtausendmal verkaufte, hatte einen Helden namens Dirk Stermann. Nun hat der Autor ein neues Buch über diesen Mann geschrieben. Es beginnt wie eine amüsante Gesellschaftssatire aus dem heutigen Wien: Dirk und seine Frau stehen vor einem Problem. Sie muss für ein paar Monate beruflich ins Ausland, aber er hat jetzt wirklich keine Zeit, sich den ganzen Tag um den gemeinsamen Sohn, Hermann, zu kümmern. Professionelle Hilfe muss also her. Freunde empfehlen, sehr modern, einen männlichen Babysitter. Sie hätten einen Ukrainer, sehr erfahren und gebildet, immer ein Zitat von Joseph Roth auf den Lippen. Und Dirk entscheidet sich, gegen all die blonden jungen Frauen, ebenfalls für einen Ukrainer. Auch wenn Maksym eigentlich nie Klassiker zitiert. Und erst macht der schweigsame Osteuropäer seine Sache auch ganz gut. Aber dann beginnt er, neben dem Sohn auch den Vater zu sitten. Und von da an scheint es nur noch eine Richtung zu geben: abwärts. Ein Roman, wie ihn nur Dirk Stermann schreiben kann: komisch, grausig, herzerwärmend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dirk Stermann
Maksym
Roman
Über dieses Buch
Dirk Stermanns Roman «Sechs Österreicher unter den ersten fünf», der sich allein in Österreich über hundertfünfzigtausendmal verkaufte, hatte einen Helden namens Dirk Stermann. Nun hat der Autor ein neues Buch über diesen Mann geschrieben. Es beginnt wie eine amüsante Gesellschaftssatire aus dem heutigen Wien: Dirk und seine Frau stehen vor einem Problem. Sie muss für ein paar Monate beruflich ins Ausland, aber er hat jetzt wirklich keine Zeit, sich den ganzen Tag um den gemeinsamen Sohn, Hermann, zu kümmern. Professionelle Hilfe muss also her. Freunde empfehlen, sehr modern, einen männlichen Babysitter. Sie hätten einen Ukrainer, sehr erfahren und gebildet, immer ein Zitat von Joseph Roth auf den Lippen.
Und Dirk entscheidet sich, gegen all die blonden jungen Frauen, ebenfalls für einen Ukrainer. Auch wenn Maksym eigentlich nie Klassiker zitiert. Und erst macht der schweigsame Osteuropäer seine Sache auch ganz gut. Aber dann beginnt er neben dem Sohn auch den Vater zu sitten. Und von da an scheint es nur noch eine Richtung zu geben: abwärts.
Ein Roman, wie ihn nur Dirk Stermann schreiben kann: komisch, grausig, herzerwärmend.
Vita
Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weit bekannt. 2016 erschien sein Roman «Der Junge bekommt das Gute zuletzt», und die Welt urteilte: «Ein lustiger deutscher Medienstar, der als österreichischer Romancier sehr ernst genommen werden sollte.» Auch sein Roman «Der Hammer» war ein großer Erfolg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Cordula Schmidt Design,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Gerald von Foris
ISBN 978-3-644-01136-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Mögen deine Probleme unlösbar und deine Schwierigkeiten unüberwindlich sein.»
Ukrainischer Segen
«Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.»
Friedrich Hölderlin
EINSZehennebel
In dieser Geschichte komme ich nicht gut weg. Vielleicht hätte ich ja doch meine Handschuhe ausziehen sollen? Auf der Kärntner Straße hatte mich eine Wahrsagerin angesprochen. Die Dame mit dem bunten Halstuch und der tiefen Stimme fragte mich freundlich und in gebrochenem Deutsch, ob sie mir aus der Hand lesen dürfe. Es war Winter, und ich trug Handschuhe. Die Wollhandschuhe, die ich zu heiß gewaschen hatte. Jetzt waren sie verfilzt und eigentlich eine Nummer zu klein, aber ich trug sie trotzdem, obwohl ich meine Finger in dem steifen Gewebe kaum bewegen konnte. Handschuhe wie in Schockstarre. Trotzdem wärmten sie besser als keine Handschuhe, und ich wollte sie nicht ausziehen, und durch den Handschuh konnte sie nicht lesen.
«Ausziehen», sagte sie.
«Nein, zu kalt», entgegnete ich.
«Doch, ich will deine Hand sehen!»
«Nein, ich will nicht, dass Sie meine Hand sehen und dann irgendetwas Schlimmes vorhersagen. Ich will es lieber nicht wissen.»
«Doch, ich sage dir die Zukunft voraus. Ich bin Hellseherin.» Kalte Atemwolken drangen aus ihrem Mund. Als rauchte die Hexe ohne Zigarette.
«Nein, danke. Sehr freundlich. Und wenn Sie wirklich die Zukunft kennen, wissen Sie ja, dass ich meinen Handschuh nicht ausziehen werde.»
«Ich sehe die Zukunft, und ich sehe deine Hand in der Zukunft.»
«Na ja, vielleicht im Sommer mal. Aber jetzt hat es Minusgrade. Ich zieh den Handschuh nicht aus. Und wie gesagt, ich will es überhaupt nicht wissen.»
Sie starrte mich wütend an. In ihren überschminkten Wimpern funkelten Eiskristalle.
«Tja, also dann», sagte ich fröhlich und schritt ungelesen davon.
«Du wirst an der nächsten Straßenkreuzung totgefahren», schrie sie mir nach.
Vermummte Passanten schauten mich neugierig an. Ein Todgeweihter.
Ich ging über die nächste Straßenkreuzung bei der Staatsoper. Kein einziges Auto ringsumher. Vielleicht war sie gar keine echte Hellseherin, sondern einfach nur eine arme Frau aus einem südosteuropäischen Land. Ihr Fluch hatte auch eher etwas von Dunkelsehen. In Ungarn, der Ostslowakei oder Rumänien hatte sie sich entscheiden müssen, ob sie als Hellseherin oder beinlos bettelnde Frau arbeiten wollte. Sie hatte sich für Beine entschieden.
Statt des Autos, das mich totfuhr, kam ein Anruf aus New York.
Der Wetterbericht im Radio verkündete Zehennebel. Ich schaute auf meine Füße.
«Zähen Nebel», sagte Nina. «Die meinten zähen Nebel, nicht Zehennebel. Was soll das denn bitt schön sein: Zehennebel?»
Ich zuckte mit den Schultern und aß ein Stück von der kalten Pizza Caloria. Eigentlich sollte jede Pizza so heißen, selbst die mit Spinat oder ohne alles. Irgendetwas Unheimliches geschieht im Ofen mit dem Teig, das alle Kohlehydrat-Tabellen sprengt. Teig, Öl, Käse, Hitze. Unheilige Verbindungen. Und dann geht man auf wie der Teig selbst.
«Hab ich dir erzählt, dass ich gestern an einem Schulhof vorbeigegangen bin?»
Sie schüttelte den Kopf, wie sie es nur an Wochenenden tat. Langsamer als normal. Erschöpft von der ganzen Woche. In der Hand hielt sie ihre Kaffeetasse mit der Aufschrift «Carpe That Fucking Diem».
«Die Pizza ist von vorgestern», sagte sie, als wäre ich ihr Feind. Sie war wütend eingeschlafen, geladen aufgewacht und hatte sich diese Tasse genommen. Sie hätte auch die Tasse mit dem Reh nehmen können oder die mit dem schielenden Eichhörnchen, die mir von einem Schwerstbehinderten aus einem Heim in Niederösterreich geschenkt worden war. Nach meinem Auftritt war er gekommen und hatte mir die selbst bemalte Tasse lächelnd überreicht. Er sagte etwas, das ich nicht verstehen konnte, und ich bedankte mich. Das Eichhörnchen schielt so stark, dass es seinen eigenen Schweif sehen kann. Den Oachkatzlschwoaf, den ich hervorragend aussprechen kann, sehr zum Ärger vieler Österreicher. Die sind immer enttäuscht, wenn der gschissene Deitsche sich da überhaupt nicht schwertut. Oachkatzlschwoaf, Oachkatzlschwoaf. Dafür kann ich Hendl noch immer nicht richtig aussprechen. Bei mir klingt es wie Händel. Wann immer ich dialektal versage, behaupte ich, in meinem Tal spräche man so.
«Dein Tal gibt es nicht», sagt Nina.
«Doch, es ist das Tal, in dem alle so sprechen wie ich», sage ich. Eine Melange aus Dialektwörtern des ganzen Landes.
«Neandertal?», tippt sie.
«Nein, zwischen Donau und Inn. Sehr versteckt.»
Die «Carpe That Fucking Diem»-Tasse hatte mir mein depressiver Lateinlehrer Guminski zum Abitur geschenkt. Er fuhr Fiat und wusste, was das in den späten Siebzigerjahren bedeutete.
«Fiat ist Latein und heißt: Es möge etwas geschehen. Das denke ich mir jedes Mal, wenn die Scheißkarre nicht anspringt. Also jedes Mal, wenn ich die Scheißkarre starten will.»
Ich hatte die Tasse jetzt schon über dreißig Jahre. Von Düsseldorf hatte ich sie mit nach Wien genommen, mehrmals umgezogen war ich mit ihr. Von der Papagenogasse in die Kettenbrückengasse, vom Rudolfsplatz in den Alsergrund. Verschiedene Frauen hatten in der Früh aus ihr getrunken.
«Und, was war auf dem Schulhof?», fragte Nina gelangweilt und schluckte den viel zu heißen Kaffee, ohne eine Miene zu verziehen. Sie ist komplett hitzeunempfindlich. Schält dampfende Kartoffeln mit der bloßen Hand, greift ohne Handschuh in Öfen, holt gekochte Eier ohne Löffel aus dem sprudelnden Wasser. Mit den Fingern. Würde es bei uns brennen, sie würde das Feuer mit der flachen Hand ausdämpfen.
«Da war ein kleines Mädchen. Vielleicht elf oder zwölf. Und sie schrie die anderen am Pausenhof an: Wenn ich erst die Pille nehme, ficke ich euch alle vom Platz!»
«Wow. Tolle Geschichte. Weißt du, du bist ein wunderbarer Mensch, aber ich mag dich nicht», sagte sie, warf mir die «Carpe That Fucking Diem»-Tasse vor die Füße und stürmte hinaus. Der heiße Kaffee dampfte auf dem Boden.
«Also doch Zehennebel», rief ich ihr hinterher. «Das Radio hatte doch recht.»
Aber sie hörte mich wohl nicht mehr. Ich klebte die Tasse, legte mich ins Bett, das noch nach ihr roch, und nutzte den Tag. Mehrere Minuten lang. Dann stand ich auf und ging Hermann wickeln, und wie immer sang ich dabei mit ihm eine für ihn abgewandelte Version meines liebsten Arbeiterliedes. «So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir zieh’n. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer, wir sind die Säuglinge von Wien.»
Ich wickelte Hermann, so wie meine Mutter den anderen Hermann Stermann gewickelt hatte in den letzten Jahren seines Lebens, als er tablettensüchtig war und immer schwächer wurde.
«Jeden Tag habe ich deinen Opa gewickelt und gewaschen», hatte meine Mutter mir später erzählt. «Aus Scham hat er sich nie dafür bedankt. Wir schwiegen und taten, als gäb’s das nicht.»
«Als wäre er ganz normal aufs Klo gegangen?»
«Ja.»
Hermann Stermann war im Gefängnis auf die Welt gekommen. Sein Vater Heinrich war Polizist und wohnte mit seiner Familie im Gefängnis in Beeck, einem Stadtteil von Duisburg. Die Wohnung lag im Stockwerk über den Zellen und war gut belegt. Hermann, der kleine Peter, der andere Bruder, dessen Namen ich nie wusste, und die zwei Schwestern, die beide Diakonissen wurden. Meine Urgroßmutter, die nichts Einnehmendes an sich hatte und leer und böse wirkt auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das ich in meinem Arbeitszimmer hängen habe. Heinrich mit imposantem Backenbart, mein Großvater mit Segelohren, der kleine Peter schief sitzend auf einem zu großen Sessel im Fotostudio. Peter wirkt verschreckt. Vielleicht ahnte er schon den Magenkrebs, der ihm gegen Ende des Zweiten Weltkriegs während eines Bombenangriffs in einem Berliner Keller den Tod bringen sollte. Peter war Maler, der einzige Künstler in meiner Familie. Ein sehr düsteres Ölgemälde hängt in meinem Wohnzimmer. Ein Bahnübergang in einer Duisburger Arbeitersiedlung. Mattes Licht kommt von einer Laterne. Verschwommen erkennt man dunkle, gebeugte Körper, auf dem Weg zur Arbeit, es ist vielleicht sechs Uhr morgens, an einem Wintertag. Der Himmel hängt tief und schwarz. Das Bild ist wirklich bedrückend. Aber von meinem Großonkel. In der Schule sollten wir im Kunstunterricht mit Öl malen. Ich schlug vor, im Stil Peter Stermanns zu malen. Meine Lehrerin traute mir das nicht zu und überredete mich stattdessen, Ansichtskarten von Duisburg zu übermalen. Also gab ich auf den blauen Himmel einfach in dicken Schichten schwarze und graue Ölfarbe. Sonst veränderte ich die Karten nicht. Die fertigen Bilder sahen anders aus als die meines Großonkels, aber sie gefielen mir. Trotzdem bekam ich eine 5.
Meine Großtanten: resignative Mädchen, eins sechzehn, eins achtzehn, die ihre beste Zeit weder vor noch hinter sich haben. Von Duisburg-Beeck, wo es in meiner Vorstellung immer Winter und sechs Uhr früh war, direkt ins Diakonissen-Mutterhaus Kaiserswerth, in dem sie irgendwie lebten, bis sie starben und auf dem angrenzenden Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden.
Mein Urgroßvater steht in der Mitte seiner Familie. Heinrich, mit der soliden Anstellung. Als er ein junger Mann war, hatte sein Freund Theodor König ihn gefragt, ob er nicht mit einsteigen wolle in die Gründung einer Brauerei. Heinrich hatte abgewinkt: «Bier braut man nicht, das trinkt man. Gefängnisse sind sicherer. Eingesperrt wird immer.» Theodor König gründete also seine Brauerei allein und nannte sie nach sich selbst. König Pilsener.
Hätte Heinrich anders entschieden, wäre ich heute ein Bierbaron. Hat er aber nicht. Und so kam mein Großvater Hermann nicht im reicheren Duisburger Süden in einer Villa auf die Welt, sondern im Norden, in einem Gefängnis. Und kackte dann als alter Mann in Windeln, die meine Mutter unbedankt wechselte.
So wie ich bei meinem Sohn Hermann jetzt. «So flieg, du flammende, du braune Windel.»
Es läutete an der Tür. Mit Hermann auf dem Arm öffnete ich. Meine hustende Hausbesorgerin stand vor der Tür.
«Ich habe Grippe, aber kein Mensch besucht mich. Da hab ich mir gedacht, ich dreh den Spieß um. Kranke besuchen Gesunde. Sind Sie gesund?»
Ich nickte.
«Und Hermann?»
«Auch. Noch. Sie sollten nach Hause und sich ins Bett legen.»
«Ja, wahrscheinlich. Kann ich mich kurz bei Ihnen auf dem Sofa ausruhen?»
«Lieber nicht.»
«Verstehe», sagte sie leise. Sie schwitzte stark. «Diese Katze macht mich wahnsinnig. Was die wohl mit dem armen Tier machen. Das Schreien geht einem durch Mark und Bein.»
«Hier hört man sie auch», sagte ich. «Keine Ahnung, was da los ist, aber die schreit ja schon seit Monaten so. Ich gehe jetzt mal mit Hermann im Kinderwagen raus.»
«Draußen nebelt’s. Vorhin hab ich meinen Ex-Mann besucht. Ich hab kaum die Hände vorm Gesicht gesehen!»
«Hoffentlich haben sie den nicht auch angesteckt.»
«Doch. Hoffentlich schon.»
Sie schlurfte keuchend zurück in ihre kleine Hausbesorgerinnenwohnung, in der sich Berge von Gerümpel auftürmten. Ich habe unsere Hausbesorgerin noch niemals mit einem Wasserkübel oder einem Wischmopp gesehen. Trotzdem ist das Stiegenhaus sehr ordentlich, beinahe übersauber. Sie habe einen Schmutzengel, hat mir die Hausbesorgerin einmal verraten. Tatsächlich gibt es da den älteren Herrn von Tür 12, der gerne nachts wischt, wenn alles schläft.
Der Vorteil beim Kinderwagen für ältere Väter ist, dass sie ihn gleichzeitig als Gehhilfe nutzen können. Ich stützte mich also auf den Schiebebügel und schob Hermann durch den dichten Nebel. Man sah tatsächlich die Hand vor Augen nicht. Ich seh die Hand vor Augen aber auch ohne Nebel nie. Warum sollte ich mir die Hand vor die Augen halten? Wo Nina wohl hingegangen war?
Ich war erst in der Nacht von einem Auftritt in Linz zurückgekommen und hatte ihr meinen Tourplan fürs Frühjahr und den Herbst auf den Frühstückstisch gelegt.
Sie wirkte müde, am nächsten Morgen. Wahrscheinlich hatte Hermann sie in der Nacht wach gehalten. Ich war ganz frisch.
«Du trittst im nächsten Jahr an fast 400 Abenden auf», sagte sie und griff sich die Tasse.
«Nein. Ich glaube, es sind nur 140 Auftritte», antwortete ich. «Im August hab ich zum Beispiel überhaupt nur zwei Auftritte.»
«Und jede Woche die Fernsehsendung.»
«Ja, und jede Woche die Fernsehsendung.»
«Du hast einen kleinen Sohn», sagte sie.
«Ich weiß. Hermann.»
«Gut, dass du dich erinnerst.»
Hermann lag auf dem großen Sofa und zerriss die Seite mit dem Kreuzworträtsel im Zeit-Magazin. Er hatte wohl keine Lust, um die Ecke zu denken.
«Und wie stellst du dir das vor?»
«Wir brauchen wohl manchmal einen Babysitter.»
«Ich werde wieder arbeiten», sagte sie.
«Prima. Ein neues Projekt?» Nina hatte im Vorjahr zwei kleine Jobs gehabt, ein paar Stunden die Woche, einmal im Museum für Angewandte Kunst und einmal in der Sammlung Leopold. Ich fand gut, dass sie mal rauskam, es war ja auch gar nicht leicht in ihrer Branche, irgendetwas zu finden.
«Kein Projekt», sagte sie. «Ich meine richtig.»
«Du hast mir gar nicht erzählt, dass du dich wo bewirbst. Das ist ja super.»
«Hab ich auch nicht. Ich habe einen Anruf bekommen. Aus New York. Ich kann dort im österreichischen Kulturforum anfangen.»
Hermann zerriss jetzt auch das Cover des Zeit-Magazins. Der Schauspieler Ethan Hawke war darauf, mit rosafarbenem Anzug und im Ausfallschritt. Ich fühle mich wie ein junger alter Mann, stand unter dem Bild. Hawke hatte einen Bart wie ich und eine ähnliche Frisur, nur dunkleres, noch nicht so weißes Haar. Jetzt lag der junge alte Mann in Fetzen auf unserem Sofa.
«New York», murmelte ich. «Und wie stellst du dir das vor?»
«So wie die letzten vier Jahre», sagte Nina. «Nur umgekehrt.»
«Ich war nicht in Amerika.» Das kam jetzt ein bisschen schneidend. «Im Ernst, wie soll das funktionieren?»
Immer und immer wieder hatten wir diskutiert. Natürlich wollte ich, dass Nina wieder arbeitet. Ihre Halbtagsjobs hatten ihr und uns gutgetan.
«Das ist eine Chance, die kommt so schnell nicht wieder», sagte sie. «Ich bin jetzt wirklich lange von der Bildfläche verschwunden gewesen. Es ist einfach cool, so ein Angebot zu bekommen in meiner Situation.»
«Cool? Und was heißt: deine Situation. Du hattest doch keinen Schlaganfall. Du hast ein Kind bekommen. Es wird doch wohl irgendein verpisstes Museum in Wien geben, das einen Job für dich hat.»
Verpisstes Museum, das war so ein Running Gag gewesen, seit wir mit unserem Babysohn in einer Ausstellung in der Kunstsammlung NRW gewesen waren. Wir hatten ihm keine Windel angezogen, und das Bild, vor dem er pinkeln würde, sollte das beste der Ausstellung sein. Nina hielt ihn auf dem Arm, wir schlenderten von Bild zu Bild. Ließen Hermann Zeit für die Entscheidung. Matisse, Miró, Dalí, nichts. Schließlich pinkelte er doch los, und wir kürten Francis Picabias Gemälde «Les Points» zum Sieger. Ich mochte unsere Methode der Kunstbewertung, und mir gefiel Picabias Bild. Zwei gelbe Farbpunkte, ein grüner, ein schwarzer. Es war so schwer, Kunst einzuschätzen, und mit Hermann gab es zumindest ein verbindliches Kriterium. Kunst soll etwas auslösen im Betrachter. Bei Hermann war es eine direkte körperliche Reaktion. Wir hängten in unserer Wiener Wohnung ein Plakat des Bildes aufs Klo. Als Erinnerung und als Hilfe bei Blasenschwäche.
«Freust du dich gar nicht für mich?»
Sie schaute mich so wütend an, dass es mir schwerfiel, mich für sie zu freuen. Im Radio liefen die Nachrichten, und ich hörte das Wort Zehennebel.
New York, dachte ich. Nicht Linz oder Ybbs an der Donau, Orte, in denen ich auftrat. Oder Dresden. Vor Linz war ich zwei Tage lang Teil der «Humorzone Dresden» gewesen. Achtzig Künstler auf elf Bühnen an fünf Tagen unter dem Motto «Man darf auch mal lachen müssen!». Normalerweise meide ich solche Ansammlungen von Humorarbeitern, aber ich kannte den Veranstalter schon seit Jahren. «Du stecksten Finger innen Po und dresden!», hatte mir ein lustiger Taxifahrer gleich bei der Ankunft verkündet.
Die gesamte Spaßmeute war in einem noblen Hotel beim Bahnhof untergebracht. In der Lobby traf ich einen schwäbischen Kollegen, der in den letzten Jahren vor allem in England aufgetreten war. Auf britischen Bühnen sorgt er schon mit seinem Eingangssatz für Gelächter. «Hello, I am a German comedian.» Für Engländer ein Schenkelklopfer. Ein lustiger Deutscher? Das muss ein Witz sein. Und tatsächlich habe ich in den beiden Tagen ausschließlich traurige Künstler erlebt. Man erzählte einander von Niederlagen, künstlerischen Hinrichtungen und privaten Katastrophen. Schon im Shuttlebus zum Theater saß ein verzweifelter Humorschaffender aus dem Rheinland neben mir. Seine Tränensäcke hingen so schlaff unter müden Augen, als würden sie sich bald vom Gesicht lösen. «Meine Tochter ist neun Monate alt und schreit seit ihrer Geburt. Tag und Nacht», erklärte er seine Erschöpfung. «Jetzt hat ein Arzt herausgefunden, dass ein Wirbel bei ihr verrutscht ist. Sie hat vor Schmerzen gebrüllt!» Was für eine Vorstellung. Sein Leben mit chronischen Schmerzen beginnen. Das arme Kind, der arme Witze-Vater.
In der engen und überhitzten Garderobe hockte ein Humorist aus Hessen einsam auf einem wackeligen Holzstuhl, neben sich eine fast leere Flasche sächsischen Weißweins. Proschwitzer Katzensprung. Ich kannte ihn von einem gemeinsamen Fernsehauftritt in Norddeutschland und grüßte, aber er starrte nur unverwandt auf sein Handy.
«Facebook?», fragte ich.
Er schüttelte müde den Kopf. «Nein», sagte er. «Taschenrechner. Ich rechne immer. Gebe irgendwelche Zahlen ein, völlig wahllos, und addiere oder subtrahiere. Je nachdem. Das mach ich immer in der Garderobe. Vor dem Auftritt und in der Pause.»
«Cool», sagte ich. «Macht’s Spaß?»
«Nein», antwortete er. «Überhaupt nicht. Aber ich weiß meine App-ID nicht, deshalb kann ich mir kein Spiel aufs Handy laden. Und Rechnen ist besser als nichts. Ich sitz ja immer allein backstage, normalerweise.» Er trug auf dem Kopf ein graues Bundeswehrbarett, Teil seines Bühnenoutfits. Ich sah auf sein Display.
«812», sagte ich. Er nickte. «Ist das gut?»
«Gut?» Er lachte kurz. «Weiß nicht. Egal. Ist ja nur eine Rechnung, ohne Ziel. Das Ergebnis spielt keine Rolle.»
«Warum drückst du dann überhaupt auf ‹ist gleich›?»
«Das muss ja alles ein Ergebnis haben. Nur ist das Ergebnis mir eben scheißegal, verstehst du?»
«Du könntest jetzt 812 durch irgendwas dividieren», schlug ich vor und setzte mich neben ihn.
Er hielt das Handy so, dass ich mit draufsehen konnte.
«Gut. 812 geteilt durch. Hast du einen Vorschlag?»
«Sich selbst. 812 durch 812. Zum Beispiel.»
«Okay.» Er tippte. «Ist gleich. Eins», sagte er. «Steht hier. Wow, dachte, das ergibt null.»
Ich nahm den letzten Schluck aus der Flasche mit dem Proschwitzer Katzensprung.
«Hab ich noch nie gemacht. Dividieren. Gute Idee», sagte er. Dann stand er auf und ging zum Bühnenaufgang. Unterhaltung ist kein Honiglecken.
«Mama ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika», sagte ich zu Hermann. Wieso hatte sie mir nicht früher davon erzählt? Darüber war noch nicht das letzte Wort gesprochen. Natürlich war es klar, dass sie wieder arbeiten gehen würde, aber gleich auswandern?
«Willst du, dass ich hier verkümmere?», hatte sie gebrüllt. Nein, das wollte ich nicht, und ich verstand, dass New York ihr zugefallen war, dass sie nicht aktiv einen Arbeitsplatz gesucht hatte, der möglichst weit von Wien entfernt war.
«Wir sollten uns von unserer Arbeit nicht auseinanderdividieren lassen», sagte ich. Sie lachte.
«Sagt jemand, der nie da ist?»
«Einen Atlantik entfernt. Sechs Stunden auf jeder Uhr. Weiter weg, als ich je war. Und Hermann?»
Sie begann zu weinen. Ich nahm sie in den Arm. Sie schüttelte mich ab. «Denkst du, die haben angerufen und ich hab sofort meinen Koffer gepackt? Ich habe mir die Entscheidung schwerer gemacht, als je ein Koffer sein könnte.»
«Und jetzt?»
«Jetzt ist nicht Herbst. Wir haben Zeit, das alles zu organisieren. Wir finden jemanden.»
«Einen Babysitter?»
«Natürlich eine Babysitterin. Jemanden, der fix da ist. Verlässlich. Lieb. Eine, der wir unseren Sohn anvertrauen können. Nicht so wie damals bei Kina.»
Sie wusste, dass ich mit meiner großen Tochter schlechte Erfahrungen mit der Babysitterin gemacht hatte. Meine Tochter Kina. Sie kommt in «6 Österreicher unter den ersten 5» vor. Meine damalige Frau Sophie hat es furchtbar wütend gemacht, dass ich ohne ihr Wissen einen Roman über uns geschrieben habe. «Du bist nicht Knausgård», schreit sie mich heute noch an, wenn wir uns zufällig sehen. «Du hast nur einen von Motten zerfressenen Norwegerpulli und kein Recht, über uns zu schreiben!»
Wahrscheinlich war das Buch der endgültige Grund für unsere Trennung. Und meine Tourneen. Damals hatte es angefangen. Der Agenturchef hatte vor der ersten Saison zu mir gesagt: «Du wirst sehen, wenn man auf Tournee ist und dann nach Hause zurückkehrt, ist es, als käme man aus der Kriegsgefangenschaft. Du bist zwar wieder da, gehörst aber irgendwie nicht dazu. Weil alle ihren Alltag ohne dich gestalten.» Er sollte recht behalten.
Damals arbeitete ich noch beim Radio. An zwei Tagen in der Woche hatte ich abends Sendungen, an den anderen war ich auf Tournee. Und wenn ich zu Hause war, kümmerte ich mich um den Haushalt und das Kind. Beides machte ich schlecht. Kina zog ich zu warm oder kalt an, und egal, was ich im Haushalt auch tat, es war falsch. Ich kaufte falsch ein, wischte oberflächlich, übersah Schmutz, wusch Wäsche zu heiß oder zu kalt. In der kurzen Zeit, die ich zu Hause war, machte ich so viele Fehler wie andere, die den ganzen Tag daheim sind. Am schlimmsten waren die Fenster. Ich putzte, so gut ich konnte, aber immer fand Sophie Grund zur Kritik. Schlieren. Unsichtbare Schlieren. Sie konnte sie im Dunkeln sehen, ich noch nicht einmal bei starkem Gegenlicht. Ich hasste die Fenster. Ich verbrauchte Unmengen an Glasreinigern, aber es reichte nie. Sie blickte zum Fenster und schüttelte stumm den Kopf.
Irgendwann schenkte ich Sophie eine Reise nach Südfrankreich. Eine Woche allein, in einem teuren Hotel. In dieser Woche ließ ich professionelle Fensterputzer kommen. «Bitte, egal, was es kostet, putzen Sie bitte so gut, wie Sie noch nie geputzt haben», sagte ich. Und als jedes Fenster perfekt geputzt war, ließ ich sie sicherheitshalber ein zweites Mal putzen. Am Ende hatten wir die saubersten Fenster von ganz Wien. Die Fensterputzer und ich waren hochzufrieden.
Ich holte Sophie mit Kina vom Flughafen ab. Wir fuhren nach Hause, ich öffnete die Haustüre. Sophie sah zu den Fenstern und sagte: «Da sind Schlieren.»
In diesem Moment wusste ich, dass es vorbei war.
Da war die Geschichte mit der Babysitterin erst ein paar Monate her. Martina.
Sie sah aus wie der Tod und tunkte Pommes in Ketchup. Ein Soßenrest klebte in ihrem Mundwinkel. Spröde Lippen, wächsernes Gesicht, ihre strähnigen, langen Haare schienen am Kopf angeklebt zu sein. Hinter ihr starrte mich ein serbischer Heerführer an, links und rechts von dem Bild hingen Wandteppiche. Neben uns aß eine Großfamilie ein riesiges Hunnenschwert. Aufgespießte Fleischberge, grobe Visagen, selbst die Kinder hatten die stämmigen Körper von Schwergewichtsboxern. Eine Band spielte Balkanmusik, es war drei Uhr früh. Die Kinder waren im Volksschulalter. Ich fragte mich, wie sie in fünf Stunden dem Unterricht würden folgen können.
Das «Beograd» in der Nähe des Funkhauses hatte die ganze Nacht geöffnet. Meine Regisseurin Angelika hatte vorgeschlagen, dass wir uns hier nach der Sendung treffen. Ich hatte ihr Martinas Brief gezeigt. Sie war genauso geschockt und berührt gewesen wie ich.
«Ich bin nur zwei Jahre älter als du und möchte noch nicht sterben», hatte Martina mir geschrieben. Und: «Ich würde dich gerne einmal treffen.»
«Tamo daleko», sang die Band, ein altes Kriegslied. «Tamo daleko gde cveta beli krin, Tamo su živote dali zajedno otac i sin.» Dort, weit weg, wo die Lilien blühen, dort gaben Vater und Sohn gemeinsam ihr Leben. Die serbische Großfamilie sang lautstark mit. Martina starrte auf ihren Teller, als wollte sie sich Teller einprägen für die Ewigkeit, die vor ihr lag. Sie trug ein zerknittertes T-Shirt, in ihrer Armbeuge war ein grünblauer Fleck.
«Ist es zu laut hier?», fragte ich.
Sie lächelte, schüttelte fast unmerklich den Kopf und nahm einen Schluck Wasser. Ihre Lippen blieben trocken, unbefeuchtbar, als würden sie jeden Augenblick von ihr abbröckeln.
«Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wirklich gekommen seid», sagte sie.
«Klar», sagte ich, dabei war überhaupt nichts klar. Mir hatte der Brief Angst gemacht. Vor zwei Wochen hatte Martina in meiner Sendung Talk Radio angerufen. Ich war der Moderator, und es war ein großartiges Gespräch über Angst und Hoffnung. Sie hatte die Hörer dazu aufgerufen, sich als potenzielle Spender bei der Knochenmarkzentrale zu melden. Es seien viel zu wenige registriert. Für sie selbst gebe es keine Hoffnung mehr, aber so viele Kranke warteten verzweifelt auf Hilfe. Der Aufwand sei gering. Man müsse sich nur Blut abnehmen lassen, falls es ein «Match» sei, werde Knochenmark entnommen und dem Leukämiepatienten verpflanzt.
Durch die Scheibe sah ich in den Regieraum. Angelika, der Techniker und die Telefonistin saßen reglos da und hörten ihr zu. Die Nacht schien noch stiller geworden zu sein.
Einige Tage später informierte uns die Knochenmarkzentrale, nach der Sendung hätten sich so viele Menschen bei ihnen gemeldet, dass sie organisatorisch völlig überfordert seien.
Dann kam der Brief.
«Lieber Dirk, ich bin nur zwei Jahre älter als du und möchte noch nicht sterben. Ich würde dir gerne von Angesicht zu Angesicht mein Leben erzählen. Das wünsche ich mir, so kurz bevor ich mir gar nichts mehr wünschen kann.»
Ich war gerade dreißig geworden. Sie war also 32.32 und todgeweiht.
«Wie lange hast du noch zu leben?», fragte Angelika.
Was für eine Frage. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nie auf einer Beerdigung gewesen, hatte noch nie einen Toten gesehen, noch nie an einem Sterbebett gesessen. Wie lange hast du noch zu leben, das war ein Satz aus Filmen, und das hier war kein Film.
«Ein paar Wochen, ein paar Monate», antwortete Martina. Ich nickte, als könne ich diesen Satz begreifen. Sie sprach von weißen und roten Blutkörperchen, von Zahlen und Statistiken.
Ich hörte zu und stellte mir ihre Organe vor, die, während wir sprachen, zerstört wurden. Ihre Blutbahnen, die Achterbahnen in den Untergang waren. Die Schlachten, die in ihr tobten, während ich aus meinem Weinglas trank.
«Aber gibt es nicht doch noch irgendwie die Chance auf eine Knochenmarkspende?», fragte Angelika.
Martina schüttelte den Kopf und wischte sich das Ketchup aus dem Mundwinkel.
«Eigentlich bin ich Stewardess», sagte sie leise. Ich verstand sie kaum neben den schmetternden Serben. «Bei Lauda Air. Bevor ich krank wurde. Als Stewardess bekomme ich manchmal Freiflüge. Ich habe meinen Eltern einen Flug nach Thailand geschenkt. Das war die Maschine, die abgestürzt ist. 1991. Meine Eltern hätten mich retten können mit einer Spende. Aber ich habe sie in den Tod geschickt.»
Weit weg, dort wo die Lilien blühen.
Ich hatte sofort Niki Lauda vor Augen. Wie er ernst durch die Trümmer im Dschungel schritt, die rote Kappe auf dem verbrannten Kopf, zwischen den qualmenden Überresten von Flug 004. Wie er roboterhaft über technische Details sprach, während 223 Tote um ihn herumlagen. Das Wort Schubumkehr hatte ich da zum ersten Mal gehört.
«Oh, mein Gott», sagte Angelika, als wäre Martina nicht der lebende Beweis für dessen Nichtexistenz.
«Das tut mir leid», sagte ich.
Sie lächelte, als wollte sie mir zu verstehen geben, dass meine hilflose Floskel wie ein feuchter Waschlappen war, mit dem man einen Buschbrand löschen will. Oder ein brennendes Flugzeug.
«Ich habe auch einen Bruder», sagte sie.
«Könnte dessen Knochenmark nicht auch passen?», fragte Angelika hoffnungsvoll.
«Daniel hat sich umgebracht. Er war überfordert. Er hätte spenden können, aber die Verantwortung hat ihn überfordert. Es war eine furchtbare Zeit nach dem Tod meiner Eltern. Daniel hing so sehr an Mama und Papa. Und wir beide hatten auch ein ganz enges Verhältnis. Als ich krank wurde, brach für ihn eine Welt zusammen. Es gab schon einen Termin für die Transplantation, aber dann fand ich ihn in seiner Wohnung. Er hat sich erhängt. Er war meine letzte Chance. Mein kleiner Bruder.»
Sie begann zu weinen. Angelika nahm sie in den Arm und sprach leise zu ihr. Ich verstand nichts. Hörte die Serben singen. Dachte Unglück. Rutschte auf meinem Stuhl, als könnte ich mich so von dem Wahnsinn entfernen, den Martina schilderte. In dem sie lebte. In dem sie starb.
Ich blickte auf die Uhr, die für sie schneller ging. Halb vier in der Früh.
«Ich muss gehen», sagte ich. «Ich hab eine kleine Tochter und muss mit ihr in drei Stunden aufstehen. Aber ich weiß nicht, wie ich mich von dir verabschieden kann.»
«Sag einfach: Bis bald», antwortete Martina.
Am darauffolgenden Sonntag stand sie im Foyer des Funkhauses. Kreidebleich. Sie sah noch schlechter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. In ihrer Armbeuge steckte eine Kanüle unter einem Verband.
«Du kommst uns besuchen?», fragte ich überrascht.
«Ich mache jetzt Telefondienst bei euch. Angelika hat mich gefragt, ob ich Lust dazu hätte, und ja, das klingt interessant.»
«Aha, prima», sagte ich. Mit mir hatte vorher niemand gesprochen. Ich wusste, dass Angelika sie noch einmal getroffen und mit ihr das Grab der abgestürzten Eltern besucht hatte. Ein schlichter Stein mit zwei Vornamen. Aber dass sie jetzt Mitarbeiterin von Talk Radio war, hätte man mit mir abklären müssen. Immerhin war ich der Moderator der Sendung. Von Mitternacht bis zwei Uhr morgens war es meine Aufgabe, amüsante Gespräche zu führen. Wie sollte das gehen, wenn mir auf der anderen Seite des Studiofensters eine sterbende Frau gegenübersaß?
Mit schweren Schritten gingen wir die Treppen in den zweiten Stock hinauf.
«Warte kurz», sagte sie im ersten Stock. «Ich muss mich mal ausruhen.»
«Klar», sagte ich. «Soll ich dich stützen?»
«Nein, es geht schon. Ich brauche nur ein paar Minuten.»
«Ja, sicher. Es ist nur, die Sendung beginnt gleich.»
Sie nickte und schloss die Augen. «Verstehe. Es geht gleich wieder.»
So standen wir im menschenleeren nächtlichen Treppenhaus. Ich stellte mir vor, sie würde hier, in meinen Armen, sterben.
Einige Jahre zuvor war ein Kollege während einer Jazzsendung an einem Herzinfarkt gestorben. Die Sendung wurde von zwei Moderatoren präsentiert. Der eine fiel während einer Moderation vom Stuhl, und der andere moderierte so lange weiter, bis eine Platte startete. Erst dann rief er den Notarzt. Gnadenloser, missverstandener Professionalismus. Daran dachte ich, während sie, ein weißes Gespenst, neben mir nach Luft schnappte. Ich hörte über die Ganglautsprecher bereits die Nachrichten um Mitternacht. «Und nun noch die Wetternachrichten für heute, Montag, den 14. Mai 1996.»
«Wir kommen gleich», brüllte ich Richtung Studio.
Bei jeder Sendung saß sie nun am Telefon. Wenn ich das Funkhaus betrat, erwartete sie mich schon beim Empfang und begrüßte mich mit einem Kuss auf beide Wangen. Ihre Lippen waren unverändert spröde, sie roch nach Jod und Metall. Mit gedämpfter Stimme berichtete sie mir, was Angelika während der vergangenen Woche mit ihr unternommen hatte.
«Ich will ihr die letzten Tage ihres Lebens bereichern», hatte Angelika mir erklärt. «Sie hat ja niemanden, nur uns und die Ärzte.» Und so ging sie mit Martina ins Theater und zu Kabarettveranstaltungen, organisierte Bootsausflüge und kochte für sie.
«Du hast sie adoptiert», sagte ich.
«Ich will, dass sie ein erfülltes Leben hat, bevor alles für sie vorbei ist», sagte Angelika, die Florence Nightingale des Radios. «Ich habe das Gefühl, ihre Werte werden besser, wenn ich mich um sie kümmere. Als wären ihre Thrombozyten auch gespannt, was als Nächstes kommt.»
«Echt? Du glaubst, Thrombozyten mögen Kabarett?»
«Keine Ahnung, aber sie sagt, dass es ihr besser geht, wenn wir uns sehen.»
Wer bei Talk Radio anrief, musste zuerst mit Martina sprechen. Sie entschied dann gemeinsam mit Angelika, wer zu mir in die Sendung geschaltet wurde. Gespräche über Haustiere, kaputte Beziehungen, Astrologie, Radtouren, Obst, Zahnschmerzen, defekte Trockenhauben, Migranten. Und nach den Sendungen Gespräche mit Martina über ihr Blutbild.
So vergingen die Wochen und Monate. Die Sendung und Angelika schienen Martina am Leben zu halten. Hin und wieder luden die beiden mich zu ihren Aktivitäten ein, aber ich fand meist Ausreden. Fensterputzen, Kina betreuen, Auftritte. Ich wollte nicht auch noch abseits der Sendung so intensiv in ihr Leben eintauchen. Wann immer ich Martina sah, reduzierte sich meine Lebenslust. Als saugte sie mir Energie ab. Die Chronik ihres angekündigten Todes. Wenn sie lächelte, ihr letztes Lächeln. Wenn sie seufzte, ihr letzter Seufzer.
«Es geht mir nicht so gut», war der Satz, den sie vor sich hertrug; ob sie ihn aussprach oder nicht. Die Präsenz ihrer Krankheit war erdrückend.
«Wenn du mal einen Babysitter brauchst, mach ich das gerne», sagte sie eines Tages unvermittelt. «Ich mag Kinder.»
«Danke für das Angebot», log ich. «Gut zu wissen.»
Die Vorstellung, dass sie mit Kina allein in meiner Wohnung war, machte mir Angst, und ich hasste mich für dieses Gefühl. Sie war ja kein Monster, sondern eine junge Frau, deren Schicksal zu Tränen rührte. Aber ich brauchte Distanz zum Schicksal. Anders als Angelika, die jetzt mit Martina sogar mehrtägige Reisen unternahm. Budapest, Berlin, Triest.
«Ist das nicht zu anstrengend?», fragte ich.
«Sie hat ihre Medikamente und Kanülen dabei, wir machen viele Pausen.»
«Nicht für sie», sagte ich. «Für dich.»
Angelika sah mich an, als hätte man mir mein Empathiezentrum herausoperiert.
«Nein», antwortete sie.
Ich sah, dass im Regieraum Aufregung herrschte. Über die Gegensprechanlage erklärte mir Angelika, am Telefon sei ein Hörer, der suizidal wirke. Sie würden die Musik früher abbrechen und ihn sofort in die Sendung schalten.
Der Hörer sprach stockend, atmete schwer, machte lange Pausen. Wollte nicht mehr, kündigte an, Tabletten zu nehmen. Es war diffus. Er hatte angerufen, um zu sprechen, sprach aber kaum. Dann legte er unvermittelt auf. Ich bat ihn, noch einmal anzurufen, sich noch einmal zu melden. Gab eine Nummer durch, die nicht öffentlich war. Wo er anrufen konnte, abseits der Sendung.
Angelika hatte währenddessen die Polizei informiert. Es gab immer die Möglichkeit einer Fangschaltung, für genau solche Fälle. Es war eine Nummer aus Wien. Angelika hielt mich während der restlichen Sendung auf dem Laufenden. Ein junger Mann, Mitte zwanzig. Die Polizei und der Psychosoziale Dienst waren ausgerückt. Er lebte, aber man hatte tatsächlich eine große Menge an Tabletten gefunden.
«Wir haben ihn angerufen und mit ihm ausgemacht, nach der Sendung zu ihm zu fahren», sagte Angelika.
«Wir? Sollen wir das nicht lieber den Fachleuten überlassen?»
«Er möchte das gern», sagte Martina. «Wir haben es ihm versprochen.»
Bis fünf Uhr in der Früh saßen wir in dem tristen Apartment auf abgenutzten Ikea-Möbeln. Zwei Mitarbeiter vom Psychosozialen Dienst, Angelika, Martina und ich. Der junge Mann hockte still da. Martina erzählte ihm ihre Geschichte. Die Eltern in Thailand, der Bruder, der sich umgebracht hatte, und, neu für mich, von ihrem Mann, der auf dem Weg ins Krankenhaus zu ihr tödlich verunglückt war.
«Ich will leben und muss sterben. Du darfst leben. Weißt du, wie großartig das ist? Leben dürfen?»
Sogar die zwei Psychologen schienen schockiert von ihrer Ansprache, und der junge Mann wirkte nun zusätzlich zu seiner Lebensmüdigkeit auch noch schuldbewusst. Ich verließ die Wohnung. Angelika und Martina blieben.
«Du wusstest das mit ihrem Mann?», fragte ich Angelika.
«Natürlich», antwortete sie. «Das ist vielleicht eine faszinierende Wende.»
Ich blickte sie verständnislos an.
«Sie hat Samen von ihm. Sie lässt sich künstlich befruchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eigenes Kind als Knochenmarkspender infrage kommt, ist sehr groß. Es gibt Hoffnung!»
«Hoffnung?»
«Dass sie es doch noch schafft!»
Ein paar Monate später sah man schon was. Eine kleine Wölbung unter ihrem T-Shirt. Die Befruchtung war erfolgreich verlaufen. Trotz der Medikamente, die Martina weiterhin nehmen musste, hatte es funktioniert. Das ungeborene Kind wuchs in ihrem verwüsteten Körper. Neben den aktuellen Blutwerten wurden wir jetzt auch mit Informationen über den Embryo versorgt.
«Es ist klein, aber sonst ist alles in Ordnung», sagte Martina. «Die Ärzte sind zufrieden mit der Kleinen. Mit mir nicht so. Gut möglich, dass ich bei der Entbindung verblute, weil meine Gerinnung so niedrig ist. Darum rät mein Frauenarzt dringend ab. Aber das ist meine einzige Chance. Wenn ich es nicht versuche, sterbe ich genauso.»
Angelika ging mit Martina zum Jugendamt. Sie unterschrieb, dass sie, falls Martina wirklich bei der Geburt sterben sollte, das Kind adoptieren würde.
«Das ist das Mindeste, was ich tun kann», sagte Angelika. Ihr sah man die Belastung inzwischen auch an.
Da Martinas Zustand immer kritischer wurde, sollte die Geburt früher als geplant eingeleitet werden. Sechs Wochen vor dem eigentlichen Termin.
Martina trug einen verwaschenen blassrosa Bademantel über dem Krankenhausnachthemd. Angelika und ich saßen ihr gegenüber im Besucherraum des Hanusch-Krankenhauses. Wir hielten beide ihre Hände.
«Ich bin so froh, dass ihr da seid», flüsterte Martina. Ihre Stimme war kaum wahrnehmbar und zitterte.
Angelika nahm sie in den Arm. Sie streichelte ihre strähnigen Haare. Beide begannen zu weinen.
Martina sah auf die Krankenhausuhr. «Ich muss zum Professor», sagte sie und verließ den karg eingerichteten Raum.
«Wie stehen ihre Chancen?», fragte ich.
Angelika schüttelte den Kopf.
Nach wenigen Minuten kam Martina wieder. «Es geht los. Sie haben gestritten, aber am Ende entschieden, dass wir es machen.»
Wir begleiteten sie zum Aufzug.
«Vielleicht sehen wir uns jetzt zum letzten Mal», flüsterte sie. «Ich danke euch für alles, für die ganze Zeit, die ihr …»
Sie brach zusammen. Wir knieten uns zu ihr auf den Boden, nahmen sie gemeinsam in den Arm, weinten gemeinsam.
Dann halfen wir ihr hoch. Sie drückte auf den Aufzugknopf. Die Anzeige war wie der Countdown einer Hinrichtung. 5, 4, 3, 2, 1, E. Die Tür öffnete sich. Sie stieg ein, blickte uns über die Schulter an. Ein letztes gequältes Lächeln. Die Tür schloss sich.
«Wie lange wird es dauern?», fragte ich Angelika.
Sie wischte sich Tränen aus dem Auge. «Ich weiß es nicht. Es wird ein Kaiserschnitt. Ihr Körper schafft es nicht auf natürlichem Weg.»
«Was für ein Wahnsinn», stöhnte ich erschöpft.
«Es war die intensivste Zeit meines Lebens, diese Zeit mit ihr», sagte Angelika. «Mein Freund hat mich verlassen, weil ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe. Viel mehr als mit ihm. Er war tatsächlich eifersüchtig auf eine Sterbende.»
Wir sahen auf die Uhr. Stellten uns vor, was jetzt im OP geschah. Ihr Blut, das sich nicht stillen ließ.
Ich dachte an den Brief. Ich bin nur zwei Jahre älter als du und möchte noch nicht sterben. Wie lang war das jetzt her? Eineinhalb Jahre? Ich hatte das Gefühl, seit achtzehn Monaten nicht mehr wirklich unbeschwert gewesen zu sein. Als hätte sich ein Schatten über unser Leben gelegt.
Plötzlich öffnete sich die Glastür, Martina stand vor uns. Mit roten, verquollenen Augen. «Sie haben es abgebrochen. Sie können die Verantwortung nicht übernehmen, dass ich während der Operation sterbe!»
Die nächsten beiden Wochen erschien sie nicht zur Sendung. Ich war erleichtert und fühlte mich gleichzeitig schuldig. Es war, als hätte man im Studio die Fenster geöffnet. Die Sendung war endlich wieder nur harmloses Geplauder, meine Lebenslust stieg.
Dann wartete sie wieder kurz vor Mitternacht beim Empfang. Bleich und verloren wie immer.
«Hallo, schön, dich zu sehen», murmelte ich und hoffte, dass meine Enttäuschung mir nicht anzumerken war.
«Das Kind ist gestorben. In mir liegt ein totes Kind», sagte sie, und jedes Licht am Horizont erlosch.
Wochen vergingen. Sie kam wieder regelmäßig ins Funkhaus und nahm die Anrufe entgegen. Ich spürte, dass nun auch Angelika ganz erschöpft war. Mit dem Baby war die Hoffnung gestorben. Martina sagte, man könne das Kind nicht herausholen, weil die Operation zu gefährlich sei. Sie saß am Telefon der Radiosendung, mit einem toten Körper in ihrem sterbenden Körper.
«Könntest du mit ihr nicht auch vielleicht einmal etwas unternehmen?», fragte Angelika. «Ich versuche gerade, die Beziehung zu meinem Freund zu kitten.»
«Ich bin die nächsten beiden Tage auf Tournee», sagte ich.
«Und was machst du mit Kina? Sophie ist doch noch auf der Exkursion.»
Sophie, meine Frau, war Biologin und in Osttirol auf der Suche nach einem Endemiten, dem Laufkäfer Carabus alpestris hopii, auf den sie sich spezialisiert hatte. «Ich weiß noch nicht. Die Oma ist ausgefallen, und Kina ist krank. Sie hat dieses Dreitagefieber. Die sechste Krankheit. So nennt man das.»
«Martina könnte doch auf deine Tochter aufpassen. Sie kann wirklich gut mit Kindern umgehen.»
«Ich checke erst mal noch andere Möglichkeiten», sagte ich. Aber niemand hatte Zeit. Also rief ich Martina an. Sie erklärte sich sofort bereit und stand kurz darauf mit einer kleinen Tasche vor unserer Wohnungstür. Meine Tochter begann zu weinen, als Martina sich zu ihr auf die Spieldecke setzte. Aber schon bald bauten sie zusammen Türme aus Holzklötzen.
Ich hatte im Gästezimmer ein Bett für Martina hergerichtet und verließ die Wohnung. Eine Notlösung, die einzige mögliche. Ich fuhr nach Graz, am nächsten Tag weiter nach Klagenfurt. Sophie konnte ich nicht erreichen, weil sie irgendwo in den Dolomiten ohne Empfang ihre Käfer suchte.
Nach dem Auftritt in Graz rief ich Martina an. Kina schlief. Alles war in Ordnung. Ich solle mir keine Sorgen machen.
Am nächsten Tag fuhr ich weiter nach Kärnten. Als ich im Hotel ankam, läutete mein Telefon. Angelika war am Apparat.
«Es geht um Martina», sagte sie. «Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören?»
«Die gute», sagte ich. Schlechte Nachrichten hatte ich in der letzten Zeit zu oft gehört.
«Gut», sagte Angelika. «Martina ist gesund.»
Ich verstand gar nichts.
«Keine Leukämie. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Sie hatte nie welche. Sie war auch keine Stewardess, ihre Eltern leben, es gibt keinen Bruder und keinen Mann. Und keine Schwangerschaft. Nichts. Sie hat uns angelogen, die ganze Zeit. Sie ist ein Psycho!»
Und sie erzählte mir aufgeregt, wie ihr Freund zu recherchieren begonnen hatte, weil ihm die Geschichte mit dem toten Kind merkwürdig vorkam. Das Leichengift hätte sie längst umbringen müssen. Man kann nicht mit einem toten Embryo im Körper leben.
Er rief bei Lauda Air an und fand heraus, dass sie dort nie gearbeitet hatte. Die vermeintliche Grabstätte ihrer Eltern war irgendein Grabstein von wildfremden Menschen. Schließlich fand er Martinas echte Eltern, und die erzählten ihm, sie sei lange in stationärer Behandlung gewesen, habe aber den Aufenthalt auf eigenen Wunsch abgebrochen. Nichts war wahr. Im Hanusch-Krankenhaus wusste man nichts von ihr, es gab keinen «Fall Martina».
Ich saß in Klagenfurt erstarrt am Hörer. Ich legte auf und wählte meine eigene Nummer in Wien. Ich ließ es ewig läuten. Niemand hob ab.
Ich lief ins Hotelfoyer und schrie panisch nach der Polizei. Die Rezeptionistin starrte mich entsetzt an.
Ich rief ein Taxi und brüllte den Fahrer an, er solle so schnell wie möglich nach Wien fahren. Während die Karawanken hinter uns kleiner wurden, telefonierte ich mit der Polizei und mit Angelika.
Die Beamten brachen die verschlossene Tür auf, aber die Wohnung war leer. Auch Martinas kleine Reisetasche fehlte. Kinas Schrank stand offen, ein Großteil ihrer Kleidung war weg und ihr Lieblingskuscheltier.
Im Kommissariat wartete Angelika auf mich. Sie hatte ein Foto dabei, das Martina am Brandenburger Tor zeigte. Das wurde an die Presse weitergegeben. Die Fahndung lief. Mir blieb nichts übrig, als zu warten und immer panischer zu werden. Angelika und ihr Freund betreuten mich.