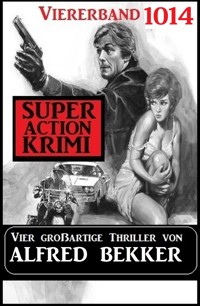Commissaire Marquanteur
und die Schüsse auf Monsieur Marteau: Frankreich Krimi
von Alfred Bekker
Wer will Polizeichef Marteau töten? Nach unmissverständlichen
Drohbriefen folgt ein ernstzunehmender Anschlag. Den Videoaufnahmen
nach handelt es sich um eine Frau, und der Verdacht konzentriert
sich auf die Tochter eines Auftragsmörders. Ist sie die einzige,
die den Chef gern tot sehen möchte? Commissaire Marquanteur und
seine Kollegen ermitteln unter Hochdruck.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick,
Jack Raymond, Jonas Herlin, Dave Branford, Chris Heller, Henry
Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Mein Name ist Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire in
Marseille. Mein Kollege François Leroc und ich sind Teil einer
Sonderabteilung, die den etwas umständlichen Namen Force spéciale
de la police criminelle, kurz FoPoCri, trägt und sich vor allem der
Bekämpfung der organisierten Kriminalität gewidmet hat.
Unser Chef ist Monsieur Jean-Claude Marteau, Commissaire
général de police.
Eigentlich sind es Leute wie François und ich, die in der
Schusslinie stehen. Ermittler im Außendienst eben. Und der Chef der
Abteilung hat natürlich auch alle Hände voll zu tun – nur erledigt
er das vom Büro aus, und seine Sekretärin versorgt ihn mit so viel
von ihrem guten Kaffee, wie hineingeht und nötig ist, um ab und zu
mal eine Nacht durchzuarbeiten.
Aber diesmal war es anders.
Diesmal stand der Chef selbst in der Schusslinie.
*
Monsieur Jean-Claude Marteau erstarrte, als er den roten Punkt
über das Grau seines Mantels zucken sah.
Der Laserpointer eines Zielerfassungsgerätes!
Monsieur Marteau reagierte blitzschnell. Er warf sich hinter
eines der am Straßenrand parkenden Fahrzeuge zur Seite.
Sekundenbruchteile später schlug ein Projektil in den Asphalt
ein. Ein Schussgeräusch war nicht zu hören. Monsieur Marteau
kauerte hinter einem Renault, zog die Dienstwaffe hervor und
wartete ab.
Irgendwo in dieser schmalen, unübersichtlichen Seitenstraße
lauerte ein Killer auf ihn.
Monsieur Marteau umrundete in geduckter Haltung den Renault.
Aufmerksam streifte sein Blick die Fassaden der Häuser, die
Balkone, die Reihe der parkenden Wagen am Straßenrand. Der Killer
hatte alle Vorteile auf seiner Seite.
Wieder sah Monsieur Marteau den Laserpunkt tanzen.
Er duckte sich.
Kugeln schlugen durch die Bleche des Renaults, ließen einen
der Reifen platzen und die Scheiben zerspringen. Ein Satz, und
Monsieur Marteau hatte sich hinter dem dahinter parkenden Van einer
Installateurfirma verschanzt.
Passanten blieben stehen, hier und da war ein Panikschrei zu
hören.
Monsieur Marteau griff in die Innentasche seines Mantels und
holte sein Handy hervor. Die Nummer des FoPoCri-Präsidiums
Marseille war in das Menü einprogrammiert. Ein Knopfdruck, und er
war verbunden.
»Hier Jean-Claude Marteau«, meldete er sich. In knappen Worten
gab er seine Position und Lage durch.
Verstärkung war unterwegs. Aber bis die eintraf, würde es noch
etwas dauern.
Monsieur Marteau klappte das Handy ein, steckte es weg und
tauchte vorsichtig hinter seiner Deckung hervor. Die Pistole vom
Typ SIG Sauer P 226 hielt er dabei im beidhändigen Anschlag.
Ein Schuss zischte haarscharf an Monsieur Marteaus Kopf
vorbei.
Sein Blick glitt hoch, entlang an den Hausfassaden. Fieberhaft
versuchte er zu erkennen, von wo aus man ihn ins Visier genommen
hatte.
Er sah eine Bewegung an einem Fenster im dritten Stock. Ein
Gewehrlauf wurde zurückgezogen.
Monsieur Marteau umrundete in geduckter Haltung den Van, lief
über die Straße. Einige Passanten beobachteten ihn dabei
misstrauisch. Monsieur Marteau holte seinen Dienstausweis hervor,
hielt ihn hoch und rief: »Gehen Sie aus der Schusslinie! Da oben
ist ein Killer.«
Monsieur Marteau erreichte die andere Straßenseite. Er hetzte
den Bürgersteig entlang. Seine Kondition war zwar nicht mehr so gut
wie damals, als er ein junger Mann war, aber für einen Mann seines
Alters war er in guter körperlicher Verfassung.
Aus der Ferne hörte er die Sirenen eines Polizei-Fahrzeugs. Er
konnte nicht warten, bis die Kollegen am Ort des Geschehens waren.
Er wollte den geheimnisvollen Killer stellen, der es auf ihn
abgesehen hatte. Monsieur Marteau lief auf den Eingang des Gebäudes
zu, in dem er den Killer gesehen hatte.
Haus Nummer 234.
Es war kein moderner Bau. Und das in jeder Hinsicht. Die
Fassade bröckelte, und die Videokamera über der Tür hatte eine
zersprungene Linse.
Monsieur Marteau drückte ein gutes Dutzend Klingelknöpfe. Ein
Surren ertönte.
Die Tür ließ sich öffnen. Monsieur Marteau stürmte zu den
Aufzügen.
Auch sie wurden eigentlich von Videokameras überwacht.
Jemand hatte die Kabel herausgerissen. Sicherheitspersonal
schien es in Nummer 234 nicht zu geben. Man verließ sich auf die
Videokameras, die so etwas wie eine Illusion von Sicherheit
erzeugten.
Einer der Aufzüge öffnete sich.
Ein Mann in einer dunkelbraunen Jacke trat heraus. Über der
Schulter trug er eine längliche Tasche, wie man sie für
Golfschläger verwendete.
Monsieur Marteau hielt ihm seinen Ausweis unter die
Nase.
»FoPoCri! Bitte öffnen Sie die Tasche!«
Der Mann war etwas verdutzt, gehorchte dann aber. Sehr
vorsichtig öffnete er das langgezogene Futteral. Es enthielt
tatsächlich Golf-Schläger.
»Verzeihen Sie«, sagte Monsieur Marteau.
»Schon gut. Was ist denn los?«
»Wo wohnen Sie?«
»Dritter Stock.«
»Sind Sie gerade jemandem begegnet?«
»Nein. Ich wohne in Apartment C 23, bin durch die Tür und dann
zum Aufzug gegangen.«
»Niemand da?«
»Nein.«
»Gibt es einen zweiten Ausgang?«
»Ja, aber der ist abgeschlossen, da kommen Sie nicht so
einfach durch – es sei denn, Sie wohnen hier und haben einen
Schlüssel.«
»Danke.«
Indessen heulten Sirenen durch die Straße. Das waren die
Kollegen der Polizei.
Die Aufzugtür bewegte sich. Ehe sie sich schließen konnte,
stellte Monsieur Marteau den Fuß dazwischen. In einem der oberen
Stockwerke hatte jemand den Aufzug aktiviert. Aber solange die
Sensoren der Schiebetür einen Widerstand registrierten, verhinderte
die Sicherheitsschaltung, dass der Lift benutzt werden konnte.
Monsieur Marteau zog seinen Mantel aus, rollte ihn zu einem Bündel
und legte ihn so auf den Boden, dass sich die Tür nicht schließen
konnte.
»Rühren Sie das nicht an!«, wies Monsieur Marteau den Mann in
der braunen Jacke an. Seine Stimme hatte einen autoritären Klang,
der keinen Widerspruch duldete. »Gehen Sie hinaus zu den Beamten
der Polizei und sagen Sie Ihnen, dass sie das Haus umstellen
sollen!«
Der Mann stand wie erstarrt da.
»Na los!«, forderte Monsieur Marteau nachdrücklich. »Worauf
warten Sie noch?«
Der Mann in der braunen Jacke setzte sich zögernd in
Bewegung.
Monsieur Marteau ging indessen vorsichtig die Treppe
hinauf.
Nachdem der Aufzug funktionsunfähig war, gab es nur diesen Weg
hinunter. Das hatte er gewollt.
Monsieur Marteau nahm die SIG in beide Hände.
Normalerweise residierte er in seinem Büro im Polizeipräsidium
und koordinierte die Einsätze des FoPoCri-Präsidiums von Marseille.
Ein Schreibtischjob. Aber wenn er auch nicht so im Training war wie
die aktiven Commissaires im Außendienst, so hatte er doch nichts
verlernt.
Er arbeitete sich bis zum ersten Treppenabsatz vor. Den Lauf
der SIG ließ er herumschnellen, riss ihn empor.
Es war niemand zu sehen.
Mit großen Schritten ging er weiter hinauf, immer zwei, drei
Stufen auf einmal.
Er erreichte das erste Obergeschoss, warf einen Blick den Flur
entlang.
Niemand zu sehen.
Vielleicht war der Killer auch längst weg, geflohen über einen
der Balkone auf der anderen Seite des Hauses.
Monsieur Marteau kehrte ins Treppenhaus zurück, erreichte das
nächste Stockwerk. Auch hier – nichts!
Die meisten Mieter waren um diese Zeit nicht zu Hause.
Als er das nächste Geschoss erreichte, schlich er besonders
vorsichtig den Flur entlang. In diesem Stock glaubte er das Gewehr
des Killers gesehen zu haben.
Der Grundriss unterschied sich von dem der unteren Stockwerke.
Der Flur machte eine Biegung. Dann führte er direkt an einer Reihe
von Fenstern entlang. Eines der Fenster war ein Stück hochgeschoben
…
Kein Zweifel, von hier aus hatte der Schütze auf ihn gefeuert.
Vorsichtig näherte sich Monsieur Marteau der Stelle. Auf dem Boden
lagen mehrere Patronenhülsen. Achtlos hatte der Killer sie
zurückgelassen.
Entweder bedeutete das, dass er in seinem mörderischen Job ein
blutiger Anfänger war, oder …
… es war Absicht!, dachte Monsieur Marteau. Der Killer will,
dass ich genau das hier zu sehen bekomme!
Monsieur Marteaus in so vielen Dienstjahren gewachsener
Instinkt für Gefahren meldete sich.
Sein Handy schrillte.
Mit der Linken griff er in die Innentasche seines Jacketts und
holte den Apparat hervor.
»Ja?«, meldete er sich.
Die Stimme, die er dann vernahm, war kaum mehr als ein
flüsterndes Krächzen.
»Ich weiß genau, wo Sie sind, Jean-Claude Marteau. Ich weiß
alles über Sie. Ihre Gewohnheiten, Ihre Vorlieben, Ihre Schwächen.«
Ein Kichern folgte. »Jeden Augenblick könnte ich Sie töten – ohne
dass Sie auch nur das Geringste dagegen unternehmen könnten!«
»Wer sind Sie?«, fragte Monsieur Marteau ruhig.
Die Stimme klang jetzt dumpf und verfremdet. Das höhnische
Lachen überforderte den Lautsprecher des Handys. Alles, was zu
hören war, war ein durchdringender, klirrender Laut.
»Haben Sie Angst, Monsieur Marteau?«, fragte die unheimliche
Stimme dann. »Schmecken Sie die Nähe des Todes? Er sitzt Ihnen wie
ein ewiger Verfolger im Nacken. Sie können nichts dagegen tun.
Irgendwann werde ich zuschlagen. Vielleicht in einer Sekunde –
vielleicht erst in einem Jahr oder niemals.«
»Sie haben vor Kurzem meinen Wagen in die Luft gejagt«,
stellte Monsieur Marteau fest.
Der Unbekannte schwieg.
Monsieur Marteau ging einen Schritt weiter.
»Sie müssen mich sehr hassen«, stellte er kühl fest. Seine
eigenen Emotionen verbarg er fast völlig.
»Oh, ja, das tue ich.«
»Was habe ich Ihnen getan?«
»Sie werden schon noch darauf kommen, Monsieur Marteau. Aber
zuvor werde ich Sie durch die Hölle der Ungewissheit und der
Todesangst schicken. Eine Reise, die Sie sich redlich verdient
haben.«
Monsieur Marteau hatte das Fenster beinahe erreicht.
An der Fensterscheibe war deutlich sichtbar der Schweißabdruck
einer ganzen Hand zu sehen. Zierlich und langfingrig, wie die Hand
eines Pianisten. Eine Spur, so deutlich, dass sie der Traum jedes
Erkennungsdienstlers war.
Zu deutlich …
Eine Sekunde später brach die Hölle los.
2
Als François und ich die Seitenstraße in Marseille-Mitte
erreichten, hörten wir den Knall einer gewaltigen Detonation. Ich
fuhr den Sportwagen, den mir die Fahrbereitschaft des FoPoCri zur
Verfügung stellte, schräg auf den Bürgersteig.
Unser Kollege Boubou Ndonga traf einen Augenblick später ein,
brauste mit seinem Rover die Straße entlang und bremste mit
quietschenden Reifen.
Wir rissen die Türen auf, sprangen raus und hatten dabei die
SIGs schon in der Faust. Im dritten Stock von Haus Nummer 234 war
ein Fenster buchstäblich herausgesprengt worden. Ein glutroter
Flammenpilz schoss empor. Mauerstücke wurden aus der Wand gebrochen
und in die Tiefe gerissen. Innerhalb von Sekunden bildete sich eine
Staubwolke, die alles einhüllte.
Unten auf der Straße wichen die Polizeibeamten vor den
herunterkrachenden Betonbrocken zurück.
Mein Freund und Kollege François Leroc und ich setzten zu
einem kleinen Spurt an. Boubou folgte uns.
»Marquanteur, FoPoCri!«, rief ich einem Beamten zu, der
unseren Weg kreuzte. »Was ist hier los?«
»Jemand hat auf euren Chef geschossen!«
»Wo ist Monsieur Marteau?«
Der Polizist deutete auf Haus Nummer 234.
»Irgendwo dort drinnen! Wir haben angefangen das Haus zu
umstellen, da ging plötzlich die Bombe los.«
Ich ließ den Beamten stehen und lief Richtung Eingang.
François und Boubou folgten mir.
Wir erreichten den Aufzug, dessen Schiebetür immer wieder
gegen einen zusammengerollten Mantel fuhr. Wir nahmen die Treppe.
Bei Bränden und Explosionen sind Aufzüge tabu, das gehört zum
kleinen Einmaleins der Sicherheitsbestimmungen.
Wir hetzten die Treppen hinauf bis in den dritten Stock, dann
den Flur entlang. Dann stoppten wir im Lauf. Monsieur Marteau stand
wie zur Salzsäule erstarrt da, den Blick auf das Loch gerichtet,
das die Explosion in die Fassade gerissen hatte. Sämtliche Scheiben
waren zersprungen.
Ich atmete tief durch, steckte die SIG ins Holster.
»Gott sei Dank, Chef! Ihnen ist nichts passiert.«
Monsieur Marteau schien uns zunächst gar nicht zu bemerken.
Sein Blick war nach innen gekehrt. Er war tief in Gedanken
versunken. Dann ging ein Ruck durch ihn. Er wandte den Kopf in
unsere Richtung. Sein Gesicht blieb unbewegt.
»Das war ziemlich knapp«, sagte er dann. »Aber ich bin
überzeugt davon, dass ER es genau so wollte.«
»Wer?«
»Der Killer, der mir schon eine ganze Weile auf den Fersen
ist. Erst mit zusammengeklebten Briefen, dann mit Anrufen und einem
Sprengstoffattentat auf meinen Wagen. Und nun …«
»Nun hat er Sie direkt ins Visier genommen«, stellte François
fest.
Monsieur Marteau nickte. Er deutete auf das Loch in der Wand.
»Von hier aus hat er auf mich gezielt. Mit einem Gewehr, das
über Laserzielerfassung verfügte. Hätte ich den roten Strahl nicht
aufblitzen sehen – ich hätte jetzt wohl eine Kugel im Kopf.«
Der Chef trat etwas näher an das Loch in der Wand heran.
Vom Fenster war nichts geblieben.
»Seltsam«, murmelte er dann.
»Worüber denken Sie nach, Chef?«, fragte ich.
»Der Killer hat eine deutliche Spur hinterlassen. Einen
Handabdruck … Ich konnte ihn gerade noch sehen und wunderte mich
über den Dilettantismus des Täters, da explodierte alles. Es wirkte
beinahe so, als ob …« Monsieur Marteau machte eine kurze Pause. Auf
seiner Stirn erschienen tiefe Furchen. »… als ob er mit mir spielen
wollte.«
»Ein grausames Spiel.«
»Ja, wie eine Katze, die noch wartet, ehe sie ihre Beute
endgültig tötet.«
»Chef, bei allem Respekt …«
Monsieur Marteau hob die Augenbrauen und sah mich an.
»Ja?«
»Sie sollten diesem Fall jetzt endlich Priorität
einräumen!«
Unser Chef nickte düster. »Vielleicht haben Sie recht.«
3
Das gesamte Gebäude wurde von Beamten der Polizei und
eintreffenden Commissaires durchsucht. Die Kollegen des zentralen
Erkennungsdienstes aller Marseiller Polizeiabteilungen machten sich
daran, nach jeder noch so kleinen Spur zu suchen.
Der Täter war offenbar entkommen. Möglicherweise über eine der
Feuerleitern. Kollegen der Polizei stellten fest, dass eine der
Wohnungstüren im vierten Stock aufgebrochen worden war. Vielleicht
war das sein Fluchtweg gewesen.
Wir befragten Dutzende von Personen aus der Nachbarschaft, um
etwas mehr über den mysteriösen Schützen zu erfahren, der auf
Monsieur Marteau angelegt hatte.
Monsieur Marteau bestand darauf, am Tatort zu bleiben und bei
den Ermittlungen dabei zu sein.
Es war Mittag, als die Kollegen der Spurensicherung erste
Ergebnisse mitteilen konnten. Danach war der Sprengstoff von außen
an das Mauerwerk angebracht worden. Das war auch der Grund dafür,
dass Monsieur Marteau nicht durch die Wucht der Detonation zerfetzt
worden war. Genauere Rückschlüsse, etwa Herkunft und Beschaffenheit
des Sprengstoffs, waren erst nach zusätzlichen Laboruntersuchungen
möglich.
François und ich begleiteten Monsieur Marteau schließlich zu
seiner Wohnung, die nur ein paar Straßen weiter gelegen war.
Die Kleidung unseres Chefs hatte bei dem Anschlag ziemlich
gelitten. Sie war vollkommen verstaubt, und so wollte Monsieur
Marteau nicht in seinem Büro im Präsidium erscheinen.
François fuhr mit dem Sportwagen, während ich in Monsieur
Marteaus Wagen mitfuhr, einem Mercedes aus unserer
Fahrbereitschaft.
Eins stand fest, wir konnten Monsieur Marteau jetzt auf keinen
Fall aus den Augen lassen. Der Täter, der ihn beinahe umgebracht
hatte, würde es vermutlich wieder versuchen. Seit einiger Zeit
schon wurde unser Chef terrorisiert. Zunächst waren es nur
zusammengeklebte Hass- und Drohbriefe gewesen, als deren Urheber
von uns zunächst ein Computerfreak verdächtigt worden war, gegen
den wir im Zusammenhang mit einem Fall von illegalem Organhandel
und einer Mordserie an Obdachlosen ermittelt hatten. Aber diese
Spur erwies sich rasch als Sackgasse. Der Computerfreak hatte es
geschafft, in die EDV des FoPoCri einzudringen. Daher war er auch
über alle Ermittlungsdetails informiert gewesen. Ein
Trittbrettfahrer, dem es Freude gemacht hatte, im Schatten eines
anderen Angst und Schrecken zu verbreiten. Nach seiner Festnahme
hatte der Terror keineswegs aufgehört.
Ganz im Gegenteil.
Der oder die Unbekannten hatten den Druck auf ihr Opfer
erhöht. Auf die Briefe folgten Anrufe. Die Stimme war stets so
verzerrt gewesen, dass damit der Täter nicht zu identifizieren
gewesen wäre.
Dann war Monsieur Marteaus Wagen auf dem Parkplatz vor unserem
Dienstgebäude explodiert, nachdem dies Augenblicke zuvor durch
einen Anruf angekündigt worden war. Und jetzt dieses Attentat, dem
Monsieur Marteau nur um Haaresbreite entgangen war.
»Der Attentäter muss Sie sehr hassen«, sagte ich an Monsieur
Marteau gewandt, während wir vor einer roten Ampel warteten. Ich
saß am Steuer des Mercedes. Monsieur Marteau saß mit nachdenklichem
Gesicht auf dem Beifahrersitz. Er nahm die Situation mit
erstaunlicher Gelassenheit hin. Aber diese Ruhe – ja, manchmal
sogar Kaltblütigkeit – gehörte zu seinem Charakter.
Wie viel davon Maske war, konnte man bei unserem Chef niemals
so ganz durchschauen.
»Die meisten, die mich derart hassen könnten, sind nicht mehr
in Freiheit«, meinte Monsieur Marteau dann.
Monsieur Marteaus Apartment lag in einer Straße in
Marseille-Mitte.
François, der mit dem Sportwagen vorausgefahren war, parkte am
Straßenrand und stieg aus. Er blickte sich um. Dann winkte er uns
kurz zu. Ich lenkte den Mercedes jetzt ebenfalls an den Straßenrand
und hielt hinter dem Sportwagen.
»Sie sollten nicht mehr ohne Kevlar-Weste aus dem Haus gehen«,
meinte ich. »Wer weiß, wo dieser Wahnsinnige beim nächsten Mal auf
Sie lauert. Außerdem sollten Sie überlegen, ob Sie nicht in
nächster Zeit woanders übernachten.«
»Übertreiben Sie nicht!«, mahnte mich unser Chef. »Ich habe
vor, meinen Dienst ganz normal fortzusetzen, ohne Abstriche. So
einfach lasse ich mich nicht in die Knie zwingen.«
Ein paar Minuten später standen wir vor Monsieur Marteaus
Wohnungstür.
Unser Chef öffnete.
Wir traten ein, ich zog dabei die SIG aus dem Gürtelholster.
Schließlich konnte man nicht wissen, ob der Unbekannte nicht
vielleicht hier auf sein Opfer wartete.
Monsieur Marteau lächelte nachsichtig, als ich die Waffe
schließlich wegsteckte.
»Ich bin froh, dass ich nicht in einer Position bin, in der
ich ständig irgendwelchen Personenschutz um mich habe. Das würde
mir ganz schön auf die Nerven gehen.«
»Kann ich verstehen«, meinte ich.
»Ich ziehe mir eben was anderes an. Sie können sich in der
Zwischenzeit einen Drink machen, wenn Sie wollen. Ist alles
da.«
Monsieur Marteau verschwand im Schlafzimmer.
Nach einem Drink war mir nicht. Und François ging es
ähnlich.
Ich dachte nach. Irgendwie musste es doch möglich sein, dem
Unbekannten auf die Spur zu kommen.
»Der Kerl hat seinen Terror immer weiter getrieben«, meinte
François.
»Kerl?«, fragte ich. »Wer sagt dir, dass es ein Kerl
ist?«
François verzog das Gesicht.
»Der Täter«, ahmte er den kühl-sachlichen Tonfall nach, in dem
unsere Presseabteilung Erklärungen an die Öffentlichkeit zu geben
pflegte. »Es wirkt so, als wollte er den Druck immer weiter
erhöhen.«
Monsieur Marteau kehrte zurück. Er band sich eine Krawatte um.
Mit schnellen, routinierten Bewegungen machte er sich einen
schmalen Knoten. Plötzlich sagte er: »Wenn das stimmt, was die
Kollegen vom Erkennungsdienst herausgekriegt haben, und der
Sprengsatz wirklich außen angebracht wurde, dann kann das nur
heißen, dass der Schütze mich nicht zerfetzen wollte.«
»Was wollte er dann?«, hakte François nach. »Ihnen Angst
einjagen?«
»Warum nicht?« Monsieur Marteau zuckte die Schultern. Sein
Gesicht wirkte blass. Die Ereignisse hatten ihn mehr mitgenommen,
als er zuzugeben bereit war.
»Chef, als Sie den Schützen entdeckten.«
Monsieur Marteau unterbrach mich.
»Ich habe ihn nicht gesehen. Nur den Lauf seiner Waffe. Das
war alles.«
»War zu dem Zeitpunkt bereits irgendetwas an der Außenfassade,
vielleicht ein paar Handbreit unterhalb des Fensters, zu
sehen?«
»Nichts, woran ich mich jetzt erinnern könnte.«
»Versuchen Sie sich die Situation noch einmal ins Gedächtnis
zurückzurufen!«
Monsieur Marteau fuhr sich mit der Hand über das Kinn, ging
zum Fenster und blickte hinaus auf den Straßendschungel von
Marseille. Er schüttelte den Kopf.
»Da war – glaube ich – nichts. Andererseits sind
Sprengladungen heute mitunter klein und kompakt. Auf die Entfernung
hin kann man so etwas für alles Mögliche halten.«
»Vermutlich hat der Täter die Ladung angebracht, während sie
ihm in Nummer 234 gefolgt und die Treppe hinaufgehetzt sind«,
meinte François.
Monsieur Marteau nickte langsam.
»Durchaus möglich. Aber der Punkt ist, dass er mich getötet
hätte, wenn die Ladung innen angebracht gewesen wäre.«
Das Telefon schrillte. Monsieur Marteau ging an den
Apparat.
Ein Knopfdruck auf den Anrufbeantworter, und das Gespräch
wurde aufgenommen.
Eine verzerrte Stimme meldete sich. Unser Chef schaltete den
Lautsprecher ein, damit wir mithören konnten. Der letzte Rest an
Farbe war aus seinem Gesicht geflohen.
»Ich weiß, wo Sie jetzt sind, Jean-Claude Marteau. Sie können
mir nicht entgehen. Immer bin ich bei Ihnen. In Ihren Gedanken …
Ich bin die Angst, die Ihnen den Rücken hinaufkriecht und die Sie
nicht mehr schlafen lassen wird.« Ein irres Kichern folgte. Es
wirkte hysterisch. »Sie fragen sich, warum ich den Sprengstoff
außen angebracht habe, warum ich Sie noch am Leben ließ. Ich sagte
Ihnen ja, dass ich irgendwann zuschlage und Sie töte … Irgendwann!
Sie werden in ständiger Ungewissheit leben. Und auch die beiden
Commissaires, die sich jetzt in diesem Moment bei Ihnen in der
Wohnung befinden, werden Ihnen nicht helfen können.«
Ich wirbelte herum.
»Von den Fenstern weg!«, rief ich.
Monsieur Marteau verstand sofort, duckte sich. Mit zwei
Schritten war ich neben dem Fenster. François ebenfalls. Wir
hielten die SIGs in den Händen, blickten hinaus und suchten mit den
Augen die Fensterzeilen auf der gegenüberliegenden Straßenseite
ab.
Nirgends war etwas Verdächtiges zu sehen.
Die verzerrte Stimme meldete sich erneut aus dem
Telefonlautsprecher.
»Es gibt kein Entrinnen für Sie, Jean-Claude Marteau. Kein
Entrinnen! Sie werden bezahlen!«
»Für was denn, verdammt noch mal?«, rief Monsieur
Marteau.
»Sie sind ein intelligenter Mann, Monsieur Marteau. Bevor Sie
sterben, werden Sie es wissen.« Die Verbindung wurde
unterbrochen.
4
Wir riefen Kollegen herbei. Sie sollten ermitteln, ob uns
jemand von der anderen Straßenseite beobachtete. Es gab allerdings
noch eine andere mögliche Erklärung dafür, dass unser Gegner über
das, was in Monsieur Marteaus Apartment geschah, so gut Bescheid
wusste.
Ich nahm mir systematisch alle Lampenschirme, den Telefonhörer
und andere typische Stellen zu, an denen Wanzen bevorzugt
angebracht wurden. Und ich wurde schnell fündig. Ich hielt das
kleine, daumennagelgroße elektronische Abhörgerät empor.
François und Monsieur Marteau verstanden sofort. Es wurde kein
Wort mehr gesprochen.
Wir gingen hinaus auf den Flur. Von dort aus riefen wir per
Handy den Erkennungsdienst.
»Die sollen sich mein Apartment mal gründlich vornehmen«,
meinte Monsieur Marteau.
»Sie können hier nicht bleiben, Chef«, erklärte ich. »Diese
Wanze – und wer weiß, ob es die einzige ist! – kam ja nicht von
allein in Ihre Wohnung. Unser Gegner war dort drin …«
»… und hat hoffentlich irgendeine Spur hinterlassen«, mischte
sich François ein.
Ein Haar, ein Speichelrest, eine Textilfaser – all das konnte
uns ein ganzes Stück weiterbringen.
Als wir die Eingangshalle des Apartmenthauses erreicht hatten,
sprach ich einen der uniformierten Sicherheitsleute an, die hier
für Sicherheit sorgten. Der Wachmann saß in einem gläsernen Büro
und überwachte auch die Videoanlage.
Wir hielten ihm unsere Ausweise entgegen.
»Was ist denn passiert?«, erkundigte sich der Wachmann.
»In Monsieur Marteaus Apartment ist jemand eingedrungen«,
sagte ich. »Sie führen hier eine Video-Überwachung durch?«
»Ja.«
»Das heißt, es kann niemand das Haus betreten, ohne
aufgenommen zu werden.«
»Das ist richtig.«
»Und wie lange reichen diese Aufzeichnungen zurück?«
»Achtundvierzig Stunden. Danach werden die Bänder gelöscht,
sofern uns nicht irgendein Vorfall gemeldet wird.«
»Ich möchte Sie bitten, uns sämtliche Bänder auszuhändigen«,
ließ sich nun Monsieur Marteau vernehmen.
Der Wachmann nickte.
»Okay, Monsieur Marteau. Wie Sie wollen.«
Wir wussten nicht, seit wann sich die Wanze in Monsieur
Marteaus Wohnung befunden hatte. Möglicherweise war das bereits
seit Wochen der Fall, dann brachten uns die Video-Bänder nicht
weiter. Aber möglicherweise hatten wir ja Glück, und auf den
Bändern war jemand zu sehen, der in das vage Bild passte, das wir
uns bisher von dem Attentäter gemacht hatten.
Der Wachmann machte sich daran, die Bänder
zusammenzusuchen.
»Ihnen ist niemand aufgefallen, der Monsieur Marteaus
Apartment besuchen wollte?«, fragte ich.
»Nein«, erklärte der Wachmann.
»Ihre Kollegen müssen wir auch noch befragen.«
»Kein Problem.«
5
Der große Magnum Colt wummerte. Der Rückschlag der gewaltigen
Waffe vom Kaliber 45 war mörderisch. Raphael Toville hielt sie
beidhändig. Sein gebräuntes, von dunklem Haar umrahmtes Gesicht war
zu einer Maske des Hasses verzerrt. Immer wieder feuerte er.
Etwa dreißig Meter entfernt befand sich ein dicker Holzpfahl.
Eine Gestalt war daran festgebunden, hing in den dicken Stricken
wie ein Toter. Raphael Toville schoss erneut. Die Kugel fetzte in
eine graue Jacke hinein, riss sie auf. Die Gestalt zuckte, der mit
einer Baseballkappe bedeckte Kopf wurde durch ein weiteres
Projektil von den Schultern gerissen.
Stroh kam zum Vorschein.
Eine Art Vogelscheuche war es, was sich Toville als Ziel
gewählt hatte. Nach sechs Schüssen war die Trommel des Magnum leer.
Es machte klick.
Mit einem wütenden Aufschrei schleuderte der breitschultrige
Toville die Waffe von sich.
»So ein verdammter Mist!«, krächzte er.
Seine Augen waren blutunterlaufen, die Hände zu Fäusten
geballt. Einer der zahlreichen Leibwächter, die Toville umgaben,
beeilte sich, die Waffe aufzuheben. Die Bodyguards trugen allesamt
dunkle Anzüge, kombiniert mit ebenso dunklen Hemden. Sie wirkten
fast wie Reverends. Nur die Maschinenpistolen und Funkgeräte
erinnerten daran, dass sie mit der Frohen Botschaft nichts zu tun
hatten.
»Reg dich doch nicht so auf«, hauchte eine dunkle, weibliche
Stimme.
Toville drehte sich herum und blickte in die herausfordernden
blauen Augen einer atemberaubenden Schönheit. Das blonde Haar fiel
ihr lang über die Schultern. Ihr Gang hatte etwas Gazellenhaftes.
Sie trug ein ziemlich enges Kleid, das von den Vorzügen ihrer Figur
kaum etwas verbarg.
»Claudine!«, stieß Toville hervor. Er schluckte. »Was machst
du hier?«
»Ich habe dich gesucht. Und deine Ballerei hört man im ganzen
Haus. Ich konnte mir also denken, dass du wieder hier draußen im
Garten bist.«
Toville nickte.
Einer seiner Gorillas hatte indessen den Magnum Colt
nachgeladen. Wortlos übergab er seinem Boss die Waffe.
»Lass es«, hauchte Claudine. »Die Hunde sind schon ganz
verrückt.«
Toville stieß einen dumpfen Schrei hervor und ballerte die
gesamte Trommel leer. Die Vogelscheuche zuckte. Dann steckte
Toville die Waffe hinter den Hosenbund.
»Ich bin verdammt wütend«, knurrte er. »Hast du schon gehört,
was heute vor Gericht los war?«
Claudine zuckte die Achseln.
»Dein Anwalt meint, ich sollte dich fragen.«
»Eric ist ein verdammter Narr!«
»Liebling, red nicht so über meinen Bruder! Du weißt, dass ich
das nicht mag.«
»Ist doch aber wahr! Dieser Idiot bringt uns noch alle in den
Knast. Ich habe alles getan, um ihm den Prozess zu ersparen, ich
habe meine Verbindungen spielen lassen und werde das auch weiter
tun. Aber er muss sich an die Absprachen halten!«
»Er hat Angst, Darling. Angst, für viele Jahre hinter Gitter
zu wandern!«
»Veranstaltung von illegalem Glücksspiel – damit werden die
Anwälte, die ich Eric bezahle, mit links fertig. Es wird zu
irgendeinem Deal kommen. Und was die Verabredung zum Mord angeht,
hat der Staatsanwalt mächtig auf den Putz gehauen. Aber das war
alles nur Theaterdonner. Die Beweislage ist schlecht, sie werden
ihm das nicht anhängen können.« Tovilles Gesicht verzog sich zur
wütenden Grimasse. »Wenn er – verdammt noch mal – die Nerven
behalten würde … Er ist heute schon fast zusammengebrochen.«
Toville ging auf Claudine zu, fasste die junge Frau bei den
Schultern und sah ihr scharf in die Augen.
»Ich habe viel für deinen Bruder getan. Und womit wird er es
mir am Ende danken? Damit, dass er mich ans Messer liefert!«
»Aber so etwas hat er doch gar nicht getan!«
»Noch nicht. Noch nicht. Aber wenn der erst mal ins Reden
kommt, was glaubst du, was dann los ist?« Toville bleckte die Zähne
wie ein Raubtier.
Claudine schluckte. Sie studierte aufmerksam Tovilles
Gesichtszüge.
»Sollte nicht heute Morgen dieser Mann von der FoPoCri
aussagen?«, fragte sie.
»Nicht irgendein Commissaire«, korrigierte Toville, »sondern
Monsieur Jean-Claude Marteau, Commissaire général de police in
Marseille persönlich. Er wurde zu den Ermittlungen seiner Abteilung
befragt. Ja, schau mich nicht so an, Engelchen. Es ist tatsächlich
der Jean-Claude Marteau. Damals war er einfacher kleiner
Commissaire.« Toville wandte sich an einen seiner falschen
Reverends, zog die Magnum hervor und warf ihm die Waffe zu. Der
Leibwächter fing sie auf.
»Steck ein paar Dinger in die Trommel! Ich bin meine Wut noch
nicht ganz los.«
»Okay, Chef!«
»Lebende Ziele sind einfach nicht zu ersetzen.«
6
Es war später Nachmittag, als wir in Monsieur Marteaus Büro
saßen.
Melanie, seine Sekretärin, servierte uns ihren berühmten
Kaffee, der im gesamten Präsidium einen geradezu legendären Ruf
besaß.
Monsieur Marteau rührte seinen dampfenden Pappbecher kaum an.
Er wirkte sehr nachdenklich.
Wir arbeiteten tagtäglich mit ihm zusammen. Er war unser
Vorgesetzter, aber auch eine Art väterlicher Freund und Mentor, der
seine Hand über uns hielt, wenn mal was schiefging.
Eigentlich müsste man so einen Menschen genau kennen und im
Laufe der Zeit alles über ihn wissen. Aber das Privatleben von
Monsieur Marteau war die ganzen Jahre hindurch immer eine Art
Geheimnis geblieben. Im Grunde wusste ich nicht viel über ihn, was
nicht unmittelbar mit dem Dienst zu tun hatte. Er hatte bei der
Armee gedient und war später Commissaire geworden. Nachdem seine
Familie Gangstern zum Opfer gefallen war, hatte er sein Leben
völlig dem Kampf gegen das Verbrechen gewidmet. Vielleicht besaß er
so etwas wie ein Privatleben gar nicht.
Oft genug war er morgens der erste im Büro und blieb bis spät
in die Nacht dort. Einer, der unermüdlich für das Recht und den
Schutz der Schwachen arbeitete.
Monsieur Marteau hörte sich geduldig den vorläufigen Bericht
der Spurensicherung an. Julie Coubertin, eine Kollegin vom
Erkennungsdienst, trug ihn vor und erläuterte uns die einzelnen
Erkenntnisse.
»Insgesamt befanden sich drei Wanzen in Ihrer Wohnung,
Monsieur Marteau. Fingerabdrücke haben wir nicht gefunden, aber
dafür etwas, das einen Menschen ebenso eindeutig zu identifizieren
vermag.«
Monsieur Marteau zog die Augenbrauen empor.
»Und das wäre?«
»Ein Ohrabdruck. Wir fanden ihn an der Tür.«
Erst seit Kurzem war man bei der Bekämpfung von
Einbruchsdiebstählen darauf gekommen, Täter durch Ohrabdrücke zu
identifizieren. Bevor Einbrecher eine Wohnung betraten, lauschten
sie häufig an der Tür, um abzuschätzen, ob jemand zu Hause war.
Dabei hinterließen sie mitunter einen Abdruck, der ebenso
individuell wie ein Fingerabdruck ist. Der Nachteil dieser Methode
bestand bis jetzt noch darin, dass es – anders als bei
Fingerabdrücken – keine umfangreichen Datensammlungen gab, mit
denen man die gewonnenen Abdrücke vergleichen konnte. In den
entsprechenden Dateien befanden sich erst die Ohrabdrücke einiger
hundert gefasster Einbrecher, und es würde noch Jahrzehnte dauern,
bis die Ohr-Archive mit jenen für Fingerabdrücke auch nur im
Entferntesten vergleichbar waren. In der Praxis bedeutete das, dass
man den Täter erst einmal ermittelt und gefangengenommen haben
musste, um ihn dann mit dem Ohr-Print zu überführen.
Julie Coubertin zeigte uns den Abdruck mit Hilfe eines
Overheadprojektors.
»Ein ziemlich kleines Ohr«, meinte Monsieur Marteau. »Es passt
irgendwie zu der zierlichen Pianisten-Hand, deren Abdruck ich am
Fenster gesehen habe.«
»Was ist mit den Wanzen?«, fragte ich. »Gibt es in der
Hinsicht irgendwelche Hinweise?«
»Es handelt sich um das, was ich als handelsübliche Ware
bezeichnen würde«, berichtete Julie Coubertin. »Das schließt zwar
nicht aus, dass Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben, aber die
ganze Abhörvorrichtung deutete doch eher darauf hin, dass hier
keine Spezialisten am Werk waren. Vielleicht ergibt die Auswertung
der Videoaufzeichnungen weitere Hinweise.« Damit gab sie das Wort
weiter an Maxime Valois, der zur Fahndungsabteilung unserer FoPoCri
gehörte und im Innendienst tätig war.
»Nun, wir wissen natürlich nicht, seit wann die Wanzen
installiert waren«, erklärte er. »Aber die Auswertung der Bänder
hat einen Hinweis ergeben, dem wir nachgehen sollten. Wir haben
alle auf den Bändern aufgenommenen Personen durch den Computer
gejagt und auf optische Übereinstimmungen mit gesuchten oder
erkennungsdienstlich erfassten Personen hin verglichen.«
»Und?«, fragte Monsieur Marteau.
»Leonard Rodin hat gestern das Apartmenthaus betreten, in dem
Sie wohnen. Ob Ihre Wohnung sein Ziel war, wissen wir nicht. Die
Kamera auf Ihrem Flur hatte gestern eine Funktionsstörung …«
»… oder wurde manipuliert«, mischte sich François ein.
»Durchaus möglich«, gab Valois zu. »Die technischen
Einzelheiten müsste man untersuchen. Allerdings dürfte es bei dem
Namen Rodin bei Ihnen klingeln, Monsieur Marteau.«
Unser Chef nickte.
»Das kann man wohl sagen. Rodin ist der Mann fürs Grobe in
Diensten eines gewissen Eric Halmarque, dem eine Nobeldisco mit dem
Namen CÈLESTE gehört, gegen den seit einiger Zeit ein Prozess
läuft. Als das Attentat auf mich verübt wurde, kam ich gerade aus
dem Gerichtsgebäude, wo ich meine Aussage gemacht hatte, und war
auf dem Weg zu meinem Wagen, den ich ein paar Straßen weiter
abgestellt hatte.«
»Dieser zeitliche Zusammenhang sieht für mich nicht gerade
nach Zufall aus«, warf Commissaire Boubou Ndonga ein.
Gegen Eric Halmarque hatte unsere Abteilung vor einiger Zeit
ermittelt. François und ich hatten zwar nicht an dem Fall
gearbeitet, aber wir hatten genug darüber mitgekriegt, um
einigermaßen Bescheid zu wissen.
Eric Halmarques CÈLESTE galt als stadtbekannter Umschlagplatz
für Designer-Drogen. Außerdem hatte Halmarque illegales Glücksspiel
betrieben. Was Letzteres anging, war er unseren verdeckten
Ermittlern auf den Leim gegangen. Allerdings bezweifelten
Halmarques Anwälte inzwischen, dass die Ermittlungen rechtmäßig
gewesen waren. Sie forderten einen Ausschluss der dabei gewonnenen
Erkenntnisse von der Beweisaufnahme im Prozess. In dem Zusammenhang
war Monsieur Marteau am Morgen befragt worden, und vielleicht
würden auch noch einige unserer Kollegen vorgeladen werden.
»Möglicherweise will jemand Druck auf Sie ausüben, Monsieur
Marteau«, meinte François.
»Um irgendetwas an meiner Aussage zu ändern?« Er schüttelte
den Kopf. »Ich glaube kaum. So naiv ist Halmarque nicht.«
»Wer steht hinter Halmarque?«, erkundigte ich mich an Valois
gewandt.
»Raphael Toville, von dem wir vermuten, dass er eine große
Nummer im illegalen Glücksspiel und bei der Verbreitung von
Designer-Drogen ist. Toville ist übrigens ein Cousin von
Halmarque.«
Valois wandte sich an Monsieur Marteau. »Erinnern Sie sich an
einen gewissen Pablo Halmarque?«
Monsieur Marteau bestätigte.
»Ja …«
»Das ist der Vater von Eric Halmarque!«
»Ja, ich erinnere mich … Pablo hatte seine Finger damals im
Mädchenhandel. Ich war maßgeblich an seiner Verhaftung
beteiligt.«
»Liegt da bei Eric Halmarque vielleicht ein Rachemotiv vor?«,
fragte ich.
»Pierre, sein Vater bekam zehn Jahre damals …«
»… und starb nach drei Jahren in der Haft«, sagte Maxime
Valois. »Und zwar bei einer Schlägerei in der
Gefängniskantine.«
Monsieur Marteau hob die Augenbrauen. »Davon wusste ich
nichts.«
»Als Rachemotiv etwas weit hergeholt«, kommentierte
Ndonga.
»Wir müssen jeder Spur nachgehen«, gab Valois zu
bedenken.
»Und da gibt es in der Tat noch eine weitere, die wir nicht
aus den Augen verlieren sollten«, meldete sich nun Josephe
Kronbourg zu Wort. Zusammen mit seinem Partner Léo Morell hatte er
in der Anfangsphase den Fall allein bearbeitet, weil wir anderen
Commissaires vollauf damit beschäftigt gewesen waren, einen
Waffenhändler-Ring zu sprengen und unseren entführten Kollegen
Stéphane Caron zu befreien.
Monsieur Marteau wandte sich zu den beiden herum.
»Was haben Sie herausgefunden?«
»Adam Loutriche ist seit dem zwölften dieses Monats auf freiem
Fuß.«
Monsieur Marteaus Stirn umwölkte sich.
»Wer ist dieser Loutriche?«, fragte ich.
»Ein Profi-Killer, der seit fünfundzwanzig Jahren im Gefängnis
einsitzt. Er schwor damals Rache, weil er mich für seine Verhaftung
verantwortlich machte. Im Gerichtssaal wurde er immer wieder
ausfällig, wenn er mich sah. Er musste schließlich aus dem Saal
gebracht werden.« Monsieur Marteau hob den Kopf. »Wie konnte das
passieren?«
Josephe Kronbourg antwortete: »Loutriche nutzte einen
Krankenhausaufenthalt zur Flucht. Der Mann ist todkrank. Er hat
Krebs im Endstadium und nur noch wenige Monate zu leben.
Unwahrscheinlich also, dass er noch mal in das Killer-Geschäft
einsteigt – mal davon abgesehen, dass die Zeit auch an ihm nicht
vorbeigegangen sein dürfte. Andererseits hat er seinen Hass auf Sie
nicht vergessen, Monsieur Marteau. Ich habe mit dem
Gefängnispsychologen gesprochen. Loutriche hegt immer noch
Gewaltphantasien, was Sie betrifft. Seine Fixierung auf Sie trägt
krankhafte Züge. Er wäre zu allem fähig!«
»Warum hat mich niemand davon verständigt, dass Loutriche frei
ist?«, brummte Monsieur Marteau. Der Ärger war ihm deutlich
anzusehen. Seine Hände ballten sich Fäusten.
»Seine Flucht ist kein Fall unserer Abteilung«, gab Josephe zu
bedenken. »Und außerdem liegt die Sache mit Ihnen schon so lange
zurück, dass wohl niemand daran dachte, Sie zu warnen.«
Léo Morell fuhr fort.
»Loutriches Flucht fand am Zwölften statt. Zwei Tage später
wurde Ihr Wagen in die Luft gejagt. Er könnte es also sein.«
Monsieur Marteau zog die Augenbrauen zusammen.
»Aber die Briefe … Das begann viel früher!«
Léo nickte.
»Wenn Kokain und Crack ihren Weg ins Gefängnis finden, dann
wird es auch möglich sein, ein paar Briefe auf den Weg zu bringen.
Die Drohbriefe waren im Übrigen aus den Seiten des Marseiller
Abendblatts zusammengeklebt. Und Loutriche war ein regelmäßiger
Leser dieser Zeitung. Und was die Telefonanrufe angeht, so ist das
aus dem Gefängnis heraus auch keine Schwierigkeit. Schließlich sind
per Handy schon ganze Mafia-Imperien jahrelang aus dem Knast heraus
regiert worden.«
»Noch etwas spricht für Loutriche als Täter«, ergänzte Josephe
schließlich. »Er hatte eine militärische Ausbildung – als
Sprengstoffspezialist. Er kannte sich also bestens aus.«
Monsieur Marteau nickte.
»Bleiben Sie am Ball, was Loutriche angeht.« Er wandte sich an
François und mich. »Und Sie beide möchte ich bitten, im Umfeld des
Toville/Halmarque-Clans zu ermitteln. Möglicherweise gibt es da
doch Zusammenhänge.«
Bevor wir auseinandergingen, wandte sich Monsieur Marteau noch
an Boubou.
»Wie geht es Stéphane?«, erkundigte er sich. »Haben Sie etwas
Neues gehört?«
Unser Kollege Stéphane Caron war während seiner Zeit, die er
als Kidnapping-Opfer in der Gewalt von Waffenschmugglern verbracht
hatte, übel misshandelt worden. Die Gangster hatten ihn für einen
Mann der Konkurrenz gehalten und mit Hilfe von Wahrheitsdrogen
Informationen aus ihm herausholen wollen. Das war das Schlimmste
gewesen. Inzwischen war Stéphane wieder über den Berg, und wir
hofften natürlich alle, dass er keine dauerhaften Schäden
davontragen würde.
»Stéphane hat mich angerufen. Die letzten Tests waren leider
nicht eindeutig. Er bleibt noch ein paar Tage zur Beobachtung in
der Klinik«, berichtete Boubou. »Wahrscheinlich kommt er erst
nächste Woche raus. Jedenfalls brennt er drauf, seinen Dienst
wieder aufnehmen zu können.«
»Damit soll er sich ruhig noch etwas Zeit lassen«, sagte
Monsieur Marteau.
7
Adam Loutriche war lang und schlaksig. Sein volles Haar war
aschgrau. Er trug einen Trenchcoat, der für die Witterung
eigentlich etwas zu warm war.
Nach seiner Flucht hatte er sich neue Kleidung besorgt und
versucht, seine alten Unterwelt-Verbindungen wieder aufzunehmen.
Aber es hatte sich vieles geändert.
Fünfundzwanzig Jahre war eine lange Zeit …
Und während dieser ganzen Zeit hatte der Hass unaufhörlich in
ihm gebrannt.
Loutriche hustete erbärmlich. Der Krebs fraß an seiner Lunge.
Und wenn man den Ärzten Glauben schenken konnte, dann war das
meiste davon schon nicht mehr intakt. Wochen noch, vielleicht
Monate. Das war alles, was Loutriche blieb.
Aber für das, was er vorhatte, würde es reichen.
Ein zynisches Lächeln spielte um die dünnen Lippen des
Killers. Mit langsamen, fast schleppend wirkenden Schritten ging er
eine schmale Seitenstraße im Viertel entlang.
Hat sich alles sehr verändert hier, dachte Loutriche. Einen
Augenblick lang war er sich unsicher, ob er sich vielleicht vertan
hatte. Die Hausnummer an einer Boutique gab ihm die Orientierung
zurück.
Und dann fand er, was er suchte.
Carlos Second Hand-Laden.
Loutriches Rechte steckte in der Manteltasche und umfasste den
Griff der SIG Sauer P 226, die er bei seiner Flucht einem Wachmann
abgenommen hatte.
Carlos Laden lag im Souterrain eines sechsgeschossigen Hauses.
Loutriche betrat den Laden.
Der wenige Platz war mit Bergen von Comic-Heften, alten
Pulp-Magazinen, Haushaltsgeräten und Schallplatten aus den
Sechzigern und Siebzigern belegt. Ein pittoreskes Chaos. Hinter dem
Tresen stand ein kleiner, dünner Mann mit wachen grauen
Augen.
Er starrte Loutriche an, als ob er einen Geist vor sich hätte.
Dann schluckte er.
Loutriche schob den Riegel vor die Tür. Ein dünnes Lächeln
stand in seinem Gesicht.
»Hi, Carlo. Sag bloß, es hat dir die Sprache
verschlagen.«
»Mein Gott, Adam!«
»Hast wohl nicht mehr gedacht, dass wir beide uns noch mal
über den Weg laufen, was?« Loutriches Worte endeten in einem
erbärmlichen Husten.
Carlo machte eine schnelle Bewegung zur Seite.
Eine zu schnelle Bewegung.
Loutriche riss die SIG aus dem Mantel. Der Lauf zeigte auf
Carlos Oberkörper. Der Ladenbesitzer erstarrte.
»Hey, mach keine Dummheiten, Adam!«
»Das fällt mir etwas leichter, wenn du keine machst.«
»Mann, was denkst du denn von mir?«
»Du bist ein käuflicher Schleimer, der immer dem gehorcht, vor
dem er am meisten Angst hat, Carlo. Ich denke, daran hat sich in
all den Jahren nichts geändert.«
Carlo schluckte. Loutriches Stimme klirrte wie Eis. Er spürte
die absolute Gefühlskälte seines Gegenübers. Diesem Mann machte es
nichts aus, notfalls über ein paar Leichen zu steigen. Das war
damals so gewesen, und es gab für Carlo nicht den geringsten Grund
anzunehmen, dass sich daran etwas geändert hatte.
»Hört sich nicht gut an, dein Husten.«
»Scheiß drauf!«, knurrte Loutriche.
Carlos Augen wurden schmal.
»Was willst du?«
»Ich brauche neue Papiere … Und du warst doch immer der
Spezialist für so etwas.«
»Tut mir leid, Adam!«
»Was?« Loutriches Gesicht verzog sich. Er schnellte
überraschend vor, langte über den Tresen und packte Carlo am
Kragen. Er zog ihn halb über den Tisch und setzte ihm die SIG an
die Stirn.
Carlo zitterte.
»Du wirst doch einen alten Freund nicht hängen lassen,
oder?«
»Adam, nimm die Waffe weg, ich.«
Loutriche versetzte Carlo einen brutalen Stoß. Carlo wurde
zurückgeschleudert, krachte gegen eine Regalwand und rutschte zu
Boden. Er blutete aus der Nase.
»Überleg dir sehr gut, was du sagst, du Scheißkerl!«
»Adam, es ist nicht so, dass ich dir keine Papiere besorgen
will.«
»Ach, nein? Freut mich zu hören.«
»Adam, ich bin aus dem Geschäft!«
»Aber du kennst die, die jetzt das Geschäft machen,
oder?«
»Schon, aber …«
»Also, sieh zu, dass du alles Nötige veranlasst!«
Carlo erhob sich.
Loutriche griff in die Manteltasche und holte ein Kuvert
hervor.
»Hier«, sagte er. »Das sind Passfotos und was du sonst noch
brauchst.«
»Es gibt ein paar mächtige Leute, denen es nicht gefällt, dass
du wieder aus dem Verlies herausgekrochen kommst, Loutriche«,
zischte Carlo. »Diese Leute haben Schwierigkeiten genug, die
brauchen nicht noch Probleme mit einem, der schon lebendig begraben
war.«
Loutriche lachte rau.
»Diese Leute können mich mal. Und wenn du mir nicht hilfst,
bist du ein toter Mann, Carlo! Und du weißt, dass ich jeden
gekriegt habe. Jeden!«
8
Das CÈLESTE lag in einer vielbefahrenen Avenue. Wir hofften
dort Leonard Rodin zu finden, Halmarques Mann fürs Grobe.
Der Rausschmeißer am Eingang ließ uns anstandslos durch.
Offenbar waren wir seinem Geschmack nach gut genug angezogen,
um im CÈLESTE unser Geld ausgeben zu dürfen.
Laserblitze zuckten durch den Raum. Die Musik stampfte. Auf
der Tanzfläche wiegten sich schöne Körper zum Takt der Musik.
Manche der Tänzer wirkten wie in Trance.
Wir wandten uns an die Bar.
Der Mixer wollte uns seine neueste Spezialität andrehen und
redete wie ein Wasserfall. Das meiste konnte man wegen der lauten
Musik ohnehin nicht verstehen.
»Wir suchen Monsieur Rodin«, brachte ich schließlich
vor.
Der Mixer wurde plötzlich sehr zugeknöpft.
»Leonard Rodin. Der arbeitet doch hier«, ergänzte
François.
»Was wollen Sie denn von Leonard?«
Ich lächelte dünn.
»Das würden wir ihm schon gerne selbst sagen.«
»Fragt sich nur, ob Leonard auch mit Ihnen reden will!«
»Ich glaube schon«, erwiderte ich und legte den Dienstausweis
auf den Tisch.
»Ich habe keine Ahnung, wo Leonard ist.«
»Dann möchten wir gerne mit Monsieur Halmarque
sprechen.«
»Einen Moment.«
Der Mixer griff zum Telefon.
Ich ließ den Blick schweifen. An einem der Nebeneingänge sah
ich einen Mann mit dunklen, fast schulterlangen Haaren. Er war groß
und sehr breitschultrig. Ich erkannte ihn von den Fotos wieder, die
ich von ihm gesehen hatte.
»Da ist er!«, rief ich.
Mit schnellen Schritten durchquerte ich den Raum. François
folgte mir.
Eine sonnengebräunte Dunkelhaarige tanzte mir entgegen.
»Hi, Lust auf einen Drink?«
»Ein anderes Mal.«
Ich schob sie zur Seite. Rodin schien gemerkt zu haben, dass
wir zu ihm wollen. Leute wie er hatten oft einen sechsten Sinn, um
Polizisten zu erkennen. Vielleicht hatte er auch beobachtet, wie
ich dem Mixer meinen Ausweis gezeigt hatte. Jedenfalls war er
plötzlich nicht mehr da.
Ich setzte zu einem Spurt an, stieß gegen einen der Tänzer.
Die unfreundlichen Bemerkungen überhörte ich.
Ein Raunen ging durch die Menge.
»Machen Sie Platz! FoPoCri!«, rief ich.
Wir erreichten den Nebeneingang, an dem wir Rodin gerade noch
gesehen hatten. Ein Vorhang aus Perlenketten verdeckte ihn.
Ich teilte ihn mit der Hand, ging hindurch und blickte einen
langen, mit Teppichboden ausgelegten Flur entlang.
Rodin befand sich am Ende des Flurs. Er ging mit schnellen
Schritten davon, drehte sich dabei halb herum.
»Monsieur Rodin! Bleiben Sie stehen! FoPoCri!«, rief
ich.
Rodin riss eine Automatik unter seiner Lederjacke hervor.
Einen Sekundenbruchteil später wummerte die Waffe los.
Zweimal kurz hintereinander peitschten Schüsse durch den Flur
und pfiffen dicht über uns hinweg. Die Projektile zerfetzten einige
Meter hinter uns die Deckenverkleidung. Eine Neonröhre zersprang.
Es wurde etwas dunkler.
Ich riss meine SIG heraus und gab einen Warnschuss ab.
Rodin verschwand hinter einer Biegung.
Ich spurtete los. François folgte mir.
Wir erreichten die Biegung. Mit der SIG in beiden Händen
tauchte ich aus der Deckung. François gab mir Feuerschutz. Von
Rodin war nichts mehr zu sehen.
Links befanden sich die Aufzüge. An den Leuchtanzeigen war zu
sehen, dass einer davon gerade benutzt wurde. Der Lift war auf dem
Weg nach unten. Am Ende des Flur befand sich der Notausgang über
das Treppenhaus. Die feuerfeste Stahltür stand einen Spalt weit
offen.
»Nimm du den Lift, ich nehme mir das Treppenhaus vor!«, rief
ich.
»Wahrscheinlich will er in die Tiefgarage«, war François
überzeugt.
Ich spurtete los, ließ die Stahltür mit einem wuchtigen Tritt
zur Seite springen und sah mich um.
Von Rodin war nichts zu sehen. Ich hetzte die Stufen hinunter.
Tief unter mir hörte ich eine Tür ins Schloss fallen.
Zwei Treppenabsätze brachte ich hinter mich. Dann führte eine
Tür hinaus in einen Hinterhof. Sie war abgeschlossen. Ein Schlüssel
befand sich in einem Glaskasten. Bei Gefahr konnte dieser leicht
zerstört und die Tür geöffnet werden. Aber alles war
unversehrt.
Ich lief weiter, eine weitere Treppe hinab.
Schließlich erreichte ich die Stahltür, die zur Tiefgarage
führte. Ich riss die Tür auf, ließ den Blick über die Reihen von
parkenden Fahrzeugen schweifen.
François sah ich in einiger Entfernung bei den Aufzügen. Er
pirschte sich mit der SIG in der Faust an einen Betonpfeiler heran
und machte mir ein Zeichen. Er wusste auch nicht, wo Rodin
steckte.
Aber er musste hier sein.
Ich suchte hinter einem der Betonpfeiler Deckung und wartete
ab.
Auf der anderen Seite der Tiefgarage heulte ein Motor auf. Ein
Porsche jagte über den Asphalt. Ich schnellte vor, packte die SIG
mit beiden Händen und stellte mich mitten auf die Fahrbahn. Der
Porsche brauste auf mich zu. Durch die Windschutzscheibe sah ich
Rodins verzerrtes Gesicht.
Anstatt abzubremsen, gab er noch Gas.
Sekundenbruchteile, bevor die Stoßstange des Porsche mich
erfassen konnte, sprang ich zur Seite. Der Porsche jagte Zentimeter
an mir vorbei. Ich rappelte mich hoch und gab zwei gezielte Schüsse
mit der SIG ab. Der Reifen des rechten Hinterrades platzte mit
einem ohrenbetäubenden Knall. Flammen züngelten empor. Der Geruch
von verbranntem Gummi verbreitete sich in der Tiefgarage. Funken
sprühten, als die Felgen über den Asphalt kratzten.
Rodin versuchte, den Wagen gerade auf der Fahrbahn zu halten,
aber das gelang ihm nicht. Er streifte einen parkenden Renault und
wurde zur Seite gerissen. Sekundenbruchteile später bohrte sich der
Porsche frontal in eine überlange Mercedes-Limousine hinein.
Rodin riss die Tür auf.
François war bereits bei ihm. Er näherte sich dem Porsche mit
der SIG in beiden Händen.
Ich kam von hinten heran.
Rodin erstarrte. In der Rechten hielt er noch immer seine
Automatik.
»Die Waffe weg, Sie haben keine Chance!«, rief François.
Rodin gehorchte, ließ die Pistole fallen.
Ich hielt ihm den Ausweis unter die Nase. »Marquanteur,
FoPoCri. Sie sind vorläufig festgenommen.«
»He, was habe ich denn getan?«
»Oh, da kommt einiges zusammen … Widerstand gegen die
Staatsgewalt zum Beispiel. Hände auf das Wagendach, Beine
auseinander!«
Er gehorchte. Ich durchsuchte ihn nach Waffen und legte ihm
Handschellen an.
»Was wollen Sie?«, fragte Rodin. »Was habe ich mit der FoPoCri
zu tun? Ich mache meinen Job und zahle Steuern – wie jeder brave
Bürger.«
»Wir fragen uns auch, was Sie mit der FoPoCri zu tun haben,
Monsieur Rodin«, hakte ich nach. »Insbesondere mit dem unserem
Chef, Monsieur Jean-Claude Marteau.«
»Ich kapier überhaupt nichts.«
»Was wollten Sie gestern in einem ganz bestimmten
Apartmenthaus in Marseille-Mitte.«
Er grinste.
»Marseille-Mitte kenne ich nur aus dem Reiseführer!«
»Auf unsern Chef Jean-Claude Marteau wurde ein Attentat
verübt, und jemand hat seine Wohnung verwanzt …«
»Was Sie nicht sagen.«
»… und einen Tag zuvor betritt der Handlanger eines gewissen
Eric Halmarque das Apartmenthaus, in dem Monsieur Marteau wohnt.
Und wie Sie sicher wissen, steht Ihr Boss momentan vor Gericht und
läuft nur auf Kaution frei herum. Heute Morgen sagte Monsieur
Marteau aus, kurz danach geschah das Attentat.«
»He, he, was wollen Sie mir da anhängen?«
»Was wollten Sie gestern bei Monsieur Marteau?«, fragte jetzt
François.
»Mit einer vernünftigen Antwort auf diese Frage wären wir fürs
Erste schon zufrieden.«
»Ich war überhaupt nicht da!«
»Vielleicht haben Sie den Wachmann im Parterre einen falschen
Namen angegeben. Aber Sie waren da. Es gibt eine wunderschöne
Video-Aufnahme von Ihnen.«
»Vielleicht sollte ich jetzt mit meinem Anwalt reden.«
»Vielleicht sagen Sie jetzt einfach, was Sie da
wollten.«
»Ich sage keinen Ton mehr!«
»Sie haben das Recht zu schweigen«, gestand ich ihm zu. Ich
strich seine Haare zurück, um sein Ohr sehen zu können. Für einen
derart großen Mann war es ziemlich klein und zierlich.
François hatte bereits das Handy in der Rechten und
telefonierte mit dem Hauptquartier.
»Die Kollegen kommen gleich, um Monsieur Rodin abzuholen«,
erklärte er dann. Der Ohr-Abdruck würde Klarheit bringen.
9
Nachdem die Kollegen Rodin abgeholt hatten, empfing uns noch
ein ziemlich nervöser Eric Halmarque in seinem Büro.
Er war ein hochgewachsener Mann mit dunklen, leicht gewellten
Haaren. Seine Hände wirkten für einen Mann sehr zart und
feingliedrig. Halmarque hatte uns erwartet.
Ein grimmig dreinblickender Leibwächter und ein Anwalt
bildeten eine Art Begleitschutz für ihn.
»Commissaire Pierre Marquanteur«, stellte ich mich vor. »Dies
ist mein Kollege François Leroc. Wir haben ein paar Fragen an
Sie.«
»In Zusammenhang mit Leonard Rodin?«, fragte Halmarque.
»Ja, deshalb auch.«
»Er ist mein Angestellter, aber das heißt nicht, dass ich
dafür haften muss, wenn er Mist gebaut hat.«
»Sie sind auf Kaution frei, nicht wahr? Das heißt, dass Sie im
Handumdrehen wieder im Gefängnis sitzen, wenn irgendetwas
vorfällt.«
Er grinste mich an.
»Sie wollen mir drohen, Monsieur Marquanteur? Mein Anwalt,
Monsieur Thorfus, ist Zeuge und wird …«
»Regen Sie sich nicht unnötig auf!«, unterbrach ich ihn. »Ich
wollte Sie nur darauf hinweisen, dass es Ihnen übel bekommen wird,
wenn Sie mir irgendwelche Bären aufzubinden versuchen.«
»Sie versuchen meinen Mandanten einzuschüchtern, Monsieur
Marquanteur. Ich muss dagegen protestieren!«, meldete sich Thorfus,
der Anwalt, mit hochrotem Kopf zu Wort.
»Einspruch stattgegeben«, sagte ich. »Aber Sie sind hier nicht
vor Gericht. Noch nicht.«
Halmarque hob die Augenbrauen.
»Was wollen Sie, Monsieur Marquanteur?«
»Haben Sie eine Ahnung, was Rodin gestern bei Jean-Claude
Marteau wollte?«
»Nein, keine Ahnung.« Halmarques Gesicht verdüsterte sich
sichtlich bei der Nennung dieses Namens.
»Wir verdächtigen ihn, in Monsieur Marteaus Privatwohnung
eingedrungen zu sein und dort Wanzen angebracht zu haben.«
»Warum sollte er das tun?«
»Vielleicht hatte er einen Auftrag von Ihnen.«
»Ach!«
»Haben Sie dazu irgendetwas zu sagen?«
»Hören Sie, ich mag Ihren Monsieur Marteau nicht, und Sie sind
mir auch nicht besonders sympathisch, aber um Ihren Vorgesetzten
fertig zu machen, brauche ich eine Kompanie von Anwälten, aber
nicht Männer wie Rodin.«
»Wie weit geht Ihre Abneigung gegen Monsieur Marteau?«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Er brachte Ihren Vater hinter Gitter …«
»… wo er nach kurzer Zeit jämmerlich starb, ich weiß.«
»Kurz nach Monsieur Marteaus Aussage vor Gericht wurde auf ihn
geschossen.«
Halmarque zuckte die Schultern.
»Wenn der Schütze getroffen hätte, würde mir das nicht
leidtun. Aber ich habe nichts damit zu tun.«
»Das hoffe ich, Monsieur Halmarque. Für Sie!«
François legte mir eine Hand auf die Schulter.
»Hier kommen wir nicht weiter, Pierre.«
Ich atmete tief durch. Halmarques selbstzufriedenes Lächeln
reizte mich bis aufs Blut. Ich richtete den Zeigefinger auf
Halmarque.
Mein Blick fiel wieder auf die feingliedrigen, zierlichen
Hände dieses Mannes. Monsieur Marteaus Schilderung von dem Abdruck
auf der Fensterscheibe ging mir nicht aus dem Kopf.
»Wo waren Sie gestern, so zwischen 10.30 und 11.30 Uhr?«
Halmarque verzog das Gesicht.
»Im Gericht! Weil Ihr Bluthunde mir ja unbedingt was anhängen
musstet, statt ehrliche Geschäftsleute ihren Job machen zu
lassen.«
»Irrtum, Monsieur Halmarque! Verkaufen Sie mich nicht für
dumm! Ich habe mich genau informiert. Nach der Vernehmung von
Monsieur Marteau wurde die Sitzung für anderthalb Stunden
unterbrochen.«
»Wahrscheinlich habe ich mich dann mit Monsieur Thorfus,
meinem Anwalt, beraten … Er wird jederzeit bestätigen, dass wir
zusammen waren.«
»Sofern Monsieur Thorfus darauf Wert legt, wegen Meineides
dranzukommen und seine Zulassung als Anwalt zu verlieren, nur zu!«,
ermunterte ich.
»Was soll denn das nun wieder heißen?«
Ich wandte mich an Thorfus.
»Nun, sagen Sie selbst, wo Sie waren!«
»Sie wissen es doch! Bei einer Besprechung zwischen
Staatsanwalt, Richter und Anwalt der Verteidigung …«
»… bei der Monsieur Halmarque nicht dabei war«, vollendete
ich.
Thorfus wandte sich an Halmarque.
»Tut mir leid, Monsieur Halmarque.«
Halmarque lachte schallend. Er erhob sich, ging auf mich zu
und sandte mir einen Blick zu, von dem man glauben konnte, dass er
imstande war zu töten.
»Okay«, sagte er. »Ich war mit meinen Leibwächtern im Bistro
frühstücken. Und wenn‘s sein muss, wird das gesamte Personal des
CÈLESTE Stein und Bein schwören, dabei gewesen zu sein.«
Ich lächelte dünn.
»Beim nächsten Mal sollten Sie sich ein Alibi ausdenken, das
wenigstens den Hauch von Glaubwürdigkeit hat. Sie werden es
brauchen.«
»Es wird kein nächstes Mal geben, Marquanteur!«
»O doch, das wird es«, prophezeite ich ihm.
10
Als wir im Hauptquartier eintrafen und in Monsieur Marteaus
Büro erschienen, hörte sich dieser schweigend unseren Bericht an.
Dann erklärte er: »Von Rodin ist inzwischen ein Ohrabdruck gemacht
worden.«
»Und?«, fragte ich.
»Sein Ohr war es nicht, das an die Tür gedrückt wurde.«
»Das bedeutet nur, dass er nicht gelauscht hat«, meinte
ich.
»Vielleicht hatte er einen Komplizen.«
»Ja, möglich. Monsieur Basile und Monsieur Hebriche nehmen ihn
sich gerade zum Verhör vor. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich
fürchte, nicht allzu viel. Vor dem Haftrichter werden wir ganz alt
aussehen, wenn nicht noch ein Wunder geschieht.«
»Wir müssen die Videobänder noch einmal durchgehen. Vielleicht
gibt es da noch eine Person, die irgendwie in einem Zusammenhang
mit Rodin steht«, meinte François.
»Wir haben sie alle durch den Computer gejagt«, gab Monsieur
Marteau zu bedenken.
»Es kann ja auch jemand sein, dessen Bild noch nicht in
unseren Dateien zu finden ist.«
»Natürlich.«
Eine Pause entstand.
Monsieur Marteau war die Müdigkeit anzusehen. Auch wenn er es
nicht zugegeben hätte, die Sache ging ihm an die Nieren.
»Gibt es schon eine Spur von Loutriche?«, fragte ich.
Unser Chef schüttelte den Kopf. »Nein. Und ich fürchte, der
ist auch zu schlau, um sich so schnell wieder erwischen zu
lassen.«
»Wo werden Sie heute übernachten? In Ihre Wohnung können Sie
nicht, aber wenn Sie wollen, können Sie bei mir unterkommen.«
Monsieur Marteau schüttelte den Kopf.
»Ich will nicht, dass jemand anderes zur Zielscheibe
wird.«
»Ich gehe davon aus, dass wir den Kerl kriegen. Und zwar
bald!«
Monsieur Marteau lächelte dünn.
»Ihr Optimismus in Ehren, Pierre. Aber ich bin mir da nicht so
sicher.«
»Wir haben in Marseille eine Wohnung für solche Zwecke.«
»Okay, dann werden wir Sie dorthin begleiten«, schlug François
vor.
»Eigentlich hat Commissaire Lacroix diese Aufgabe. Aber wenn
Sie nicht im Stehen einschlafen, können Sie gerne mitkommen!«
Wir fuhren mit zwei Wagen. Monsieur Marteau und Fred Lacroix
benutzten einen alten Honda, der ziemlich unscheinbar wirkte.
François und ich nahmen einen Renault aus unserer Fahrbereitschaft.
Der Sportwagen hätte zu viel Aufsehen erregt. Und das Letzte, was
wir wollten, war, eventuelle Verfolger auf uns aufmerksam
machen.
Fred und Monsieur Marteau fuhren voran, während François und
ich darauf achten sollten, dass uns niemand folgte.
Um Verfolger abzuhängen, machten wir ein paar Umwege durch das
nächtliche Marseille in Richtung Marseille-Mitte und dann wieder
stadtauswärts.
Wir befanden uns bereits in Richtung Süden, um dann die Brücke
über die Autobahn zu überqueren. Ein BMW fuhr dicht auf. Er war mir
bereits zuvor aufgefallen. Jetzt war ich mir sicher, dass er uns
verfolgte.
»Kannst du die Nummer erkennen, François?«, fragte ich.
»Ja, einigermaßen.«
»Dann lass die Kollegen sie doch mal durch den Computer
jagen!«
»Okay.«
François gab über Funk die Nummer durch. Das Ergebnis der
Anfrage hatten wir innerhalb weniger Augenblicke. Der Wagen war als
gestohlen gemeldet.
François funkte den vor uns fahrenden Dienst-Honda an.
Monsieur Marteau meldete sich.
»Wir werden von einem gestohlenen Fahrzeug verfolgt, Chef. Ich
schlage vor, nicht auf die Brücke zu fahren, sondern vorher
abzubiegen.«
»Nächste Abzweigung ist die vier!«
»Dann nehmen wir die. Vielleicht können wir dem Verfolger eine
Falle stellen.«
Der Honda nahm die Abfahrt, die in die Landesstraße vier
mündete.
Auf der linken Seite konnte man die Konstruktion der Brücke
aufragen sehen. Wir folgten ihm. Der BMW blieb uns tatsächlich
dicht auf den Fersen.
Bei einem McDonalds bogen wir links ab. Dann kurz danach
wieder rechts. Wir kamen in enge Seitenstraßen, die von hoch
aufragenden Bürohäusern umsäumt wurden. Die Lichter aus tausenden
von Fenstern machte hier die Nacht fast zum Tag.
Unser Kollege Fred Lacroix lenkte den Honda in eine
Einbahnstraße hinein. Wir folgten. Der BMW klebte wie eine Klette
an unserer Stoßstange.
Die Einbahnstraße war sehr eng. Zu beiden Seiten parkten
Fahrzeuge.
François nahm das Funkgerät.
»Monsieur Marteau, wir knöpfen uns den Verfolger jetzt
vor.«
»Okay.«
Ich bremste.
Der BMW-Fahrer ging ebenfalls in die Eisen.
Fred Lacroix trat indessen das Gaspedal des Hondas durch und
brauste davon. Mit quietschenden Reifen bog er um die nächste Ecke.
Wir rissen die Türen des Renaults auf, zogen die SIGs aus den
Gürtelholstern.
Der BMW hatte zwei Insassen, beide nur als schattenhafte
Umrisse erkennbar.
Ein Van kam in diesem Moment aus einer Einfahrt heraus, setzte
sich hinter den BMW und hupte ungeduldig.
Die Fahrertür des BMW sprang auf. Eine vermummte, in
Sturmhaube und Lederjacke gekleidete Gestalt kam hervor, riss eine
zierliche Maschinenpistole vom Typ Uzi empor. Die Waffe knatterte
los. Das Mündungsfeuer blitzte auf, während ein mörderischer
Kugelhagel in unsere Richtung gestreut wurde.
Wir duckten uns blitzschnell. Die Projektile stanzten Löcher
in den Kofferraum des Renaults. Die Heckscheibe
zersplitterte.
Sobald der Geschosshagel verebbte, tauchte ich aus der Deckung
empor.
Der Vermummte rannte davon. Er feuerte ziemlich ungezielt in
unsere Richtung.
Der Van bekam auch etwas ab. Die Seitenscheibe zersprang, der
Fahrer duckte sich.
Der Vermummte verschwand.
Ich näherte mich dem BMW, hielt die SIG mit beiden
Händen.
Der zweite Mann im Wagen rührte sich nicht, saß einfach nur
starr da.
François näherte sich von der anderen Seite.
»FoPoCri! Die Hände hoch!«, rief er.
Keine Antwort.
François riss die Beifahrertür auf, richtete die SIG auf den
Kerl, packte ihn an der Schulter. Dann zog er ihm die Sturmhaube
vom Kopf.
»Eine Schaufensterpuppe«, stellte François fest.
In dieser Sekunde ging mir einiges durch den Kopf. Ich dachte
daran, hinter dem Flüchtenden her zu hetzen, ich fragte mich, was
die Puppe im BMW sollte und …
… hörte ein Ticken!
»François! Spring weg!«, schrie ich aus Leibeskräften.
Im nächsten Moment gab es ein ohrenbetäubendes
Explosionsgeräusch und ein rotgelber Flammenpilz schoss
empor.
Mörderische Hitze umgab mich. Die Druckwelle der Explosion war
enorm. In der Umgebung zersprangen Scheiben. Mit einem Hechtsprung
rettete ich mich in letzter Sekunde, kam auf den Boden und rollte
mich ab. Ich begrub das Gesicht unter den Händen, um mich
notdürftig zu schützen, während Metallteile durch die Luft flogen.
Der Flammenpilz züngelte empor. Dunkler Rauch stieg auf. Der Mann
aus dem Van stürzte heraus und rannte davon.
Von François konnte ich nichts sehen.
Ich hoffte nur, dass die Flammen ihn nicht verschlungen
hatten.
Der Flammenpilz fiel in sich zusammen, aber nur, um sich
anschließend erneut aufzublähen. Ein dumpfes Geräusch ertönte. Die
mörderische Hitze versengte mich. In meinem Hals kratzte es. Ich
bekam kaum noch Luft.
Mir war klar, dass ich schleunigst hier weg musste.
Ich rappelte mich auf, taumelte in Richtung Straßenrand. Dann
stellte ich mich in eine Türnische, die notdürftigen Schutz bot.
Eine weitere Detonation erfolgte. Die Flammen griffen auf den Van
und auf unseren Renault über. Auch der Van explodierte. Seine
Vorderfront flog buchstäblich auseinander. Metallteile flogen wie
Geschosse durch die Luft.
Ich griff zum Handy, rief das Hauptquartier an. Gleichzeitig
suchte ich mit den Augen nach François. Aber in den dicken,
beißenden Rauchschwaden konnte ich nichts erkennen.
»François!«, schrie ich.
Keine Antwort.
11
Das LE PARADIS war einer der nobelsten Nachtclubs in
Marseille. Ein Laden, in dem Smoking-Zwang herrschte und der Abend
schnell tausend Euro kosten konnte.
Als Raphael Toville zusammen mit zwei Bodyguards eintraf, gab
er einem der Kellner seine Karte. Auf der Showbühne tanzte derweil
eine Gruppe bildschöner Girls, die völlig synchron nach und nach
den Rest ihrer ohnehin sehr spärlichen Kleidung ablegten.
Raphael Toville verzog gelangweilt den Mund.
»Eure Mitternachtsshow ist aber auch nicht das, was sie mal
war«, meinte er abfällig.
»Die Avenue des Dames ist nicht das Moulin Rouge«, erwiderte
der Kellner.
Toville lachte dröhnend. Einige der Gäste drehten sich
um.
»Wenn euer Boss Mumm in den Knochen hätte, würde er aus so
einem Laden etwas machen! Etwas, das das Moulin Rouge vergessen
lässt!«
Der Kellner war zu höflich, um etwas zu erwidern.
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Monsieur Parese erwartet
Sie im Separee.«
»Oh, dann muss es ja wichtig sein.« Toville stieß einem seiner
Männer den Ellbogen in die Rippen. »Glotz nicht so, Bilal! Eine so
miese Show ist es nicht wert, dass du dir dafür die Augäpfel
verrenkst.«
Sie folgten dem Kellner durch eine Nebentür. Sie gingen den
Flur entlang. Vor einer zweiflügligen Ebenholztür standen zwei
martialisch aussehende Wächter. Einer von ihnen hatte eine Uzi über
der Schulter. Bei dem anderen ragte der Griff eines Revolvers
zwischen den Knöpfen seines Jacketts hindurch.
»Waffenkontrolle«, grunzte einer der beiden.
»Wer sagt das?«, rief Toville aufgebracht. »Das kommt nicht
infrage!«
»Monsieur Parese sagt das.«
»Dann gehen wir gleich wieder. Und du kannst deinem Boss
sagen, dass er mich bitte nie wieder wegen einer angeblich
wichtigen Sache aus dem Bett klingeln soll! Kapiert?«
Die beiden Gorillas sahen sich ratlos an.
»Einen Moment«, meinte dann der mit dem Revolver. Er öffnete
die Tür, verschwand für ein paar Augenblicke und kehrte dann mit
hochrotem Kopf zurück. »Kommen Sie rein!«, forderte er.
Toville grinste abschätzig.
»Früher hätte Big Andy Parese sich nicht von solchen
Volltrotteln bewachen lassen«, versetzte er, während er an den
beiden Gorillas vorbeiging.
Zusammen mit seinen Bodyguards betrat er einen Raum, in dessen
Mitte sich eine lange Tafel befand. Ungefähr ein Dutzend Personen
hatten bereits daran Platz genommen, aber mehr als die Hälfte davon
waren Leibwächter und anderes Begleitpersonal.
Der weißhaarige Andy – eigentlich Andre – Parese saß am Ende
der Tafel.
Toville sah sich um. Parese war nicht die einzige bedeutsame
Persönlichkeit im Raum.
Da war zum Beispiel noch Big Pascha Mustafi. Er führte ein
Glücksspiel-Syndikat. Links von ihm hatte ein massiger,
kahlköpfiger Mann Platz genommen. Er hieß Ivica Jordanovic, hatte
lange Zeit ein Drogenkartell angeführt, war Anfang der Achtziger
auf illegale Müllentsorgung umgestiegen und hatte sich inzwischen
mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt. Zumindest, was den kriminellen
Teil seiner Geschäfte anging.
»Sie sind der Letzte, Toville«, sagte Parese mit leichtem
Tadel in der Stimme.
»Ja, und ich wäre fast wieder gegangen. Nächstes Mal tue ich
das auch, wenn Sie Ihren Wach-Idioten nicht beibringen können, mich
mit Respekt zu behandeln!«
Parese lächelte matt.
»Sie sind jung, Monsieur Toville. Aber wenn Sie ein ganz
Großer werden wollen, müssen Sie lernen, Ihre Gefühle zu
kontrollieren.«
Toville verzog verächtlich das Gesicht. Er setzte sich. Seine
Männer nahmen neben ihm Platz.
»Fangen Sie an, Monsieur Parese! Was ist so wichtig, dass Sie
eine große Versammlung einberufen müssen … Mitten in der Nacht!«
Toville lachte heiser. »Oder geht Ihr Nachtclub inzwischen so
schlecht, dass Sie auf diese Weise Kunden zu Ihrer müden Strip-Show
herbeilotsen müssen!«
Pareses Gesicht erstarrte. Der Blick, den er Toville nun
zuwandte, war eisig. Er schien es als unter seiner Würde zu
empfinden, darauf zu antworten.
Stattdessen meldete sich Big Pascha Mustafi zu Wort.