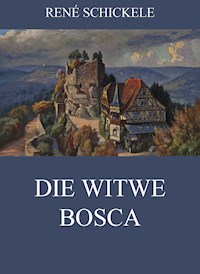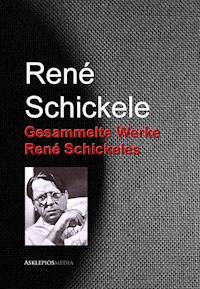Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
René Schickeles 'Symphonie für Jazz' ist ein bemerkenswertes Werk, das sich auf innovative Weise mit dem Einfluss des Jazz auf die zeitgenössische Musik auseinandersetzt. In einer Mischung aus lyrischer Prosa und musikalischer Erzählung entführt der Autor die Leser in eine Welt voller Rhythmus und Melodie. Schickele verwebt geschickt Elemente des Jazz mit traditioneller Musik, um eine faszinierende Synthese zu schaffen, die sowohl Denkanstöße als auch ästhetisches Vergnügen bietet. Diese einzigartige Komposition zeigt Schickeles künstlerische Sensibilität und sein Verständnis für die Verbindung zwischen verschiedenen Musikstilen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Symphonie für Jazz
INHALTSVERZEICHNIS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
KAPITEL 1
Inhaltsverzeichnis
Bäbä, tu. Bäbä, tut. Tut! bäbä.
Ein Hurra – Bäbätu.
Auf das Känguruh!
Miau.
Die ganze Nacht hat es geregnet. Wie eine Mühle ging der Regen in der Finsternis, die Traufe machte dazu den rauhen, kurzpulsigen Lärm eines Motors: raduwalu, raduwalu.
Manchmal schwoll das Rauschen des Regens an, dann vernahm man das hellere Rascheln von Laub, ja sogar den Flug der Wassertropfen von Bäumen unterschied man. Einen Augenblick lag die Regennacht in einer andern Tonart.
Nur die Traufe arbeitete unverändert weiter. Raduwalu, raduwalu.
Brrrr – um! plotzt die Brandung. Brum! Krach der Kräche. Donnernder Applaus. Ein Zischen, Sausen:
Brr – rr – rr – rum!
Tagsommer.
Nachtsommer.
Wüste Zeit.
Fliegender Holländer auf einem Alkoholschiff.
Der geschminkte Mann im Pyjama am Flügel spielt Bach.
Vor ihm das Mädchen tanzt den Kreuzestod.
Kasse! Kasse! Schwarze Kasse!
Mi! au.
Bis aus dem Topasrauche deiner Augen
Auf einmal blaues Feuer schlug –
Die Motorräder belfern. Gestank von Asphalt und Benzin. Die Elektrische krächzt mit einer Kehlkopfstimme in der Kurve, ihre gesprungene Glocke schimpft die Straße zusammen. Aber den neuen Limousinen weht ein Rauschen von Wohlhabenheit voran! Um sie herum knurren und spucken die Autos, die geschäftlichen Zwecken dienen. Schreie im Gewühl, metallene Schreie, Schreie, als kämpften Maschinen ums Leben.
In einer Pause, vom blauen Himmel gefallen, hört man eine Mönchsgrasmücke. Taktaktaktak-fiieh-je! lockt das Tierchen, bevor es singt.
Der Asver – wenn er je so weit käme – würde seine eigene Regierung stürzen. In ihm haben wir das letzte Exemplar des romantischen Revolutionärs. Niemand fürchtet ihn mehr, nicht einmal der demokratische Reichstagsabgeordnete Kommer. Kurt Kommer nennt Asver den indanthrenroten Stänkerer.
Und dennoch ist ein Kalikönig unglücklich. Man denke!
Wer hat es denn heute noch gut?
Ei, der Josephus Samtaug, der nur ›piepsi, piepsi‹ zu lächeln, braucht, damit die goldbraun gebrutzelten Tauben ihm in den Mund fliegen.
Sonst niemand?
Doch. Vielleicht. Der Musikant.
O schöne Fahrt, so leicht der Wind,
Vor dem Fernen sich entfalten –
Hip-hip-hurra! für John van Maray und seine Frau Johanna.
Bäbä, tu. Bäbä, tut! Mi! au.
Zuerst die Vorgeschichte.
Ein Maray kam gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts (vermutlich aus Ungarn) in die Schweiz und heiratete die Tochter eines Züricher Handwerkers. Sie bekamen viele Kinder. Von deren Schicksal kennt man nur das Glück des ältesten Sohnes. (Wahrscheinlich hat es daran bei den andern gefehlt.) Der Bursche trat, gemeinsam mit seinem Freund, einem nichtsnutzigen Patriziersproß, in holländische Dienste. Er begann als Gemeiner, gleich als Offizier der Freund. Beide gewannen das Spiel, der Gemeine gleichzeitig mit dem Offizier, sie kehrten nicht in die Schweiz zurück, sondern heirateten Holländerinnen und starben als goldbetreßte Obersten im Land ihres Glücks und ihrer Frauen.
Augen, Mund, Hände, Glück und Leid, Trotz, Zorn, Liebe, Erbarmen, Röte und Blässe – es sind dieselben wenigen Wörter, die immer wiederkehren, und die Musik davon ist so tief!
›Spinnweb, Spinnweb an der Wand –‹
Ein Sohn des einen Obersten ehelichte die Tochter des andern, und der ehemalige Schreinergeselle und Gemeine im holländischen Kolonialdienst Maray sah und genoß es einen endlos verzauberten Lebensabend lang, wie ein Amsterdamer Geschlecht unter seinem Namen wie einem halbbarbarischen Feldzeichen die Stufen des Reichtums und der öffentlichen Würden emporstieg. Von dieser Zeit an hieß die Familie: van Maray.
Das Geld saß locker bei dem Geschlecht, und zwar merkwürdigerweise gerade bei solchen, die den Namen van Maray führten. Die Töchter entschlüpften in standhafte Familien und kamen oft genug in die Lage, Bruder und Bruderskinder verleugnen zu müssen. Nur eines blieb der Sippe durch die Zeiten als Privileg erhalten: der höhere Kolonialdienst. Von Geschlecht zu Geschlecht floh immer wieder einer in das rettende Eden von Sumatra, Borneo, Java. Sie kamen in ziemlich unordentlichem Zustande an, staffierten sich aber bald heraus. Hätte Holland keine Kolonien gehabt, so wäre das Geschlecht der Maray längst von der Oberfläche der Gesellschaft verschwunden.
Auch der Vater John van Marays diente seine Zeit in Holländisch-Indien. Er kam in späteren Jahren hin als die andern, denn er war etwas weniger leichtsinnig. Dafür ging er auch früher wieder fort und kaufte sich ein Haus in Zabern, Europa, Deutschland, Bezirk Unterelsaß.
Die Wahl des Vogesenstädtchens an der Grenze Lothringens bedeutete einen Ausgleich zwischen den Wünschen der Frau, einer französischen Lothringerin, die das Heimweh plagte, und dem Abscheu des Mannes vor dem Königreich der Frösche jenseits der Zaberner Steige.
John van Maray wuchs in Zabern auf, und da er Holländer war, fühlte er sich als Elsässer. Bald nach Kriegsausbruch erkrankte die Mutter. Um sie zu zerstreuen, wollte ihr John vorlesen. Er wählte, was er über alles liebte, das Hohe Lied. (Ein überheller Tag, in dem es nächtig rauscht.) Sie unterbrach ihn:
»Mein armer Junge, du hast den holländischen Knödel im Hals. Spiele lieber Klavier, da hört man es weniger.«
Auch als John am Klavier saß, verließ ihn nicht der forschende Blick der Mutter, er demütigte ihn, weil daraus soviel Überlegenheit nach ihm stach, außerdem gab dieser Blick ihm ein unlösbares Rätsel auf. Musterte sie ihn nicht, als ob er gleich in irgendeinem Wettkampf auftreten sollte und sie von ihrem Bett seine Aussichten abschätzte? Soviel schien ihm gewiß. Was er aber nicht begriff, das war der Zweifel an seiner Kraft und Geschicklichkeit.
Er war ein schlechter Schüler, doch der Anführer der Klasse. Er konnte Klavier klimpern, kaum daß er es noch recht gelernt hatte, und vor den Stunden drückte er sich nur, weil der Lehrer verschämterweise taub war und keinen Ton unterscheiden konnte, wenn er nicht auf die Tasten sah.
In dieser Zeit trug John sich mit dem Plan, ein Epos zur Verherrlichung eines aussterbenden Volkes, der Siouxindianer, zu dichten: Das Schwanenlied des roten Mannes. Der Titel stand fest.
Da er katholisch war, wie seine Mutter, trat er gleichzeitig als Meßdiener in der Pfarrkirche auf, und alle Welt, sogar der protestantische Vater, erklärte ihn für den glänzendsten unter den ›Pagen des lieben Gottes‹ (eine Lieblingswendung der Mutter, die freilich die überragende Stellung des Sohnes im Pagenkorps verkannte). Er schwenkte das Weihrauchfaß wie keiner, und wenn er das große Meßbuch von der Evangelien- zur andern Seite des Altars hinübertrug, so – nun so geschah etwas. Die Mädchen horchten auf, wenn er die Klingel rührte. Sie spürten seine Hand.
Er besaß auch eine Geliebte. Zwar hatte er noch kein Wort mit ihr gesprochen, aber er tauschte Briefe mit ihr. Der Briefkasten war ein dicker Stein unter einem Holunderbaum.
Allen diesen Zeichen des Genies verschloß sich die Mutter. Deshalb glaubte John, der weiche und gewalttätige Vater liebe ihn, mache ihn kühn für das Leben, die Mutter dagegen verdächtige und kränke ihn bewußt auf den Tod. Dabei war gerade die Mutter die leidenschaftliche Natur, die nur nicht wollte, daß er es sich allzu leicht mache. Während der Vater, wenn ihn niemand sah, als ein versonnener Enterich stundenlang in einer Ecke die Wundereier seines Ehrgeizes ausbrütete. Sein Ehrgeiz bezog sich ausschließlich auf den Sohn. Was wünschte er ihm? Seine eigene falsche Würde, maßlos erhöht.
Der Alte lebte in Wirklichkeit nur noch von seiner Pension. Er ging aber herum und ließ sich anstaunen, weil er, der die Welt gesehn hatte und reich schien, sich freundlich mit der Niedrigkeit seiner Umgebung begnügte. Blond und breit, wie er daherkam, teilte er schwungvolle Grüße aus, erwiderte welche, so höflich und herablassend wie möglich, etwas ironisch und dennoch überzeugt, alle Huldigungen zu verdienen, da er in seinem Sohn einen Schatz besaß, der jedes in Zabern sichtbare und unsichtbare Vermögen übertraf. Dieses Ansehn also wünschte er dem Sohn, in einem Zabern, das sich über die Erdteile erstreckte. Mitten in der heroischen Landschaft stand dann ein Klavier, in das, statt der vermufften Zaberner Luft, aus grüßenden Hüten ein Goldregen strömte.
John hatte die Mutter niemals klagen, niemals weinen gesehn. Wenn der Vater tobte, hob sie das Gesicht und schaute reglos in das Unwetter, so, als ob der Aufruhr nicht im Zimmer herrschte, sondern draußen, hinter dem Vater, jenseits des Fensters. Sie war groß, schwarz und hager, mit einer breiten Stirn und kurzen, starken Klavierhänden. In ihren Augen war ein Durcheinander von trocken leuchtenden Dunkelheiten. Sie spielte Klavier wie ein Mann, dabei war ihr tönendes Sinnen, ihr Lächeln das eines Mädchens – eines verlassenen Mädchens, wie ihre Schwester einmal sagte, als sie auf Besuch nach Zabern gekommen war. Diese Schwester wollte einige Wochen bleiben, John gefiel sie gut, sie war in Paris verheiratet und lernte ihn gleich als Kavalier an.
Nach vier Tagen warf der Vater sie hinaus. Er behauptete, sie sei nur gekommen, um seine Frau zu verderben.
Dies nun war einer der seltenen Fälle, wo John es mit der Mutter hielt. Lange Zeit beobachtete er dem Vater gegenüber eine Zurückhaltung, die einer Verurteilung gleichkam. Der Vater litt sichtlich darunter. Indes wurde die Mutter immer schwächer.
»Wenn Deutschland siegt, werdet ihr Augen machen, was dann kommt«, sagte sie eines Tages. »Die Holländer zu allererst.«
Johns Vater, der Deutschland alles Gute wünschte (nur nicht gerade die holländischen Kolonien), drehte seine großen, gläsernen Augen nach ihr, erkannte, was aus ihren Worten sprach: Schadenfreude, Hilflosigkeit, drohende Rache, und nickte. Er hätte gerade so genickt, wenn sie auf den Gedanken verfallen wäre zu sagen: »Hättest du Vernunft gehabt und uns in Lothringen angekauft, es wäre kein Krieg gekommen.« Alles nahm er von ihr hin. Der bevorstehende Verlust seiner Frau, somit seines lebenswichtigsten Widerstandes, erschreckte ihn furchtbar, gewissermaßen fühlte er sich kopfüber ins Leere stürzen, wo es keinen Halt mehr gab.
Die Mutter starb. Der alte Maray zog fluchtartig über den Rhein und erwarb ein Haus am größten süddeutschen See.
Seit dem Tode der Frau blieben seine Augen, die vorher hartblau gewesen waren, stumpf und verschwommen, mit gelblichen Klecksen in den Winkeln. Er schrie nicht mehr, er schlug nicht mehr das tropische Rad, der Jähzorn, der seine ganze Kraft gewesen, blieb mit der Frau in der Erde versunken.
John wurde auf das Konservatorium in Stuttgart geschickt, wo er fleißig arbeitete und sein erstes sinnliches Abenteuer bestand, freilich gedieh es nicht über zwei, drei etwas hastige Umarmungen hinaus, denn die Dame befand sich gerade im Umzug nach Berlin, und auch das erste geistige Abenteuer begegnete ihm hier in der Gestalt des Staatsanwaltssohnes Asver.
Die Revolution brach aus, da warf sich sein Freund Asver für vier Tage zum Diktator Württembergs auf. Wenn sich in Johns Bewunderung für den Mann einige Zweifel mischten, so lag dies an Asver, der ihm einmal erzählt hatte, als Junge sei er darauf aus gewesen, Katzen in den heißen Backofen zu sperren, ›um zu sehn, was die gequälte Kreatur alles aushalte und anstelle‹. In dieser ›intellektuellen Neugier‹ wollte Asver den frühen Beweis für sein revolutionäres Temperament erkannt haben. John sagte nicht nein, aber er zitterte, als Asver wirklich ein Maschinengewehr in die Hand bekam. Die Schwaben sind ruhige Leute, das Maschinengewehr kam nicht zum Schuß, und Asver übersiedelte nach Berlin.
Inzwischen guckte der alte Maray nicht über den Zaun seines Gartens, nur noch auf den See und das ferne Gebirge. Er beantwortete keinen Brief. Jedoch wenn John seine baldige Ankunft meldete, dann riet er ihm in ein paar herzlichen Zeilen, gescheit zu sein und seine Ferien anderswo zu verbringen: »Außerdem bin ich ein altes Weib geworden und kann keinen Mann mehr um mich vertragen. Es grüßt und küßt Dich Dein liebender Vater.«
Bei seinem Tod hinterließ er John nichts als das Haus am See und die Musikbibliothek aus mütterlichem Besitz.
John ließ die Bibliothek in Holland versteigern und trat eine Reise an. Er war ein ausgewachsener Junge, dunkel, mittelgroß, breitschultrig, starkknochig, und schaute, aus einem noch zu schmalen, zu blassen Gesicht, gleichsam mit einem holländischen Knödel im Blick, gierig in die Welt.
KAPITEL 2
Inhaltsverzeichnis
Wer kurz nach dem Krieg ausländischen Boden betrat, traf hinter der Grenze auf ein Fest, dessen er sich bis an sein Lebensende erinnern wird.
Die ›herrliche Welt‹, daheim bis auf den Grund zerstört, hier stand sie noch und war nur hold durcheinandergeraten. Die Menschen bewegten sich mit gelösten Gliedern, körperlich geadelt, freiere, stolzere Wesen als früher. Ein Segen von Verschwendung hing vom Himmel. Durch den Tag wogte das Nachtfest weiter, von einem paradiesischen Dammbruch in Sonne getaucht. Es schien keine alten Frauen und keine Knaben mehr zu geben, geflügelt durchschritten die Geschlechter die Lebensalter. Ein endloser Tanz um den Freiheitsbaum, der ein Phallus war.
Nebenan ging der Reigen derer, die des andern Geschlechts nicht bedurften zur Liebe, und manche tanzten auf beiden Böden, hier im Freien und in der Laube dort. Die gleiche Musik galt für den ganzen Tanzboden, selbst für die aufgeriebene Garde der Tugend.
Wie überall war in Deutschland die erotische Kameradschaft zwischen den Geschlechtern, schon vor dem Kriege im Anstieg, während des vieljährigen Glücksspiels um Börse und Leben mächtig ins Kraut geschossen. Aber draußen zeigte die Entsündigung der Lust ihre große, fleischfarbene Blüte im Festlicht, und der Tanz galt dem Anbruch der versprochenen goldenen Zeit, der Gewißheit eines Sieges, wie ihn größer keine Menschheit je erringen könnte: das von der Angst entgiftete Leben frohlockte. Und noch eins. Neuen Reichtum gab es auch in Deutschland genug, doch wagte er sich noch nicht so offen hervor, weil inzwischen das alte Bürgertum vor aller Augen verarmte. Der Goldhelm der neuen Herren wartete im Schrank.
John van Maray hatte noch kein Volksfest gesehn. Er kannte nur Menschenmengen, die sich schier auffraßen vor hungriger Begeisterung oder denen, wenn sie sich als die schwächeren fühlten, drohende Muskelschauer über den Leib liefen wie einem wilden Tier.
Zwei Schritte hinter der Grenze geriet er in die unwahrscheinlichste Fülle, in etwas, wovon er in der Kindheit viel gehört hatte, ohne es sich recht vorstellen zu können: in die sagenhafte holländische Kirmes. Holland strotzte von frisch erworbenem Gut, und es gab kein altes Vermögen, das nicht der Krieg der andern gemehrt hätte. John wurde von Verwandten aufgenommen wie der verlorene Sohn. Er hatte sie bisher nicht gekannt. Nun aber gab er sich liebenswürdig, gleich einem Engel in Gottes Gunst, er leuchtete, ohne es zu wissen, er war ein Spiegel, der jedes Lächeln mit verzehnfachtem Strahlen zurückgibt, und da er Musiker war, dankte er, flehend um immer mehr, stürmte, klagte, erobernd, und siegte er in seiner Musik.
Gut spielte er, gut, wie ein glückliches Kind gut ist.
Er spielte in den Häusern, wo er eingeladen war, und nachher in den Hallen des Hotels und in Cafés und wo er sonst mit seinem Anhang herumzog. Und wenn er müde wurde, trank er. Er trank weiter, wenn er nicht mehr spielte. Dann kam die Jazzband.
Jede Nacht konnte man an diesem oder jenem öffentlichen Ort John van Maray sich unter die Mitglieder einer Jazzband niederlassen und die zwei, drei letzten Stücke unter einem Hagel von Einfällen dirigieren sehn. Scharen von Nachtbummlern fuhren durch die Stadt, bis sie den ›verrückten Maray‹ bei seinem privaten Schlußkonzert ausfindig gemacht hatten. Erst trieb er nur Spaß mit der Jazzmusik, behandelte sie als Gegenstand seines musikalischen Ingrimms, wobei er sich mühte, die Niggerei ins Maßlose zu übertreiben. Er hoffte, schließlich werde dem Publikum der Skandal klar werden, den er meinte. Das Publikum merkte nichts dergleichen, und John begann sich mit dem tönenden Unsinn aus Radau und Singsang zu befreunden. Denn der Jazz ist so verwandt mit dem Alkohol, daß er ihn fast ersetzen kann.
In England, wo er so weiterjuckte, kam er darauf, den Negerstimmen einen eigenen, ernsthaften Text unterzulegen. Es gelang. Tut! bäbä. Als sein Erfolg wuchs und er im frisch lackierten London des Nachkriegs zu seinem Erstaunen auf gebildete, feinfühlige Menschen traf, beschwor er aus dem pöbelhaften Taumel der Instrumente eine Strophe von Baudelaire oder Swinburne wie eine Erscheinung. Es gelang. Ein Hurra für John! Wieder wanderte er von Haus zu Haus und landete in den Sälen der Hotels, wo er Auszeichnungen erfuhr, wie sie in jenen Jahren sonst nur den berühmtesten Kriegsfliegern zuteil wurden.
Da kam ein Mann zu John und fragte, was er koste.
John sah gleich, daß er nicht spaßte.
Nach einer kurzen Unterredung wurde beschlossen, John solle eine Jazzband zusammenstellen und mit ihr durch Skandinavien reisen. Das Honorar betrug mehr, als John je besessen hatte. »Auf die Weise kommt Ordnung in Ihre Reise – und vielleicht auch in Ihr Leben«, sagte der Manager. Und: »Hier ist die Route mit den genauen Abfahrtszeiten«, sagte er. »Ich reise immer voraus und besorge alles. Verstehn Sie? Und hier ist ein Scheck.«
Darauf schüttelte der Mann ihm kräftig die Hand, und John sah ihn erst in Kopenhagen wieder, von wo der Manager mit den andern Musikern gesättigt nach England zurückreiste.
Für John ging die Tournee weiter. Er wanderte musizierend durch Belgien, Italien, Frankreich, bis nach Spanien hinein, manchmal allein, manchmal in Begleitung einer Frau. Manchmal mußte er ein Retourbillett für sie lösen, manchmal verschwand sie ohne Benachrichtigung. So ging es drei Jahre.
Ein viertes Jahr verbrachte er als Kapellmeister an einer Berliner Oper. Es war das anstrengendste von allen. Er rettete sich an das Stadttheater in Zürich. Hier erwartete ihn eine hochdramatische Sängerin, die in seinen Armen schwor, einen großen Mann aus ihm zu machen.
Zu spät. Mi-auh ...
John erkrankte.
Als er schließlich ohne allen Grund seinen Direktor ohrfeigte, empfahl ihm dieser brüllend das Sanatorium eines Schweizer Arztes. So nahmen vier wüste Jahre ein Ende.
Aus jener Zeit muß noch ein scheinbar geringfügiges Ereignis erwähnt werden, nämlich ein Trink- und Lügengelage zu Beginn der skandinavischen Tournee. Die Vorgeschichte, bei der wir stehn, wird jetzt etwas unordentlich. Dafür hat sie einen moralischen Schluß.
Auf seiner skandinavischen Tournee lernte John in Göteborg einen Arzt kennen, einen Menschen, der mit den pfiffigsten Augen der Welt nur für eines Sinn und Blick hatte: die Dämmerzustände der menschlichen Seele.
Von seinem Frohsinn bunt gescheckt und gewappnet, unter einem Helmbusch, dessen Farben im senkrechten Strahl einer höheren Erleuchtung flatterten, ein fahrender Ritter der Unterwelt, so tummelte sich der Schwede an den dunkeln, den gefährlichen Wassern, die unsre verschwiegensten Regungen und Gebärden widerspiegeln und die für ihn nicht die geringste Gefahr darstellten – nicht die geringste. Bäbä, tu. Bäbä, tut.
Er rieb sich listig die Hände und kugelte sich vor Vergnügen, als John ihm am Morgen nach einem Zechgelage im Hotel einen Traum erzählte. John erinnerte sich später nicht mehr, was das für ein Traum war. Er wußte nur, daß sie viel getrunken hatten und der Arzt ihm an Hand des Traumes die urhafte Grausamkeit seines Wesens klarmachte, so daß er sich eine Weile als ein Borgia vorkam. Es schmeichelte ihm nicht wenig. In solcher Stimmung ließ er sich überreden, statt, wie die andern Musikanten, mit der Bahn, auf dem Götakanal nach Stockholm zu fahren, gewissermaßen quer durch Schweden, von einem Meer zum andern.
Tut! bäbä, eine unbeschreibliche Fahrt! Mit Ausnahme der Trollhättafälle, die sie auf einer Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden bequem hätten besichtigen können, war zwei Tage lang nichts zu sehn als flaches, waldumsäumtes Land, worin alle paar Stunden ein buntes Fachwerkhaus auftauchte. Nachts rasselten die Ketten in den Schleusen. Solcher mit einem infernalischen Weckwerk versehenen Krücken benötigt der Götakanal nicht weniger als achtundfünfzig, um endlich in den Mälarsee und nach Stockholm zu gelangen.
Natürlich schliefen sie nur bei Tag, obwohl sie kräftig tranken. Aber auch tags rasselten die Wecker der Schleusen, kaum daß sie eingeduselt waren. Einfach auf Deck nebeneinander zu sitzen und in sich hineinzutrinken, wie ein Trupp von Amerikanern es ihnen vormachte, erschien ihnen menschenunwürdig. Um ihrer Scham willen unterhielten sie sich. Sie taten, als ob sie nicht söffen, sondern austrocknende Gespräche führten. Und da der schwedische Doktor auf nichts so versessen war wie auf Träume, so erzählte John ihm Träume.
Serienweise lieferte er sie, im Dutzend und im Schock.
Während er sprach, erfand er sie, er brauchte sich nicht anzustrengen, die Begeisterung des Doktors und der eisgekühlte Rheinwein berauschten ihn in gleichem Maße.
Die meisten Träume spielten in seiner Kindheit. Denn wir finden es immer merkwürdig, wenn schon ein Kind von Empfindungen angewandelt wird, die das Vorrecht der Erwachsenen bilden sollten. John erzählte allerhand von junger Liebe. Dann schlug die Liebe in Haß um. Er bekam es mit einem Mitschüler zu tun, einem käsebleichen Gesellen, der ihn einmal schrecklich blamiert hatte und der, nach langem Verschollensein, plötzlich wieder in seiner Erinnerung auftauchte. Er führte geradezu Krieg gegen ihn, obwohl der Kerl ihn bei nüchternem Verstand nichts anging.
Sobald John mit einem Traum zu Ende war, begann der Schwede: »Also, hören Sie zu!« – es klang wie ein Manöversignal, und alsbald stieg er in John hinunter, jetzt war er dran, und er tat sich um. Was John da über sich zu hören bekam, war atemberaubend. Er konnte sich nicht satt hören an all den Gewalttaten und verzwickten Abenteuern, die in den Abgründen seiner Seele geschahen. Manchmal fragte er sich, wer von ihnen beiden als der phantasievollere Märchenerzähler zu gelten habe, der Schwede oder er. Es war eine Art Sängerkrieg auf dem Götakanal, quer durch Schweden, von einem Meer zum andern.
Er träumte auf dem Platz, mit offenen Augen. Nicht anders hielt es der schwedische Doktor. Die Farbe der Träume wechselte mit der Tageszeit, und gegen Abend, zur Stunde, da bei den Kranken das Fieber steigt, gerieten sie in Ekstase. Immer wieder schloß der Schwede John in die Arme und schwor ihm ›die weißglühende Freundschaft der Weisen‹. Material für Jahre wissenschaftlicher Arbeit habe er ihm geliefert, sagte er, Material ... für Jah-re ... John rief, daß er ihm ewige Dankbarkeit schulde – endlich habe er sich kennengelernt! Tränen standen ihnen in den Augen. Geistig und körperlich gebrochen, sanken sie auf das Sofa der Kabine, wo ihre Betten zurechtgemacht waren, und verbrachten eine spukhafte Nacht. Am Morgen schöpften sie neue Kräfte aus der getürmten Fülle von Broten, Fischen und Schnäpsen, ›die ein schwedisches Büfett‹ heißt.
Beim Abschied in Stockholm legte John dem kränklichen Lüstling und Arzt ein Geständnis ab. Alles sei gelogen, rief er, alles – bis auf den Traum im Göteborger Hotel, und den habe der Teufel ihm eingegeben. Der sei schuld an den folgenden Ausgeburten trunkener Langeweile quer durch Schweden, von einem Meer zum andern, schuld an allem. Man solle nie einen Traum erzählen!
John fand keinen Glauben. Der Schwede lachte, daß die Leute sich nach ihm umdrehten, wieherte ein vom Leuchten seiner Goldplomben entzündetes Lachen in den blauen Tag zwischen Himmel und See, umarmte John, schüttelte ihm kräftig die Schultern: »Erfunden haben Sie die ganze Menagerie, erfunden? Das erzählen Sie einem andern!« und stieß ihn aus dem Wagen, der sie vom Landungsplatz vor das Hotel geführt hatte. Lachend fuhr er weiter in seine Wohnung.
Als John van Maray nun das empfohlene Schweizer Sanatorium aufsuchte und es sich zeigte, daß dessen Leiter mit der psychoanalytischen Methode allerhand anzufangen wußte, hätte er sich gern analysieren lassen. Er sagte sich nämlich, dies sei das einzige, wozu er unter Umständen noch tauge. Jedoch der vorsichtige Schweizer Arzt, Dr. L., verschob es von Woche zu Woche, und schließlich sprach er überhaupt nicht mehr davon. Freilich waren Johns Erzählungen von den Traumorgien auf dem Götakanal nicht danach angetan, sein Vertrauen zu gewinnen.
Man hatte ihn eben kennengelernt!
Mit seinem seelischen Gleichgewicht stand es nicht zum besten, deshalb war er ja auch in einem Sanatorium, und da, auf der hohen See seines Spleens, lauerte er auf die Analyse wie ein Freibeuter auf das Postschiff. Enterhaken und Leitern lagen bereit, er trug ein Messer zwischen den Zähnen und Pistolen in jeder Hand.
Einem Querulanten weicht man am besten aus. Dr. L. hatte es aufgegeben, sich seinem Patienten zum Kampf zu stellen. So weit waren sie, als John ihm eines Morgens mit einem tollen Traum aufwarten konnte. Wahrhaftig, er hatte geträumt wie ein Buch.
Zuvor sei aber von einem Kindheitserlebnis John van Marays berichtet, das am besten hier seinen Platz findet.
(Bald hat die Unordnung ein Ende!)
KAPITEL 3
Inhaltsverzeichnis
Zwölfjährig debütierte John in der Literatur. Es war ein falscher Start, denn ihn erwartete die Musik, nicht die Dichtung, und außerdem beging er ein krasses Plagiat.
Er hatte in der Zeitschrift Der gute Kamerad ein langes Gedicht in Hexametern gelesen, betitelt: Unsre Klasse.
Unsre Klasse gefiel ihm gleich so gut, daß er ein Kunststück fertigbrachte, wie es ihm vorher und nachher kein einziges Mal gelingen wollte: er lernte das Gedicht auswendig.
»Hört mal«, sagte er im Schulhof, »da habe ich ein famoses Gedicht gelesen ...«
Die Zuhörer zeigten sich nicht weniger begeistert als er, und in seiner Freude behauptete sein bester Freund, der im Ernstfall Old Shatterhand hieß: »Das hat er gar nicht gelesen! das paßt ja genau auf unsere Klasse! Das hat er selbst gemacht.«
John hatte nicht daran gedacht, aber jetzt stand er geblendet.
Sein Leugnen wurde schwächer, und als ein käsebleicher Mitschüler namens Depsich, dessen Eltern aus dem Pommerschen oder von sonstwo dort oben eingewandert waren, in der nächsten Stunde aufstand und dem Lehrer meldete: »John van Maray hat ein Gedicht auf unsre Klasse gemacht und kann es auswendig hersagen«, und gleichzeitig Old Shatterhand, der hinter John saß, ihm einen kräftigen Puff in den Rücken versetzte, da stand er auf und gab sein Gedicht auf ihre Klasse zum besten.
Sein Ruhm war groß und schnell vergessen, am gründlichsten von ihm selbst. So daß er vierzehn Tage später dem aus dem Pommerschen hergelaufenen Depsich ohne Arg das Heft des Guten Kameraden lieh, in dem sein Gedicht stand.
Das Gedicht war keineswegs anonym, sondern voll gezeichnet. »Fritz Meyer« stand unter dem letzten Vers: »Fritz Meyer, Quartaner (Apolda)«.
Und nun war es wiederum der Depsich, der in der Stunde aufstand und meldete: »John van Maray hat sein Gedicht aus dem Guten Kameraden gestohlen. Der Verfasser heißt Fritz Meyer und wohnt in Apolda.« Dabei hielt er dem Lehrer die Zeitschrift unter die Nase.
Kaum zu sagen, wie hämisch sein Grinsen war, das Grinsen des käsebleichen, hergelaufenen Depsich, als John sich umwandte, um das Loch im Himmel zu suchen, aus dem jählings der Donner der Vernichtung herabgefallen war! Die Köpfe der Mitschüler verschwammen zu einem feurigen Nebel. Nur das Gesicht des Depsich, das strebte teigig grimassierend zur Decke, als ob der Kopf lauter Luft enthielte. Nun, so war es wohl auch. Jahre lang sah John das Grinsen des pommerschen Luftballons deutlich vor sich. Es wurde ihm geradezu schlecht, wenn er daran dachte.
Die ungeheure Demütigung ging nicht so schnell vorüber wie der Ruhm, aber auch sie ging vorüber – wenigstens scheinbar. Als John abends in einer menschenleeren Gasse auf den Depsich gestoßen war und ihn windelweich gehauen hatte, war die Sache für sie beide abgetan. Er gehörte nicht zu Johns hervorragenden Feinden. John stand zu hoch, John war Winnetou. Als solcher machte er an der Spitze seiner Indianerbande die Zaberner Steige unsicher. Und was war der andre? Der Gefreite Depsich im Korps des ebenfalls hergelaufenen Colonel Smith.
Im folgenden haben wir es auch nur mit diesem zu tun, dem Colonel Smith, Erb- und Todfeind des Indianerstammes, Colonel Smith, der bald darauf den Besuch eines Verwandten aus Amerika erhielt.
Der Erb- und Todfeind war Befehlshaber des englischen Forts an der Zaberner Steige und galt für fast ebenso stark wie John, und wenn auch die Söhne der Steuereinnehmer, Kaserneninspektoren, Post- und Bahnassistenten, aus denen die Regierungstruppen bestanden, zum größten Teil waschechte Bleichgesichter waren, so legte Colonel Smith den Ureinwohnern der Jagdgründe doch beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg.
Zumal als er die Feuerwaffe einführte, gewann er ein Übergewicht, das die andern in brennender Weise zu spüren bekamen. Sie brauchten eine gewisse Zeit, bis sie genug Taschengeld gesammelt, genug erhandelt und aus der mütterlichen Haushaltungskasse gestohlen hatten und endlich alle miteinander zum Kauf von Taschenteschings schreiten konnten. Sie planten nämlich einen vernichtenden Feuerüberfall auf den weißen Mann, der nicht durch vereinzelte, voreilige Schüsse aufmerksam gemacht werden sollte, daß die Rothäute sich heimlich die Donnerbüchsen der Zivilisation zulegten.
Um den Vorsprung wettzumachen, wählten die Indianer ein stärkeres Kaliber. Man konnte gröbere Salzstücke in die Schrothülse hineintun, auch knallte es doppelt so laut.
Der Entscheidungskampf war auf den nächsten schulfreien Tag, einen Donnerstag, festgesetzt, das Unternehmen sorgfältig vorbereitet. Unter anderm hatten John und seine Freunde den letzten Sonntag benutzt, um im Steinwall des englischen Forts eine Dynamitpatrone anzubringen. Die zwanzig Meter lange Zündschnur endete in einem Haselnußstrauch. Der Sohn eines Steinbruchbesitzers, ein ganz hervorragender Indianer, hatte sie zu Hause gefunden.
Drunten im Städtchen war Colonel Smith, der Quartaner Karl Friedrich Buttermann, und drunten im Städtchen waren John und er keine schlechten Freunde. John rief ihn Fitzi, wie seine Mutter ihn rief. Der Vater besaß eine kleine Bank bei der Pfarrkirche.
Von dem Besuch des amerikanischen Verwandten hörte man am Mittwoch. Da kam Fitzi mit einem goldenen Dollarstück auf den Schulhof, zeigte es her und sagte, der amerikanische Verwandte habe es ihm geschenkt. Er sah aus wie ein Pfennig aus dünnem gelben Gold. Alle durften es befühlen und auf die flache Hand legen, und dann gingen sie in die Eingangshalle, wo Fitzi sich niederkauerte und das goldene Dollarstück auf den Steinplatten klingen ließ. Es war echt. Gold, echtes Gold.
Auf dem Heimweg nahm John den Fitzi zur Seite und fragte ihn, was er für das Dollarstück haben wollte. Er bot an: zwei Bände Karl May, fünf Jahrgänge des Guten Kameraden, fünfzig leere Kakaobüchsen, einen Globus mit Sonne und Mond. Das waren Sachen, die ihm gehörten, aber Fitzi fand keinen Gefallen daran.
Da erzählte John ihm von dem Armeerevolver seines Vaters, den er im indischen Urwald getragen, und von einem echten malaiischen Menschenskelett, auch das konnte er haben. Der Vater hatte es in der Ecke seines Arbeitszimmers stehn. Der Revolver lag in einer Kiste im Speicher.
Fitzi begleitete John noch vor dem Essen nach Hause, um den Revolver und das Skelett zu besichtigen.
Er wählte aber das Briefmarkenalbum. Das lag bei John auf dem Tisch und war ein schönes, dickes Album, vollgeklebt mit Marken, für das schon Vater und Mutter gesammelt hatten und das er nur ›auf Probe‹ besaß, wobei es sich erweisen sollte, ob er schon groß genug sei, einen derartigen Schatz zu mehren. Das wählte er. Und »Topp« sagten sie.
John versteckte das Dollarstück in der hintersten Ecke der Schreibtischschublade.
Am nächsten Tag überfielen die Rothäute das englische Fort an der Zaberner Steige, verschossen ein Kilo Viehsalz, die gesamte Besatzung geriet in Gefangenschaft. Die Zündschnur der Dynamitpatrone hatte freilich versagt.
Die Regierungstruppen mußten bei Manitou schwören, nie mehr Dienst gegen die legitimen Herren der Jagdgründe zu tun, dann durften sie heimgehn und Kaffee trinken.
Colonel Smith aber wurde an den Marterpfahl gebunden. Und vor dem Marterpfahl wurde ein Reisigfeuer entzündet, wie es sich gehörte, und die Sieger tanzten heulend um den Pfahl, Tomahawks schwangen sie und Skalpiermesser und knallten die Teschings in die Luft.
Als sie Colonel Smith losbanden und aus der Rauchwolke ans Licht zogen, war er blau im Gesicht und keineswegs in der Lage, die Abbitte zu leisten, die sie ihm zumuteten. Sie schüttelten ihn tüchtig, trugen ihn auch noch, und dies dauerte eine schwere Stunde, durch Wälder und Wiesen hinunter bis an den Bach, wo er kräftig gewaschen wurde. Dann kam der Indianer mit der Kognakflasche, den John zu seiner Mutter entsandt hatte. Die Rothäute öffneten dem Obersten gewaltsam den Mund und flößten ihm Kognak ein, bis er sich verschluckte und ganz entsetzlich husten mußte. Davon erwachte er zum Leben.
Als Fitzi heimging, war er über die Maßen munter, keiner hatte ihn je so vergnügt gesehn.
Am Sonntag machte der Bankier Buttermann Besuch bei Herrn van Maray. Er trug das Briefmarkenalbum unter dem Arm. Gleich wurde John in den Salon gerufen.
»Wo hast du das goldene Dollarstück?« fragte der Vater. Die steile Falte über der Nasenwurzel war dreigezackt, und das bedeutete Orkan. John kannte seinen Vater.
Oh! das Dollarstück war schnell zur Stelle, mit einer stummen Verbeugung überreichte der Junge es Herrn Bankier Buttermann, stammelnd suchte er sich zu entschuldigen. »Du bleibst heute zu Hause«, schnitt ihm der Vater das Wort ab, und Herr Buttermann warf ihm einen schadenfrohen Blick zu.
John kannte seinen Vater. Als der nach Tisch geruht hatte und die Mutter zur Vesper gegangen war, brach der Sturm los. Der Sturm öffnete ruhig die Zimmertür, stand einen Augenblick da, als überblickte er sein Feld – dann brach er los. Es war ein Orkan, John hatte sich nicht getäuscht. Als Wrack ging er aus dem Naturereignis hervor.
Bereits am nächsten Tage wurden die Regierungstruppen sowohl wie der Indianerstamm von Amts wegen aufgelöst. Fitzi und John jedoch blieben fortan unzertrennlich, obwohl die beiden Väter sich in List und Gewalt überboten, um die Söhne auseinanderzuhalten – vielleicht auch deshalb. »Verstehst du«, hatte Fitzi gesagt, »nie im Leben wäre mir ein verräterisches Wort über die Lippen gekommen, aber ich war ja betrunken, völlig betrunken. Da habe ich gequatscht. Weißt du, es soll auch bei den Großen vorkommen.«
Im übrigen bereute er nichts.
Gemeinsam wandten die beiden sich dem Fußballsport zu.
Nun, mehr als zwanzig Jahre später, hatte John im Sanatorium, wo, wie gesagt, fleißig analysiert wurde, und als er gerade so auf der Lauer lag, um dem Arzt einen flagranten Fehlspruch über das Funktionieren der Wolfsgruben und Selbstschüsse in seinem Seelenleben zu entreißen, zwanzig Jahre später hatte er einen schlimmen Traum.
Sein Freund Fitzi war verschwunden. Bald hieß es, er sei getötet und die Leiche im Wald an der Zaberner Steige versteckt worden. Von wem? Niemand konnte es sagen. Als die Leiche ausgegraben wurde, stand John unter seinen Mitschülern und blickte voll ängstlicher Neugier in das arme, blau angelaufene Gesicht.
Unterwegs nach Zabern zurück begann man von Handelsleuten aus dem Lothringischen zu munkeln, wie sie an den Donnerstagen, dem Markttag, über den Paß in die Stadt kamen – die sollten Fitzi verprügelt und, als er plötzlich tot umfiel, im Wald verscharrt haben. Man erzählte in der Stadt davon, ohne genaueres zu wissen, und alles war klar. Dann wechselte die Szene.
John sah sich nur noch auf dem Schulhof und im Klassenzimmer. Wie in einem Gefängnis bewegte er sich darin, konnte nicht mehr heraus, obwohl er, zitternd vor unbegreiflicher Angst, immer wieder versuchte, aus dem Schulgebäude zu entkommen. Wenn er auf seine Kameraden zutrat, kehrten sie ihm den Rücken oder lösten sich in Dunst auf. Er suchte Old Shatterhand und entdeckte ihn endlich weit weg in einer Ecke des Schulhofes. Und Old Shatterhand schaute ihn an! Reglos schaute er ihn an und weinte vor sich hin. Da wußte John, daß auch sein bester Freund an seine Schuld glaubte. Er lief zu ihm hin und schrie: »Ich war es nicht, ich habe Fitzi nicht getötet – glaubst du, ich hätte ihn getötet?« Old Shatterhand rührte sich nicht, nur seine Augen, die strahlten vor Mitleid, und ein Tränenpaar nach dem andern trat gleichzeitig aus der Iris und rollte schnurgerade rechts und links über die Backen. Gleich darauf stand John vor Gericht.
Ein Haufen Geschworener füllte die ansteigenden Bänke. Unter ihnen saß sein Vater. Auch er schien traurig in seinem großen Zorn, der sein Gesicht rötete – die Adern auf den Schläfen waren geschwollen, und John sah deutlich die blauen Knötchen darin. Er schenkte dem Sohn keinen Blick.
Obwohl John wußte, daß er die Tat nicht begangen hatte und es beschwören wollte, fühlte er erschauernd, wie das Schuldbewußtsein gleich einer unaufhaltsamen Flut in ihm stieg, das Flüssige, Kalte, Gefährliche trat aus ihm heraus, es überschwemmte den Saal. Auf einmal wandten alle Geschworenen den Kopf und richteten drohend den Blick auf ihn. Am weitesten vorn, leuchtend vor wehmütigem Zorn, hing ganz groß das Gesicht seines Vaters.
Hatte er ein Geständnis abgelegt? Er hob die Arme, wollte widerrufen, entschlossen zu lügen, zu lügen, bis zum Ende zu lügen.
Es war ein schlimmer Traum. Denn jetzt wurde auch noch Freund Fitzi hereingetragen mit seinem blau angelaufenen Gesicht und als Zeuge gegen John auf einen Tisch gelegt. Das Ärgste aber: John gelang es nicht, aufzuwachen!
Er machte Licht, erkannte das blanke, kahle Sanatoriumszimmer, stand auf und zog den Schlafrock über. Er rückte den Stuhl an den Tisch und begann einen Abschiedsbrief an die Hochdramatische des Züricher Stadttheaters zu schreiben. Er schrieb ihr und hatte dabei das deutliche Gefühl, zu lügen: ob er der Hauptschuldige am Tode seines Feindes Fitzi sei, wisse er nicht, alles in ihm sträube sich gegen die Annahme des Gerichts, nie hätte er sich, nie ihn irgend jemand für geldgierig gehalten. Wenn er jemand hätte ermorden wollen, so wäre es der Depsich und nicht der gute Fitzi gewesen. Doch da das Todesurteil in seinem Prozeß nun einmal feststehe, ziehe er es vor, sich selbst das Leben zu nehmen.
Hier hielt er in seinem Brief, als er endlich erwachte.
Bei der Morgenvisite erzählte er Dr. L. seinen Traum. Noch ganz demütig war er von der maßlosen Angst, die er ausgestanden. Unmöglich konnte der Schweizer Doktor glauben, daß er sich da eine Geschichte für ihn zurechtgemacht habe. Mit allen Spuren einer schweren Niederlage saß er vor dem morgenfrischen Doktor im Stuhl, seine Stimme bebte, noch viel mehr bebte sein Herz. Wortlos, ohne eine Miene zu verziehen, stand Dr. L. und hörte zu.
Als er mit den hundert entsetzlichen Einzelheiten des Traumes zu Ende war, klopfte Dr. L. ihm auf die Schulter:
»Gut«, sagte er. »Sehr gut!«
Seine Zähne blinkten in einem sauberen Lächeln, so verließ er das Zimmer. Er war von gewöhnlicher Größe, hielt sich gerade und trug einen unauffälligen Anzug.
Erstaunt erst, dann beleidigt, starrte John durch die geschlossene Tür hinter dem Riesen an Unglauben her. Auf einmal sah er den andern Doktor vor sich, den Schweden vom Götakanal. Ganz ungeniert reckte er sich in der Sonne und lachte John an aus weitgeöffnetem Mund, in dem es von Gold und weißen Zähnen schäumte. Wie ein Blitz wirkte das Lachen, quer durch Schweden, von Meer zu Meer.
»Das erzählen Sie einem andern!« rief er schallend, und seine Worte waren der Donner, der auf den Blitz zu folgen pflegt ...
John sprang auf: »Nein, nein! Nie mehr.«
Mit weichen Knien trat er ans Fenster und blickte in den Park des Sanatoriums hinaus. Es war ein Schweizer Park, ordentlich angelegt, sauber gehalten. Die Allee von Rotdornbäumen stand in Blüte. Als er das Fenster öffnete, sprangen hundert Vogellaute in das Zimmer.
Still schwor er sich, keine Träume mehr zu erzählen, weder echte noch erfundene. Sie sind eine einzige Zigeunerbande, sagte er sich, die echten wie die erfundenen, und tauschen ständig die Masken.
Schließlich weiß man nicht mehr, welche echt und welche erlogen sind. Nicht einmal die Wissenschaft kennt sich aus. Heimlich und im Zwielicht kann ich ja gelegentlich auch so was aufsuchen, mit Vorsicht – immerhin mit Vorsicht. Handelt es sich doch um Usurpatoren und tiefsinnige Verderber des hellen Tages! Man sollte sie in Ketten legen, bevor man sich mit ihnen einläßt ...
Was ich zum Leben brauche, das sind Bäume, die deutlich im Licht stehn, ebensolche Menschen darunter, und Gott vergelt's, wenn die Menschen lächeln und die Bäume gar noch blühn. Was ich brauche, sind Schneeballsträucher, wie sie dort den Bäumen das Geleit geben, Gestalten aus einer Kinderprozession, und einen gelben Weg, der männlich zum Ziele führt ... Lieber Eckensteher im besenreinen Zürich als der fliegende Holländer auf einem Alkoholschiff!
Von dem Tag an war er gesund.
Sein erster Gang führte ihn auf das Postamt. Um den Frieden, den er mit seiner Seele geschlossen, auch vor der Welt zu bekräftigen, telegraphierte er an den Schweden, frei nach dem Bayernkönig und Dichter:
»Rechts stehn Träume, links stehn Träume
Und dazwischen Zwischenräume.
In der Mitte läuft ein Mann,
Der nicht sehn noch hören kann« –
was aber freundschaftlich gemeint war.
Die Hochdramatische in Zürich erhielt ein Blumenarrangement, ein wahres Denkmal, und einen Abschiedsbrief, der von bürgerlicher Lebensweisheit strotzte.
»Jetzt ist er ganz verrückt«, meldete sie dem Direktor. »Von John van Maray hören wir nichts mehr.«
Irrtum!
Bald las sie in einer Zeitung, daß John an der Charlottenburger Oper dirigiere. Eine günstige Kritik. Sie erschrak bis ins Mark.
Die berühmte Sängerin Ursel Bruhn kam nach Zürich. Was sang die Person? Lieder von John van Maray. Ja, der Dirigent der Züricher Tonhallenkonzerte schämte sich nicht, ein mißtönendes und liebloses Orchesterstück Marays aufzuführen. Als aber die Hochdramatische von Gastspielreisen des kleinen Spießers Maray hörte, begann sie von ihm zu träumen.
Eines Tages war er mit seinem Orchester in Zürich.
Kaum hatte er den Taktstock niedergelegt, da erhob sich in der ersten Reihe eine junge Dame mit braunrotem Haar und begab sich an der Spitze nachdrängender Musikfreunde in das Künstlerzimmer.
Kannte jemand die Person?
Im allgemeinen Lärm ging die Frage unter.
Und die Hochdramatische machte sich unter den Augen des applaudierenden Saales ebenfalls auf den Weg zum Künstlerzimmer. Sie lächelte. Sie lächelte wie ein aufziehendes Gewitter. Gleichzeitig suchte und fand sie ein stummes Schluchzen in der Kehle. Sie hielt es fest.