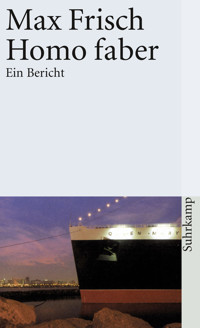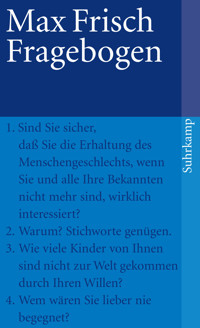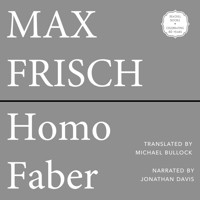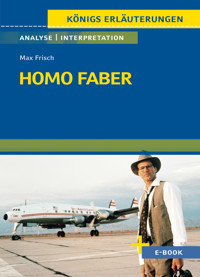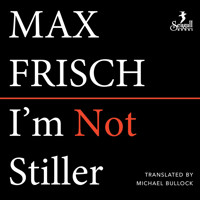14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Tagebuch 1966-1971 steht in der Kontinuität des ersten. Die Aufzeichnungen, ob Erzählung oder Bericht, Fiction oder Analyse, Verhöre, Fragbogen oder Handbuch, Reisebericht oder Erinnerung, protokollieren unsere Zeit und die Situationen des einzelnen in ihr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Max Frisch
Tagebuch 1966-1971
Suhrkamp
suhrkamp eBook Berlin 2011
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1972
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags
sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,
auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75010-0
www.suhrkamp.de
Für Marianne
1966
Fragebogen
1.
Sind Sie sicher, daß Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert?
2.
Warum? Stichworte genügen.
3.
Wieviele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch Ihren Willen?
4.
Wem wären Sie lieber nie begegnet?
5.
Wissen Sie sich einer Person gegenüber, die nicht davon zu wissen braucht, Ihrerseits im Unrecht und hassen Sie eher sich selbst oder die Person dafür?
6.
Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
7.
Wie heißt der Politiker, dessen Tod durch Krankheit, Verkehrsunfall usw. Sie mit Hoffnung erfüllen könnte? Oder halten Sie keinen für unersetzbar?
8.
Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?
9.
Wen hingegen nicht?
10.
Hätten Sie lieber einer andern Nation (Kultur) angehört und welcher?
11.
Wie alt möchten Sie werden?
12.
Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder Nein.
13.
Warum nicht, wenn es Ihnen richtig scheint?
14.
Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv?
15.
Wann haben Sie aufgehört zu meinen, daß Sie klüger werden, oder meinen Sie's noch? Angabe des Alters.
16.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
17.
Was, meinen Sie, nimmt man Ihnen übel und was nehmen Sie sich selber übel, und wenn es nicht dieselbe Sache ist: wofür bitten Sie eher um Verzeihung?
18.
Wenn Sie sich beiläufig vorstellen, Sie wären nicht geboren worden: beunruhigt Sie diese Vorstellung?
19.
Wenn Sie an Verstorbene denken: wünschten Sie, daß der Verstorbene zu Ihnen spricht, oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen?
20.
Lieben Sie jemand?
21.
Und woraus schließen Sie das?
22.
Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht: wie erklären Sie es sich, daß es dazu nie gekommen ist?
23.
Was fehlt Ihnen zum Glück?
24.
Wofür sind Sie dankbar?
25.
Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches?
Statistik
Die durchschnittliche Lebensdauer betrug um Christi Geburt nur 22, zur Zeit von Martin Luther schon 35,5, um 1900 noch 49,2 und heute 68,7 Lebensjahre. Die Lebensverlängerung bedeutet zugleich eine Umschichtung der Altersklassen. Um 1900 stellten die Jugendlichen (bis zum zwanzigsten Lebensjahr) noch 46% der Bevölkerung, 1925 nur noch 36%, 1950 noch 31%, und für 1975 rechnet man mit 28% jugendlichen Menschen. Entsprechend steigen die Altersklassen (nach dem sechzigsten Jahr); um 1900 waren es noch 7% der Bevölkerung, um 1975 werden es 20% sein.
Bodega Gorgot
Wenn seine Frau ihn nicht unterbricht, sieht jedermann, daß sie nicht mehr zuhört; daß es ihr zu lang wird, wenn er spricht. Er ist Goldschmied. Seine Arbeit wird geschätzt. Eine Fachauszeichnung (Landesausstellung 1939) nimmt er von der Wand. Ein Lehrling und zwei Angestellte haben es gemerkt. Was eigentlich? Das wissen sie nicht, aber sie haben es gemerkt: der Alte meint ihnen den Beweis zu schulden, daß er's besser kann, und sie machen ihn fertig, auch wenn ihm dieser Beweis gelingt. Jetzt sitzt er fast jeden Abend in der Bodega. Die jungen Bärte, ihre Hosenmädchen mit offenem Haar usw., es stört ihn nicht, daß sie nicht arbeiten um 5 Uhr nachmittags. Die Bodega ist auch tagsüber düster. Als junger Mann hat er gearbeitet; das ist ihm geblieben. Nachher geht er nochmals in seine Werkstatt. Einmal kommt sie in die Bodega; er hat schon getrunken und macht eine schlechte Figur. Sie hat es nicht anders erwartet; das weiß er. Sie legt ihre Hand auf seine Hand, bringt den Goldschmied nach Haus. Sein Vater war Volksschullehrer. In mancher Hinsicht, zum Beispiel politisch, weiß er einfach mehr als seine Frau, in andern Dingen weniger; das letztere genügt: wenn sie für seine politischen Kenntnisse oder Meinungen kein Interesse hat, wird er unsicher. Wenn sie behauptet, Trotzki sei erschossen worden, widerspricht er, aber es überzeugt sie nicht; sieht er später in einem Buch nach, so wird er wütend, daß sie ihn hat unsicher machen können. Wochenlang kommt er nicht mehr in die Bodega. Vielleicht hat er eine andere Pinte gefunden, die sie nicht kennt. Sie ist ausgebildete Kindergärtnerin, hat ihren Beruf damals wegen der eignen Kinder aufgegeben; sie macht die Buchhaltung für den Goldschmied, was nicht viel Arbeit ist; sie ist unersetzlich. Später wieder sitzt er am runden Tisch in der Bodega; er sieht sich die jungen Bärte an, trinkt, spricht mit niemand. Nimmt er eine Zeitung, so kommt ihm vor, als habe er alles schon gelesen. Vielleicht hat sie ihn verlassen. Was er macht, wenn er so da sitzt und schweigt: er rechtfertigt sich. Schließlich hat er einen Laden gegründet aus eigener Kraft, schließlich ist seine Arbeit unter Fachleuten anerkannt usw. Zwei Kinder, jetzt schon erwachsen und selbständig, merken, daß er ihre Achtung braucht; sein Eigenlob macht es ihnen nicht leicht. Sie hat ihn nicht verlassen; sie weiß, daß der Goldschmied sie braucht, und trägt ihr Kreuz mit Anstand. Sie ist Mitte 40. Es wird sich nichts mehr ändern. Eigentlich kann er sich ihr Leben nicht vorstellen. Sie kommt mit der Einkaufstasche in die Bodega und trinkt auch einen Clarete. Vielleicht schon sehr früh, schon am ersten Abend hat sie gemerkt, daß man ihn unsicher machen kann. Er galt als Draufgänger; Erfolg bei Frauen usw. Er überredete sie zu einer Bootfahrt, um als Ruderer seine Tüchtigkeit zu zeigen, und empfand es als Versagen seinerseits, als es zu regnen begann. Sein Versagen jetzt ändert nichts an ihrer Beziehung zu ihm, im Gegenteil, es bestätigt sie. Wie er in der Bodega den gemeinsamen Wein bezahlt, ihre Einkaufstasche nimmt und ihr dann den Mantel hält und wartet, wie er nicht zu sagen wagt: Jetzt komm schon! und wie er sich verantwortlich macht, wenn sie beinahe ihre Handschuhe vergessen hätte –
BERZONA
Das Dorf, wenige Kilometer von der Grenze entfernt, hat 82 Einwohner, die Italienisch sprechen; kein Ristorante, nicht einmal eine Bar, da es nicht an der Talstraße liegt, sondern abseits. Jeder Gast aus den Städten sagt sofort: Diese Luft! dann etwas bänglich: Und diese Stille! Das Gelände ist steil: Terrassen mit den üblichen Trockenmauern, Kastanien, ein Feigenbaum, der Mühe hat, Dschungel mit Brombeeren, zwei große Nußbäume, Disteln usw. Man soll sich hüten vor Schlangen. Als Alfred Andersch, schon seit Jahren hier wohnhaft, auf das kleine Anwesen aufmerksam machte, war das Gebäude verlottert, ein altes Bauernhaus mit dicken Mauern und mit einem turmartigen Stall, der jetzt Studio heißt, alles mit Granit gedeckt. Das Tal (Val Onsernone) hat keine Sohle, sondern in seiner Mitte eine tiefe und wilde Schlucht, in die wir noch nie hinabgestiegen sind; seine Hänge sind waldig, darüber felsig und mit den Jahren wahrscheinlich langweilig. Im Winter habe ich es lieber. Die einheimische Bevölkerung lebte früher von Strohflechterei, bis auf dem Markt zu Mailand plötzlich die japanischen Körbe und Hüte und Taschen erschienen; seither ein verarmendes Tal.
Vorsatz
Vieles fällt natürlich nach fünf Jahren im Ausland (Rom) deutlicher auf, ohne deswegen nennenswert zu werden, wenn es nicht zu neuen Einsichten führt, und das ist bisher nicht der Fall gewesen. Daher der Vorsatz, über die Schweiz mindestens öffentlich keine Äußerungen mehr zu machen.
. . .
Tatsächlich haben Ausländer, die in der Schweiz wohnen, oft ein froheres Verhältnis zu diesem Land als unsereiner. Sie enthalten sich jeder fundamentalen Kritik; unsere eigene Kritik ist ihnen eher peinlich, sie möchten diesbezüglich verschont bleiben. Was, außer dem schweizerischen Bankgeheimnis, zieht sie an? Offenbar doch allerlei: Landschaftliches, die zentrale Lage in Europa, die Sauberkeit, Stabilität der Währung, weniger der Menschenschlag (da verraten sie sich gelegentlich durch pejorative Klischees), vor allem aber eine Art von Dispens: es genügt hier, daß man Geld und Papiere in Ordnung hat und auf keine Veränderung sinnt. Wenn nicht gerade die Fremdenpolizei sie ärgert, so ist die Schweiz für den Ausländer in der Schweiz kein Thema. Was sie genießen: Geschichtslosigkeit als Komfort.
. . .
Das Versprechen, über die Schweiz keinerlei Äußerungen mehr zu machen, ist leider schon gebrochen. (»Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr: man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen«.) Vielleicht war die Heimkehr verfrüht.
CASA DA VENDERE
Das kommt vor: eine Villa steht schon seit längerer Zeit verlassen, von den Bewohnern keine Spur. Es scheint, daß die Leute einfach aufgestanden sind vom Tisch, ohne abzuräumen; Risotto in einer Schüssel verschimmelt, Wein in einer offenen Flasche, Reste von Brot steinhart. Nicht einmal ihre Kleider haben sie mitgenommen, ihre Schuhe, ihr persönliches Zeug. Erst nach Wochen blieb das elektrische Licht aus, weil niemand die Rechnung bezahlte; das fiel auf … Inzwischen wurde einiges gestohlen; die Haustüre war nicht geriegelt; ein Portal mit naivem Sgrafitto, darüber ein Balkon, dessen Geländer verrostet ist, die grünen Jalousien sind jetzt geschlossen, der Verputz (Yoghurt mit Himbeer) fladenweise abgebröckelt. Im Garten steht eine Tafel: CASA DA VENDERE, wie ich höre: schon seit Jahren.
Der Goldschmied
Er wird ein schlimmes Ende nehmen. Das weiß er, wenn er in der Bodega sitzt. Der spanische Kellner, wenn er den Dreier Clarete auf den Tisch stellt, blickt anderswohin, spricht schon zum nächsten Tisch. Sein Vater starb einfach an Herzschlag; im Bus. Kommt jemand in die Bodega, der den Goldschmied von früher kennt, so bleibt der Goldschmied nicht lang, legt sein Geld hin, sowie der alte Bekannte sich setzt. Er versteht's nicht, daß ein Lehrling ihn fertig macht. Als junger Mann, damals nach der Kunstgewerbeschule, arbeitete er im Ausland (Straßburg); 1939 kehrte er zurück. Er hat den Lehrling entlassen und einen andern genommen: auch der neue läßt den Wasserhahn tropfen. Vermutlich ist er ein Pedant nicht nur in seiner Werkstatt; 27 Jahre Arbeit mit der Lupe. Kommt er von seiner Arbeit nach Hause, hält er eine schmutzige Küche nicht aus. Zum Beispiel. Manchmal denkt er an Brandstiftung. Sie weiß es, daß er eine schmutzige Küche nicht aushält, und findet es nachgerade lächerlich, daß das sein Problem ist. Der spanische Kellner in der Bodega behandelt ihn freundlich, aber nachlässiger als alle andern Gäste. Er wagt nicht zu verlangen, daß sie die Küche in Ordnung hält. Sie hat es auch früher nie getan; offenbar ist er empfindlicher geworden, seit er als Mann ein Versager ist. Schon seine Bitte, sie möge das Geschirr nicht tagelang stehen lassen, weil es ihn einfach ekle, führt zu Spannungen. Schließlich ist sie diplomierte Kindergärtnerin und nicht seine Magd. Die Küchen-Spannungen enden jeweils damit, daß ihm seine Lächerlichkeit bewußt wird; wenn es soweit ist, wäscht sie wortlos das Geschirr, aber nicht vorher. Sein Laden mit Werkstatt liegt in einer Gasse der Altstadt, wo Brandstiftung viel ausrichten würde vor allem nach Mitternacht. Wenn der Goldschmied, allein zu Hause, das Geschirr wäscht und trocknet und auch den Boden der Küche reinigt, weiß er, daß sie keinen Grund hat zu danken; es ist ein offener Vorwurf. Dann und wann tut er's trotzdem, weil ihn das ungewaschene Geschirr ekelt. Wieso nimmt sie keinen anderen Mann? Tut er's nicht und wartet er, bis sie das Geschirr wäscht, so muß er sich zusammen nehmen, daß er sich nicht bei ihr entschuldigt; sie ist ja wirklich nicht seine Magd. Einigermaßen wohl fühlt er sich nach dem ersten Zweier in der Bodega; er trinkt selten mehr. Aber der Zweier hält nicht lange an. Nachher geht er nochmals in die Werkstatt, wenn die Angestellten weg sind; er stellt den tropfenden Wasserhahn ab. Einmal ein schwerer Fehler in der Buchhaltung, den sie gemacht hat; er sagt ihr nichts davon. Er erwirbt sich keine Achtung, wenn er sie kränkt. Wenn sie eine Woche bei ihren Eltern ist, stört ihn das ungewaschene Geschirr in der Küche nicht; er spült es erst am letzten Abend, bevor sie zurückkommt. Sein Einkommen ist nicht groß, aber es reicht. Wäre es nicht das Geschirr in der Küche, so wäre es etwas anderes, was ihm zeigt, daß sie seine Wünsche zu erfüllen kein Bedürfnis hat. Das weiß er. Natürlich geht es nicht um das Geschirr. Das alles weiß er. Es ist lächerlich. Er tut ihr leid. Sie kommt nicht mehr in die Bodega, um ihn zu holen; er empfindet es als Entmündigung, wenn sie ihn holt. Er ist schwierig. Das war immer so: wenn er einmal krank ist, gibt sie sich rührende Mühe. Das bleibt. Früher hatte er Freunde; er ruft sie kaum noch an, scheut sich, weil es lächerlich ist, was ihn beschäftigt. Was man eheliche Auseinandersetzung nennt, kommt vor, aber er meidet solche Auseinandersetzungen; dann sagt er genau, was er nicht hat sagen wollen: die Sache mit dem ungewaschenen Geschirr. Zum Beispiel. Zeitweise gibt sie sich Mühe. Sein Interesse an öffentlichen Angelegenheiten (Sanierung der Altstadt) ist erloschen; zwar liest er den Tagesanzeiger, wenn er in der Bodega sitzt. Verglichen mit allem, was in der Zeitung steht, ist es lächerlich, was ihn beschäftigt. Es ist unter seiner Würde. Wenn es je zu einer Brandstiftung kommt, so darum.
Früher brauchte er sich nichts gefallen zu lassen; ein Draufgänger, Erfolg bei Frauen usw. Noch vor kurzem brauchte er sich vieles nicht gefallen zu lassen, weil es gar nicht dazu kam. Zum Beispiel: sie hat das Foto von Straßburg einfach von der Wand genommen, verschwinden lassen. Seine Frau fürchtet jetzt immer, daß er sich lächerlich mache. Wenn jemand bei einem Fehlanruf einfach aufhängt, ohne sich zu entschuldigen, nimmt er's persönlich; er sagt nochmals: Huber! obschon der andere eben aufgehängt hat. Hinten in seinem Laden (vormittags) sitzt er bei Neon-Licht, die Lupe in die Augenhöhle geklemmt; seine Frau spricht mit den Kunden, er fast nicht mehr, oder wenn ein Kunde mit dem Goldschmied selbst sprechen will, beugt er sich über den Tisch, damit der Kunde nicht sein Gesicht sehe. Es gibt noch Leute, die seine Broschen kaufen. Meistens sagt er nichts, überhaupt nichts, wundert sich nur, was eigentlich los ist, daß er sich alles gefallen läßt. Vielleicht meint sie, daß der Goldschmied es nicht einmal merkt. Dann fragt sie jedesmal: »Hast du wirklich die Wohnung abgeschlossen?« Manchmal blickt der Goldschmied sie einfach an: als wäre er imstande sich aufzuhängen. Einer der Kellner, der junge Spanier, hat es auch gemerkt, wird freundlicher, seit der Goldschmied seinen Mantel nicht mehr auszieht; dazu trägt er die Baskenmütze, packt Fleischkäse aus einem knisternden Papier; offenbar geht er zum Abendessen nicht nach Haus. Wenn der Goldschmied mit jemand Streit hat, weiß er, daß sie auf der Seite der andern ist von vornherein; da braucht er gar nichts zu erzählen. Sie will immer sein Bestes und tut, als mache er nur noch Fehler. Manchmal will er Schluß machen. In der Bodega macht es ihm nichts aus, wenn die Aschenbecher schmutzig sind. Einmal muß sie's sagen: »Der ganze Schmutz kommt ja von dir.« Das kann man ihm beweisen. Es ist immer besser, wenn er nichts sagt. Eine Stunde nachdem er aus der Toilette gekommen ist, merkt der Goldschmied, daß seine Hose nicht zugeknöpft ist; vielleicht ist das schon öfter vorgekommen, und der Goldschmied hat's überhaupt nicht bemerkt. Im Mantel fühlt er sich sicherer. In der Bodega erinnert er sich an einen Fall, von dem er als Schüler gehört hat: ein Arbeiter, Mineur, der Speiseröhrenkrebs hatte, legte sich eine Zündkapsel in den Mund; sein Hirn verspritzte in den Arkaden beim Hechtplatz. Der wollte es gräßlich, wie der Goldschmied es eigentlich nicht will. Gegen 6 Uhr wird die Bodega voll, dann macht er Platz; er sitzt ja schon im Mantel, und es fällt nicht auf, wenn er geht. Das Geld legt er vorher auf den Tisch. Ein andrer Fall: als Kunstgewerbeschüler, als er in Wiedikon mit seiner Mutter wohnte, hörte er beim Zähneputzen im Badezimmer einen ungewöhnlichen Ton aus dem unteren Badezimmer, nicht sehr laut, ungefähr so wie wenn jemand mit einem kleinen Hammer den Spiegel zerschlagen hätte, nur ohne Klirren danach; ein Schuß; nach zwei Stunden trugen sie den Sarg aus dem Miethaus. Je älter man wird, um so schlichter möchte man's. Auf dem Albis kennt er Plätze genug, die sich eignen; es braucht ja nicht am Sonntag zu geschehen, wenn es viele Spaziergänger gibt, Familien mit Kindern. Manchmal denkt er: Ich häng mich auf! beispielsweise wenn sie sagt: »Rede nicht, sondern denke.« Er kommt immer regelmäßiger in die Bodega. Wenn er sich gesetzt hat, sieht er sich die Leute vorerst an; dann denkt er. Was eigentlich? Ein junger Bart mit Langhaar am runden Tisch sagt: Guten Appetit. Später hört er von einem Nebentisch das Wort: Schwanz. Der Goldschmied muß aufpassen, daß er nicht alles auf sich bezieht; überhaupt muß er immerfort aufpassen. (Nicht nur wenn er aus der Toilette kommt.) Ein Leben lang hat er sich bemüht, nicht widerlich zu werden, ein Leben lang hat er immer das Klo-Fenster geöffnet, in der Eisenbahn hat er immer den Mantel über sein Gesicht gezogen, wenn er schlafen wollte. Jetzt in der Bodega kennt man den Goldschmied nur noch im Mantel: ein Alter, zufrieden mit Fleischkäse und Clarete. Kein Trottel, wie sie zu Hause meint, aber er muß aufpassen. Wenn er in der Bodega das Geld auf den Tisch legt, zählt er's zweimal, nach einer Weile sogar ein drittes Mal. Ein Sprung von einem Aussichtsturm wäre sicher, aber wenn er es sich ausdenkt: widerlich für die Hinterlassenen, und ein Leben lang hat er sich bemüht, nicht widerlich zu werden. Der Goldschmied weiß, es müßte bald geschehen. Geboren bei Zürich (Adliswil) und aufgewachsen in Zürich, kennt er natürlich die Mühlebachstraße und die Mühlegasse; trotzdem hat er auf der Straße eben die verkehrte Auskunft gegeben. Zum Glück war sie nicht dabei. Wenn sie vor dem Fernsehen sitzen: seine Meinung überzeugt nie, er ist immer für Leute, die seine Frau nicht überzeugen, zum Beispiel für Willy Brandt. Einmal denkt er auch an Gashahn; nur gibt es in der Wohnung keinen Gashahn. Sie will immer sein Bestes: zum Beispiel, daß er unter Leute gehe. Nachher sagt seine Frau, daß wieder nur er die ganze Zeit geredet habe, daß er den andern nicht zuhöre usw., der Goldschmied weiß bloß, daß es niemand überzeugt, wenn der Goldschmied einmal auch etwas sagt. Sicher und für die Hinterbliebenen nicht widerlich ist einzig die Schlafmittel-Methode, die er unmännlich findet; immerhin hat er in den letzten Monaten angefangen, Schlaftabletten zu sammeln, versteckt sie in der Werkstatt. Aber auch dazu muß der Mensch aufgelegt sein; es genügt nicht, daß einer keine Angst hat. Man nimmt nicht dreißig Schlaftabletten einfach so, wirft sie aus der flachen Hand in den Mund, jeweils drei oder vier, die jedesmal mit Wasser hinunter zu spülen sind oder mit Chianti. Wenn der Goldschmied, um dazu aufgelegt zu sein, Streit anfängt wegen einer Lappalie (wieder hat sie den Tagesanzeiger von heute weggeworfen), ist sie vernünftig. Sogar mütterlich; nachher kocht sie seine Lieblingsspeise, läßt ihn Fernsehen einschalten. Später entschuldigt er sich. Was schlimmer und schlimmer wird, liegt nicht an ihr: »Kindisch!« das sagt man eben so; sie hat es nicht so gemeint, wie er es hört. Vieles hat sie schon vor 10 oder 20 Jahren genau so gesagt, und es hat dem Goldschmied nichts ausgemacht, wenn sie gesagt hat: »Trottel«. Das meint sie nicht wörtlich, sonst hätte sie nicht ein Leben lang mit dem Goldschmied gelebt. Sie schlafen noch immer Bett an Bett. Es liegt nicht an ihr, daß sie vor Leuten sagen muß: »Das heißt nicht Karfunkel, du meinst Karbunkel.« Vollkommen sachlich; übrigens hat sie es ihm schon zu Hause gesagt. Es ist furchtbar, wenn man überhaupt nichts mehr sagen kann. Einmal sagt sie: »Jetzt redest du wie ein Gaga«, aber dafür entschuldigt sie sich; sie hat es so gemeint – sie sagt das nie wieder.
Eigentlich braucht es gar keinen Entschluß mehr, wenn er auf einer Bank sitzt am Wald: es genügt der Blick auf die Stadt, Limmat, Türme, Gasometer bei Schlieren, ein Liebespaar, das in den Wald geht. Der Goldschmied hat jetzt die Schlafmittel in der Manteltasche. Er wird 64. Worauf wartet er? Wenn er in der Nacht ohnehin auf die Toilette muß: zehnmal je drei Tabletten je mit einem Schluck, das ist zu machen. Es muß nur sicher sein. In die Bodega kommt er nicht mehr (der Goldschmied wird nicht vermißt, aber er fehlt: der alte Eisenofen, das Ofenrohr durch den Raum usw., zwei oder drei Alte gehören eigentlich zum Inventar), plötzlich weiß er nicht, wozu in diese Bodega. Wenn er Papier mit seinem Briefkopf nachbestellen läßt oder wenn er sich nochmals eine neue Baskenmütze kauft, bedeutet es nicht, daß der Goldschmied warten will, bis zum ersten Hirnschlag. Dann ist es zu spät. Die Schwiegertochter in San Paolo schreibt, sie kommen im September nach Zürich; der Goldschmied wird sich nicht an ihren Kalender halten, so nett ihr Vorschlag gemeint ist: Familien-Ausfahrt an den Vierwaldstättersee, wo es die gebackenen Felchen in Bierteig gibt. Sie findet, der Goldschmied arbeite zu viel. Wenn er in der Nacht ohnehin auf die Toilette muß, ist es schon 4 Uhr morgens, und wenn er um 9 Uhr nicht zum Kaffee kommt, ruft sie um Hilfe, man wird von einer Ambulanz ausgepumpt. Es ist nur zu machen gegen Abend; nicht zu spät, damit die Ambulanz nicht zu früh kommt; nicht zu früh, damit er nicht schon vor dem Fernsehen einschläft. Schneetreiben am andern Tag; damit sein Vorsatz, gegen 10 Uhr abends die Schlafmittel zu nehmen, nicht auffällt, verbringt er den Tag wie üblich: vormittags in der Werkstatt, nachmittags in der Bodega (zum letzten Mal), er trinkt nicht mehr als üblich, liest den Tagesanzeiger, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie merkt bloß, daß er wieder in der Bodega gewesen ist: »Du vertrottelst noch in dieser Bodega.« Wenn man sich in der Hand hat, braucht man sich nichts gefallen zu lassen; da der Goldschmied sie nicht einmal anblickt, sondern im Tagesanzeiger blättert, tut, als habe er es nicht gehört, wiederholt sie: »Du vertrottelst.« Dabei hat der Goldschmied sich in der Hand wie schon lang nicht mehr; er findet es nur schade, daß sie das gerade heute sagt. Am andern Morgen ein toter Goldschmied, das geht nicht; sie müßte sich Vorwürfe machen, daß sie das gesagt hat. Sie schlafen noch immer Bett an Bett. Um 10 Uhr, wenn jeweils die Nachrichten kommen, denkt der Goldschmied fast jedesmal daran. Der Goldschmied kennt jemand mit Hirnschlag. Scheinbar ist es nur das Lid, das streikt; es gibt Sonnenbrillen, um das zu verdecken; plötzlich sind alle Leute sehr lieb zu ihm, unsicher, ob er noch denken kann. Weiß so jemand, daß er lallt? Er wird sich nicht mehr davon erholen, aber es muß nicht sein, daß es zum zweiten Hirnschlag kommt. Noch hat der Goldschmied sich in der Hand, noch kann er denken. Ein andermal geht es wieder nicht: seine Frau muß morgen zum Arzt, sagt sie. Es kann sein, daß man schneiden muß, sagt der Arzt, kein Grund zur Sorge, eine Sache von 8 oder 10 Tagen … So lang muß er's verschieben.
Der Goldschmied lebt noch immer. Es kommt zu den gebackenen Felchen in Bierteig am Vierwaldstättersee im September mit dem Enkelchen aus San Paolo. Jajaja! Nur die Großmutter fühlt sich nicht zum besten; sie erzählt die Geschichte ihrer Operation im Frühjahr, während der Goldschmied findet, die gebackenen Felchen in Bierteig schmecken auch nicht mehr wie früher. Der Sohn aus San Paolo: Generalvertreter einer schweizerisch-amerikanischen Firma, schon fast ein Amerikaner, wenn er so von Latein-Amerika erzählt und dazu die einheimischen Schwäne füttert. Der Goldschmied hört, daß Geld überhaupt keine Rolle mehr spiele, auch wenn er 90 wird, überhaupt keine Rolle. Jajaja! sagt nicht er, sondern die Großmutter; sie sagt es nicht zu ihm, sondern zum Enkelchen.
Wie er in der Bodega sitzt (der Eisenofen ist noch immer da, nur die Kellner haben gewechselt) und wie er den Fleischkäse aus einem knisternden Papier packt, dann kaut – seine Frau ist gestorben, der Laden verkauft, er wohnt in einem städtischen Altersheim.
BERLIN
Zu sehen ist, was man schon weiß. Seither bin ich öfter in Berlin gewesen und habe auf Besichtigung der Mauer verzichtet. Uwe Johnson führt uns wie eine amtliche Person im Dienst, ohne Kommentar; da er sehr groß ist, beugt er sich höflich, wenn eine technische Information verlangt wird, und nimmt jedesmal seine Pfeife aus dem Mund, wie immer in schwarzer Lederjacke, Kopf kahlgeschoren. Er selber bezeichnet sich nicht als Flüchtling, kann aber nicht mehr auf die andere Seite. Ein Tag mit Sonne und mit kaltem Wind, viel heller nordischer Himmel über Stacheldraht. Wenn man die Mauer sieht, so gibt es nichts dazu zu sagen; allerdings läßt sich bei diesem Anblick auch nichts anderes reden. Erst später in einer Kneipe (sie liegt fast noch im Niemandsland) kommt es zum persönlichen Gespräch, ohne daß er seine schwarze Lederjacke etwa ablegt, die er auch im sommerlichen Rom getragen hat. Ein Amtskleid? Der Tabak-Beutel, den ich aus der Tasche nehme, ist ein Geschenk von ihm, weil ich einmal gesagt haben soll – nicht in Rom, nein, in Spoleto und nicht in der Bar, sondern beim Kiosk … Ein homerisches Gedächtnis hat dieser Mann; Mecklenburg wird sich darauf verlassen dürfen.
Erinnerungen an Brecht
Wie ich Brecht im November 1947, wenige Tage nach seinem Eintreffen in Europa, zum ersten Mal gesehen habe: in der kleinen bücherreichen Wohnung von Kurt Hirschfeld, Dramaturg des Zürcher Schauspielhauses, das drei Brecht-Stücke in deutscher Sprache uraufgeführt hat. Brecht saß da, wie man ihn von raren Fotos kannte, auf der Bank ganz in der Ecke: grau, still, schmal, etwas verkrochen, ein Mann in der Fremde, die seine Sprache spricht. Er schien froh um die Wände an seinen Schultern links und rechts. Ein Bericht über die »Hearings«, die Brecht gerade hinter sich hatte, wurde abgebrochen, als ich dazukam. Ich war damals 36, Architekt. Da er Zürich nicht kannte, zeigte ich ihm den Weg hinunter zum Stadelhofen. Die Stadt, wo er sich auf unbestimmte Zeit niederzulassen gedachte, beachtete er mit keinem Blick. Ich berichtete ihm von Deutschland, soweit ich es von Reisen kannte, vom zerstörten Berlin. Ich solle bald nach Herrliberg kommen, um mehr zu berichten. »Vielleicht kommen Sie auch einmal in diese interessante Lage«, sagte Brecht auf dem Bahnsteig, »daß Ihnen jemand von Ihrem Vaterland berichtet und Sie hören zu, als berichtete man Ihnen von einer Gegend in Afrika.«
Die Wohnung, zur Verfügung gestellt von dem jungen Ehepaar Mertens, war gratis; seine wirtschaftliche Lage, als Brecht in Zürich lebte, war miserabel: die Reise nach Europa wurde finanziert aus dem Verkauf von Haus und Möbeln in Amerika; die damaligen Einnahmen hätten kaum für einen Studenten gereicht; zwar begannen Verhandlungen mit Peter Suhrkamp, der aber damals auch kein Kapital hatte. Vielleicht täuschte mich sein einziger Luxus: die guten Zigarren. Und seine Gastlichkeit. Brecht, der seine wirtschaftliche Lage nie erwähnte, wirkte nicht mittelloser als später, später nicht wohlhabender als damals.
Empfanden wir Brecht als Deutschen? Als Bayern? Als Weltbürger? Das letztere hätte er sich als Marxist verbeten. In einer Hinsicht wirkte er, verglichen auch mit anderen Emigranten, sehr undeutsch: er analysierte auch den Krieg, den Hitler ausgelöst hatte, nie in nationalen Kategorien. (Später einmal in Weißensee, nach seiner Meinung über bestimmte SED-Funktionäre befragt, wurde er unwillig: »Vergessen Sie nicht, Frisch, es sind Deutsche!« – Dieser Ton war eine seltene Ausnahme.) Was Brecht aus seiner Emigration mitbrachte, war Immunität gegenüber dem »Ausland«; weder ließ er sich imponieren dadurch, daß andere Leute andere Bräuche haben, noch mußte er sich deswegen behaupten als Deutscher. Sein Zorn galt einem gesellschaftlichen System, seine Achtung einem andern; die Weltbürger-Allüre, die immer eine nationale Befangenheit kompensiert, erübrigt sich. Ein Augsburger mit Berlin als Arbeitsplatz, ein Sprachgebundener, Herkunft nicht als Wappen, aber als unvertauschbare Bedingtheit: die selbstverständliche Anerkennung dieser Bedingtheit; Dünkel wie Selbsthaß, national-kollektiv, erweisen sich dann als Relikte, nicht der Rede wert.
23. 4. 1948: erstes öffentliches Auftreten von Bertolt Brecht in Zürich, es blieb das einzige. In einem kleinen Keller, Antiquariat der Volkshaus-Buchhandlung, sitzen hundert oder hundertzwanzig Leute eingepfercht zwischen Bücherwänden; die Buchhändlerin veranstaltet ab und zu solche Lesungen. Brecht hört sich gehorsam meine kleine Begrüßung an, dankt mit höflichem Nicken, setzt sich an den kleinen Tisch, ohne sich auszubreiten, eher hilfsbedürftig, ohne die Zuhörer anzublicken, Brecht mit Brille und mit einem Blatt in der Hand. Ob der Titel, den er rasch genannt hat, in den hinteren Reihen verstanden worden ist, scheint fraglich. Bedrängt von der Nähe der Zuhörer – die vordersten könnten ihre Arme auf den kleinen Tisch legen, was sie natürlich nicht tun, sie sitzen mit verschränkten Armen – verliest er halblaut das Gedicht an die Nachgeborenen, erhebt sich dann flink, das Blatt in der Hand, nein, drei Blätter, und tritt zur Seite, wo es dunkel ist. Weg mit seiner Person! Es lesen Therese Giehse und Helene Weigel, die großen Könnerinnen, und man vergißt, daß Brecht zugegen ist. Nachher, oben in der Buchhandlung, gibt es wenig von Brecht; vieles ist noch ungedruckt. Einige von den Zuhörern, als sie ihre Mäntel nehmen, mustern den grauen Mann aus Distanz; Brecht wird nicht bedrängt. Später sitzt man als kleines Grüppchen bei einem Bier: Brecht, Weigel, Giehse, die dankbare Buchhändlerin, die für die Lesung nicht viel zahlen kann, das Übliche, hundert Franken; Brecht scheint ganz zufrieden.
Einmal als ich wieder nach Herrliberg kam, saßen zwei Brecht in der Diele, beide mit demselben Haarschnitt und in derselben grauen Leinenjacke, einer davon etwas hagerer und linkisch, kollegial-geniert, der andere war Paul Dessau. Caspar Neher war öfter da. Dann war Brecht locker, beinahe gemütlich, anders als sonst; Brecht war vergnügt.
Brecht in Gesellschaft von Leuten, die er nicht näher kannte – meistens waren es jüngere Leute, und man traf sich in einer Wohnung, selten in einem Restaurant, wo Unbefugte hätten zuhören können – liebte es, einer der Stilleren zu sein, derjenige, der sich vor allem erkundigt: Schwerpunkt der kleinen Gesellschaft, aber nicht Mittelpunkt, ungefeiert, im Mittelpunkt war immer ein Thema. Ich erinnere mich kaum, daß Brecht erzählte. Er gab ungern Rohstoff. Er breitete nicht aus, verkürzte wenn möglich auf Anekdote hin, die, wenn auch vielleicht zum ersten Mal erzählt, immer etwas Fertiges hatte. Nur selten hatte er ein Bedürfnis zu schildern. Daß Brecht fabulierte, sich in Erfindungen gehen ließ, einen Einfall vergeudete aufs Geratewohl oder vor Ulk überbordete, habe ich nie erlebt; aber was die Fabulierer dann nicht können, das konnte er: zuhören auf eine aufmunternde, ungeizige Art, sofern etwas berichtet wurde; er brauchte nichts zu sagen oder fast nichts: seine Kritik an den Vorfällen übertrug sich auf den Erzählenden. Mehr als dem Debatteur erlag man dem Zuhörer Brecht.
Einmal besichtigten wir Siedlungen für die Arbeiterschaft, Krankenhäuser, Schulhäuser etc. Der Herr vom Bauamt, das ich um die offizielle Gefälligkeit gebeten hatte, ein Adjunkt, der uns mit einem amtlichen Wagen an alle Ränder der Stadt fuhr, verstand die Fragen des Gastes nicht, erläuterte von Siedlung zu Siedlung dasselbe, während Brecht, anfänglich verwundert über soviel Komfort für die Arbeiterschaft, sich mehr und mehr belästigt fühlte durch eben diesen Komfort, der Grundfragen nicht zu lösen gedenkt; plötzlich, in einem properen Neubau, fand er sämtliche Zimmer zu klein, viel zu klein, menschenunwürdig, und in einer Küche, wo nichts fehlte und alles glänzte, brach er ungeduldig die Besichtigungsfahrt ab, wollte mit der nächsten Bahn an die Arbeit, zornig, daß eine Arbeiterschaft auf diesen Schwindel hineinfällt; noch hoffte er, das sei nur in dieser Schweiz möglich, Sozialismus zu ersticken durch Komfort für alle.
Brecht muß ein manischer Aufschreiber gewesen sein, machte aber nie diesen Eindruck. Das Gefühl, als Besucher unterbreche man ihn, hatte ich nie; er machte einen Sessel frei, von Papieren oder Büchern, wechselte sofort vom Schreiber zum Zuhörer, zum Frager, wobei er sofort auch den Gegenstand seines Interesses wechselte. Kein Wort von seiner Arbeit; die war ausgeschaltet. Verließ man ihn nach zwei oder drei Stunden, wirkte er wach wie vorher; es kam nie zum Ausleiern eines Abends. Ob er danach arbeitete, weiß ich natürlich nicht; ich stelle ihn mir vor wie Galilei: nicht emsig, nur immer gegenwärtig, jederzeit anfällig für Entdeckungen. Eigentlich hätte zu ihm ein Stehpult gepaßt. Ich kann mir nicht denken, daß Brecht, ob er über dem Kleinen Organon oder über den Antigone-Versen sitzt, wie vor einem Mauseloch lauert; eher so: er pflückt, er erledigt, er merkt vor, er hält fest, er probiert, immer locker durch den Wechsel. Anders wäre die Fülle seines Nachlasses kaum zu begreifen, die ihm übrigens, wie es scheint, nicht recht bewußt war: Peter Suhrkamp erzählte einmal, wie Brecht, als sie die Satzproben zu den Stück-Bänden besprachen, auf einen größeren Schriftgrad drängte, damit, wie Brecht meinte, sein Werk doch eine gewisse Ausdehnung bekäme, wenigstens fünf Bände sollten es schon sein.
Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration, ich las das Gedicht in den Kriegsjahren auf der Straße, wie man Tagesmeldungen liest, stehend; die Kohlepapierkopie fast unleserlich, man bekam sie mit dem Auftrag, weitere Kopien herzustellen und die Gedichte weiterzuleiten; in meinem Atelier (ich hatte zwei Zeichner, keine Sekretärin) tippte ich mit acht Durchschlägen:
»Denn man muß dem Weisen
seine Weisheit erst entreißen,
Drum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.«
Es gehört zu den Erinnerungen, die man sich selber ungern glaubt: da saß ich in der Herrliberg-Wohnung mindestens einmal in der Woche, aber der Gedanke, Brecht etwas abzuverlangen, kam mir nicht, auch als Helene Weigel einmal verriet, was der Überseekoffer dort in der Ecke enthielte. Brecht war 51, der Meister, wie kollegial er sich auch verhielt, und dem Jüngeren fiel nicht ein, daß es ihn vielleicht freuen könnte, wenn man etwas verlangte aus dem Gepäck, das heute als Klassiker-Ausgabe ein ganzes Gestell füllt. Er arbeitete damals am Kleinen Organon unter anderem. Auch das hätte ihm der Jüngere nicht abverlangt, wenn Brecht es nicht eines Tages von sich aus gegeben hätte: wie eine Hausaufgabe. Er möchte wissen, sagte er, ob das verständlich werde. Natürlich las ich es noch in der Nacht, aber meldete mich Tage lang nicht; als ich das Manuskript gelegentlich zurückbrachte, glaubte ich noch immer nicht recht, daß Brecht auf mein Urteil wartete, und legte das Manuskript auf den Tisch, dankend, von anderem redend, schamlos genug: ich überließ es Brecht, das Gespräch darauf zu bringen. Das war wieder einmal draußen auf dem Kiesklebedach; die Weigel kochte, Brecht fragte, während wir hin und her gingen auf der Terrasse, Brecht äußerst aufmerksam, unverdrossen-aufmerksam, interessiert noch an meinen Mißverständnissen, bereit zu prüfen, ob das am Leser liege oder am Text. Es blieb meine einzige Manuskript-Lektüre. Hingegen hielt es der Anfänger für selbstverständlich, daß der Meister abverlangte, auch selbstverständlich, daß er nicht das nächste Wiedersehen abwartete, sondern sich an die Schreibmaschine setzte und sofort antwortete.
Eine Zeitlang bedrängte mich Brecht, ich solle als Schweizer endlich ein Tell-Stück schreiben. Zu zeigen wäre, daß der Bauernaufstand der Vierwaldstätte zwar erfolgreich war, aber reaktionär gegenüber der Habsburg-Utopie, eine Verschwörung von Querköpfen. Aber das müsse schon ein Schweizer schreiben. Die These, die er vom Theatralischen her verlockend machte, ist der geschichtlichen Wahrheit zumindest näher als der Hymnus, den wir Friedrich Schiller mit dem Rütli-Denkmal gedankt haben, nur schien sie mir allzu beliebig verwendbar als Legitimation heutiger Vögte. Ich wußte nie, ob Brecht, wenn er pfiffig war, seine Pfiffigkeit für undurchschaubar hielt. Ein andermal: Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes, das wäre ein landsmännischer Stoff für mich, ein Schimpfer großen Stils, ein Wohltäter, der von allen Seiten bekämpft wird und siegt, und dann sein Werk mißbraucht sieht. Schließlich ein letzter Vorschlag: die Celestina von De Roja einzurichten für die Giehse, Brecht bot sich als Verfasser der Songs an, die ich da und dort brauchen würde. Ich saß in einem öffentlichen Park mit dem geliehenen Buch, das er bereits mit Zeichen gespickt hatte, mit Titeln für fällige Songs. Es war verlockend. Ich bekam es mit der Angst. Brecht, wenn man sich einließ, baute jeden um.
Etwas in der Denkart von Brecht, sowohl im Gespräch wie in den theoretischen Schriften, machte den Eindruck: Das ist nicht er, das ist seine Therapie. Drum sind Brechtianer gefährdet: sie perfektionieren die Therapie gegen ein Genie, das sie nicht haben.
Was er offenkundig nicht leiden konnte: wenn jemand meinte schmeicheln zu müssen. Ein Schauspieler, der es bei Tisch versuchte, bekam für den Rest des Abends keine Antwort und keine Frage mehr. Ein zu dummer Mensch, Brecht legte es nie darauf an, daß sich jemand als Brecht-Kenner ausweisen mußte; Lob machte ihn unwirsch, Lob als Ersatz für Einsicht.
Einmal am See, als ein Gewitter heraufzog, sah ich ihn sehr ängstlich; als ich den einheimischen Wetterkenner spielte und versicherte, daß wir rechtzeitig unter Dach kommen würden, zuckte er die Schulter: »Ich möchte nicht von einem Blitz getroffen werden«, sagte er, »das würde ich dem Papst nicht gönnen.« Er war wirklich nervös.
Die erste Brecht-Regie (zusammen mit Caspar Neher) hatte fast unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattgefunden: in Chur, Februar 1948. In Zürich sahen wir die Antigone, gespielt von Helene Weigel, nur in einer Matinee, die einmalig war und nicht ausverkauft; Hauptsache für Brecht, daß er hatte probieren können. Er hatte keine come-back-Eile. Ob Chur oder Zürich, Brecht probierte für Berlin. Das Stück, das er dem Zürcher Schauspielhaus zur Uraufführung überließ, war ein vergleichsweise harmloses, Herr Puntila und sein Knecht Matti, geschrieben in Finnland vor langer Zeit, und daß er aus fremdenpolizeilichen Gründen nicht für die Regie zeichnen konnte, war ihm nicht unangenehm. Das alles waren Vorbereitungen, je unauffälliger um so lieber. Während der Proben blieb er im Hintergrund. Ab und zu ein Tip: Eine junge begabte Schauspielerin, Tochter aus reichem Haus, sollte da eine kleine Magd spielen mit einem Wäschebottich. Als Brecht kicherte, wußte sie nicht, was sie verkehrt machte. Sie trug ein Requisit, das kein Gewicht hat. Höflich, nicht ohne die begabte Bürgertochter im übrigen zu loben, verlangte er bloß, daß bei jeder folgenden Probe ein Klumpen nasser Wäsche in dem Bottich sei, nichts weiter. Nach drei Wochen sagte er: Sehen Sie! Ihre Hüften hatten kapiert … Brecht auf der Bühne: immer etwas geniert, als gehörte er da nicht hin; trotzdem sah man die besondere Geste, die er wünschte und die er nicht vormachen konnte, die er eher parodierte. Er konnte unschlüssig sein. Was heute nicht geht, vielleicht geht's morgen oder übermorgen, wenn man sich heute nicht abfindet, wenn man die Unbefriedigtheit aushält und nicht vorgibt zu wissen, wie und ob es jemals gehen wird. Er berief sich nicht auf Theorie, sondern schaute und reagierte; der Eindruck hatte den Vorrang; freilich wußte Brecht, was er abbilden wollte, und erlag nicht dem Beliebig-Eindrucksvollen. Er brauchte auf Proben (jedenfalls in Zürich, wo er großenteils mit »unpolitischen« Schauspielern zu tun hatte) nie eine politische Vokabel, um zu argumentieren; wenn Matti, der Knecht, sich die Landschaft ansehen muß unter der Begeisterung des Puntila, des Großgrundbesitzers, war die Geste und Mimik der Indifferenz, die den Knecht schweigen läßt, einfach »schöner«, »lustiger«, »natürlicher«, so wie es sofort viel »schöner« ist, wenn die Magd, mit dem Wäschebottich, trotz ihrer strammen Jugend nicht allzu aufrecht (wie eine Tennis-Spielerin etwa) einhergeht. Lauter Geschmacksfragen! Ich fand eine Szene ziemlich ordinär. Brecht: Nanu? Meine Begeisterung über anderes schob er beiseite: »Was finden Sie dann daran ordinär?« Nun wußte ich es nicht. »Wir treffen uns nachher«, sagte er, »überlegen Sie es sich!« Es zeigte sich, als man genau darüber redete, das Unbewußt-Politische meines Geschmackes; Brecht lachte: »Sie wollen, daß Puntila sich wie ein Herr benimmt, aber das tut er ja, gerade wenn er ordinär wird.« In den Proben waren Schauspieler oft verdutzt, daß da plötzlich einer hellauf lachte im hinteren Parkett: Brecht.
Plötzlich, bei einem nächsten Zusammentreffen, hatte er wieder das Häftlingsgesicht: die klein-runden Augen irgendwo im flachen Gesicht vogelhaft auf einem zu nackten Hals. Dabei konnte er grad sehr munter sein. Ein erschreckendes Gesicht: vielleicht abstoßend, wenn man Brecht nicht schon kannte. Die Mütze, die Joppe: wie von dem prallen Dessau entliehen; nur die Zigarre steckte authentisch. Ein Lagerinsasse mit Zigarre. Man hätte ihm ein dickes Halstuch schenken mögen. Sein Mund fast lippenlos. Er war sauber, nur unrasiert; kein Clochard: kein Villon. Nur grau. Sein Haarschnitt wirkte dann wie eine Maßnahme gegen Verlausung oder wie eine Schändung, die ihm angetan worden ist. Sein Gang: da fehlten Schultern. Sein Kopf erschien klein. Nichts von Kardinal, aber auch nichts von Arbeiter. Überhaupt sah Brecht nie wie ein Arbeiter aus, das wäre ein Mißverständnis seiner Tracht; eher so, wie Caspar Neher etwa einen Handwerker stilisieren würde, Tischler vielleicht: mit einem Kopf, daß die Römische Kirche nur in ihren Fundus hätte greifen müssen, um einen sehenswerten Kardinal zu haben. Jetzt aber, wie gesagt, war da nichts vom Kardinal, und man ging neben einem Brecht, der einen verlegen machte wie ein Beschädigter. Er klagte über nichts, im Gegenteil, er rühmte die Giehse. Wir saßen im Café Ost, das es heute nicht mehr gibt, gegenüber einem leeren Stammtisch mit studentischem Couleur-Firlefanz. Was macht einen Schauspieler aus? Man überlegte, als habe Brecht nie eine Zeile darüber geschrieben. Er hatte Zeit, Lust zu sprechen, im Gespräch war er wach und lebhaft, alles andere als ein Geschädigter, denklustig. Erst draußen auf der Straße ging er wieder wie einer, der unser Mitleid erweckt, wie ein Geschundener, die graue Schirmmütze in die Stirne gezogen. Vor allem der Hals: so nackt. Er ging geschwind, aber die Arme machten nicht mit. Die graue Farmer-Jacke: als habe man ihn aus Beständen einer Anstalt eingekleidet, und nur das Bündel von Schreibstiften, die er immer in der oberen Tasche trug, war privat, die Zigarre unerläßlich, sonst wußte er nicht, wohin mit den Händen, und schob sie dann wie etwas Entblößtes flach in die Rocktaschen.
5. 6. 1948, Puntila-Uraufführung in Zürich: das Publikum jubelte nicht. Brecht hingegen war zufrieden. »Solche Stücke muß man immer und immer wieder spielen, bis sie sich dran gewöhnen«, sagte er, »wie sie sich an Schiller gewöhnt haben. Das braucht einige Jahre.« Infolgedessen redete er wie nach einer Probe.
Nur ein einziges Mal sah ich Brecht zusammen mit einem Vertreter der Bourgeoisie; der Stadtbaumeister ließ es sich nicht nehmen, zu einem kleinen Mittagessen einzuladen an einem Ort, wo man auf Zürich schaut – Brecht, statt das erwartete Lob auf Zürich auszusprechen, fragte mich, ob ich New York kenne. Ich müsse es sehen, es lohne sich, aber ich dürfe nicht zu lang warten, wer weiß, wie lang New York noch steht … Der Stadtbaumeister machte keine Konversation mehr.
Die Ideologie-Diskussion, in der ersten Zeit unumgänglich, hörte nach und nach auf – nicht wegen meines Widerspruchs, sondern weil ich ihm zu ungeschult war, und Brecht hatte andere Aufgaben als mich zu schulen; er ließ sich lieber auf meine Baustelle führen und Konstruktionen erklären, Probleme der Architektur, auch Schlichteres: die Organisation einer größeren Baustelle. Fachkenntnisse, vor allem wenn sie sich in Betätigung zeigten, erfüllten ihn mit Respekt. Ruth Berlau war dabei, als Frau bald gelangweilt, während Brecht pflichtschuldig, wenn auch ängstlich, Gerüst um Gerüst erstieg, schließlich sogar einen Zehnmeter-Sprungturm, wo man das Areal am besten überblicken konnte; hier oben war er allerdings für Erläuterungen nicht zu haben, nur für Respekt: Alle Achtung, Frisch, alle Achtung! und als Ruth Berlau, die Kamera vor dem Gesicht, auch noch wünschte, daß Brecht weiter hinaustrete auf die Plattform, weigerte er sich; erst unten war er für Statik-Unterricht empfänglich. »Sie haben einen ehrlichen Beruf.« Sein Gruß, wenn man sich verabschiedete, war manchmal flüchtig, nie herablassend, aber kurz und leicht; jetzt, nach der Besichtigung meiner Baustelle, war er sehr ausdrücklich: kollegial.
August 1948, als wir die Grenze bei Kreuzlingen-Konstanz passierten, war Brecht fünfzehn Jahre nicht mehr auf deutschem Territorium gewesen. Es war auch nur ein Ausflug für einen Abend. Der äußere Anlaß, für Brecht ein willkommener Vorwand, war eine Aufführung bei Heinz Hilpert, Deutsches Theater in Konstanz, von meinem ersten Stück, das ich lieber nicht wiedergesehen hätte. (Im November desselben Jahres, später also, reiste Brecht nach Berlin über Prag und kehrte dann nochmals für einige Monate nach Zürich zurück, bevor er sich 1949 endgültig in Ost-Berlin niederließ.) Ein Zürcher Bühnenarbeiter, der einen alten Lancia besaß, fuhr uns bis zum Schlagbaum. Brecht: »Gehen wir zu Fuß!« Die Kontrolle der Pässe, damals noch immer als sanfte Sensation empfunden, verlief reibungslos. Brecht betontermaßen unberührt. Wir gingen also zu Fuß in das Städtchen, ein schon sehr deutsches Städtchen, unzerstört mit Schildern »Speisewirtschaft« in Fraktur. Nach hundert Metern, mitten in einem Gespräch über irgend etwas, blieb Brecht stehen, um die Zigarre, die offenbar ausgegangen war, wieder anzuzünden, Blick zum Himmel: »Der Himmel ist hier nicht anders!«, dazu jene unwillkürliche Geste, die öfter vorkam: er schob den hageren Hals im weiten Kragen hin und her, ein Zucken, das ihn lockerte. Später die Begrüßung bei Heinz Hilpert und seinen Getreuen; Überschwang machte Brecht immer linkisch, er hielt sich an ein Bier, während ein junger Schauspieler (er hatte schon von der Dreigroschenoper gehört) das Unternehmen in Konstanz zu lobpreisen nicht ermüdete; Brecht staunte: über das Vokabular, das ihn stumm machte. Nach der Aufführung verbreitete sich Brecht über deutsches Bier, das nach wie vor das beste Bier sei; kurz darauf: Gehen wir! Er schwieg sich aus, bis man wieder in Kreuzlingen war; eine Bemerkung von Wilfried Seifert, der uns begleitete, brachte ihn plötzlich zum Bersten. Er begann mit einem kalten Kichern, dann schrie er, bleich vor Wut; Seifert verstand nicht, was mit Brecht los war. Das Vokabular dieser Überlebenden, wie unbelastet sie auch sein mochten, ihr Gehaben auf der Bühne, ihre wohlgemute Ahnungslosigkeit, die Unverschämtheit, daß sie einfach weitermachten, als wären bloß ihre Häuser zerstört, ihre Kunstseligkeit, ihr voreiliger Friede mit dem eigenen Land, all dies war schlimmer als befürchtet; Brecht war konsterniert, seine Rede ein großer Fluch. Ich hatte ihn noch nie so gehört, so unmittelbar wie bei dieser Kampfansage in einer mitternächtlichen verschlafenen Wirtschaft nach seinem ersten Besuch auf deutschem Boden. Plötzlich drängte er zur Rückfahrt, als habe er Eile: »Hier muß man ja wieder ganz von vorne anfangen.«
»Nehmen Sie dieses Foto nach Polen mit«, sagte er, »wahrscheinlich treffen Sie auch Leute von der Regierung, fragen Sie, ob das stimmt.« Er gab mir eine Illustrierte, die nicht eigentlich berichtete, immerhin Bilder zeigte, so daß man vermuten mußte: Mißhandlungen in Schlesien, KZ-Zustände. »Fragen Sie überall, ob das stimmt!« verlangte Brecht, und ich konnte mir nicht vorstellen, daß Leute von der Regierung beispielsweise bei einem Bankett sich einlassen auf diese Illustrierten-Anklage; Brecht: »Fragen kann man immer.« Es war sein Ernst. »Wenn es in Polen diese Zustände gibt«, sagte Brecht, »so muß etwas unternommen werden.« Als ich von Polen zurückkam, war er begierig zu hören, rief an, sobald er von meiner Rückkehr wußte. Ich radelte also nach Herrliberg mit viel Stoff: Breslau, heute Wroclav, Congrès International des Intellectuels pour la Paix, Warschau. Ich erwartete ein schwieriges Gespräch. Was ich zu berichten wußte, war zwiespältig, Brecht voll Erwartung. Grüße von Anna Seghers. Allein mit Brecht, der die Ostblock-Länder noch nicht aus eigner Anschauung kannte, erzählte ich einfach drauflos. Fragwürdiges, Erfreuliches, Bedrückendes, Undurchsichtiges. Ich lieferte das Konkrete. Eindrücke von einer Fahrt durch Schlesien; Gespräch mit einem polnischen Bauern, der tadellos Deutsch redete: Knecht in Ostpreußen, wo er lernte und soviel ersparte, daß er zu einem eigenen Hof in Ostpolen kam, Krieg, von den Russen aus seiner Heimat vertrieben, jetzt angesiedelt auf schlesischem Boden; eine Lebensgeschichte. Brecht war ein offener Zuhörer, was die Berichterstattung erleichterte; ich sah ihn bestürzt oder erfreut je nachdem, alles in allem eher bekümmert. Die Art, wie Fadejew und der brillante Ehrenburg manövrierten, verdroß ihn: »Wenn man schon einen Kongreß macht, dürfte das nicht vorkommen.« Ab und zu rief er die Weigel, aber wir blieben allein, Brecht aufgewühlt, oft stumm, unverhohlen betroffen, weit davon entfernt, das Mißliche zu bestreiten. Einmal sein Vorwurf, daß ich beim Staatsempfang, wo hunderte von Intellektuellen sich um ein Buffet sammelten, nicht rundheraus gewisse Fragen gestellt habe. Was ich an beginnendem Aufbau und Planung in Warschau (das Projekt wurde nach dem Sturz von Gomulka annulliert) gesehen hatte oder was man in Kellerkneipen unter Ruinen, abseits vom offiziellen Optimismus, an lebensfrohen und unmittelbaren und glücklichen Menschen erleben konnte, berichtete ich gern; Brecht nahm es als Beweis, daß ich nicht polemisierte, und verbuchte das Negative, das auch in seiner Ansicht negativ war, um so ernster. »So geht das ja nicht«, sagte er mehrmals, »das muß geändert werden.« Später setzte sich Helene Weigel dazu, ich sollte weiter berichten, teilweise wiederholen; es ging nicht mehr. Nicht nur die Weigel hatte auf alles, was der Augenzeuge meldete, die gebrauchsfertige Auslegung in maßregelndem Ton; auch Brecht war wie verwandelt jetzt, plötzlich ungehalten nicht über Fadejew, sondern über mich. Ich saß in einer Prüfung, um durchzufallen. Unterrichtet darüber, was in Polen vorging, nahm ich mein Fahrrad.
Sicher ist Herzlichkeit nicht das erste, was auffiel an diesem Mann, der Rohstoff ungern preisgab, und Gefühle sind Rohstoff. Wärme in Worten, das war in seiner Gegenwart auch dem Partner nicht möglich; daß Brecht im persönlichen Umgang sich eines nahezu gleichen Vokabulars bediente für Duldung oder Achtung oder Zuneigung, gab ihm vorerst etwas Instanzhaftes. Seine Gestik (ich komme immer wieder auf seine Gestik: dabei war sie sehr knapp, manchmal fast mechanisch-stereotyp) leistete vor allem Parodie. Was mußte da immer wieder parodiert werden? Brecht muß die Sentimentalität sehr gekannt haben, und was nur von ferne hätte ein Gefälle dahin haben können, verbannte er. Seine Höflichkeit, die sich nicht in Floskeln ausdrückte, sondern im Verhalten bei der Begrüßung oder bei Tisch, eine graziöse Höflichkeit war das einzige, was er als Ausdruck der Zuneigung zuließ. Gemütlichkeit torpedierte er sofort, und wenn nötig, ziemlich grob. Er fühlte sich sichtlich nicht wohl. Nur im Gedicht, also unter artistischer Kontrolle, war gestattet, was Brecht sonst durch Witz und Gestik isolierte: Gefühle. Brecht war schamhaft. Waren Frauen zugegen, zeigte Brecht, im Gegensatz zu den meisten Männern, keinerlei Veränderung, keine Imponier-Geste; Frauen in Gesellschaft waren Genossen, somit neutralisiert, oder sie waren Gänse, die, als solche erkannt und behandelt, das Gespräch nicht lange störten. Dann zeigte Brecht mehr als sonst und so, daß man sich wunderte, Herzlichkeit gegenüber Männern.
Frühling 1950, Berlin: Der Hofmeister, Tragikomödie von Lenz in der Bearbeitung des Berliner Ensembles, zum ersten Mal der Vorhang mit der weißen Picasso-Taube, nachher Brecht draußen auf dem Platz vor dem Deutschen Theater, ohne Aura. Es freute ihn offensichtlich, daß man nach Berlin kam, um die Arbeit des Ensembles zu sehen. Kein berühmter Schauspieler, ein paar Bekannte aus Zürich: Hans Gaugler, Regina Lutz, Benno Besson. Es war wie ein Schock: zum ersten Mal sehe ich, was Theater ist. Bestätigung seiner Theorie? Man vergaß sie, indem ihr Versprechen eingelöst wurde – wahrscheinlich sehr unvollkommen, verglichen mit den späteren Produktionen des Berliner Ensembles oder des Piccolo Teatro in Mailand, die heute in Gefahr sind steril zu werden … Brecht wirkte jünger als sonst. Er schlug vor, daß ich in Weißensee schlafe, er wollte Diskussion; nur war da noch eine gesellige Mai-Feier im Theater, eine Anstandspflicht. Keine Kundgebung; diese hatte tagsüber in den Straßen stattgefunden. Jetzt wurde getanzt, Geselligkeit mit betontem Verzicht auf Krawatte; alle zeigten etwas Entschlossen-Wohlgelauntes, Stimmung mit Gutscheinen, die man an einem Buffet einlösen konnte. Die Frage: Wie gefällt's Ihnen hier? machte mich etwas verlegen. Wolfgang Langhoff, auch ein alter Bekannter aus Zürich, grüßte mißtrauisch; ich sah mich, ob ich wollte oder nicht, in der Rolle eines Westlers, der die Ost-Zone beschnüffelt mit der verstohlenen Gier, Unfreiheit und Armut und Trostlosigkeit festzustellen. Ich fühlte mich nicht wohl. Brecht war anwesend, wie es sich gehörte, im übrigen unauffällig. Begeistert von der Aufführung, die ich eben gesehen hatte, verfiel ich doch einem öden Unbehagen an dieser Feier; selbst das Buffet (ich hatte Hunger) schien unterrichten zu wollen, wie hier gelebt wird, und wie alles einander grüßte: Welche Kameradschaft! Alles hatte eine leichte Nötigung, und wenn man sich ihr verweigerte, spürte man das krasse Mißverständnis, das die Nötigung verschärfte, alles positiv zu sehen; schon Schweigen wirkte feindselig. Helene Weigel, festlich-liebenswürdig, holte den Außenseiter zu einem Tanz; ich war schon nicht mehr zu retten: alles erschien mir jetzt demonstrativ, also verdächtig. Draußen über schwarzen Ruinen fand ein Feuerwerk statt; jetzt stellte Brecht sich wie alle an ein Fenster, wartete auf das knallende Schluß-Bukett, rauchend, kurz darauf kam er: »Wir können gehen, Frisch, oder möchten Sie noch bleiben?« Nach unauffälligem Abgang, jetzt wieder draußen auf der finsteren Straße, redete er über Fachliches. Die Ruinen waren nicht aktuell, nichts Nebensächlicheres als Ruinen. Brecht war in bester Verfassung: elastisch, leicht.
Das Gerücht, daß Brecht, von den Russen in einen Palast gesetzt, wie ein Großfürst hause inmitten der Armut von Ost-Berlin und daß die Weigel kostbare Antiquitäten aus der armen Zone käuflich erbeutet habe, fand ich, wie erwartet, nicht bestätigt. Eine Villa wie tausend andere in Berlin: unzerstört, nur etwas vernachlässigt in einem verlotterten Garten, geräumig und, wenn ich mich richtig erinnere, fast teppichlos. Ein schöner alter Schrank, ein paar Möbel bäuerlichen Stils, alles in allem wenig, Provisorisches wie immer um Brecht. Ich schlief in einer Dachkammer, ehedem Dienstmädchenzimmer; Wände voll marxistischer Klassiker. Am anderen Morgen: Brecht schon an der Arbeit, aber er hat Zeit; fünf Minuten steht er mit dem Gast, der den Weißensee noch nie gesehen hat, unten am Weißensee, dann lieber im Arbeitszimmer als unter dem Mai-Grün einer Weide. Selbstkastration des Hofmeisters: als dramaturgisches Problem. Mein Eindruck, daß man in Weißensee etwas anders redete als in Herrliberg, wäre kaum zu belegen; trotzdem hatte ich damals diesen Eindruck. »Es müssen jetzt Stücke geschrieben werden von Leuten, die die Sorgen dieses Staates aus Erfahrung kennen«, sagte Brecht, »das kann einer nicht von drüben.« Es gab, wenn auch noch ohne Mauer, ein Hier und ein Drüben. Zugleich lag ihm sehr daran, daß kein Boykott entstehe; ich sollte mit Barlog sprechen wegen eines Schauspielers, der, da er bei Brecht spielte, drüben Schwierigkeiten bekam. Im übrigen erinnere ich mich nicht mehr an das lange Gespräch, aber daran: wie Brecht den hochbürgerlichen Grundriß dieser Villa umfunktionierte, ohne sie etwa umzubauen, mühelos; er brauchte sich nicht im mindesten zu wehren gegen die Architektur, Brecht war stärker, und es wirkte nicht wie Beschlagnahme, nicht einmal wie Besitzwechsel; die Frage, wem die Villa gehörte, stellte sich nicht, Brecht benutzte sie, wie der Lebende immer Bauten der Ausgestorbenen benutzt, Lauf der Geschichte. Später fuhr man ins Theater; Brecht mit Schirmmütze und Zigarre am Steuer eines alten offenen Wagens, Spruchbänder der gestrigen Mai-Feier in verkehrslosen Straßen, ringsum Ruinen unter dem dünnen Berlin-Himmel, Brecht heiter: »Wann kommen Sie hieher?«
Ein andermal in Weißensee: »Man hat Ihnen Formalismus vorgeworfen. Was verstehen die Leute, die diese Anklage erheben, unter Formalismus?« Brecht versuchte es mit der leichten Schulter: »Nichts.« Es verdrießt ihn, daß ich genauer frage; er lehnt sich in seinen Arbeitssessel, raucht, gibt sich sorglos-belustigt: »Formalismus heißt, ich gefalle gewissen Leuten nicht.« Was ihn verdrießt, verrät der ungehaltene Nachsatz: »Im Westen hätten sie wahrscheinlich ein anderes Wort dafür.« Dann spricht man über anderes, und später erst, als ich dazu nichts mehr erwartete, in einem anderen Zusammenhang, kommt die eigentliche Antwort leichthin: »Daß wir für die Schublade arbeiten, sehen Sie, das lernte man in der Emigration. Vielleicht kommt eine Zeit, wo man unsere Arbeit ausgräbt und brauchen kann.«
Ich bin nur wenigen Menschen begegnet, die man als große Menschen erkennt, und befragt, wie sich die Größe von Brecht nun eigentlich mitgeteilt habe, wäre ich verlegen: eigentlich war es jedesmal dasselbe: kaum hatte man ihn verlassen, wurde Brecht um so gegenwärtiger, seine Größe wirkte hinterher, immer etwas verspätet wie ein Echo, und man mußte ihn wiedersehen, um sie auszuhalten, dann nämlich half er durch Unscheinbarkeit.
Über das Verhalten von Brecht während des 17. Juni 1953 befragte ich später zwei Ensemble-Leute, Egon Monk und Benno Besson. Hat Brecht am Vormittag, als die ersten Meldungen von der Stalin-Allee kamen, eine Rede gehalten vor seinen Mitarbeitern? Was feststeht: die Proben (Der Zerbrochene Krug und Don Juan) wurden abgebrochen. Wohin hat Brecht sich im Lauf des Tages begeben? Wie hat er die Ereignisse, so weit sie ihm zur Kenntnis kamen, beurteilt: als Kundgebung der Arbeiterschaft, deren Unzufriedenheit er für berechtigt hielt, oder als Meuterei? Welche Informationen hatte Brecht? Argwöhnte er, daß der Westen sich den Volksaufstand, der ohne Führung war, zu Nutzen machen könnte und daß es zum Krieg kommt? Hatte er eine Möglichkeit einzugreifen? Welche? War Brecht hin und her gerissen? gleichmütig? kopflos? untätig? Verlangte er von seinen Mitarbeitern, wie sie sich zu verhalten haben? War Brecht (wie das Gerede es schon damals darstellte) feige, ein Verräter gegenüber der Arbeiterschaft? Oder war er verzweifelt, daß die Arbeiterschaft sich durch romantisches Vorgehen selbst gefährdete? War Brecht empört über das Eingreifen der sowjetischen Tanks oder hielt er es für unerläßlich, um den Westen vor Übergriffen zu warnen? – auch die beiden Ensemble-Leute, die ich befragte, lieferten mehr Auslegungen als Belege; ihre Auslegungen waren unvereinbar. Peter Suhrkamp verschickte Kopien des Brecht-Briefes an Ulbricht: die vollständige Fassung.
Mein letzter Besuch vor seinem Tod, September 1955, war ein kurzer und sogar etwas steifer Besuch an der Chaussee-Straße. Wohnung mit Blick auf den Friedhof. Ich war befangen; Benno Besson war gerade da, den ich persönlicher kannte als andere Ensemble-Leute, und es bestand damals ein Mißtrauen zwischen uns, das zu politischer Borniertheit führte. Wir hatten in letzter Zeit regelmäßig miteinander gestritten, Besson und ich, waren damals noch ganz und gar unversöhnt, und unsere Begrüßung, als ich bei Brecht eintrat, war entsprechend: auf Gegenseitigkeit blicklos. Ob Brecht davon wußte? Ich störte ein Arbeitsgespräch, man stand noch einige Minuten, Höflichkeit nötigte Brecht, daß er Besson, obschon Dringliches zu klären war, entließ mit einer Geste des Abbrechens. Allein mit Brecht, den ich lange nicht gesprochen hatte, blieb es etwas offiziell. Brecht: das Ensemble sei nun etabliert, so daß er es andern werde überlassen können. Es drängte ihn, so tönte es, zu schreiben. Er sah krank aus, grau, seine Bewegungen blieben sparsam. Ich kam von Proben in West-Berlin; Hanne Hiob, seine Tochter, spielte eine Hauptrolle, und Caspar Neher machte das Bühnenbild. Beim Mittagessen: Wie denkt man im Westen über die Kriegsgefahr? Man kam jetzt, wenn man aus dem Westen kam, von weither. Die übliche Frage: Und was arbeiten Sie? blieb aus. Helene Weigel war dabei; sie befragte mich darüber, wie ich mich denn zur Verfolgung von Konrad Farner in der Schweiz verhielte. Zeitweise aß man ziemlich wortlos. Keine Witze. Ich blieb befangen. Ein unoffenes Gespräch, eigentlich überhaupt keines; das Gefühl, daß ich das Unoffene verschuldete, war peinigend, nicht zu tilgen durch Berichte, wie es Suhrkamp ging, nämlich schlecht. Wiedervereinigung? Dazu Brecht: »Wiedervereinigung heißt noch einmal Emigration.«
Es bleibt rätselhaft, daß Brecht sich einen Stahlsarg verordnet hat. Wovor soll der Stahlsarg schützen: vor den Machthabern? vor der Auferstehung? vor dem »Aas mit vielem Aas«?
Es gibt einen Satz, der Brecht gerecht wird, obschon er nicht auf ihn geschrieben worden ist: »Trotz der Einseitigkeit seiner Lehre ist dieser märchenhafte Mensch unendlich vielseitig«, ein Satz von Maxim Gorki über Leo Tolstoj.
ZÜRICH
Mutter im Sterben. Zeitweise meint sie, daß wir zusammen in Rußland sind. Sie ist 90. Ob sich in Odessa viel verändert habe seit 1901.
Nachtrag zur Reise
In nächtlichem Zimmer zeigt jemand ein Papier, ein Formular mit russischer Schrift, ein graues und mürbes Blatt: auf der Rückseite bekritzelt von Rand zu Rand mit einer winzigen Handschrift, die nur mit der Lupe zu lesen sein dürfte. Eine Genossin wurde deportiert, sie erfuhr nie, warum. Nach einem Jahr im Lager bat sie um Einzelzelle, was schlimmer ist; Ratten. Ihre zweite Bitte: Papier. Beides wurde ihr schließlich gewährt. Sie bekam solche Formulare der Lager-Verwaltung und verbrachte drei Jahre in Einzelhaft. Sie übersetzte aus dem Gedächtnis: Don Juan von Lord Byron. Als sie damit zu Ende war, bat sie um Entlassung aus der Einzelhaft. Jetzt wieder im Sammellager und bei der Landarbeit trug sie das Manuskript am Leib versteckt. Nach insgesamt 8 Jahren (wenn ich richtig berichte) wurde sie als unschuldig entlassen. Ihre Übersetzung von Lord Byron wird jetzt, 1966, gedruckt und soll in einem großen Theater vorgetragen werden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ich habe Rubel, Honorar für den Abdruck eines Romans in der Zeitschrift Inostranja Litteratura, 900 Rubel. So viel verdient ein Arbeiter in einem halben Jahr. Ich kann nichts damit anfangen: Hotel und Flugreisen sind mit Dollar zu bezahlen. Und ausführen darf ich die Rubel auch nicht. So bleibt uns nur, Champansky zu trinken, Kaviar zu essen. In Odessa gibt es keinen. Ein Flug auf die Krim ist nicht möglich: erstens nicht mit meinen Rubel, zweitens haben wir keine Dollar mehr, drittens brauchten wir nochmals ein Visum aus Moskau. So vertreiben wir die Zeit (die schöne Potjomkin-Treppe kennen wir inzwischen; die Liebknecht-Kolchose, in einem bunten Prospekt als Vorbild angepriesen, ist nur mit Dollar-Taxi zu erreichen, und als dafür unsere Dollar gerade noch reichen, ist sie nicht zu besuchen wegen Klauenseuche, »einer Krankheit, die es auch im Westen gibt«) – so vertreiben wir uns die Zeit auf einem Fußballplatz, Karten durch Intourist