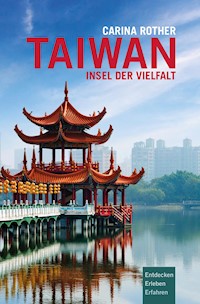
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Missionshilfe Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hightech-Insel, Corona-Vorbild, freiste Demokratie Asiens. Aber auch ein Ort, wo Geister besänftigt werden und Götter durch die Straßen ziehen: Taiwan, ein Land der Gegensätze. Die pazifische Insel strotzt nur so vor religiöser und spiritueller Vielfalt. Ihre Kultur vereint indigene Elemente, taiwanische Identität und chinesische Einflüsse. Heute steht sie vor der Bedrohung durch den übermächtigen Nachbarn China und kämpft um Anerkennung in der Welt. Begleiten Sie die Autorin auf eine Entdeckungsreise – durch das kulinarische, historische und politische Taiwan. Zu heißen Quellen und entlegenen Dörfern. Und vor allem: in daoistische, buddhistische und christliche Glaubenswelten – und damit in die Herzen der 23 Millionen Menschen, die Taiwan zu dem machen, was es ist: einzigartig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Taiwan
Insel der Vielfalt
Carina Rother
Alle Rechte vorbehalten.
Missionshilfe Verlag, Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg
[email protected], demh.de
Herausgeber: Evangelische Mission Weltweit e. V. (EMW)
Konzept und Lektorat: Tanja Stünckel und Corinna Waltz
Korrektorat: Hans-Hermann Stocklassa
Umschlaggestaltung und Illustrationen: Ari Gröbke, Hamburg, arigroebke.de
Satz und Druck: MHD Druck und Service GmbH, Hermannsburg, mhd-druck.de
ISBN Print: 978-3-946426-33-2
ISBN E-Pub: 978-3-946426-27-1
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über dnb.de abrufbar
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Nachtluft in Taipei
TEIL I: Reise durch Taiwan
Rund um die Insel
Vom Wiederkommen und Bleiben
TEIL II: Götter, Geister, Gegenwelten
Wohnungssuche mit Erdgottsegen
Taiwan, die Geisterinsel
Konfuzianismus: Liebe als Pflicht
Ein neues Jahr beginnt
Taiwan, Welt der Zeichen
Daoismus: Ein Tempel für alle Fälle
Mazu mag es laut
Buddhismus: Barmherzige Gelassenheit
TEIL III: Taiwans Kirchen
Die Wurzeln des Christentums
Christentum und indigener Glaube
Kirche in der Diktaturzeit
Eine politische Kirche
Homophobie in Taiwans Kirchen
Anker für neue Gemeinden
Schluss: Leben im Schatten der Bedrohung
Über die Autorin
Einleitung: Nachtluft in Taipei
Als ich das erste Mal Fuß auf taiwanischen Boden setzte, hatte ich nicht die leiseste Vorahnung, welch große Rolle die kleine Insel in meinem späteren Leben spielen sollte.
Es war ein Wintertag im Februar. Ich war Mitte zwanzig und gerade am Internationalen Flughafen Taoyuan gelandet. Angeschoben von den Massen, die sich aus dem Flieger ergossen, folgte ich den Schildern durch die weitläufigen, modernen Gänge zur Passkontrolle. Im Internet hatte es geheißen, dass ich als deutsche Staatsbürgerin visafrei nach Taiwan einreisen konnte. Ganz anders als meine Reiseerfahrung mit China, die stets mit monatelanger Vorbereitung, einem mehrseitigen Visaantrag und mehreren Besuchen bei der chinesischen Botschaft verbunden war. Und hier, in Taiwan, sollte ich nun einfach meinen Pass am Schalter vorzeigen und würde mit einem Stempel in die Freiheit der taiwanischen Luft entlassen werden. Was für ein ungewohnter Luxus.
An jenem Februartag kam ich gerade von einem Stopover in Peking. China und Chinesisch – der Inhalt meines Studiums – war in den letzten fünf Jahren auch zu meinem Lebensinhalt geworden. Taiwan war dabei ein Ort, der stets als Fußnote mitschwang, mir aber immer fremd geblieben war – eng verwoben mit der chinesischen Geschichte und doch ganz anders, ein Fach für sich, dieses zweite chinesischsprachige Land, das ich nun zum ersten Mal betrat.
Jetzt sollte ich dieses Land also selbst kennenlernen. Ich war zu einem Zwischenstopp nach Taipei gekommen, als Teil einer großen Asienreise nach erfolgreichem Masterabschluss. Die Region einmal nur zum Vergnügen erkunden, anstatt immer mit Lern- und Forschungsdruck im Hinterkopf – ich war bester Dinge. In Peking hatte ich bereits meine ehemalige Uni und ein paar alte Bekannte besucht und festgestellt, dass mein Chinesisch seit meinem Sprachaufenthalt etwas eingerostet war. Hierher, nach Taipei, kam ich nun auf Empfehlung eines Kommilitonen aus der Sinologie. Der hatte sich für sein Sprachstudium eben nicht das große, allbekannte China ausgesucht, sondern die kleine chinesischsprachige Insel, die die meisten Deutschen wohl nicht einmal auf einer Landkarte ausmachen könnten. Ihn hatte es sofort begeistert, mit seiner ganz anderen Atmosphäre als der, die wir aus China kannten. Und auch mich sollte es schon bald in seinen Bann ziehen – das Land, das in den Jahren seither zu meiner Heimat geworden ist: Taiwan.
Erste Schritte: Neuland
Die Ankunft am Flughafen war abgewickelt. Ich hatte meinen Weg durch Bus und Bahn gefunden und wurde soeben von dem wuseligen unterirdischen U-Bahnhof ausgespuckt – hinein in das abendliche Stadtzentrum Taipeis. Haltestelle Da’an, Ausgang vier. Die U-Bahn-Schranken öffneten sich zu einer Flaniermeile im jungen, modernen Herz der Innenstadt. Vor mir lag eine unbekannte Welt voll neuer Eindrücke, Gerüche und Geräusche. Ich sog die Luft tief in die Lungen ein. Der Bordstein funkelte und glitzerte fremd im Abendlicht. Das macht der Glimmer im Beton, der die schickeren Stadtviertel der Hauptstadt pflastert. In Europa hatte ich das zuvor noch nie gesehen.
Auf der Hauptstraße vor meinem Hostel bummelten junge Menschen mit großen Getränkebechern in der Hand auf und ab. Da’an liegt zwischen zwei großen Universitäten, wie ich heute weiß, und ist, trotz der schillernden Glasfassaden der Bürogebäude ringsum, studentisch geprägt. In einer Seitenstraße reihten sich Garküchen aneinander, deren Kund*innen auf Hockern um wackelige Klapptische unter freiem Himmel saßen und sich über eine heiße Nudelsuppe oder einen süßen Tofupudding – Douhua – beugten. Mein Appetit auf diese neue Welt war geweckt. Ich ließ mich durch die Straßen treiben.
Überall wehten mir Satzfetzen entgegen in der Sprache, an der ich mich seit nunmehr fünf Jahren abmühte: Chinesisch. Aber sie hatten einen anderen Klang als der vertraute Pekinger Akzent mit seinen harten Zungenschlägen und gerollten „-err“s am Satzende. Den Taiwaner*innen schien dieselbe Sprache weicher von den Lippen zu fließen, in einem fast nuscheligen Singsang, den ich verstand, und der mir dennoch fremd war. Und es gab so viele Worte auf den roten und blauen Schildern, die an den dampfenden Essensständen des Nachtmarkts hingen, die mir gänzlich unbekannt waren. Nicht nur, dass die Schriftzeichen anders aussahen als die, die ich gelernt hatte – Taiwan hat die maoistische Schriftreform nicht mitgemacht, die die chinesischen Zeichen in den 1950er-Jahren vereinfachen sollte (und sie „verschandelt“ hat, wie so manche Taiwaner*in mit kaum verhohlenem Stolz hinzufügen würde). Nein, auch die gesamte Sprachentwicklung des Hochchinesischen verläuft seit seiner Einführung in Taiwan 1945 getrennt vom chinesischen Festland. Das hat zur Folge, dass mir hier Begriffe für die alltäglichsten Dinge begegneten – von Kartoffel über Toilette bis zu U-Bahn – die ich mir von Neuem aneignen musste.
Auf den Geschmack gekommen
An diesem ersten Abend in Taiwan interessierten mich die sprachlichen Unterschiede noch herzlich wenig. Ich war Touristin, schlemmte mich durch die Garküchen des Nachtmarkts, probierte etwas Chou Doufu hier – das gefürchtete, starkriechende „Stinketofu“ frittiert mit süßsaurer Kohlbeilage – etwas Baobing da – geschabtes Wassereis mit Fruchteinlage und Zuckersirup. Auch der obligatorische Bubble Tea durfte natürlich nicht fehlen. Die schiere Auswahl an Tee- und Saftsorten an den Teeständen an jeder Ecke war umwerfend. Dazu kamen die Einlagen: Von sogenannten Boba-Bällchen, Stärkekügelchen verschiedener Größen und Farben, deren Güte mit „sehr Q“ (lies: „kiu“) beworben wird, was so viel heißt wie bissfest, zäh, aber trotzdem nachgiebig-knatschig – „Q“ eben – über Fruchtgelee bis hin zu gesundheitsfördernden Samen wurden mir lauter unbekannte Optionen präsentiert, zu denen ich auch noch Tiandu und Bingkuai bestimmen sollte – also wie süß und wie heiß oder kalt mein Getränk sein sollte. Ich entschied mich für die konservative Wahl: einen Standard Naicha mit Zhenzhu, also Milchtee mit „Perlen“, den großen schwarzen Stärkekügelchen. Normal süß und heiß bitte. Wer hätte damals gedacht, dass ich noch viele Jahre Zeit haben würde, alle Optionen durchzuprobieren und meine Bestellung zu verfeinern? Heute nehme ich am liebsten einen Schuss Grapefruitsaft in meinen Grüntee, Kokosgelee für die Süße, wenig Zucker und kühl, aber ohne Eis.
Dabei habe ich – wie schon an diesem ersten Abend in Taipei – ein obligatorisches schlechtes Gewissen, während ich dabei zusehe, wie die hart arbeitenden Nebenjobber*innen hinter der Theke meinen Tee in einen 0,5-Liter-Plastikbecher gießen, dessen Öffnung dann an Ort und Stelle maschinell mit einer Plastikfolie verschweißt wird, um gleich darauf von mir mit einem Plastikstrohhalm durchstochen zu werden. So viel Plastik für 10 Minuten Erfrischung … Aber in Taiwan ist der Bubble Tea ein Stück Lebensgefühl und darf beim Nachtmarktbummel an einem heißen Sommerabend ebenso wenig fehlen wie die bunten Plastiktüten mit heißen, frittierten und gegarten Speisen jeder Couleur. Gegessen wird im Gehen, im Stehen oder auf Hockern an den Klapptischchen, an denen sich langsam eine dichte Traube aus essenden, plaudernden und lachenden Nachtmarktbesucher*innen vorbeischiebt – unterbrochen von dem gelegentlichen Moped, das im Schritttempo durch die Menschenmenge tuckert, und den unvermeidbaren Kinderwagen, in denen Kleinkinder zu einer Stunde über den nächtlichen Fressmarkt geschoben werden, zu der in Deutschland jedes Kind schon lange im Bettchen liegt.
Am Nachtmarkt führt kein Weg vorbei
Aber für Taiwan mit seinem subtropischen Klima und heiß-feuchten Sommerwetter, das jedes Leben tagsüber in klimatisierte Innenräume verbannt, und mit Angestellten, die unter langen Arbeitstagen ächzen, und erst nach Sonnenuntergang etwas Zeit zur Entspannung und Frischluft finden – sind die kostengünstigen Nachtmärkte eine Lebensader – eine Gelegenheit für den entspannten Familienbummel ebenso wie den schnellen Mitternachtssnack nach einem anstrengenden Tag.
Doch wie auch die Taiwaner*innen, die dieser Versuchung von klein auf ausgesetzt sind, musste ich schnell lernen, dass der Nachtmarktbesuch sich besser zur schönen Ausnahme eignet als für die tägliche Nahrungsmittelzufuhr – zu schnell häufen sich die Pfunde auf der Hüfte von den duftenden, herzhaften und fettigen Speisen, die alle durchprobiert werden wollen.
Komfortfaktor Essen
Als ich in Taipei ankam, war der Nachtmarkt noch ein aufregendes, neues Phänomen. Aber ich gewöhnte mich bald und gerne daran, ebenso wie an die ständige Verfügbarkeit von frisch zubereiteten günstigen Mahlzeiten. Taiwans schnelllebige Arbeitswelt lebt von den unzähligen Imbissen und Restaurants an jeder Straße, die die Angestellten in ihren Mittagspausen zum Beispiel mit heißen Nudelsuppen für umgerechnet zwei Euro, einer Portion deftig gefüllter Teigtaschen, genannt Jiaozi, für drei Euro oder einem japanischen oder koreanischen Menü für rund sechs Euro versorgen. In Taiwan wird deutlich seltener zuhause gekocht als bei uns. Nicht nur, weil das Auswärtsessen und das Mitnehmen von fertigen Portionen weder viel Geld noch Zeit kosten, sondern auch weil es einfach zur Kultur gehört. Essen, und Essen gehen, genießen einen hohen Stellenwert in Taiwan – im Alltag ebenso wie zum besonderen Anlass.
Ob es darum geht, einen Geschäftsabschluss zu besiegeln, die künftigen Schwiegereltern kennenzulernen, oder den Angestellten für ihr Engagement in der Firma zu danken – ein Bankett im Restaurant ist stets die erste Wahl. Je besonderer der Anlass, desto mehr Suppen, Fleisch-, Fisch-, und Gemüsegerichte stehen auf der runden Tafel, an der sich alle rundherum bedienen. Gegessen wird mit Stäbchen, meist aus Schälchen, mit oder ohne Reis, je nachdem, wie schnell die Gäste satt werden sollen. Das ist die traditionelle, gehobene Küche. Sie ist ebenso beliebt und kulturell verankert wie die alltäglichen Mahlzeiten in den vielen Garküchen am Straßenrand. Die einfachen Läden mit ihren Hockern an Plastiktischen und ihrer Hausmannskost werden übrigens von Universitätsprofessor*innen und CEOs genauso frequentiert wie von Arbeiter*innen und Studierenden. Warum auch zu Hause kochen, wenn warmes, erschwingliches Essen für jeden Geschmack oft nur ein paar Schritte von der Haustür entfernt wartet? Auch ich genieße täglich diesen praktischen Lebensstil.
Knoblauch weglassen, um Verlangen zu zügeln
Das erste Restaurant, das ich in Taipei betrat, war ein Buffet. Nicht irgendeins, sondern ein vegetarisches, buddhistisches Buffet. Mein Kommilitone, der mich dorthin eingeladen hatte, begrüßte mich mit den Worten: „Hast du so etwas schon einmal gesehen?“ Das hatte ich noch nicht, weder in Deutschland noch in China. Auf einem dreistöckigen Buffettisch in der Mitte des Raumes waren in Tellern und Warmhalteplatten vegetarische und vegane Speisen aufgehäuft, so weit das Auge reichte. Von Tofugerichten über Fleischimitate, gegarte und eingelegte Gemüse, frittierte Pilze bis hin zu Nudeln und überbackenen Kartoffeln lag da alles, was ein Vegetarierinnenherz wie meines nur so begehren konnte. Wir nahmen uns zwei Tabletts und Greifzangen, mit denen wir von allem etwas auf unsere Einwegteller schaufelten. Um das Buffet herum stand eine Schlange, die sich langsam um den Tisch bewegte. Wenn man gewählt hatte, wurde der Teller an der Kasse gewogen, Reis und Suppe dazu ausgehändigt, und für wenige Euro konnte ich mein erstes vegetarisch-buddhistisches Mahl in Taiwan genießen.
Weil der Buddha empfiehlt, keinem Lebewesen Leid zuzufügen, verzichten gläubige Buddhist*innen auf Fleisch, entweder an bestimmten Tagen im religiösen Kalender oder das ganze Jahr lang. Da der Buddhismus neben verschiedenen Facetten des ostasiatischen Volksglaubens, die sich grob unter Daoismus zusammenfassen lassen, die größte Rolle im spirituellen Leben der Taiwaner*innen spielt, hat Taiwan so viele vegetarische Restaurants wie kaum ein anderes Land. Während ich in Deutschland erst in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass jedes Lokal auch eine vegane Option bereithält, versteht in Taiwan auch der kleinste Imbiss seit jeher die Bitte um „su“ – vegetarisch. Meistens folgt die Frage, wie es um Eier und Milch steht – nach buddhistischer Auffassung ist das okay – und ob Zwiebeln und Knoblauch in Ordnung seien.
Letztere haben im buddhistischen Vegetarismus keinen Platz, weil sie als aufputschende Substanzen gelten, die ebenso wie Alkohol die Sinne trüben und die Gefühle in Wallung bringen. Starke Begierden sind im Buddhismus unerwünscht. Geistiges Ziel ist das friedvolle Abfinden mit dem Auf und Ab des Lebens, das Ablegen von Sehnsüchten, Begehrlichkeiten und Verlangen, da sie die Triebkräfte hinter dem Leiden sind. Leiden gilt es zwar, als unabdingbare Erfahrung menschlicher Existenz zu akzeptieren – aber vermehrt werden soll es nicht.
In Taiwan lebt Religion, die in China zerstört wurde
Mir war Buddhismus schon immer sehr sympathisch – auch wenn ich wenig davon verstand. In Taiwan spürte ich buddhistische Einflüsse von Anfang an viel stärker als während meines einjährigen Peking-Aufenthalts. Das mag daran liegen, dass die Kulturrevolution in den 1960er-Jahren nicht nur materielles, sondern auch immaterielles religiöses Erbe in China zerstört hat, und die Jahrzehnte des ikonoklastischen Kommunismus die „reaktionären“, „abergläubischen“ Religionen in den Herzen der Menschen unterdrückt haben.
Zwar hat in China in den letzten Jahren eine wahre „Renaissance des Glaubens“ stattgefunden – denn, so scheint es, die emotionalen Bedürfnisse der Menschen sind durch wachsenden Wohlstand alleine nicht zu decken. Aber manche Traditionen bleiben verschüttet und verloren.
Ein anderer Grund, warum ich in Taiwan schnell den Eindruck gewann, dass die Spiritualität, die in unseren Kursen über die Weltanschauungen des klassischen Chinas oft zur Sprache kam, mir aber in Peking wenig zu begegnen schien, ist womöglich, dass ich mich den Menschen in Taiwan von Anfang an näher fühlte – und mir dadurch ein tieferer Einblick in das Innenleben der Gesellschaft gewährt wurde.
Kulturelle Nähe zum Westen
Ob bei Plaudereien mit anderen Hostelgästen oder rund um den Esstisch mit den Bekannten meines Kommilitonen – irgendwie erschienen mir die Menschen zugänglicher, offener. Klar – Taiwan ist eine entwickelte Wirtschaft mit mittlerem Einkommen. Die Menschen sind früher wohlhabend geworden als in China, wo der Lebensstandard erst in den letzten zwanzig Jahren rapide angestiegen ist. Das verringert die Distanz. Fremde Gesichter sind schon seit Weltkriegsende in den Städten präsent und kein solches Kuriosum mehr, wie sie es in China – sehr zum Leidwesen von Tourist*innen und Arbeitsmigrant*innen – oft noch sind. Ausländische Filme werden in Kinos und auf Streamingdiensten ebenso konsumiert wie heimische Produktionen – anders als in China, wo gerade bei ausländischen Produktionen den Spitzfindigkeiten der Zensurbehörden Rechnung getragen werden muss. Das jährliche Kontingent für Filmpremieren aus dem Westen ist beschränkt, und den amerikanischen Blockbustern werden seit Neuestem patriotische, chinesische Actionheld*innen entgegengestellt.
Kurzum, die kulturelle Distanz zwischen mir und meinen neuen taiwanischen Bekanntschaften war einfach kleiner. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich mich nicht auf dünnes Eis begab, wenn ich offen über politische oder ideelle Themen sprach. In China war ich es stets gewohnt gewesen, alle Fragen, die Nationalstolz und Propaganda betrafen, sorgfältig zu umschiffen, um die Gefühle meines Gegenübers nicht zu verletzen. Schließlich hatte ich auch von reflektierten, kritisch denkenden Freund*innen dort Aussagen gehört wie: „Ohne die staatliche Kontrolle wäre ein Riesenland wie China nicht zu regieren. Für das schnelle Wachstum braucht es die harte Hand der Zentralregierung.“
In Taiwan, das stellte ich schnell fest, begegnete mir das Gegenteil. Die Leute wollten Debatte, suchten Ideenaustausch. Als ich 2015 erstmals taiwanischen Boden betrat, war das Land bereits 20 lange Jahre demokratisch. Sich über die Regierung zu beschweren und gegen ihre Politik zu protestieren, gehörte zu den Lieblingsbeschäftigungen der Taiwaner*innen, über Altersgruppen und Parteiaffinität hinweg. Wer will, kann an jeder Ecke ein Gespräch darüber beginnen, was diese Partei oder jene*r Präsident*in alles falsch gemacht hat – und auch, wenn Vertreter*innen der älteren Generation, die noch die nationalistische Erziehung der Militärdiktatur „genossen“ hat, gerne mal verlauten lassen, dass „früher alles besser“ war – oder auch: „Wir hatten damals noch richtige Werte“, „Die Gesellschaft ist heute zu frei“ – dann stimmen sie mir spätestens dann zu, wenn ich sie frage, ob es nicht besser sei, dass sie heutzutage diese und jede Meinung ungestraft äußern können.
Hostelbegegnung mit Essenseinladung
Meine Erinnerungen an die ersten Tage in Taipei haben alle mit Essen zu tun. Nachdem ich mir beim vegetarischen Schmaus mit meinem Kommilitonen eine Liste von Empfehlungen abgeholt hatte, was ich in Taipei unbedingt zu erleben und besichtigen hatte, wollte ich die Stadt ein wenig auf eigene Faust erkunden. Doch es sollte noch etwas dauern, bis ich die jahrtausendealten Kunstschätze des Palastmuseums, die japanische Architektur des Regierungsviertels und die neonfarbene Jugendkultur der Ausgehmeile Ximending zu sehen bekam. Erst einmal schlief ich die Tage und wachte die Nächte, wie bei einer Zeitverschiebung von sechs Stunden und dem unweigerlichen Jetlag zu erwarten war. In meinen wachen Stunden klickte ich mich durch Internetseiten in Vorbereitung meines ersten Reisevorhabens – einer Fahrradtour um die Insel – und plauderte mit den anderen zwischen Raum und Zeit gestrandeten Gästen in meinem Hostel.
Einer von ihnen war Syd, ein endzwanziger Software-Ingenieur (keine Seltenheit im IT-starken Taiwan). Er war für einen neuen Job nach Taipei gezogen und gerade noch auf der Suche nach einer Wohnung. Nachdem wir im Hostel mehrfach freundliche Worte gewechselt hatten, lud er mich prompt zu meinem zweiten Abendessen auf der fremden Insel ein (auch das, wie ich feststellte, keine Seltenheit, sondern eine gängige Geste im Repertoire der taiwanischen Willkommenskultur). Ich weiß noch, dass wir in einem hippen, holzverkleideten Restaurant in der Nähe des Hostels saßen und Reis mit verschiedenen Beilagengerichten verspeisten, darunter Diguaye. Das sind gedünstete Süßkartoffelblätter, die ungefähr so schmecken wie unpürierter Spinat, dazu Sojasoße und viel Knoblauch – bis heute eine meiner absoluten Lieblingsspeisen.
Wo ist es besser?
Syd hatte eine Engelsgeduld mit meinem rostigen Chinesisch, das noch keineswegs auf die taiwanischen Hörgewohnheiten abgestimmt war. Zäh und tapfer hangelten wir uns in unserem Gespräch voran. Er erzählte mir, der Touristin, von Taiwans schöner Ostküste, den Bergen, Schluchten und Stränden, die ich auf meiner Radtour unbedingt besuchen sollte. Ich berichtete auf sein Nachfragen hin von den Unterschieden zu China, die mir in meinen ersten Tagen in Taipei aufgefallen waren. Auch das ist keine Seltenheit. Taiwaner*innen freuen sich immer, wenn ich bekunde, dass die Luft in Taiwan um Welten besser ist als in Peking, dass mich die Freundlichkeit und Offenheit der Leute hier sofort positiv überrascht hatte, und dass mir das langsamere Lebenstempo in der taiwanischen Hauptstadt, mit weniger Ellbogenmentalität im Vergleich zu China, von Anfang an aufgefallen sei. Syd, wie die anderen seiner Landsleute, mit denen ich diese aufrichtigen Beobachtungen im Laufe der Zeit geteilt habe, nickte zufrieden. Ich hatte, mit meinem Blick von außen, erkannt und bestätigt, was den allermeisten Taiwaner*innen ein wertvolles Gut ist: Auch wenn der große Nachbar das wirtschaftliche Wachstum und den Einfluss in der Welt für sich gepachtet hatte, auch wenn er die Insel politisch und militärisch bedrohte und die historischen Verstrickungen mit ihm die Zukunft von Taiwans Demokratie gefährdeten – Taiwan war immerhin, und allen Widrigkeiten zum Trotz, ke’ai, also liebenswert.
Der leidige Vergleich
Es stimmt: Ohne ein Verständnis der Taiwan-China-Beziehungen ist ein Verstehen von Taiwan und seiner Gesellschaft nicht möglich. Aber während ich in diesen ersten Tagen noch alle Eindrücke aus Taiwan mit meinen Erfahrungen in China abglich, habe ich in den Monaten und Jahren seither gelernt, dass Taiwan noch viel mehr ist als dieser Vergleich – und ganz, ganz anders als der große Nachbar, mit dem es sich Schrift und Sprache teilt. Ich habe auch gelernt, dass die meisten Taiwaner*innen es nicht gerne sehen, wenn China am Anfang einer Erzählung über Taiwan steht – selbst, wenn es schwer ist, über das eine zu reden, ohne das andere zu erwähnen.
Ich habe gelernt, wie stolz die Menschen in Taiwan auf ihr Land sind – nicht zuletzt wegen seiner Demokratie und Freiheit, für die sie hart und lange gekämpft haben. Ich habe auch gelernt, dass das, was Taiwan zu dem bunten, faszinierenden und liebenswürdigen Land macht, das ist, was von den Taiwaner*innen selbst kommt. Taiwans Schönheit entsteht aus den Lebensgewohnheiten, den Werten, der bewegten Geschichte, der Vielfältigkeit seiner Bevölkerung und der Vielfalt der Insel selbst.
Die Reise beginnt
Begleiten Sie mich auf meiner Reise durch dieses einzigartige Land, das portugiesische Seefahrer*innen vor über vierhundert Jahren Ilha Formosa, die schöne Insel, getauft haben. Ihr will ich mich annähern in diesem Buch, erzählt aus der Perspektive einer jungen Deutschen, einer Fremden in fremdem Land, die Taiwan einst als Reisende betreten hat und das Land seit inzwischen sechs Jahren ihr Zuhause nennt.
Mit diesem Buch will ich Sie einladen zu einer gemeinsamen Entdeckungsreise rund um Taiwan – so wie ich es auch kennengelernt habe. Haben wir im ersten Teil einmal einen Überblick gewonnen, geht die Reise tiefer: in die Herzen der Menschen. Im zweiten Teil werden wir uns einen Begriff machen von Glaubenswelten und Glaubenspraxen im Land, vom Daoismus, Ahnenglauben und Jenseitsvorstellungen bis hin zum Buddhismus. Nicht mal fünf Prozent der Bevölkerung sind christlich – aber auch sie haben viel zu erzählen. Daher widmet sich der dritte Teil dem Christentum in Taiwan. Von den Anfängen der Mission, über Kirche in der Diktaturzeit bis hin zu den Themen heutiger Gemeinden wollen wir Taiwans komplexe Geschichte und Gesellschaft noch einmal aufs Neue verstehen – und uns ein rundes, umfassendes Bild machen, von dieser Insel der Vielfalt.
TEIL I: Reise durch Taiwan
Rund um die Insel
Meine eigene Reise rund um die Insel beginnt an Taiwans dünn besiedelter Ostküste. Hier treffen peitschende Wellen auf schroffen Fels. Dann wieder strömen sanfte Fluten über weitläufige Sandstrände. Im Inland ist der Horizont bestimmt von tiefgrünen Bergflanken, die sich wie das stämmige Rückgrat der Insel von Nord bis Süd aufbäumen. Mit bis zu 4000 Meter Höhe macht der unzugängliche Bergrücken weite Teile der Inselmitte unbewohnbar. Hinter den Bergen liegt die industriell entwickelte Westküste, in deren Ballungsräumen der Großteil der 23,5 Millionen Taiwaner*innen lebt – auf engem Raum. Zum Vergleich: Meine Heimat Bayern hat die doppelte Fläche wie die Hauptinsel Taiwan, aber nur halb so viele Einwohner*innen. Das erklärt die klotzigen Apartmentblocks, die im Norden und Westen eng aneinander gedrängt das Stadtbild prägen.
Die Ostküste hingegen ist mit ihren kleinen Ortschaften, Reisanbau und Fischerdörfern ein Sehnsuchtsort für viele in Taiwan. Ob Wandern, Surfen, Wale beobachten oder Radtouren machen: Osttaiwan, von den Städtchen Yilan bis Taitung, ist der perfekte Ort dafür. Als ich das erste Mal auf meinem Fahrrad die Straßen des osttaiwanischen Hinterlands entlangrollte, vorbei an sumpfigen Reisfeldern, Betelnusswäldern, Ananasplantagen und wilden Papaya-Bäumen, begegnete ich immer wieder einem Taiwan, das in den großen Städten beinahe unsichtbar ist: das der indigenen Bevölkerung.
Die eigentlichen Taiwaner*innen
Vor vielen Dörfern stehen aus Holz geschnitzte Totems, die Dorfmauern geziert von bunten Szenen indigenen Lebens. Mal ein Jäger, der mit Pfeil und Bogen auf ein Wildschwein zielt, mal Männer und Frauen in der Tracht des Stammes, Hand in Hand zum Tanz. Dann noch ein Neonkreuz, das die Dorfkirche anzeigt – ansonsten unterscheiden sich die Ortschaften nicht von den Han-Dörfern, also solchen, die von der chinesischstämmigen Mehrheit bewohnt sind: Hier ein 7-Eleven, da ein Moped-Reparaturshop. Die Menschen nicken der fremdländischen Radlerin freundlich zu, wenn ich vorbeifahre. Kinder auf Fahrrädern umkreisen mich und stellen freche Fragen. Alle hier sprechen Mandarin. Die Sprache ihrer Vorfahr*innen scheint aus dem Leben der Jungen längst verschwunden.
In Wäldern und auf Wanderpfaden an der Ostküste stolpere ich über Gedenkschilder, die den früheren Standort eines vertriebenen indigenen Dorfes oder einer Schlacht mit den Soldaten der japanischen Kolonialregierung (1895 – 1945) markieren. Bereits seit der Ankunft der chinesischen Siedler*innen im 17. Jahrhundert wurden Taiwans Indigene immer weiter aus ihren angestammten Gebieten verdrängt, ihre Kultur von der Assimilationspolitik verschiedener Regime unterdrückt und verwässert. Dennoch ist die ursprüngliche Bevölkerung der Insel heute wieder sehr präsent. Insgesamt 16 anerkannte indigene Völker gibt es. Das demokratische Taiwan ist stolz auf seine indigenen Dörfer und feiert ihre bunten Trachten, Bräuche und Tänze mit Begeisterung und Neugier. Das zumindest sagen die einen. Die Wiederentdeckung indigener Kulturen ist Kitsch und Kommerz, es fehlt die tiefere Wertschätzung, sagen die anderen. Zumindest die Bewahrung der verbleibenden indigenen Sprachen hat es in den letzten Jahren auf die Agenda der Politik geschafft.
Linguistisch und genetisch sind Taiwans ursprüngliche Bewohner*innen verwandt mit pazifischen Völkern, die zur See fuhren, wie den Maori in Neuseeland und den Ureinwohner*innen Hawaiis – nicht aber mit den Chines*innen, die ab dem 17. Jahrhundert aus Chinas Küstenprovinzen auf die fruchtbare Insel drängten. Während die Nachfahren der chinesischen Siedler*innen heute 95 Prozent der Bevölkerung stellen, kämpfen die rund 580.000 Indigenen weiter um eine stimmige Identität in einer Welt, die nicht von ihnen und nicht für sie gemacht wurde.





























