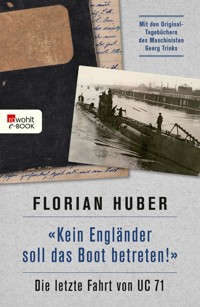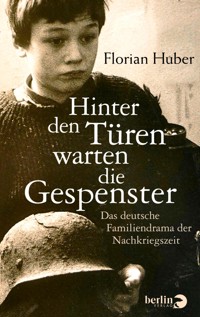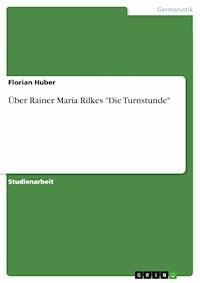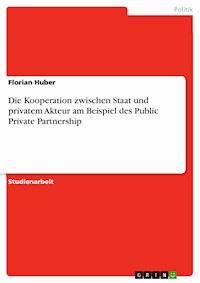12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Abenteuer in der Unterwasserwelt Kaum etwas fasziniert den Menschen so sehr wie das Ungewisse, das sich in den Tiefen unserer Ozeane verbirgt, seien es jahrhundertealte Schiffswracks oder versunkene Städte – denn die Welt unterhalb des Meeresspiegels hält Überraschungen parat, die den Inhalt der Geschichtsbücher dramatisch verändern könnten. Florian Huber ist leidenschaftlicher Unterwasserarchäologe und versucht, dem Meer diese Geheimnisse zu entlocken. Er taucht seit Jahren nach Schiffen, in Höhlen, in Brunnen und Seen, immer auf der Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. In seinem reich bebilderten Buch berichtet Huber von seinen spannendsten und riskantesten Forschungsexpeditionen: zum schwedischen Handelsschiff Mars, das 1564 mit 800 Mann Besatzung sank, zu den japanischen Schiffswracks im Pazifik vor Truk Lagoon und in die wassergefüllten Höhlen Yucatáns auf der Suche nach Überresten der Maya. Seine Geschichten sind wie Reisen in eine völlig fremde Welt. «Überwucherte Wracks oder jahrtausendealte Knochen der Maya: Ein Unterwasserarchäologe forscht in den Tiefen der Meere nach Unentdecktem. Ein faszinierendes Abenteuer unter Wasser!» STERN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Ähnliche
Florian Huber
mit Henning Engeln
Tauchgang ins Totenreich
Archäologie unter dem Meeresspiegel
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Abenteuer in der Unterwasserwelt
Kaum etwas fasziniert den Menschen so sehr wie das Ungewisse, das sich in den Tiefen unserer Ozeane verbirgt, seien es jahrhundertealte Schiffswracks oder versunkene Städte – denn die Welt unterhalb des Meeresspiegels hält Überraschungen parat, die den Inhalt der Geschichtsbücher dramatisch verändern könnten.
Florian Huber ist leidenschaftlicher Unterwasserarchäologe und versucht, dem Meer diese Geheimnisse zu entlocken. Er taucht seit Jahren nach Schiffen, in Höhlen, in Brunnen und Seen, immer auf der Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In seinem reich bebilderten Buch berichtet Huber von seinen spannendsten und riskantesten Forschungsexpeditionen: zum schwedischen Handelsschiff Mars, das 1564 mit 800 Mann Besatzung sank, zu den japanischen Schiffswracks im Pazifik vor Truk Lagoon und in die wassergefüllten Höhlen Yucatáns auf der Suche nach Überresten der Maya. Seine Geschichten sind wie Reisen in eine völlig fremde Welt.
Über Florian Huber
Für meine Eltern
und in lieber Erinnerung
an meine Großeltern
Vorwort
Das Leben wird nicht gemessen an der Zahl unserer Atemzüge, sondern an den Orten und Momenten, die uns den Atem rauben. Anonym
«Wos? Archäologie! Des is doch a brotlose Kunst!»
Noch immer muss ich schmunzelnd an die Worte meiner Oma denken, nachdem ich ihr mittags beim Schweinsbratenessen erzählt hatte, dass ich meine Ausbildung zum Hotelfachmann im Münchner Hilton nun doch nicht antrete und stattdessen Archäologe werden will. Heute – knapp 20 Jahre später – muss ich sagen, dass sie zwar teilweise recht hatte, ich meine Entscheidung aber zum Glück nicht eine Sekunde bereut habe.
Im kleinen Gebirgsbach im Garten meiner Eltern suchte ich stundenlang uralte Versteinerungen, und auf der nahegelegenen Hohenburg in Lenggries seilte ich mich heimlich in den «Hungerturm» ab, um alte Skelette zu finden. Als ich 13 war, tauchte ich das erste Mal, drei Jahre später hatte ich meinen Tauchschein in der Tasche. Spätestens nachdem ich auf Mauritius mein erstes Wrack erkundet hatte, war ich der geheimnisvollen und beeindruckenden Unterwasserwelt endgültig verfallen. Mal ehrlich: Bei der Vorgeschichte musste ich doch einfach Unterwasserarchäologe werden, oder?
Als Wissenschaftler wollte ich mich zeitlich und räumlich nie festlegen. Mich faszinieren sowohl neuzeitliche Schiffswracks im Pazifik als auch steinzeitliche Siedlungen in der Ostsee. Besonders aber haben es mir Wracks angetan. Ganze Kontinente wurden mit dem Schiff entdeckt und besiedelt; noch bevor der Mensch sesshaft und somit Bauer oder Hirte wurde, war er bereits Seefahrer. Ohne deren Entdeckerdrang gäbe es die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht. Alles, was der Mensch jemals produziert hat, transportierte er früher oder später über unterschiedlichste Wasserwege.
Früh übt sich, wer ein Unterwasserarchäologe werden will: Schon mit 5 Jahren tauche ich in Italien nach alten Schätzen
Die UNESCO vermutet, dass rund drei Millionen Wracks in unseren Seen, Flüssen und Ozeanen liegen. Das sind drei Millionen spannende, lehrreiche, aber auch tragische Geschichten des Menschen und seiner Reisen in ferne und unbekannte Länder. Ich kann mir kaum etwas Packenderes vorstellen, als nach diesen Zeitkapseln zu tauchen und die Vergangenheit ans Licht zu bringen.
Unterwasserarchäologie ist eine noch sehr junge wissenschaftliche Disziplin, was angesichts des hohen technischen Aufwands auch nicht weiter verwundert. Und obwohl die Forschungsarbeiten unter dem Meeresspiegel in der Regel komplex und zeitaufwendig sind, liegt genau darin der Reiz für mich. Unser einzigartiges Kulturgut unter Wasser zu erforschen, zu schützen und Menschen – egal ob Taucher oder nicht – dafür zu begeistern, ist meine Leidenschaft. Umso mehr freue ich mich, Ihnen mit diesem Buch einen Einblick in meine Arbeit und Abenteuer der vergangenen Jahre geben zu dürfen. Denn auch in unserer modernen Hightech-Welt gibt es sie noch, die großen und kleinen Abenteuer, die das Leben so lebenswert machen. Tauchen Sie also mit mir ab! Erkunden wir gemeinsam dunkle Höhlen, tiefe Brunnen, magische Bergseen und unbekannte Schiffswracks. Entdecken wir die Geheimnisse der Unterwasserwelt. Aber Vorsicht – vergessen Sie das Atmen nicht …!
Café Liebling, Kiel, im April 2016
Florian Huber
Reise in die Unterwelt –
Die Totenhöhlen von Mexiko
Kurz nach Sonnenaufgang erreichen wir die überwucherten Steinruinen einer ehemals blühenden Stadt. Sie liegt mitten im Dschungel Yucatáns in einem Nirgendwo, mehr als eine Autostunde von der Kleinstadt Tulum entfernt. Es ist heiß, weit über 30 Grad, und so schwül, dass der Schweiß bei der kleinsten Anstrengung aus allen Poren rinnt. Hoch über uns in den Wipfeln stoßen Brüllaffen ihre unheimlichen, bellenden Schreie aus – so als wollten sie uns davor warnen, weiterzugehen. Der Dschungel hat sich längst zurückgeholt, was ihm gehört, und fast vollständig sind die Überreste der einst imposanten Gebäude, Pyramiden, Tempelanlagen aus der Maya-Zeit unter Lianen, mächtigen Wurzeln, hoch aufragenden Bäumen oder abgestorbenem Laub verborgen. Dennoch erkennen wir umgestürzte Säulen, Treppenaufgänge, Torbögen und Reste von gepflasterten Wegen. Wir, das sind: drei Biologen und ein Archäologe aus Kiel, eine mexikanische Kollegin und ein Trupp einheimischer Helfer aus einem nahegelegenen Dorf – Nachfahren jener Maya, die einst die längst untergegangene Stadt erbaut hatten.
Doch nicht die Ruinen sind unser eigentliches Ziel, sondern ein unter der Erdoberfläche gelegenes Wasserreservoir: eine sogenannte Cenote. Diese unterirdischen, mit Süßwasser gefüllten Höhlungen dienten den mexikanischen Ureinwohnern vor vielen Jahrhunderten als Wasserquelle und wurden von ihnen als heilige Orte, als Eingänge zur Unterwelt Xibalba angesehen. Mehr als 3000 Cenoten sind auf der Halbinsel Yucatán heute bekannt. Sie durchziehen den porösen Kalkstein im Untergrund und sind häufig miteinander verbunden. In dieser jedoch sollte uns eine einzigartige und zugleich unheimliche Entdeckung erwarten.
Wir kämpfen uns durch das dichte Grün, versuchen die lästigen Moskitos zu ignorieren und erreichen endlich eine Lichtung, in deren Mitte sich am Boden ein ovaler Felsspalt von vielleicht anderthalb Meter Länge und knapp einem Meter Breite auftut. Ich leuchte mit meiner Lampe hinein. Erst in 13 Meter Tiefe trifft der Schein auf eine Oberfläche und wird durch dunkles, ruhig daliegendes Wasser reflektiert.
Bevor ich in diesen Schlund vordringen kann, müssen wir noch unser gesamtes Tauchequipment und weitere Utensilien herbeischaffen: Flaschen, Anzüge aus Trilaminat, Tauchcomputer, Flossen und Tauchmasken, auch wissenschaftliches Zubehör wie Zollstöcke und Unterwasser-Schreibblöcke, daneben Kameras, Gehäuse, Videolampen und natürlich Verpflegung. Mehrfach muss die Crew schwer beladen in der Höllenhitze die 300 Meter von unserem Auto zur Cenote zurücklegen, um alle Kisten, Boxen, Koffer und Taschen auf die Lichtung zu schleppen. Allein ein Doppelpack aus zwei Flaschen wiegt rund 30 Kilogramm.
Endlich ist es so weit. Ich wische mir den Schweiß aus den Augen, klippe den Karabiner in meinen Klettergurt und stelle mich an den vom Regen glitschigen Rand des Felsspalts. Das Seil führt über ein Holzgestell, das über dem Spalt steht und das Abseilen in die Tiefe erleichtert. Sein anderes Ende hat einer der einheimischen Helfer aus dem Dorf in der Hand. Ich blicke in die braunen Augen des Mannes, und er lächelt mich an, als wenn er nicht so recht verstehen könne, was den verrückten Ausländer in die Tiefe treibt, dorthin, wo für seine Maya-Vorfahren die Unterwelt begann.
Dann zieht er ruckartig, das Seil trägt mich, und mit einem Schwung baumle ich über dem gerade mal einen Quadratmeter kleinen Loch. Ich rücke meinen Helm zurecht, knipse die daran befestigte Lampe an und zeige mit dem Daumen nach unten. Dann gleite ich durch den engen Eingang in die Dunkelheit. Sofort merke ich, wie es angenehm kühl wird, sicher sind es hier zehn, fünfzehn Grad Celsius weniger.
Unter dem schmalen Eingangsspalt weitet sich die Cenote zu einer flaschenförmigen Höhle, oben etwas schmaler, unten am Boden rund 30 Meter im Durchmesser.
Ich drehe meinen Kopf und blicke im gebündelten Lichtschein auf riesige Wurzeln, die wie knorrige Finger aus der Decke ragen. Es riecht nach feuchter Erde und Moder. Langsam geht es weiter in die Tiefe. Vereinzelt haben sich Fledermäuse an die Felswand gekrallt und ruhen kopfüber hängend im Gewölbe. Meine Anwesenheit scheint sie nicht zu stören. Dann erreiche ich die Wasseroberfläche und tauche kurz darauf ein. «Stopp», schreie ich, während ich nach meinem Karabiner taste und ihn ausklinke. Das Seil verschwindet zügig nach oben in die Öffnung, die nun 13 Meter über mir hell blitzt, wie ein ferner, letzter Gruß aus der Welt des Tageslichts.
Ich treibe im ruhigen Wasser und blicke mich nach allen Seiten um. Viele ungewöhnliche Orte habe ich in den letzten Jahren erkundet, aber der hier ist anders. Ganz anders. Es ist ruhig und friedlich, aber gleichzeitig gespenstisch und surreal. Was wird mich hier unten im dunklen Wasser erwarten?
Von oben, wie aus weiter Ferne, höre ich ein Stimmengewirr aus Deutsch und Spanisch. Als ich auf das kleine Eingangsloch blicke, durch das ein gebündelter Sonnenstrahl fällt, sehe ich, wie mein Tauchzubehör herabgelassen wird. Ich schwimme etwas zur Seite und warte, bis das Doppelflaschenpaket samt Wing und Gurten langsam ins Wasser sinkt. Das Wing ist eine Art Luftkammer, die der Taucher auf dem Rücken trägt und die für Auftrieb und stabile Lage unter Wasser sorgt. Das Gas wird mit dem Inflator hineingebracht, der die Verbindung zur Flasche herstellt. Ich schnappe ihn mir, drücke den Knopf und blase somit ein wenig Gas in das Wing. Dann hänge ich das Seil aus und schnalle mir das Gerät auf den Rücken.
Mit dem Klettergurt gesichert, geht es an der Holzstrickleiter 13 Meter in die Tiefe der Cenote Las Calaveras
Als Nächstes checke ich die Atemregler. Von deren korrekter Funktion hängt das Leben des Tauchers ab, denn sie sorgen dafür, dass das unter extrem hohem Druck stehende Gas aus der Flasche bei jedem Atemzug in kleinen Portionen und mit dem jeweiligen Umgebungsdruck abgegeben wird. Dann setze ich meine Maske auf und schalte die große akkubetriebene Lampe ein, die auf meinem linken Handrücken befestigt ist. Mit der anderen Hand greife ich einen Schwall Wasser und lecke kurz mit meiner Zunge daran, um den Geschmack zu testen. Es ist ein Ritual, das ich mir vor Jahren in der Ostsee angewöhnt hatte. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Vermutlich dient es unbewusst dazu, Kontakt mit dem Element Wasser aufzunehmen.
Jetzt kann das Abenteuer beginnen. Ich lasse Gas aus dem Wing und sinke langsam unter die schwarze Oberfläche des unterirdischen Sees. Trotz meiner Anspannung kann ich mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Ich bin in meinem Element, bin der Unterwasserarchäologe auf seinem Weg zu einem unvergleichlichen Arbeitsplatz. So hatte ich mir das immer vorgestellt. Und genau so fühlt es sich in diesem Moment an. Wer möchte schon am Schreibtisch in der Uni sitzen, wenn er die Alternative hat, am anderen Ende der Welt in einer geheimnisvollen Höhle zu tauchen und nie Gesehenes zu entdecken? Und was ich am Grund dieser Cenote erblicke, verschlägt mir wirklich den Atem.
Im Schein der Lampe taucht schemenhaft eine helle, rundliche Form auf: ein ausgeblichener menschlicher Schädel. Gleich dahinter erblicke ich einen zweiten Schädel und dann einen weiteren. Dazwischen sind mächtige Oberschenkelknochen, gebogene Rippen, zarte Fingerknöchelchen und wuchtige Becken verteilt. Der ganze Boden ist über und über mit menschlichen Überresten bedeckt, und überall starren mich leere und dunkle Augenhöhlen an.
Ich inspiziere die unheimlichen Relikte näher und bemerke, dass die Gebisse in einigen der Schädeln seltsam aussehen: Die Schneide- und Eckzähne haben keine natürliche Form, sondern sind spitz angefeilt. Andere Schädel erscheinen merkwürdig deformiert, so als wären sie in die Länge gezogen. Und in einer Schädeldecke entdecke ich ein kleines, fast viereckiges Loch mit sauber geschnittenen Kanten. Welches Schicksal mag diesen Menschen ereilt haben?
Ich gleite weiter und versuche mir einen Überblick über diese unheimliche Totenstätte unter Wasser zu verschaffen. Es ist absolut still. Nur das polternde Geräusch der Gasblasen ist zu hören, die bei jedem Ausatmen aus meinem Atemregler entweichen und nach oben ins Nichts entschwinden. Eine derartige Fülle von menschlichen Knochen habe ich noch nie bei einer Unterwasserexpedition gesehen. Doch es bleibt keine Zeit, ins Grübeln zu verfallen, denn ich bin hergekommen, um wissenschaftlich zu arbeiten. Also ziehe ich meinen wasserfesten Notizblock aus der rechten Beintasche und mache erste Eintragungen. Was ist hier passiert? Das frage ich mich, während ich mit Bleistift den ungefähren Umriss der Cenote zeichne. Wer waren diese Menschen, und warum liegen sie hier unten, an diesem dunklen Ort mitten im Dschungel? Waren sie Opfer von Seuchen, Krankheit oder Krieg? Waren es natürlich Verstorbene, von ihren Angehörigen hier bestattet, oder haben sie dramatische letzte Minuten erlebt, weil sie den Göttern geopfert wurden?
Eine unheimliche Begegnung: 126 Maya-Schädel lagern auf dem Grund der Cenote – vermutlich ein Friedhof unter Wasser
Nur drei Wochen Zeit haben wir, um dieses Knochenchaos wissenschaftlich präzise zu dokumentieren und das Rätsel der Toten zu lösen. Und das zehn Meter unter Wasser, mitten im Nirvana! Es ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe.
Bei genauem Hinsehen sind spitz angefeilte Schneidezähne zu erkennen; in der Welt der Maya ein Schönheitsideal
All diese Gedanken schießen mir durch den Kopf, während ich meine Runden in der Cenote drehe und versuche, mir einen Überblick über die Fundsituation zu verschaffen. Doch nach zwei Stunden neigt sich das Gas in den Flaschen dem Ende zu, und ich muss – nach einem kurzen Sicherheitsstopp in drei Meter Wassertiefe – auftauchen. Ich nehme den Atemregler heraus, schnalle Flaschen und Wing ab und lasse das Zubehör von den anderen nach oben hieven. Als das Seil erneut nach unten kommt, hänge ich mich wieder in den Karabiner ein und werde unsanft ruckartig hochgezogen – zurück in die oberirdische Welt, in das vertraute Licht des Tages.
Oben angekommen, sprudle ich sofort los und berichte meinen Kollegen, was ich erlebt habe. Uli Kunz, Christian Howe und Robert Lehmann – alle drei Meeresbiologen aus Kiel und extrem erfahrene Forschungstaucher, mit denen ich schon seit Jahren zusammen auf Expeditionen gehe – blicken mich mit großen Augen an und können es kaum erwarten, selbst in die Höhle zu gelangen, um die unheimliche Szenerie zu erkunden. Und Carmen Rojas, die örtliche Archäologin aus Tulum, fühlt sich bestätigt: «Genau deshalb nennen die Dorfbewohner sie Las Calaveras – die Cenote der Totenschädel.»
Maßgeblich haben wir es Carmen – sie ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern ebenfalls eine routinierte Taucherin – zu verdanken, dass wir uns jetzt, im August 2010, überhaupt hier im Dschungel Yucatáns befinden. Denn sie hat uns eingeladen, diese rund 50 Kilometer von der karibischen Küste entfernte Fundstelle zu untersuchen. Und nun brennen wir darauf, das Schicksal der Toten von Las Calaveras mit ihr gemeinsam aufzuklären.
Die Zusammenarbeit mit Carmen Rojas hatte bereits im Jahr 2007 begonnen, während meiner ersten Reise nach Mexiko. Rein zufällig hatte ich sie in einem Tauchcenter kennengelernt und von ihr erfahren, dass es nur wenige Unterwasserarchäologen in Mexiko gebe und sie Hilfe bei der Untersuchung der Cenoten brauchte. Was dieser Begegnung noch alles folgen würde, konnte ich damals nicht ahnen: mehrere spektakuläre Expeditionen nach Yucatán, neue Erkenntnisse über die Maya, Funde von Urzeittieren und vorgeschichtlichen Siedlungsspuren, verblüffende geologische Beobachtungen und großartige Abenteuer in den unterirdischen Höhlensystemen Mexikos.
Doch der Ursprung der Geschichte reicht noch viel weiter zurück, im Grunde bis zu meinem Archäologie-Studium in München. Dort habe ich zusätzlich das Fach Ethnologie (Völkerkunde) belegt und bin sofort begeistert, als ich in einem Seminar von der untergegangenen Kultur der Maya hörte. In dieser Zeit sammle ich grundlegendes Wissen über dieses faszinierende Volk, das mir bei den Expeditionen in Mexiko eine wertvolle Basis und Hilfe sein wird.
Aber erst viel später, im Jahr 2006, springt der Funke endgültig über. In einem Sonderheft der Reihe «Spiegel Special» über Unterwasserarchäologie lese ich von den phantastischen Möglichkeiten, die Tauchgänge in den Cenoten und Höhlensystemen Yucatáns für Archäologen bieten, und erfahre, dass dort ein bekannter deutscher Höhlentaucher namens Robert Schmittner lebt. Der soll große Routine im Höhlentauchen besitzen und bereits spektakuläre Funde gemacht haben.
Mir wird klar: Ich will nach Mexiko, möchte diese faszinierende Unterwelt mit eigenen Augen sehen und die großen Maya-Städte wie Chichén Itza oder Tikal erkunden, um mir ein Bild vom Leben des verschwundenen Volkes zu machen. Als ich herausfinde, dass Robert Schmittner sein eigenes Tauchcenter in Tulum hat und Kurse anbietet, um das nicht ungefährliche Handwerk des Höhlentauchens zu erlernen, buche ich für Anfang 2007 Dezember einen Flug und lande bald darauf in Cancún.
Von dort geht es mit einem großen Überlandbus in einer rund zweistündigen Fahrt nach Tulum, einer kleinen Stadt an der «Riviera Maya», wie die dortige Karibikküste Yucatáns genannt wird. In den 1970er Jahren hatten Hippies die paradiesischen Strände entdeckt, um entspannt abzuhängen. Inzwischen geht es dort immer touristischer zu, und auch die Maya-Hinterlassenschaften sowie die geheimnisvollen Unterwasserhöhlen locken viele Fremde an.
Mindestens 10 Schulen für Höhlentaucher gibt es dort heute, doch die von Schmittner gehört zu den professionellsten und bietet eine äußerst akribische Ausbildung. Robbie erweist sich als ein netter, umgänglicher Kerl in meinem Alter – Anfang 30 zu dieser Zeit. Und als wir herausfinden, dass wir beide aus Bayern kommen, verstehen wir uns auf Anhieb wie alte Bekannte. Fernab der Heimat verbindet die gemeinsame Herkunft, und wir plaudern über Weißbier, Schweinsbraten und über den Walchensee. Dort hat Robbie das Tauchen gelernt. Und nur einen Steinwurf davon entfernt, in Lenggries, bin ich aufgewachsen.
In der nun folgenden Woche bin ich Robbies einziger Schüler. Das macht meine Ausbildung zum «full cave diver» – zum zertifizierten Höhlentaucher – umso intensiver und damit umso besser. Zunächst steht Theorie im Vordergrund, denn gleich in einer Höhle zu tauchen, wäre viel zu gefährlich. Sorgfältig erklärt mir Robbie das Besondere am Höhlentauchen und an der benötigten Ausrüstung: Weil jeder Ausfall eines Gerätes in der Unterwelt tödlich sein kann, muss der Höhlentaucher alle lebenswichtigen Teile doppelt mit sich führen: Gasflasche, Atemregler, Maske, Tauchcomputer.
Zudem erklärt mein Lehrer mir, wie man seine Gasmenge sicher berechnet und wie man sich in Höhlen orientiert. Auch diese Dinge sind eine Lebensversicherung, denn in der Tiefe kann man nicht einfach auftauchen, sollte das Atemgas ausgehen, und genauso wichtig ist es, zu wissen, wo man ist und wie man aus den Gängen zurück zum Eingang gelangt.
An der Art, wie Robbie unterrichtet, merke ich sofort, den richtigen Lehrer getroffen zu haben. Seit vielen Jahren taucht er fast täglich in den Höhlensystemen rund um Tulum und hat dementsprechend einen riesigen Erfahrungsschatz. Und aus jedem seiner Sätze spricht die Leidenschaft für das Höhlentauchen. Diese Begeisterung hatte ihn einen sicheren Job in Deutschland kündigen lassen, um seinen Traum in Mexiko zu verwirklichen.
Und endlich ist es auch für mich so weit. Mit dem Pick-up und unserer Ausrüstung fahren wir zur Cenote «Carwash». Sie wird so genannt, weil die Einheimischen dort früher am Sonntag ihre Autos wuschen. Eigentlich heißt sie Aktun Ha, was in der Sprache der Maya Wasserhöhle bedeutet. Vor uns, zwischen Schilf und abgestorbenen Ästen, öffnet sich ein fast kreisrundes, sanft abfallendes Bassin von fünf bis sechs Meter Wassertiefe, das an ein Schwimmbecken erinnert und von dessen einer Seite der Gang in die Höhle abzweigt. Im Wasser tummeln sich Buntbarsche, Schildkröten und sogar ein kleines Krokodil von einem Meter Länge, das eher Angst vor den Menschen hat, als dass es uns einen Schrecken einjagen könnte.
Bevor es in die Tiefen der Höhle geht, will Robbie einige meiner Tauchfertigkeiten beurteilen, und ich muss sie ihm in dem Becken der Cenote vorführen – unter anderem, wie gut ich mich horizontal im Wasser halten kann. Das ist in der Höhle wichtig, weil der Taucher ja weder nach oben an die Decke schrammen noch auf den Boden sinken darf, wo er Sediment aufwirbeln würde. Ich habe keine Probleme damit. Anschließend führe ich die unterschiedlichsten Flossenschläge vor. Denn während Sporttaucher mit dem klassischen Flossenschlag auskommen, also mit einfachen Auf-und-ab-Bewegungen der Flossen, müssen Höhlentaucher mehrere verschiedene Arten beherrschen. Das ist notwendig, um sich jederzeit sicher und vorsichtig fortbewegen oder drehen zu können, ohne dabei die Höhle zu beschädigen oder irgendwo hängenzubleiben.
Dazu gibt es etwa den «Frogkick», bei dem man die gespreizten Beine mit den Flossen gleichzeitig nach hinten drückt – genauso, wie ein Frosch schwimmt. Dank dieser Technik wird das Wasser nur nach hinten gedrückt, nicht nach unten und oben wie beim normalen Flossenschlag. Und so verhindert der Höhlentaucher, dass Sediment vom Boden aufsteigt und ihm die Sicht nimmt. Andere Varianten ermöglichen dem Taucher zum Beispiel, sich mit der Bewegung nur einer Flosse auf der Stelle im Kreis zu drehen («Helicopter Turn») oder sich mit Hilfe eines speziellen Flossenschlags rückwärtszubewegen, um trotz einer Strömung, die einen weitertreiben würde, auf ein und derselben Stelle zu verharren («Backkick»).
Da mir all diese Varianten bereits von früheren Tauchgängen vertraut sind, ist die Übung bald abgeschlossen. Und dann soll es in den dunklen Schlund der Höhle gehen. Robbie erklärt mir, dass wir dort zunächst keine einzige Übung machen. Er will lediglich sehen, ob ich mit der beengten, finsteren Umgebung klarkomme und mich wohl fühle. Tatsächlich beschleicht mich ein mulmiges Gefühl, als ich das erste Mal in den Abgrund gleite, das Tageslicht hinter mir verschwindet und die Enge nur noch vom Licht unserer Lampen ausgeleuchtet wird. Doch schnell weicht dieses Gefühl einem ganz anderen: der schieren Begeisterung und der freudigen Erwartung, bald die Geheimnisse der Cenoten Mexikos erkunden zu können. Robbie ist zufrieden mit mir.
Doch noch ist meine Ausbildung nicht abgeschlossen, und die Tauchgänge in den folgenden Tagen haben es in sich. Denn das Höhlentauchen ist nicht nur Spaß, sondern ein riskantes Unterfangen. Vor allem in den Anfangsjahren gab es Hunderte von Toten, und selbst erfahrene Taucher können immer wieder in bedrohliche Situationen geraten. Dank einer sorgfältigen, standardisierten Ausbildung und spezieller Ausrüstung hat sich das inzwischen allerdings deutlich verbessert. Der Taucher führt jeweils zwei Flaschen, zwei Atemregler, zwei Tauchcomputer, zwei Masken und sogar drei Lampen mit sich. Sie sind jeweils völlig unabhängig voneinander, und fällt ein Gerät aus, kann er auf das andere zurückgreifen.
Es wird jedes nur erdenkliche Szenario geprobt, um für alle Eventualitäten und Notfälle in einer Umgebung gerüstet zu sein, die keinen Fehler verzeiht. Denn in der von Gestein umschlossenen Umgebung kann man nicht einfach an die Oberfläche steigen, wenn die Gasvorräte ausgehen oder sich eine Panikattacke ankündigt. Und falls man in den dunklen Gängen die Orientierung verliert und nicht zum Ausgang zurückfindet, ist das Gas irgendwann aufgebraucht.
Prinzipiell endet jeder meiner Tauchgänge mit Robbie an der tiefsten, am weitesten entfernten Stelle der Höhle mit einem dramatischen Szenario: dem simulierten Totalausfall aller Lampen. In absoluter Dunkelheit muss ich dann die dünne Höhlenleine packen und mich mit den Händen an ihr zum Ausgang zurücktasten. Eine solche Leine ist quasi die Lebensversicherung eines Höhlentauchers. Er legt sie selbst, wenn er sich in eine neue, bislang unerforschte Umgebung begibt, oder er findet sie in bereits erkundeten Höhlen vor, weil seine Vorgänger sie dort angebracht und hinterlassen haben.
Und so gehört auch das Verlegen der Leinen zu den Übungen, die Robbie mit mir macht. Zudem trainieren wir zahlreiche weitere Notsituationen: Was tun, wenn das Gas plötzlich versiegt? Wie sich verhalten, wenn der Tauchpartner verlorengeht (prinzipiell ist man unter Wasser immer zu zweit unterwegs, um sich gegenseitig helfen zu können)? Wie eine verlorene Leine wiederfinden, was tun, wenn plötzlich Sediment aufwirbelt und die Sicht gleich null ist, wie sich durch eine enge Stelle manövrieren, durch die man eigentlich nicht mitsamt der Ausrüstung hindurchpasst, wie reagieren, wenn sich Teile der Decke lösen und herabrieseln? Und immer wieder: Was tun, wenn plötzlich alle Lampen ausfallen und man sich in völliger Schwärze in einer Welt wiederfindet, in der Panik tödlich ist?
An einem Tag wird es tatsächlich brenzlig. Wir sind tief in der Höhle und spielen eine Situation durch, in der einer der Tauchpartner kein Gas mehr bekommt. In einem solchen Fall gibt der Betroffene ein Notsignal per Handzeichen, und man muss ihn sofort mit Gas versorgen. Robbie gibt also das entsprechende Zeichen, und ich reiche ihm meinen langen Schlauch mit dem Atemregler, damit er wieder Gas bekommt. Ich selbst greife zum «Backup-Regler», der an einer Gummileine unter meinem Kinn hängt und eine zweite Gasversorgung ermöglicht, wenn der Haupt-Atemregler ausfällt – oder man ihn seinem Partner zur Verfügung stellt. Doch als ich ihn mir in den Mund stecke und tief einatmen will, kommt kein Gas! Ich mache große Augen und spüre einen Anflug von Panik. Doch bevor es eskaliert, gibt mir Robbie meinen Haupt-Atemregler wieder zurück und drückt ihn mir in den Mund. Erleichtert ziehe ich das Gas in meine Lunge, doch mein Tauchlehrer formt mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole und tut so, als würde er abdrücken: «Das hätte auch tödlich enden können.»
Und dann beginne ich zu begreifen, was eigentlich geschehen ist. Beim Tauchen zuvor hatte ich mehrmals die niedrige Höhlendecke berührt. In einem solchen Fall muss der Taucher kontrollieren, ob durch die Berührung nicht ein Ventil verändert wurde. Doch ich hatte vergessen, meine Ventile zu checken. Und eben jenes, das den Backup-Regler versorgt, hatte sich dabei von selber zugedreht.
So hätte es jedenfalls gewesen sein können, doch in Wirklichkeit hatte Robbie von mir unbemerkt nachgeholfen und das Ventil zugedreht. Sein Ziel war es, mich in eine Notsituation zu bringen, damit ich lerne, damit umzugehen. Und das war bitter nötig, denn als ich kein Gas aus meinem Backup-Regler erhielt, war ich so perplex, dass ich nicht auf die Idee kam, an das Ventil zu fassen und es zu öffnen. Ein dummer Fehler, der in einer realen Notsituation tödliche Folgen hätte haben können. Doch die Lektion sitzt. Und so gehen meine Hände von diesem Moment an automatisch zum Prüfen an die Ventile, sobald ich eine Höhlendecke auch nur minimal berühre. Und bis heute muss ich dabei jedes Mal an Robbies «Pistolenschuss» und seinen eindringlichen Blick denken.
Nach einer anstrengenden Woche mit vielen intensiven Tauchgängen und Theorie-Lektionen bis in die Abendstunden, gekrönt von einer Abschlussprüfung, überreicht mir Robbie endlich den ersehnten Schein. Nun darf ich mich offiziell «Full cave diver», zertifizierter Höhlentaucher, nennen. Genau an diesem Tag begegne ich im Tauchcenter von Robbie Schmittner einer Taucherin, die gekommen ist, um dort ihre Flaschen aufzufüllen. Sie ist klein und zierlich, hat halblanges schwarzes Haar, braune Augen und einen bunten Schmetterling auf ihr Dekolleté tätowiert. Robbie macht uns bekannt, denn er weiß, dass sie genau wie ich Archäologie studiert hat. Die Taucherin heißt Carmen Rojas, stammt ursprünglich aus Mexico City, lebt und arbeitet aber seit einigen Jahren in Tulum. Schnell kommen wir ins Gespräch, vertiefen uns in fachliche Details unserer Forschungsrichtung und über das Tauchen.
Eine aufregende Idee erwächst vor meinem inneren Auge: Hier in diesem tropischen Land als Unterwasserarchäologe zu forschen, die Geheimnisse der Höhlen und der Ureinwohner Yucatáns zu ergründen, das wäre ein Traum! Doch zunächst bleibt es bei einem nüchternen Austausch von E-Mail-Adressen. Was noch fehlt, um die Idee umzusetzen, sind Instrumente der wissenschaftlichen Kooperation zwischen den Universitäten und eine Finanzierung. Ich verspreche, mich bei Carmen zu melden, sobald ich diese Möglichkeiten in Deutschland ausgelotet habe.
Doch zunächst bleibt mir Zeit, um mich vor Ort auf die Spuren der Maya und ihrer Kultur zu begeben. Mit eigenen Augen möchte ich die sagenumwobenen Ruinen der Ureinwohner Yucatáns sehen, jenes Volkes, das all die Schätze in den Höhlen zurückgelassen hat. Nach einigen entspannten Urlaubstagen in Tulum breche ich auf zu einer Rundreise in die Vergangenheit.
Zunächst geht es in einer drei-, vierstündigen holperigen Fahrt mit dem Bus landeinwärts bis etwa in die Mitte Yucatáns. Dort liegt die Maya-Stadt Chichén Itza. Sie war zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert ein bedeutendes religiöses, ökonomisches, soziales und politisches Zentrum der Halbinsel Yucatán. Bereits 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, ist das 1547 Hektar große Gelände heute eine der wichtigsten Ruinenstätten Mexikos, die jährlich von weit über einer Million Touristen besucht wird. Bereits frühmorgens stehe ich in einer langen Warteschlange, um mein Ticket zu ergattern. Vor allem Amerikaner in XXXL-T-Shirts drängen sich mit mir durch die Straßen der Stadt und fotografieren sich selbst vor jedem Bauwerk, als gäbe es kein Morgen. Überall drängen sich fliegende Straßenhändler, um billigen Ramsch an die Touristen zu bringen, und Esoteriker in weißen Gewändern warten in der sengenden Hitze auf göttliche Energie.
Mit einer kulturellen Entdeckungsreise hat dieser Rummel wenig zu tun, und so flüchte ich mich in die weniger stark besuchte Cenote Sagrado. Sie liegt etwa 400 Meter nördlich der berühmten Pyramide des Kulkulcán, der Schlangengottheit der Maya. Die «heilige Quelle» – Sagrado ist das Wort für «heilig» – ist für mich zum einen interessant, weil sie den Anlass für den Namen der Stadt gab. Denn Chichén Itza bedeutet nichts anderes als Brunnen der Itzá (mit Itzá bezeichnete sich die dortige Bevölkerung der Maya), und mit dem Brunnen war die Cenote Sagrado gemeint. Vor allem aber ist die «heilige Quelle» für mich spannend, weil dort vor mehr als 100 Jahren jene Forschungsrichtung ihren Ursprung hatte, die mich in dieses Land gezogen hat: die Unterwasserarchäologie in Mexiko.
Ihr Pionier war der US-Amerikaner Edward Thompson. Von 1904 bis 1907 hob er mit Hilfe eines Baggers zunächst die auf dem Boden der Cenote liegenden Schlammschichten aus – und förderte zahlreiche Funde zutage. Allerdings zerstörte er dabei auch viele wertvolle Relikte. Aus heutiger Sicht ist die brachiale Methode des Ausbaggerns ein Albtraum, denn sie schadet mehr, als sie an Erkenntnissen bringt. Damals aber war die Archäologie eine sehr junge Disziplin, und die wissenschaftlich-methodische Grabungstechnik befand sich am Anfang. Die Forscher sahen sich vor allem als Schatzsucher, die einzelne, spektakuläre Objekte ausgruben. Heutige Archäologen dagegen legen ein ganzes Grabungsareal systematisch frei und dokumentieren dabei penibel die Lage eines jeden einzelnen Fundstückes, auch wenn es noch so klein und unbedeutend erscheint.
Im Jahr 1909 vollbrachte Thompson eine weitere Pioniertat. Zusammen mit einem griechischen Schwammtaucher begann er die Cenote tauchend zu erkunden und dürfte damit der erste Unterwasserarchäologe in Yucatán gewesen sein. Das allerdings war ein gefährliches Unterfangen. Wegen der vielen Sedimente war das Wasser so trüb, dass die Taucher kaum etwas sehen konnten. Zudem wurden sie ständig von Gesteinsbrocken bedroht, die sich von den 10 bis 15 Meter hohen Wänden der Cenote lösten und in die Tiefe stürzten. Und schließlich platzten Thompson wohl beide Trommelfelle, da er zu schnell in die Tiefe sank und den Druck nicht ausglich, den das Wasser auf das Ohr ausübte. Heute lernt jeder Tauchschüler, den Druck permanent zu kompensieren, indem er mit zugehaltener Nase Luft aus der Lunge in die Verbindungsgänge zum inneren Ohr presst. Bereits nach einer Kampagne stellte Thompson daher die gefährliche Methode der Unterwasser-Erkundung wieder ein.
Erst in den späten 1960er und 1980er Jahren wagten sich erneut Taucher in die Cenote, um sie archäologisch zu erkunden, und sie hatten dabei mit denselben Problemen zu kämpfen wie Thompson. Doch Aufwand und Risiken haben sich gelohnt. Mehr als 30000 Fundstücke bargen die Forscher, zählt man alle Kampagnen zusammen. Vor allem sind es zahllose Objekte aus Gold, Jade, Keramik und Holz. Überwiegend im westlichen Teil der Cenote jedoch fanden sich Objekte, die von menschlichen Dramen zeugen: Skelettreste von 73 Individuen, hauptsächlich Schädel. Welches Schicksal ihnen widerfuhr, glauben die Forscher aufgrund geschichtlicher Berichte und der archäologischen Befunde inzwischen zu wissen.
Im 16. Jahrhundert ließ der spanische Bischof Diego de Landa zwar viele wertvolle Dokumente zur Geschichte und Kultur der Maya verbrennen, jedoch verfasste er einen «Bericht über die Dinge von Yucatán» und notierte darin interessante Einzelheiten über die Cenote von Chichén Itza:
«Die Indios hatten damals und später den Brauch, lebende Menschen in diesen Brunnen zu werfen, um sie den Göttern zu opfern, wenn eine Dürre herrschte; und sie dachten, diese Menschen würden nicht sterben, obwohl man sie nicht wiedersah. Sie warfen auch viele Gegenstände aus Stein hinein, die wertvoll waren und die sie schätzten. Und wenn es Gold in diesem Land gegeben hätte, so fände sich daher in diesem Brunnen der größte Teil von ihm, derart andächtig verehrten ihn die Indios.
Der Brunnen reicht gute sieben Klafter bis zum Wasser hinab, ist über hundert Fuß breit und bis zum Wasser rund aus einem Felsen gehauen, dass es Bewunderung erregt. Sein Wasser scheint ganz grün zu sein; und ich glaube, dies wird von den Baumgruppen bewirkt, die ihn umstehen, und er ist sehr tief; oberhalb von ihm, neben seiner Eingangsöffnung, steht ein kleines Gebäude, in dem ich Götzenbilder fand, mit denen alle Hauptgötter des Landes geehrt werden sollten, beinahe wie das Pantheon in Rom.»
Die Cenote war also eine Wallfahrtsstätte, an der Götter befragt und rituell Menschen sowie wertvolle Objekte geopfert wurden. Nicht Trinkwasser schöpften die Maya aus dem runden, im Durchmesser 50 Meter großen Wasserbecken, sondern sahen es ausschließlich als einen magischen, heiligen Ort an. Kolonialzeitliche Zeugen vergleichen die Stätte in ihrer Bedeutung mit Rom oder Jerusalem. Das bestätigen heute die archäologischen Funde. Und auch das Schicksal der Toten in dem Brunnen wurde geklärt, denn an den Knochen entdeckte Schnittspuren lassen kaum einen anderen Schluss zu: Hier wurden tatsächlich Menschen geopfert.
Meine Studienreise in die Geschichte der Maya führt mich weiter in Richtung Süden. Mehrere hundert Kilometer muss ich im Überlandbus hinter mich bringen, um bis in die Ruinenstadt Bonampak im Bundesstaat Chiapas zu gelangen. Sie wurde erst 1946 entdeckt und ist wegen ihrer extrem gut erhaltenen Wandgemälde berühmt. Tief beeindruckt stehe ich vor den bunten Fresken, die sich über drei kleine Räume verteilen. Denn sie stellen das Leben der Maya eindrücklich und lebendig dar: Herrscher samt Gefolge, Tribut- und Kriegsszenen, ein Strafgericht, Tanzszenen und Blutopfer adliger Frauen. Nirgendwo sonst im Reich der Maya wurden bislang Wandmalereien entdeckt. Sie gehören zu den bedeutendsten Kunstwerken im präkolumbianischen Amerika.
Nach dem Besuch von Bonampak miete ich mir ein kleines Motorboot und fahre den Rio Usumacinta hinauf. An einer Flussschleife unweit der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala liegt mein nächstes Ziel: Yaxchilán. Übersetzt bedeutet das etwa «Grüne Steine» – ein Name, den der deutschösterreichische Archäologe Teobert Maler dem Ruinen-Ensemble Ende des 19. Jahrhunderts gab und der auf die vielen dort gefundenen Skulpturen anspielt. Wie die Maya selbst die Stadt einst nannten, ist nicht überliefert.
Und dann naht die letzte Station und gleichzeitig der Höhepunkt meiner Expedition in die längst untergegangene Welt der Maya: Tikal. Die Ruinen dieser riesigen Stadt liegen verborgen in den Regenwäldern im nördlichen Guatemala. Es gießt in Strömen, als ich sie endlich erreiche, und der Boden dampft wie ein schwitzender Riese, nachdem der Regen nachgelassen hat. Überall dringen Laute aus dem immergrünen Pflanzendickicht; Vögel schreien mit Brüllaffen um die Wette. Und sofort schwirren wieder unzählige Moskitos aus, um sich auf mich zu stürzen und mein Blut zu saugen. Über mir sehe ich einen bunten Tukan mit imposantem Schnabel im Dickicht sitzen, und vor mir kreuzt ein Nasenbär gemächlich den schmalen Pfad.
Doch was mich noch viel mehr begeistert, sind die Zeugnisse der Vergangenheit. Immer wieder komme ich an steinernen Gebäuden, mächtigen Pyramiden, Tempeln und Steinstelen mit geheimnisvollen Hieroglyphen und Bildern vorbei. Ich fühle mich in die Kulisse eines Indiana-Jones-Films hineinversetzt. Und wieder wird mir bewusst, welch ungewöhnlichen, spannenden Beruf ich habe. Als Archäologe durfte ich schon viele herausragende historische Fundstellen besuchen, aber kein Ort – ausgenommen die Pyramiden von Meroe im Sudan – beeindruckt mich mehr als Tikal. Diese Stadt ist für mich mit Abstand die schönste und exotischste aller Maya-Ruinen.
Und sie ist gigantisch. Über 65 Quadratkilometer erstreckt sich das Gelände mit den steinernen Resten und droht beständig von wuchernden Gewächsen des Dschungel verschlungen zu werden. Fleißigen Gärtnern ist es zu verdanken, dass man zumindest Teile von Tikal ohne Machete erkunden kann. Allein der zentrale Bereich mit mehr als dreitausend Bauten nimmt rund 16 Quadratkilometer ein. Archäologen schätzen, dass in den Außenbereichen an die 10000 Gebäude noch darauf warten, ihre Geheimnisse preiszugeben. Und doch ist sie eine der am besten erforschten Maya-Städte, ist ihre geschichtliche Entwicklung gut bekannt.
Erstmals besiedelt wurde sie wohl im frühen 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Mindestens 50000 Einwohner dürften auf dem Höhepunkt der Macht während der klassischen Periode im 8. Jahrhundert im Stadtzentrum gelebt haben, und inklusive der umliegenden Siedlungen mögen es sogar bis zu 200000 Menschen gewesen sein.
Wie in allen Städten der Maya liegt auch im Zentrum von Tikal ein Platz, der den räumlichen und kultischen Mittelpunkt der Stadt bildete und von beeindruckenden Ausmaßen ist. Solche großen, öffentlich zugänglichen Plätze waren ein Mittelpunkt des gesellschaftlichen, aber auch des religiösen Lebens. Sie sind von den höchsten Tempelpyramiden, den Wohnkomplexen des Adels und der Königsfamilie umgeben. All diese Bauten sind nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet: Ost und West markieren im Weltbild der Maya die Orte des täglichen Sonnenauf- und -untergangs, Norden und Süden stehen für Himmel und Unterwelt.
Doch Anfang des 9. Jahrhunderts begann Tikal sich dramatisch zu verändern und zu verfallen. Die jüngste Datierung einer Stele weist auf das Jahr 879 hin; offenbar ist die Stadt danach verlassen worden. Doch was geschah, bleibt rätselhaft. Möglicherweise verloren die Eliten ihre Macht, und zahllose Menschen verließen die Stadt oder fielen einem Massensterben zum Opfer. Die genauen Ursachen für den Kollaps der gesamten Maya-Zivilisation zu genau diesem Zeitpunkt sind bis heute nicht geklärt. Vielleicht hat auch eine verheerende Dürreperiode in Yucatán zum Untergang des Volkes beigetragen. Die Klimakatastrophe setzte um 800 ein und bescherte den Menschen extrem trockenes Klima bis in das 10. Jahrhundert hinein.
Das alles geht mir durch den Kopf, während ich im Zentrum Tikals umherwandere und den 47 Meter hohen «Tempel 1» fotografiere. Und ich frage mich, wie ein Volk, das weder das Rad noch die Metallverarbeitung kannte, in der Lage war, solche imposanten und wunderschönen Bauwerke zu errichten. Wer waren die Herrscher, die so viel Macht besaßen? Und wer die Handwerker und Arbeiter, die diese Gebäude errichten mussten? Während ich über diese Fragen sinniere und einen kräftigen Schluck aus meiner Wasserflasche nehme, öffnet sich der Himmel erneut und entlässt Regenmassen auf die Erde.
Auch wenn ich gerne länger geblieben wäre, ist meine Reise in die Vergangenheit schließlich doch zu Ende, und ich muss zurück nach Deutschland. Die Maya allerdings lassen mich nicht los. Schon auf dem Rückflug lese ich das Buch «Kollaps» des berühmten Evolutionsbiologen Jared Diamond. Er hat sich mit dem Überleben und Untergehen von Gesellschaften beschäftigt und dazu interessante Thesen aufgestellt. Während ich in das Buch vertieft bin, bemerke ich plötzlich alarmierende Veränderungen in meinem Körper. Mir wird übel, heiß, und ich fühle mich kraftlos. Stündlich geht es schlechter. In Hamburg gelandet, schleppe ich mich zum Bus Richtung Kiel und suche dort sofort das städtische Krankenhaus auf.
In mir schrillen die Alarmglocken: Vor einigen Jahren kam ich schon einmal von einer archäologischen Expedition aus dem Dschungel Ghanas mit einem tropischen Fieber zurück. Doch die Kieler Ärzte sind zunächst ratlos. Malaria können sie ausschließen, aber was es sonst sein könnte, ist nicht klar. Doch die Symptome werden immer stärker: Meine Gelenke und Muskeln schmerzen ungemein, und ich habe so starkes Fieber, dass meine Brille beschlägt. Der Anteil an weißen Blutkörperchen und Blutplättchen nimmt dramatisch ab, und die Leberwerte sinken immer tiefer. Schließlich wird den Ärzten klar: Ich habe Denguefieber. Und zwar die heftige Variante mit hämorrhagischem Fieber – also eine tropische Erkrankung, die mit Blutungen einhergeht. Sie wird von einer kleinen Stechmücke übertragen, und das muss auf meiner letzten Reisestation passiert sein. Es ist mein persönliches Souvenir aus Tikal.
Ich komme auf die Isolierstation, und da Denguefieber als Viruserkrankung nicht mit Medikamenten zu kurieren ist, muss der Körper selbst damit fertigwerden. Also verbringe ich Weihnachten und die Woche danach im Krankenhaus. Lediglich mit Wasser und alle drei Stunden mit einem Schmerzmittel versorgt, verliere ich bei der Tortur zehn Kilogramm. Ich erinnere mich an diese Woche so gut wie gar nicht mehr, und das ist vermutlich auch besser so.
Selbst ein halbes Jahr später spüre ich, dass ich noch nicht wieder ganz bei Kräften bin. Trotzdem muss ich ständig an die Maya und die Cenoten denken. Täglich sitze ich ungeduldig in meinem kleinen Büro im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Kieler Universität, telefoniere, recherchiere, schreibe Exposés und versuche Gelder für eine erste Expedition zu bekommen. Meine Überzeugungsarbeit wirkt, und die Universität stellt mir so viele finanzielle Mittel zur Verfügung, dass zumindest der Flug nach Mexiko für mich und eine kleine Gruppe Forschungstaucher bezahlt werden kann. Doch was nicht weniger wichtig ist: Wir erhalten einen offiziellen Forschungsauftrag, um mit den mexikanischen Kollegen des INAH (Instituto National de Antropología e Historia) im Rahmen des Projektes «Underwater Archaeological Atlas» die Cenoten und Höhlensysteme gemeinsam archäologisch zu erkunden.
Mit Carmen Rojas tausche ich während der ganzen Zeit Mails aus. Als ich ihr nun die gute Nachricht übermittle, ist sie hocherfreut, dass wir uns wiedersehen und die Kieler Archäologen sie unterstützen werden. Doch noch ist es nicht so weit. Erst im Jahr darauf können wir nach Mexiko aufbrechen, um einige Geheimnisse der Maya sowie noch früherer, prähistorischer Bewohner wissenschaftlich zu ergründen.
Vor allem aber muss ich zunächst ein Team zusammenstellen, muss Wissenschaftler finden, die Taucherfahrung haben, über Zeit verfügen, ebenso enthusiastische Höhlenforschungstaucher sind wie ich und bereit, sich in die Thematik einzuarbeiten. Mir fallen sofort Uli Kunz und Christian Howe ein. Sie haben die gleiche Ausbildung am Forschungstauchzentrum in Kiel gemacht wie ich, und wir kennen uns bereits aus der Zusammenarbeit von vielen Projekten. Was mir wichtig ist: Sie sind nicht nur exzellente Forschungstaucher, sondern wir liegen auch auf einer Wellenlänge. Und persönliche Sympathie ist bei einer Expedition – schon gar, wenn sie in ferne Länder führen soll – eminent wichtig. Uli ist außerdem ein sehr guter Fotograf, und Chris hat sich auf Unterwasservideo spezialisiert. Beides – die Dokumentation des Arbeitsprozesses und der Ergebnisse durch hochauflösende Fotos und Videos – sind heutzutage Standard in der Archäologie, und ich ahne, dass sie für unsere Arbeit noch eine zentrale Rolle spielen werden. Neben Uli und Chris, die sofort begeistert zusagen, spreche ich die Archäologin Ruth Blankenfeldt und den Geologen Nikolaus Bigalke an. Mit Ruth habe ich studiert, und Niko kenne ich ebenfalls vom Forschungstauchen. Wir sind seit längerer Zeit befreundet, und ich bin mir sicher, dass wir gut harmonieren werden. Schließlich werden wir lange Zeit auf engem Raum zusammenleben und anspruchsvolle, nicht ungefährliche Taucharbeiten in den Höhlen und Cenoten vornehmen, bei denen sich jeder auf den anderen absolut verlassen können muss. Auch sie sind Feuer und Flamme, als ich von dem geplanten Kooperationsprojekt in Mexiko berichte.
Im August 2009 ist es dann endlich so weit, und wir fliegen nach Cancún. Weil das Budget, das uns die Universität Kiel zur Verfügung stellt, begrenzt ist, mieten wir zwei Kleinwagen, deren Marke in Deutschland völlig unbekannt ist. Sie sind so winzig, dass wir die Rücksitzbänke umklappen müssen, um unsere Tauch- und Fotoausrüstung sowie die Gepäckstücke hineinzwängen zu können. So rattern wir nach Tulum. Auch dort wird es eng: Mit unseren knappen finanziellen Mitteln können wir uns nur ein kleines 2-Zimmer Apartement leisten, das nicht einmal über eine Klimaanlage verfügt. Wie sehr uns die schwüle Hitze und der äußerst begrenzte Raum dort in den nächsten vier Wochen zu schaffen machen werden, ist uns zum Glück noch nicht klar.
Als Nächstes suchen wir Carmen Rojas auf, deren Büro sich direkt bei den Maya-Relikten am Strand von Tulum befindet. Anders als alle anderen bekannten Fundstätten liegen die Ruinen von Tulum direkt am Meer, und die Stadt war vermutlich für die indianischen Ureinwohner wegen ihrer günstigen Lage ein wichtiger Handels-Knotenpunkt, der mehrere Regionen miteinander verband. Leguane sonnen sich auf den heißen Felsen und beäugen uns kritisch, als wir den kleinen Weg vom Parkplatz zum Kassengebäude der Ruinenanlage gehen, in deren oberem Stockwerk die Räume der Archäologen untergebracht sind. Wir betreten ein kleines Büro, das vollgestopft ist mit Büchern, Tauchzubehör und Grabungsutensilien. Carmen begrüßt uns überschwänglich und stellt uns einige ihrer Kollegen vor. Schnell sind wir beim Thema unseres Besuchs und erörtern, welche Cenoten und Höhlen am vielversprechendsten sind, um dort in den kommenden Wochen zu tauchen und sie archäologisch zu untersuchen.
Die Wahl für das erste Ziel fällt auf das ungefähr 31 Kilometer lange Höhlensystem Toh Ha. Wir stopfen unsere Kleinwagen bis unters Dach voll mit der Ausrüstung und machen uns auf zu der etwas südlich von Tulum gelegenen Cenote Chan Hol. Über sie soll der Einstieg in das riesige Höhlensystem Toh Ha erfolgen. Chan Hol bedeutet in der Maya-Sprache «Kleines Loch». Wie treffend dieser Name gewählt wurde, sehen wir sofort, als wir ankommen. Bei der Cenote, die wenig romantisch direkt an einer großen Bundesstraße liegt, handelt es sich um ein kleines, vielleicht zwei mal zwei Meter messendes dunkelschwarzes Loch. Nur das Ende einer weißen Leine sowie ein darin eingehängter, knapp über der Wasseroberfläche schwebender kleiner weißer Pfeil deuten darauf hin, dass sich hier die Eintrittspforte in ein kilometerlanges unterirdisches Wassersystem befindet.
Wir entladen die Autos und bauen unsere Ausrüstung zusammen. Dann klettern wir einen kleinen Trampelpfad hinunter zur Cenote und steigen einer nach dem anderen ins nur etwa hüfttiefe Wasser. Kaum zu glauben, dass in einer der Ecken dieser «Badewanne» ein schmaler Eingang in eine gewaltige Höhlenwelt führen soll. Wie vor jeder Expedition in die Unterwelt haben wir zuvor einen Tauchplan entworfen, in dem wir genauestens festgelegt haben, wie weit und in welche Tiefe wir vordringen wollen, wie viel Atemgas wir benötigen werden, was wir zu sehen und zu dokumentieren hoffen und wer dabei welche Aufgaben übernehmen soll, denn unter Wasser ist die Kommunikation nur schwer möglich und sollte sich auf das Notwendigste beschränken.