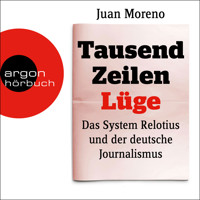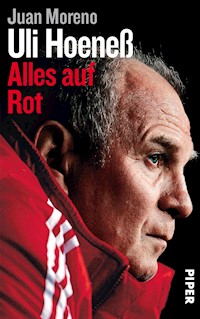14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Juan Morenos Bericht über den größten Fälschungsskandal seit Jahrzehnten Ein Reporter des «Spiegel» lieferte Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland, bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom «Spiegel» und seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren – ganz oder zum Teil – frei erfunden. Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen heftigen Widerstand im «Spiegel», die Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so stimmig, so schön. Claas Relotius schrieb immer genau das, was seine Redaktionen haben wollten. Aber dennoch ist zu fragen, wieso diese Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben konnten. Juan Moreno schreibt mehr als die unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt, was diese über den Journalismus aussagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Juan Moreno
Tausend Zeilen Lüge
Das System Relotius und der deutsche Journalismus
Über dieses Buch
Es war der größte Fälschungsskandal seit Jahrzehnten: Ein Reporter des «Spiegel» hatte Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland geliefert, bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. Sie alle wurden vom «Spiegel» und seiner legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren – ganz oder zum Teil – frei erfunden.
Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen heftigen Widerstand im «Spiegel», die Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so stimmig, so schön. Claas Relotius schrieb immer genau das, was seine Redaktionen haben wollten. Aber dennoch ist zu fragen, wieso diese Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben konnten. Juan Moreno schreibt mehr als die unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt, was diese über den Journalismus aussagt.
Vita
Juan Moreno, geboren 1972 in Huércal-Overa (Spanien), arbeitete zunächst für den WDR, dann von 2000 bis 2007 für die «Süddeutsche Zeitung». Seitdem ist er als Reporter für den «Spiegel» in aller Welt unterwegs. Er hat mehrere Bücher verfasst, zuletzt die Biographie «Uli Hoeneß. Alles auf Rot» (2014).
Inhaltsübersicht
«Wenn die Arbeit ...
Statt einer Einleitung Der Solokletterer auf dem Gipfel
Doch eine Einleitung Was dieses Buch ist – und was nicht
1. Kapitel Die Reportage
2. Kapitel Zwei Reporter und eine Geschichte
3. Kapitel Der Text, der alles veränderte
4. Kapitel Showtime
5. Kapitel «Wir glauben erst mal gar nichts»
6. Kapitel Der treue Claas
7. Kapitel Warum ich?
8. Kapitel Die Konfrontation
9. Kapitel Es war alles ganz anders
10. Kapitel Ermittlung
11. Kapitel Es hätte alles viel früher auffliegen müssen
12. Kapitel Endgame
13. Kapitel Der Journalismus ist ein anderer geworden
14. Kapitel Über das Versagen des «Spiegel»
15. Kapitel Dopamin
16. Kapitel Relotius und wir
Danksagung
«Wenn die Arbeit getan ist, wirkt alles einfach und glatt. Als sei die Story ordentlich verpackt und mit einer Schleife verziert dahergekommen. So ist es nicht. Darüber möchte ich sprechen: Wie es ist, wenn man mittendrin steckt. (…) Plötzlich stand alles in Frage. Meine gesamte Karriere drohte in die Brüche zu gehen.»
Ronan Farrow, US-Journalist und Auslöser der weltweiten «MeToo»-Debatte, am 3. Dezember 2018 beim Deutschen Reporterpreis.
Statt einer EinleitungDer Solokletterer auf dem Gipfel
Er war nicht in Panik. So viel steht fest. Es war die Nacht zum 3. Dezember 2018, Stunden vor dem größten Triumph seiner Karriere. Pressedeutschland würde sich bald wieder geschlossen vor ihm verneigen. Zum vierten Mal würde er den Reporterpreis gewinnen. Vier Mal in fünf Jahren. Das hatte es noch nie im Journalismus gegeben. Aber unglaublicher als das finde ich noch immer, dass Claas Relotius, der wohl größte Hochstapler im deutschen Journalismus, nicht in Panik war.
Kollegen, die diesen Tag mit ihm verbracht haben, sagen, dass er ein wenig ernster als sonst gewirkt habe, nachdenklicher. Aber panisch? Nein, sicher nicht.
Es gibt Filmaufnahmen von diesem Tag. Ich habe sie mir immer wieder angesehen. Es stimmt. Relotius wirkt völlig normal. Sogar ausgelassen. Je häufiger ich mir das Video anschaue, desto unwirklicher wirkt es auf mich. Dabei hatte er doch kurz vor dessen Aufzeichnung am 3. Dezember 2018 diese Nachricht erhalten:
Hello Claas,
may I ask how you wrote an article on Arizona Border Recon without coming down for an interview? Strikes me as odd that a journalist would write a piece without physically collecting facts.
Jan AZBR
Hallo Claas,
darf ich fragen, wie du einen Artikel über die Arizona Border Recon schreiben konntest, ohne hier für ein Interview aufzutauchen? Ich finde es komisch, dass ein Journalist ein Stück schreibt, ohne persönlich die Fakten zusammenzutragen.
Jan, AZBR
Ich kann mir das nur so erklären, dass er schon Dutzende Male in einer ähnlich ausweglosen Situation gewesen sein musste. Die vielen Lügen hatten sein Leben mit Sprengfallen umgeben. Man kann daran zerbrechen oder mit der Zeit zum Meister dieser Sprengfallen werden. Man kann die Überzeugung entwickeln, letztlich immer einen Ausweg zu finden, immun zu sein, ganz gleich wie schwierig die Ausgangslage ist. Immer und immer wieder stand Relotius kurz davor, als Hochstapler aufzufliegen. Er war Journalist in einem Ressort, in dem lauter Spitzenreporter saßen, die beruflich nichts anderes machten, als Menschen zu treffen, sie kritisch zu befragen und aufzuschreiben, was von diesen Menschen zu halten ist. Relotius war von Berufsskeptikern umgeben. Sie alle hatte er über Jahre mühelos umtänzelt.
Ich stelle ihn mir in dieser Zeit wie einen Solokletterer vor. Einer dieser Menschen, die ungesichert eine Steilwand hinaufsteigen, ab und zu in ihren Kreidebeutel am Rücken greifen und mit der Endlichkeit ihrer Existenz kokettieren. Das Unerträgliche ertragend, gewöhnt an den Gedanken, dass ein Fehler alles zerstören kann, und dennoch siegesgewiss. Gelassene Todgeweihte. Bei Gefahr reagieren sie kühl, rational. Der Angst wird Präzision und Kontrolle entgegengesetzt, beherzt und gekonnt, bis sie wieder Herr ihres Wahnsinns werden. Für mich als Außenstehenden, als Beobachter eines solchen Solokletterers, ist diese Ruhe verstörend. Mich lähmt Angst, der Gedanke, dass man manche Dinge schlichtweg nicht im Griff haben kann. Ich wäre in Panik.
Der Reporter Claas Relotius spielte seit fast zehn Jahren mit unglaublichem Einsatz, ging mit jedem gefälschten Text ein sagenhaftes Risiko ein, und immer wieder stand er kurz davor, alles zu verlieren.
Wahrscheinlich war Relotius im Dezember 2018 einfach an den Druck gewöhnt. Die E-Mail an diesem 3. Dezember schien für ihn nicht das zu sein, was ich in ihr sah: eine Bombe, die unweigerlich detonieren würde. Auf Relotius wirkte sie vermutlich anders. Er hatte den Abgrund oft erlebt. Für ihn war es einfach nur eine weitere E-Mail in einer langen Liste von E-Mails, die alle anfangs «unweigerlich» Richtung Katastrophe deuteten und ihn doch nie aufhalten konnten.
Das hier war seine Steilwand, die Regeln hatte er aufgestellt. Relotius war in all den Jahren von unterschiedlichsten Leuten damit konfrontiert worden, ein Lügner, ein Fälscher und Hochstapler zu sein. Er hatte eine ganze Reihe Leserbriefe, Anrufe, E-Mails erhalten, und stets wurden ihm Fehler vorgeworfen, gut belegte Fehler. Jeder dieser Vorwürfe hatte das Potenzial gehabt, seine Karriere auszulöschen, seinen Namen für immer zu ruinieren. Es waren Anschläge auf das Leben, das er führte, auf sein Image als junge, neue Stimme der Reportage. Er, Claas Relotius, hatte alle Attacken überlebt. Ganz gleich wie groß die Gefahr schien, am Ende gelang es ihm immer, sie zu bannen.
Das Wahrscheinlichste ist also, dass Relotius sich am 3. Dezember fragte, warum es jetzt anders sein sollte?
Die E-Mail, die Relotius am Morgen des 3. Dezember bekommen hat, ist von Jan Fields, Sprecherin der «Arizona Border Recon» (AZBR), einer militanten Bürgerwehr im Süden der USA. Der Verein bewacht freiwillig und unentgeltlich die Staatsgrenze der USA, um sie laut eigenen Statuten gegen illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu schützen. Politisch muss man sich die Gruppe ein bisschen wie einen Tarnfarbe tragenden, leicht entsicherten AfD-Ortsverband vorstellen, der zudem bis auf die Zähne bewaffnet ist und sich ein wenig nach Krieg sehnt. Es ist keine große Gruppe, im Grunde besteht sie aus zwei Leuten. Der Gründer heißt Tim Foley, ein beseelter Trump-Versteher, der früher als Zimmermann arbeitete, bis er vor zehn Jahren seine drei Harleys verkaufte, weil ihn die Weltwirtschaftskrise ruiniert hatte. Er zog in den Süden, nach Arizona, an die Grenze zu Mexiko. Er kaufte sich einen Trailer für zehntausend Dollar und lernte seine Freundin Jan Fields kennen. Sie kümmert sich um das Organisatorische im Verein. Anders als Foley spricht Jan nicht so gern mit Journalisten.
Ab und zu haben die beiden Gäste. Beschützer des amerikanischen Volkes. Entschlossene, wütende Männer und fast immer mit liebgewonnener Waffensammlung anreisend. Sie bewachen für ein, zwei Wochen im Jahr die US-Grenze. Sie hausen in einer improvisierten Kommandozentrale, die Foley am Fuß eines Hügels errichtet, und schauen durch Ferngläser in die Wüstenlandschaft Arizonas. Dabei genießen sie das Gefühl, Patrioten zu sein, die nicht nur wütend in den Fernseher schreien, sondern tatsächlich etwas tun, um Amerika zu verteidigen. Wenn die Männer nicht in der Kommandozentrale sind, patrouillieren sie in einem Pick-up-Truck an der Grenze, meist im Streit, wer fahren darf. Es ist in vielen Fällen nicht ganz klar, wen sie wirklich bekämpfen: Amerikas Feinde oder ihre eigenen Dämonen. Wahrscheinlich beide.
Tim Foley und seine Freundin Jan Fields sorgen gegen Bezahlung für die Logistik der temporären Grenzbewachung. Sie haben Wildkameras in Bäumen und Sträuchern versteckt, besitzen Funkgeräte und kümmern sich ums Essen. Die «Arizona Border Recon» ist im Grunde ein Dienstleister. Sie bietet mittelmilitanten Rechten in den USA eine Art politisch korrektes Urlaubsangebot, eine Mischung aus White-Supremacy-Pfadfindertum, Latinojagd und Falludscha-Invasionsromantik.
Wenn Tim Foley und seine Freundin keine Gäste haben, also zehn von zwölf Monate im Jahr, leben sie von den Journalisten, die sie besuchen. Man ahnt nicht, wie groß der weltweite Bedarf an bewaffneten, rechten US-Spinnern für Berichterstattungszwecke ist. Foley und Fields haben eine Marktnische entdeckt. Sie sind stramm rechts, aber nicht dumm. Da die Freak-Nachfrage seit der Wahl Donald Trumps gestiegen ist und echte, wirklich radikale Gruppen keine Interviews geben, weil zu ihren Feinden nicht nur die Regierung, sondern auch die Presse zählt, stehen Reporter vor einem Problem. Sie wissen, dass es solche Gruppen gibt, können ihren Lesern oder Zuschauern aber keine zeigen. Foley und Fields helfen da gern. Sie bieten die Show, die erwartet wird, inklusive Kalaschnikows, Handgranatenattrappen und kernigen Sprüchen wie diesen: «Wenn extrem bedeutet, nicht auf der Couch sitzen zu bleiben und dabei zuzusehen, wie dieses Land kaputtgeht, ja, dann bin ich Extremist.»
Das Interview kostet zweihundert Dollar. Reist man mit Kamerateam an und hat Sonderwünsche, mehr. Die «Arizona Border Recon» ist die bekannteste Bürgerwehr der Vereinigten Staaten. Foley und Fields haben eine Homepage. Es gibt Dutzende Artikel, Fernsehbeiträge, Radiofeatures, sogar einen Oscar-nominierten Dokumentarfilm über sie.
Claas Relotius meldete sich am 28. Oktober 2018 bei Foley. Er schrieb damals, dass er Reporter für den «Spiegel» sei, Europas größtes Nachrichtenmagazin, und sich für die «wichtige Arbeit» der «Arizona Border Recon» interessiere. Jeden Tag versuchten Menschen, illegal in die USA zu gelangen, «ich bin interessiert an den Leuten, die diese Menschen stoppen». Relotius erhielt, wie jeder Journalist, der Foley und Fields anschreibt, erst mal eine automatische Antwort. In ihr heißt es, dass der Verein eigenfinanziert sei und Geld für Interviews verlange. Wenn man einverstanden sei, könne man einen Termin vereinbaren. Relotius reagierte nicht.
Gute fünf Wochen später ist Jan Fields wütend. So wütend, dass sie direkt in ein Flugzeug steigen will, um nach Deutschland zu fliegen. Sie will Claas Relotius «ins Gesicht spucken», einem Mann, der sie nie gesehen hat, der aber über sie und ihre Organisation geschrieben hat. Die Reportage heißt «Jaegers Grenze», erschienen am 17.11.18 im «Spiegel». Jan fragt, wie er es wagen kann, über sie zu schreiben, ohne jemals dagewesen zu sein.
Relotius antwortet umgehend. Allerdings kurz. Es ist der Morgen des 3. Dezember.
Hi Jan!
Why do you think I did?
Best Claas
Hallo Jan,
warum glaubst du, ich hätte das getan?
Grüße
Claas
Gute zehn Stunden später, am selben 3. Dezember 2018, früher Abend. Vierhundert geladene Gäste sitzen im Tipi am Kanzleramt. Ein Theaterzelt im Herzen des Berliner Regierungszentrums. Einer der wichtigsten, viele sagen, der wichtigste deutsche Journalistenpreis soll vergeben werden. Ein Preis, der nicht von einem Magazin gesponsert wird oder einer Zeitung, einem Ministerium oder einem Industrieverband. Der Reporterpreis ist ein Preis von Journalisten für Journalisten. Das ist die Eigenwerbung. Das macht ihn einzigartig. Über hundert Vorjuroren, alles Profis, arbeiten sich durch eine Fülle an Einsendungen, weit über tausend. Sie geben eine Vorauswahl an die knapp vierzig Hauptjuroren weiter, darunter Chefredakteure, Ressortleiter, Starjournalisten, die Spitze der Branchenprominenz. Sie entscheiden letztlich, wer die besten Texte des Jahres in den jeweiligen Kategorien geschrieben hat. Der Preis ist so wichtig, dass er es sich leisten kann, kein Preisgeld auszuloben. Jeder Journalist will ihn gewinnen. Viele Karrieren beginnen erst, nachdem man ihn gewonnen hat.
Man sollte aber nicht glauben, dass der beste Text gewinnt. Es gibt den «besten» Text nicht. Genauso wenig wie es das beste Bild, das hübscheste Grübchen oder das schönste Kinderlächeln gibt. Reporterpreise sagen in erster Linie etwas über den persönlichen Geschmack der Jury, den Zeitgeist und erst dann etwas über die Qualität der Texte. Es ist ein furchtbar unfaires, viel zu subjektives Verfahren.
Es gibt kein besseres.
Ehrengast an diesem Dezemberabend ist Ronan Farrow, Sohn von Woody Allen und Mia Farrow und derzeit einer der angesehensten Journalisten der Welt. Farrow brachte die sexuellen Übergriffe des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ans Licht, seine Recherchen lösten die weltumspannende «MeToo»-Debatte aus. Dafür soll er heute mit dem «Sonderpreis für Investigation» ausgezeichnet werden. Alice Schwarzer, die große deutsche Frauenrechtlerin, hält die Laudatio. Schwarzer würdigt Farrows Leistung. Er habe «das Fundament der Macht ins Wanken gebracht» und «die Omertà gebrochen». Viele Frauen auf der ganzen Welt würden jetzt nicht mehr schweigen. Dafür gebühre diesem Journalisten Dank.
Ronan Farrow kommt auf die Bühne, umarmt Alice Schwarzer und hält im Anschluss eine Rede, wie sie nur Amerikaner halten können. Voller Wärme, Größe und Wahrhaftigkeit. Er beschreibt, was Journalisten ausmacht, nämlich letztlich alles dieser inneren Stimme zu unterwerfen. Sie sagt, was zu tun ist.
Auch ich hörte an diesem Abend eine innere Stimme.
Ich hatte ein paar Tage zuvor meinen Chefs mitgeteilt, dass ich massive Schwierigkeiten mit dem Reporter des Jahres Relotius hatte. In seinem Teil unserer Reportage «Jaegers Grenze» hatte ich einige heftige Unstimmigkeiten entdeckt. Sie glaubten mir aber nicht, waren davon überzeugt, dass ich «Rufmord» begehen und «die Karriere eines jungen Kollegen ruinieren» wollte.
Meine innere Stimme beackerte mich schon länger. Einer ihrer Vorschläge war, erneut zu meinen Chefs zu gehen, mich zu entschuldigen und zuzugeben, dass ich mich verrannt hatte. Meine Frau und ich sind beide freie Journalisten, unserer Branche geht es nicht gut. Für eine Reportage bezahlt eine Zeitung mittlerweile etwa dreihundert, vierhundert Euro, man arbeitet daran über eine Woche. Wir haben vier Kinder. «Mein Freund, es wäre ein Weg, dein Leben zurückzubekommen», sagte meine innere Stimme.
Während Ronan Farrow vor der versammelten Journalistenprominenz sprach, saß ich in einem Motel in Las Vegas und fragte mich, welche Schritte die nächsten seien. Ich hatte die Reportage, die ich gemeinsam mit Relotius geschrieben hatte, «Jaegers Grenze», mittlerweile sicher dreißig Mal gelesen. Ich wusste, dass ich den Helden der Geschichte finden musste: Chris Jaeger, wie er im Text hieß. Nicht ganz leicht, denn ich war davon überzeugt, dass dieser Typ – so wie ihn Relotius in dem Artikel beschrieb – nicht existierte.
Die Veranstaltung am 3. Dezember im Tipi am Kanzleramt endet mit dem Höhepunkt. Der Preis für die Königsdisziplin, der wichtigste Preis des Abends, für die beste Reportage des Jahres. Der Einsendeschluss lag einige Monate zurück. Texte von Claas Relotius waren bereits für die Kategorien «Bestes Interview» und «Beste Sportreportage» nominiert. In der «Reportage» ist er gleich zweimal vertreten: Mit dem Stück «Ein Kinderspiel» und «Die letzte Zeugin». Allein diese Nominierungshäufung ist atemberaubend.
Ines Pohl tritt auf die Bühne, sie ist die Chefredakteurin der Deutschen Welle. «Die Jury hat gekämpft, sie war sich bewusst der Bürde und Würde dieser besonderen Kategorie (…) Was sind eigentlich die großen Fragen dieses journalistischen Jahres 2018? Es gibt natürlich Inhalte, die uns alle bewegen. Es gibt aber auch die große Frage nach der Glaubwürdigkeit unseres Berufsstands, die uns alle bewegt. Das haben wir immer mitreflektiert, inwiefern sind die Reportagen Beleg dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich draußen waren, gut recherchiert haben, sorgfältig gearbeitet haben.»
Dann verkündet Ines Pohl, dass sich die Jury für Claas Relotius entschieden habe. «‹Ein Kinderspiel›, am 23.6.2018 im ‹Spiegel› erschienen. Herzlichen Glückwunsch, Claas Relotius.» Relotius hat den Preis nicht zuletzt für seine saubere Recherche bekommen. Sein Text ist die Antwort der Branche auf die Fake-News-Debatte, auf die «Lügenpresse-Vorwürfe». Relotius’ Text ist das, was man all den Zweiflern und Nörglern entgegenhalten will. Der bestmögliche Journalismus.
Applaus brandet auf. Pohl erklärt noch, dass Relotius für einen Text über einen jungen Mann prämiert wird, der mitverantwortlich dafür sei, den Syrien-Krieg ausgelöst zu haben. «Wenn man den Text liest, dann spürt man den Krieg, dann riecht man den Krieg (…) Die Jury befand, dass dieser journalistische Beitrag einer der Beiträge des Jahres war, den Schülerinnen und Schüler noch in vielen Jahren lesen werden, wenn sie verstehen wollen, wie dieser Krieg begann (…).»
Relotius trägt ein dunkles Jackett, eine schmal geschnittene Hose und grobe Stiefel. Er sieht gut aus. Auf der Bühne wirkt er bescheiden, fast ein wenig überfordert. Jörg Thadeusz ist der Moderator. Er macht das fantastisch, versucht etwas Lockerheit in einen Abend zu bringen, der nicht locker sein kann. Erstens, weil da viele Spitzenjournalisten zusammensitzen und es dann grundsätzlich nie locker ist, außerdem steht viel auf dem Spiel. Ein Reporterpreis ist ein Ritterschlag. Er wird für immer mit der eigenen Biographie verbunden sein, wird in den Autorenkästen unter Artikeln erwähnt werden, gleich neben dem Geburtsort, dem Studium und den Blättern, in denen man veröffentlicht hat. Thadeusz nähert sich Relotius mit einem Witz: «Herr Relotius, sind Sie schon mal auf einer Preisverleihungsbühne gewesen, als Preisträger?»
Das Publikum lacht. Relotius hat gerade den vierten Reporterpreis erhalten, hat über vierzig Journalistenpreise gewonnen, war noch öfter für Preise nominiert. Er gehört zu den erfolgreichsten Reportern, die jemals diesen Beruf ausgeübt haben. Vor einiger Zeit zeichnete ihn der US-Sender CNN als «Journalisten des Jahres» aus, eine Ehrung, die in Europa nur Claas Relotius zuteilwurde. Er ist gerade mal zweiunddreißig Jahre alt.
Relotius lächelt, als er den Preis entgegennimmt, macht aber klar, dass ihm heute nicht zum Spaßen zumute ist. «Ich wollte eigentlich nicht über mich sprechen, sondern über den Text (…) Es wäre falsch, über etwas anderes zu sprechen (…) Der Junge, über den ich schrieb, der junge Mann, er ist immer noch in dieser Stadt, die seit Wochen bombardiert wird, aber wir haben seit dem Drucktermin nichts mehr von ihm gehört. Deshalb fällt es so schwer, darüber zu reden.»
Es ist klar, was das bedeutet, bedeuten muss. Der junge Mann, Mouawiya Syasneh, der als Dreizehnjähriger Syriens Herrscher Baschar al-Assad mit einem Graffito beleidigt hat, Mouawiya, den Relotius so einfühlsam auf gut tausend «Spiegel»-Zeilen porträtiert hat, dieser junge Mann hat in den letzten sechs Monaten kein Lebenszeichen von sich gegeben. Es sind genau die Monate, in denen Assads Truppen Mouawiyas Heimatstadt Daraa eingenommen haben. Er ist, so muss befürchtet werden, tot.
Das Publikum ist berührt, klatscht mitfühlend. Etwas Syrienkrieg weht durch das Zelt. Relotius bedankt sich wortreich bei seinen Übersetzern, lächelt etwas gequält und geht ab. Jörg Thadeusz, der bloßgestellte Moderator, kratzt seine Restwürde vom Bühnenboden zusammen und verabschiedet sich.
Der angenehmere Teil des Abends beginnt. Relotius wird immer wieder auf die Schulter geklopft. Ariel Hauptmeier, Organisator und Mitinitiator des Reporterpreises, spricht ihn an, um zu gratulieren, aber auch weil er ein paar Fragen hat. Hauptmeier hat in den letzten Tagen viel über Relotius nachgedacht. Auch Jurys in den anderen Kategorien hatten signalisiert, dass sie sich am liebsten für Relotius als Sieger entscheiden würden. Er hatte nicht nur die beste Reportage des Jahres geschrieben, zusätzlich nach Meinung vieler auch noch das beste Interview geführt und die beste Sportreportage geliefert. Als weltweit einzigem Journalisten war es ihm gelungen, mit den Eltern des Footballspielers Colin Kaepernick ein langes Gespräch zu führen. Kaepernick war berühmt geworden, weil er sich aus Protest während der Nationalhymne hingekniet und damit Donald Trumps Hass ausgelöst hatte, was zugegebenermaßen nicht sehr schwer zu sein scheint.
«Wir können dem doch nicht alle Preise geben, das ist verrückt», entfährt es Hauptmeier in einem dieser Gespräche. Er ist ein angenehm zurückhaltender Westfale, der dazu neigt, die richtigen Fragen zu stellen. Ein hervorragender Journalist. Hauptmeier fragt, ob Relotius sicher sei, den Jungen gefunden zu haben, der den Syrienkrieg ausgelöst habe. Es habe ja schon einige Texte dazu gegeben. Relotius bestätigt, dass es in der Tat bereits viel über die «Kinder von Daraa» gebe, die angeblich mit einem Graffito einen Krieg entfachten, aber nach langer, intensiver Recherche, die sich über anderthalb Jahre hingezogen habe, sei er sich sicher, den richtigen Jungen gefunden zu haben. Er habe mittels Videochats mit ihm sprechen können, da Journalisten derzeit nicht in Syrien recherchieren können. Übersetzer hätten ihm geholfen. Relotius hatte sich bei ihnen auf der Bühne bedankt. Ohne sie wäre diese Geschichte nicht möglich gewesen.
Hauptmeier glaubt Relotius, mehr noch, er ist beeindruckt. So wie alle anderen in diesem Festsaal auch. Alle halten Relotius für einen würdigen Preisträger. Es ist die richtige Geschichte zur richtigen Zeit, sie sei «von beispielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz», hatte die Jury geurteilt.
Nur einer scheint an dem Abend nicht glücklich zu sein: Relotius selbst. Nicht allen fällt das auf, aber an seinem Tisch, an dem seine Kollegen vom «Spiegel» sitzen, merken einige, dass irgendetwas nicht stimmt.
Ich habe mir diesen 3. Dezember oft vorgestellt. Wie Relotius die E-Mail von Jan Fields liest, sie beantwortet, sich fertigmacht für die Zugfahrt von Hamburg, wo er lebt, nach Berlin zur Preisverleihung. Was mag in seinem Kopf vorgegangen sein, als er die E-Mail bekam? Er wusste, dass ich ihm auf den Fersen war. Vielleicht hatte er gehofft, dass ich die Sache begrabe. Meine Chefs hatten ihm gesagt, dass ich «Jaegers Grenze» für problematisch hielt. Sie hatten ihm aber auch gesagt, dass sie ihm und nicht mir glaubten.
«Claas, was ist los? Du hast den vierten Reporterpreis gewonnen und schaust, als hätte dir jemand gerade eine Tomate überreicht», fragt ihn ein Kollege.
«Es ist wegen Juan», antwortet Relotius. «Der hat sich verrannt, recherchiert mir hinterher. Der hat doch vier Kinder und wird jetzt entlassen.»
Relotius erweckte an diesem Abend den Eindruck, dass er Mitleid mit mir hatte. Dass ihn das belaste, meine irregeleitete Verblendung und die Konsequenz, die sie für die Zukunft meiner Kinder haben würde. Man war sich am Tisch einig, dass das traurig, aber mir in diesem Fall nicht zu helfen sei. Moreno spinnt, einem Kollegen nachzurecherchieren, zumal einem wie Claas Relotius, das war verrückt. Und sie hatten recht. Das war es. Denn auf ihn, Claas Relotius, wartete eine große Karriere. Eine noch größere Karriere. Er hatte ja bereits mit Anfang dreißig mehr erreicht als die meisten Kollegen in einem Journalistenleben. An diesem 3. Dezember stand für seine Kollegen fest, dass er die Ressortleitung übernehmen würde. Erst vorübergehend, höchstwahrscheinlich aber langfristig. In ein paar Wochen würde Relotius mein Vorgesetzter werden.
Der Mann übrigens, der ihn die letzten Jahre protegiert und gefördert hatte, Ressortleiter Matthias Geyer, sollte zum Jahreswechsel zum Blattmacher des «Spiegel» aufsteigen. Der Mann, der Relotius vor Jahren zum «Spiegel» geholt hatte, Ullrich Fichtner, sollte Chefredakteur werden. Die drei Männer: Relotius, Geyer und Fichtner, sie alle standen keine vier Wochen vor der Beförderung ihres Lebens.
Relotius würde künftig also keine Texte mehr schreiben. Er war am Ziel. Wenn es bisher niemandem aufgefallen war, dass er ein Fälscher war, dass er sich praktisch alle «Spiegel»-Geschichten ausgedacht hatte, warum sollte es später passieren? Die erfundenen Zitate, Personen, Szenen, Schicksale, sie würden irgendwann alle im «Spiegel»-Archiv liegen, online nicht frei verfügbar.
So viel stand fest: Relotius würde an diesem Abend seinen vorerst letzten Reporterpreis gewinnen, denn er würde aufhören, Reporter zu sein. Ressortleiter redigieren, setzen Themen, beauftragen Schreiber, sitzen in Konferenzen und denken über die großen Zusammenhänge unserer Zeit nach und wie man sie Lesern nahebringt. Durch seine nette, zurückhaltende, freundliche Art schien er wie gemacht für diese Arbeit. Viele im Haus freuten sich auf den künftigen Chef Claas Relotius. Der letzte Chefredakteur hatte ihn bei seiner Abschiedsrede explizit erwähnt. Als einen von nur drei Kollegen im ganzen Haus. Relotius ragte heraus. Er war jemand, der die Nachricht, die in Zeiten von Twitter und Facebook immer wertloser wurde, weil sie frei verfügbar war, zu vergolden verstand. Er war ein Magier. Eine Zukunft, in der Nachrichten umsonst waren, schien weniger bedrohlich, weil Relotius sie in Geschichten verwandeln konnte, die unbezahlbar waren. Fünf Jahre nach dem Syrienkrieg schrieb er einen Text, der in Schulen gelesen werden sollte, fand die Chefin der Deutschen Welle. Jeder hatte vom Syrienkrieg gehört, aber niemals zuvor so.
An diesem 3. Dezember, der für Claas Relotius mit einer E-Mail aus Arizona begann und sich mit dem Schulterklopfen hunderter Kollegen dem Ende neigte, war Claas Relotius zugleich der König seiner Branche, der größte Fälscher im deutschen Journalismus und in Gedanken bei mir.
«Worauf ich häufig angesprochen werde: das Buch, das Juan schreiben wird. Ich kann und will ihm das nicht verbieten (er ist freier Mitarbeiter), und ich will das auch gar nicht. Ein Buch über den Fall wird es so oder so geben. Und da ist es mir lieber, es schreibt einer, der wirklich nah dran war, und nicht irgendein Honk.»
Steffen Klusmann
«Spiegel»-Chefredakteur
Doch eine EinleitungWas dieses Buch ist – und was nicht
«Der große Held des deutschen Journalismus. Reporter des Jahrzehnts. Bomben-Mitarbeiter. Knaller-Andalusier. Toll, toller, Juanito. Moreno for Papst. Kann dem Mann mal bitte schön jemand das Wasser reichen?»
Alles sehr verstörende Nachrichten, E-Mails, Tweets, Sätze aus Briefen, die mich kurz vor Weihnachten 2018 erreicht haben. Mich, Juan Moreno, einen freien Autor, jemand, der seit über zehn Jahren für den «Spiegel» schreibt und zuletzt an der «Spiegel»-Pforte gefragt wurde, ob er der Taxifahrer sei, den ein Redakteur bestellt hatte. Ausgerechnet ich war plötzlich ein Medienstar. Die deutsche, ach was, die globale Pressewelt schrieb über Relotius. «Bild», «taz», «Welt», «Zeit», «FAZ», «Süddeutsche Zeitung», «Focus», ARD, ZDF, «New York Times», «Washington Post», «The Guardian», «Le Monde», «The New Yorker», «El Mundo», «Clarín», «Independent», Magazine aus Indien, China, Südafrika und Australien berichteten über den Fall. «Das wunderbare Misstrauen des Juan Moreno», schrieb der «Spiegel», man habe mir «viel zu verdanken». Das irritiert. «Morenos wunderbares Misstrauen», es klang wie ein Roman von Gabriel García Márquez. In der Regel muss man tot sein, damit der «Spiegel» so etwas Nettes über einen druckt.
Also, was hatte ich getan? Ich hatte herausgefunden, gegen massiven Widerstand im «Spiegel», dass der mit Preisen überschüttete «Spiegel»-Reporter Claas Relotius ein Fälscher war. Der «Spiegel» veröffentlichte auf seiner Internetseite am 19. Dezember 2018 ein langes Selbstzerfleischungsstück, aus dem die Öffentlichkeit davon erfuhr. Über sechzig Texte hat Relotius für das Blatt geschrieben, bis auf eine Handvoll waren sie alle gefälscht. Der schlimmste Albtraum des wohl wichtigsten, renommiertesten und stolzesten Medienhauses Deutschlands wurde wahr. Noch bevor der «Spiegel» an die Öffentlichkeit ging, hatte ich angefangen, Relotius-Texte zu überprüfen, die er für andere Medienhäuser geschrieben hatte. Auch da fanden sich massenweise Fehler. «Süddeutsche Zeitung Magazin», «Neue Zürcher Zeitung», «Cicero», «Financial Times Deutschland», «Die Welt», «Reportagen» und einige andere mehr: überall hatte er erfunden. Es ist eine Presseschau des Grauens, wenn man alles zusammenträgt. Relotius’ Texte enthielten Erfindungen, Übertreibungen, Faktenfehler, Plagiate, Ungenauigkeiten, sie sind wertlos. Wäre sein Werk ein Auto, mein andalusischer Vater würde sagen, wir Spanier hätten es gebaut.
Das alles sei ein «Tiefpunkt in der 70-jährigen Geschichte», schrieb der «Spiegel». Und während sich das mächtigste deutsche Magazin in den Dreck warf und die Kollegen der anderen Blätter das gar nicht richtig wahrnahmen, weil sie noch zu sehr mit Augenreiben beschäftigt waren, wollte nicht nur jeder von mir wissen, wie ich das aufgedeckt hatte, sondern auch, wie ich zu der Sache stand. Zum «Spiegel», zu Relotius, zum Genre der Reportage, zum deutschen Journalismus. Überhaupt zur Wahrheit. So ganz grundsätzlich.
Ich tat das, was selten verkehrt ist, wenn der versammelte Medienzirkus sich ankündigt und einen zu überfahren droht. Ich hielt die Klappe. Jedenfalls so gut es ging. In diesem Fall bedeutete das: Ich sprach mit einer Zeitung, der «Süddeutschen»; einem Sender, 3sat; und einem Online-Medium, «Spiegel Online». Ich erzählte drei Mal mehr oder weniger dasselbe. Nämlich, dass ich kein Held bin, dass der «Spiegel» mir anfangs nicht geglaubt hatte und dass ich hoffte, jemand kümmere sich um Claas Relotius.
Wenn ich heute Kollegen treffe, passiert immer dasselbe. Erst gratuliert man mir, dann wird Verständnis geäußert. Mir müsse «die Sache bis hier» stehen. Dann fragen sie doch. Und am Ende folgt ein Monolog von meiner Seite, weil alle so viele Fragen haben. Relotius hat den deutschen Journalismus verändert. Er hat mich verändert. Die Leichtigkeit, mit der ich früher Lügenpresse-Krakeeler belächelt habe, ist dahin.
Ich möchte irgendwann sagen können, dass ich alles, was ich zu sagen habe, aufgeschrieben habe. Schreiben ist das, was ich beruflich mache, was ich deutlich besser kann als reden. Darum werde ich in diesem Buch versuchen, all die Fragen zu beantworten, die mir in den letzten Monaten gestellt wurden. Es sind viele Fragen: Was genau ist passiert? Wie hast du es gemerkt? Warum glaubte man dir beim «Spiegel» nicht? Stimmt es, dass eine Journalistin aus den USA dir fast zuvorgekommen wäre?
Ich werde gegen Ende des Buches auch versuchen, das «System Relotius» zu erklären. Ich glaube, dass seine Texte wunderbar in die veränderte Welt des Journalismus gepasst haben. Über vierzig Journalistenpreise, das ist kein Zufall: Seine Reportagen schienen die Lösung für eine Branche zu sein, die zutiefst verunsichert ist. Sie kämpft um jeden Leser, und warme, tröstende Reportagen, wie sie Relotius schrieb, schienen ein möglicher Ausweg aus dieser Krise. Relotius wurde mit Leserbriefen überhäuft. Kaum einer war kritisch. Leser liebten seine Texte. Man kann, wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt, viel über den Journalismus lernen. Aber ich denke, dass sein Erfolg auch viel über uns sagt, die Leser, Profis oder Laien. Leser liebten seine Geschichten ganz offensichtlich.
Es soll um noch etwas in diesem Buch gehen: nämlich, warum ich denke, dass die netten Menschen, die mich bejubelten, sich irren. Natürlich mag ich die Komplimente. So sehr, dass ich einige Monate nach der Affäre dem Magazin der spanischen Zeitung «El País» ein Interview gab. Einziger Grund war, dass meine andalusische Mutter erfährt, was für ein toller Hecht ihr Sohn ist. Die traurige Wahrheit ist aber, dass ich kein Held bin. Mich macht die Enttarnung des Fälschers Relotius nicht zum Vorbild für Journalisten. Das ist kein guter Ort, an dem ich da bin. Ich kenne meinen Beruf. Ich weiß, was ich, Juan Moreno, der Reporter, denken würde: «Schau an, ein Held, interessant. Mal sehen, wie lange?»
Darum sollte ich gleich zu Beginn einiges klären, was dieses Buch nicht ist, gerade für die Kollegen unter den Lesern.
Dieses Buch ist keine Abrechnung. Nicht mit dem «Spiegel». Nicht mit meinen damaligen Chefs. Nicht mal mit Claas Relotius. Auf der anderen Seite ist es auch keine Auftragsarbeit. Der «Spiegel» wird es nicht mögen. Das kann ich versprechen.
Ich schreibe, wie gesagt, dieses Buch, um alle Fragen, die man vernünftigerweise an mich richten kann nach dieser Geschichte, zu beantworten. Ich schreibe dieses Buch auch, um für mich, ganz persönlich, dieses Thema zu sortieren, es ins richtige Verhältnis zu setzen und auch, um damit abzuschließen. Ich habe schon genug Zeit mit diesem Fall verbracht, mehr Lebenszeit, als mir lieb ist. Ich bin von Natur aus mit einer gewissen emotionalen Tumbheit ausgestattet, mir fällt es leicht, Dinge nicht persönlich zu nehmen, sie an mir abprallen zu lassen. In diesem Fall kam ich mehrmals an meine Grenzen, fühlte mich weder dem Druck noch den Zweifeln gewachsen. Ich habe mir das alles nicht ausgesucht und würde es niemandem wünschen.
Eine Information ist für den Leser noch wichtig, finde ich. Der «Spiegel» ist weiterhin ein wichtiger Auftraggeber für mich. Ich bin kein «Spiegel»-Reporter, wie das Blatt gerne schreibt, sondern weiterhin freier Journalist, dem ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden kann, woran ich mehrmals in der Vergangenheit erinnert wurde.
Ich kann nur versuchen, aufrichtig zu sein, versuchen, allen Seiten gerecht zu werden: dem «Spiegel», Claas Relotius, den Lesern, der Wahrheit und nicht zuletzt mir. Mir ist früh klargeworden, dass man als Einzelner gegen das mächtigste Medienhaus des Landes nur mit einem großen Schutzschild bestehen kann, einem Schild aus absoluter Transparenz. Daher habe ich mir vorgenommen, nichts zu verschweigen, auch nicht meine Fehler. Der «Spiegel» hat mir keinerlei Informationen, keinerlei Dokumente zur Verfügung gestellt, es fand keinerlei Kooperation statt. Meine Interviewanfragen wurden teilweise von der Rechtsabteilung geprüft und abgelehnt. Von einer «Rückendeckung», wie es hieß, kann keine Rede sein. Es wurde aber auch nicht versucht, das Buch zu verhindern.
Anders ausgedrückt: Ich habe keine kurze Antwort auf die Frage, ob ich einem Interessenkonflikt unterliege. Nur eine lange. Sie finden sie auf den nächsten knapp 300 Seiten.
«Ullrich, ich bin nicht dein Feind. Ich bin nur der Typ, der zur falschen Zeit am falschen Ort war und das macht, was du vermutlich an meiner Stelle genauso machen würdest. Es hätte auch dich treffen können. Du und ich, wir sind Reporter. (…) Es ist kein Neid, keine Missgunst, keine Rache, die uns antreibt, es ist, was wir sind.»
Aus meiner E-Mail an den damals designierten Chefredakteur Ullrich Fichtner, als der «Spiegel» noch von Claas Relotius’ Unschuld überzeugt war.
1. KapitelDie Reportage
Warum Claas Relotius nie ein Reporter war
Claas Relotius wurde nicht ein Mal gefragt, ob er eine feste Stelle beim «Spiegel» antreten wolle, er wurde zwei Mal gefragt. Er hatte zu dem Zeitpunkt bereits einige Texte als Freier fürs Blatt geliefert, die so gut waren, dass man ihn unbedingt fest ans Haus binden wollte. Man kann sich streiten, ob das Gesellschaftsressort des «Spiegel» das beste Reportageressort Deutschlands ist. Unstrittig ist, dass die Reporter, die dort schreiben oder geschrieben haben, zu den Helden deutscher Journalistenschüler zählen: Alexander Osang, Cordt Schnibben, Alexander Smoltczyk, Barbara Supp, Matthias Geyer, Ullrich Fichtner, Klaus Brinkbäumer, Thomas Hüetlin, Takis Würger, Jochen-Martin Gutsch und einige andere mehr. Jeder Reporter kennt diese Namen, das Gesellschaftsressort galt für viele als eine Art Dreamteam, der FC Barcelona unter Pep Guardiola.
Es ist nicht normal, dass man eine Einladung in den exklusivsten Reporterpool des Landes ausschlägt. Schon gar nicht, wenn man dreißig Jahre alt und freier Autor ist. Die Auflagen der Zeitungen und Magazine gehen seit Jahren zurück, immer weniger Geld steht für Recherchen bereit, im journalistischen Meer der Verzweiflung, in das heute Jungreporter entlassen werden, gibt es für viele genau eine Insel: den «Spiegel». Keiner bietet Reportern ein vergleichbares Gehalt, keiner vergleichbare Recherchemöglichkeiten. Nicht die «Zeit», nicht die «Süddeutsche», nicht der «Stern». Niemand.
Die beiden damaligen Leiter des Gesellschaftsressorts, Matthias Geyer und Ullrich Fichtner, fragten Relotius, ob er sich vorstellen könnte, fest beim «Spiegel» anzufangen. Man sei sehr zufrieden mit seiner Arbeit.
Claas Relotius sagte nein.
Er fühle sich sehr geehrt, freue sich über das Angebot, könne es aber leider nicht annehmen. Geyer und Ullrich verstanden die Reaktion nicht. So ziemlich jeder deutsche Journalist wäre auf Knien für so eine Stelle nach Hamburg gekrochen. Geyer fragte nach dem Grund für die Absage.
Relotius, bescheiden, wie es seine Art war, drückte sich ein wenig vor der Antwort. Es gehe um etwas Privates, um seine Schwester. Seine jüngere Schwester, die er sehr liebe. Sie sei an Krebs erkrankt, jeden Morgen und jeden Abend nach seiner Arbeit würde er, Claas Relotius, sich um die Schwester kümmern. Sie brauche viel Pflege und Zuspruch, aus diesem Grund könne er unmöglich die Verantwortung übernehmen und diese wichtige Stelle als «Spiegel»-Reporter im Gesellschaftsressort mit gutem Gewissen antreten.
Vielleicht, auch das erwähnte Relotius, könne man ja, wenn es dann noch aktuell sei, zu einem späteren Zeitpunkt erneut über das Angebot sprechen. Selbstverständlich, sagten die zutiefst ergriffenen Chefs.
Relotius hatte die krebskranke Schwester davor nie erwähnt, noch sollte er später ein Wort über diesen Schicksalsschlag verlieren. Er war auch in der Folgezeit freundlich, zurückhaltend. Es war der Moment, in dem im Ressort sein Spitzname entstand: «Der treue Claas», so wurde Claas Relotius von da an im «Spiegel» genannt.
Relotius schrieb in der Folge weiter als Freier für den «Spiegel». Die Reportagen wurden trotz der Belastung durch die Schwester nicht schlechter, mehr noch, sie wurden besser. Immer und immer wieder kam er mit Rechercheergebnissen zurück, die seine Chefs verzückten. Es regnete Preise, Relotius wurde immer besser als Reporter. Darum fragten sie nach einiger Zeit, sehr zurückhaltend, sehr respektvoll, erneut. Ob er unter Umständen jetzt eine Möglichkeit sehe, zum «Spiegel» zu kommen? Ob es, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, weil es sicher schwierig sei darüber zu reden, der Schwester besser gehe?
Ohne – verständlicherweise – ins Detail gehen zu wollen, erklärte Relotius, dass jetzt ein besserer Zeitpunkt gekommen sei. Und ja, er könne sich vorstellen, fest beim «Spiegel» anzufangen.
Ullrich Fichtner und Matthias Geyer, zwei der bekanntesten Reporter im deutschen Journalismus, hatten damit ein singuläres Talent, eine einzigartige journalistische Stimme fest an den «Spiegel» gebunden. «Ein Jahrhunderttalent», nannte ihn ein Kollege.
Dazu muss man wissen, dass der «Spiegel», ähnlich den Bayern in der Bundesliga, der langen Tradition folgt, anderen Blättern die besten Schreiber abzuwerben. Man kann bis heute kein Volontariat beim gedruckten «Spiegel» machen. Das stolze Signal nach draußen: Hier arbeitet niemand, der erst lernen muss. Hier sind nur Leute, die es bereits können. Der «Spiegel» versteht sich, begründet oder nicht, bis heute als Spitze des deutschen Journalismus, und der neue Stern im Schreiberfirmament Claas Relotius war jetzt Teil davon, Teil der Elite.
Claas Relotius hat keine Schwester.
Matthias Geyer, Relotius’ damaliger Chef, hat diese Geschichte vor einer Gruppe von Kollegen erzählt. Ich habe sie an den Anfang gesetzt, weil ich klarmachen will, wovon wir hier reden. Relotius war nicht jemand, der, gezwungen durch die Erwartungen des Umfelds, des Ressorts, der Konkurrenz, irgendwann anfing, zugespitzte Zitate in Texte zu schmuggeln. Er war nicht jemand, der später begann, als er merkte, dass er nicht aufflog, sich Beschreibungen auszudenken. Oder kleine erfundene Nebenfiguren. Dann Szenen. Und schließlich eine ganze mehr oder weniger komplett erfundene Reportage fabrizierte. So war das nicht.
Claas Relotius war ein Lügner, der nicht nur als Journalist erfundene Geschichten erzählte. Er log schon lange, bevor er beim «Spiegel» anfing. Er hätte vermutlich in jedem anderen Beruf auch gelogen. Relotius war nie ein Reporter, er war ein Hochstapler, der, wie sich zeigen wird, eher zufällig zum Print-Journalismus kam, weil er bald merkte, dass jemandem mit seinen Fähigkeiten genau hier eine meteoritenhafte Karriere offenstand. Und wäre er ein wenig charmanter, lustiger, charismatischer und seine Texte nicht ganz so melodramatisch verkitscht, könnte man dem Ganzen womöglich sogar ein wenig Catch-me-if-you-can-Flair abgewinnen. Aber auch das war Relotius nicht.
Ich weiß nicht, ob Relotius krank ist oder nicht. Er sagte von sich selbst – nachdem er aufgeflogen war –, dass er Hilfe brauche, dass er mit Ärzten rede und in Behandlung sei. Es gehört zu den wenigen Dingen, die ich ihm abnehme. Natürlich gibt es aus der Psychologie Erklärungsmodelle für Hochstapler, sie klingen immer ähnlich. Ein emeritierter Psychologieprofessor, dem ich den Fall erzählte, sagte mir, dass Relotius’ Geschichte von «geradezu beleidigender Schulbuchhaftigkeit» sei: Hochstapler sind in der Regel voll schuldfähig. Sie hätten eine starke Neigung zur dramatischen Selbstdarstellung, gepaart mit gesteigertem Geltungsbedürfnis. Ich dachte, während der Professor redete: «Neigung zur dramatischen Selbstdarstellung? Gesteigertes Geltungsbedürfnis?» Das könnte für die halbe «Spiegel»-Redaktion gelten.
Ich werde weiter hinten im Buch vertiefen, was ich an Relotius’ Charakter so faszinierend finde. Und so verstörend.
Dass Reporter mit ihren Geschichten glänzen wollen, ist eine Selbstverständlichkeit. Was aber Claas Relotius so fundamental von vielen Kollegen unterscheidet, ist, dass er beim geringsten Widerstand eben nicht «dranblieb», nicht «nachhakte», nicht nach Alternativen suchte. Relotius erfand. Er quälte sich nicht. Er sparte sich den schwierigen Part, die eigentliche Arbeit. Natürlich machen Reporter diese nicht perfekt, einige nicht mal besonders herausragend, einige, an manchen Tagen, sogar hanebüchen schlecht, aber die allermeisten machen sie ehrlich. So gut es eben geht, so wie andere Menschen in anderen Berufen auch.
Claas Relotius, das ist mir wirklich wichtig, war nie Reporter. Bevor ich also über die Entstehung von «Jaegers Grenze» schreibe, der Reportage, die Relotius’ Fälscherkarriere beenden sollte, will ich daher einige Seiten über diesen Beruf – und die journalistische Form der Reportage – schreiben.
Würde man mich fragen, welche Farbe der Reporterberuf hat, meine Antwort wäre: grau. Mattes, kaum polierbares Grau. Ein Reporterleben besteht zum großen Teil darin, Leid, Schmerz und Problemen nachzureisen, sich danebenzustellen, einen Stift und Block zu zücken und das aufzuschreiben, was man sieht. Der Schmerz der anderen, das ist Reporter-Rohstoff. Das ist nicht sonderlich glamourös. Manchmal besuche ich auch Menschen, denen es besonders gutgeht, oder die Glück gehabt haben, aber Leser mögen solche Geschichten nicht. Viele behaupten zwar, dass sie das gern lesen, es stimmt aber nicht. Zweifler mögen einen beliebigen Online-Redakteur fragen, worauf Nutzer «klicken». Jeder Online-Redakteur kann zu seinen Klickzahlen einen Vortrag halten. So wie jeder Fernsehredakteur einen über Einschaltquoten halten kann. Denn was passiert regelmäßig in Nachrichtensendungen, wenn auf einen erschütternden ein positiver Beitrag folgt? Die Zuschauer schalten ab. Brennende Häuser, ertrinkende Flüchtlinge, keifende Diktatoren, alles kein Problem. Aber zwei gute Nachrichten hintereinander, und der Zuschauer ist weg.
Als Reporter begleite ich oft Menschen in Krisensituationen. Mein Job ist es, ihnen Fragen zu stellen, Angehörige, Arbeitsstätten, Geburtsorte zu besuchen, möglichst viel über diese Menschen herauszufinden. Naturgemäß möchten das viele nicht. Und nur um das gleich zu klären: Ich kann jeden verstehen, mehr noch, ich würde den meisten empfehlen, sich nicht auf einen Reporter wie mich einzulassen. Die wenigsten profitieren von einem Gespräch. Ich rede nicht von Journalisten, die Gefälligkeitstexte schreiben, weil ihr Magazin Gefälligkeitstexte druckt. Ein richtiger Reporter wird wahrscheinlich genau nach den Erlebnissen und Informationen fragen, die man nicht preisgeben will. Kluge Menschen, andere sind selten interessant, schützen ihre Wahrheiten wie einen Schatz.
Gerade wenn man an die sensationellen Geschichten denkt, die Relotius immer wieder lieferte, muss man verstehen, dass zu den ständigen Begleitern dieses Berufes das Scheitern gehört. Es ist fest eingeplant, unvermeidbar. Eine Recherche läuft immer anders, als man es gerne hätte. Man bekommt einfach nicht die Akte, die alles beweist, das Gespräch, das man braucht, um das Puzzle zusammenzusetzen. Der Whistleblower traut sich letztlich doch nicht auszusagen. Das ist die Regel, je interessanter die Geschichten werden, desto wahrscheinlicher scheitert man. Der VW-Ingenieur, der die Abschaltvorrichtung programmiert hat, redet nicht, genauso wenig wie der Beamte, der gesehen hat, wie sein Kollege Geld von einem Baulöwen angenommen hat. Die Absage, die Niederlage ist ständiger Begleiter in diesem Beruf.
Was kann man tun, um das zu verhindern? Man muss überzeugen, manchmal sogar flirten. Man schmeichelt, schreibt nette Briefe, es gibt auch Kollegen, die drohen.
Ich habe für dieses Buch natürlich den Eltern von Claas Relotius einen Brief geschrieben. Ich fragte sie darin, ob sie mir ihre Sicht der Dinge darlegen wollen. Natürlich musste ich das tun, sie um ein Gespräch bitten, das ist Teil meiner Arbeit, weil Leser, die sich für den größten journalistischen Fälscherskandal der letzten Jahrzehnte interessieren, gerne wissen wollen, was sie zu sagen haben. Aber glaubt irgendjemand, dass ich die Eltern gern mit meinen Fragen konfrontiere? Nein, ich habe selber Kinder, ich würde einen Teufel tun und mit einem Reporter über meine Gefühle sprechen. Es gibt in diesem Beruf eine große Binsenweisheit, sie ist aus irgendeinem Film: Die meisten Journalisten wissen, wie man die Wahrheit schreibt. Sie wissen auch, wie man so schreibt, dass Menschen sich nicht angegriffen fühlen. Nur scheitern wir immer daran, beides zur selben Zeit zu tun.
Die Eltern haben mir abgesagt und ließen über einen Anwalt antworten, ebenso Claas Relotius selber.