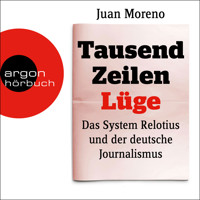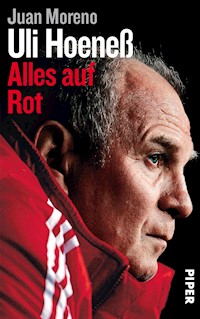9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Als der Reporter Juan Moreno von einer seiner Auslandsreisen zurückkommt, sieht er nervös die Drogenspürhunde am Zoll – er ist sich sicher, nach Kokain geradezu zu stinken. Er hat bei kolumbianischen Rebellen im Dschungel auf Kokainplatten geschlafen, anders ging es nicht – aber wie erklärt man das einem deutschen Zollbeamten? Juan Morenos Geschichten von unterwegs sind eine großartige Lektüre, überraschend, dramatisch, packend. Moreno fährt viertausend Kilometer quer durch Europa mit einem Kleinbus voller Arbeitsmigranten, spricht mit Killern der Farc-Guerilla über Auftragsmord und mit Mike Tyson über Schmerz und Ruhm. Mit kubanischen Fischern fährt er aufs Meer, und er überlebt die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt, den Darién Gap. Als er eine Auszeit braucht, geht er ein Jahr lang auf Weltreise. Aber das Abenteuer wartet auf den, der es versteht, auch anderswo: ob zu Hause, bei den frommen Pilgern auf dem Jakobsweg oder in der Heimat Spanien. Dies alles erzählt Moreno in dem typischen Sound, der ihm seit Jahren eine große Leserschaft sichert: mit Witz und Tiefgang, stilistisch elegant und scharf beobachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Ähnliche
Juan Moreno
Glück ist kein Ort
Stories von unterwegs
Über dieses Buch
Als der Reporter Juan Moreno von einer seiner Auslandsreisen zurückkommt, sieht er nervös die Drogenspürhunde am Zoll – er ist sich sicher, nach Kokain geradezu zu stinken. Er hat bei kolumbianischen Rebellen im Dschungel auf Kokainplatten geschlafen, anders ging es nicht – aber wie erklärt man das einem deutschen Zollbeamten?
Juan Morenos Geschichten von unterwegs sind eine großartige Lektüre, überraschend, dramatisch, packend. Moreno fährt viertausend Kilometer quer durch Europa mit einem Kleinbus voller Arbeitsmigranten, spricht mit Killern der Farc-Guerilla über Auftragsmord und mit Mike Tyson über Schmerz und Ruhm. Mit kubanischen Fischern fährt er aufs Meer, und er überlebt die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt, den Darién Gap. Als er eine Auszeit braucht, geht er ein Jahr lang auf Weltreise. Aber das Abenteuer wartet auf den, der es versteht, auch anderswo: ob zu Hause, bei den frommen Pilgern auf dem Jakobsweg oder in der Heimat Spanien. Dies alles erzählt Moreno in dem typischen Sound, der ihm seit Jahren eine große Leserschaft sichert: mit Witz und Tiefgang, stilistisch elegant und scharf beobachtet.
Vita
Juan Moreno, geboren 1972 in Huércal-Overa (Spanien), ist einer der prominentesten Reporter Deutschlands. Er arbeitete zunächst für den WDR, dann von 2000 bis 2007 für die «Süddeutsche Zeitung». Seitdem ist er für den «Spiegel» in aller Welt unterwegs. Moreno hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt «Tausend Zeilen Lüge» (2019), in dem er erzählt, wie er gegen starke Widerstände den Betrug des Journalisten Claas Relotius aufdeckte – einer der größten Medienskandale der Nachkriegsgeschichte. Das Buch wurde zum Nr.-1-«Spiegel»-Bestseller, Juan Moreno als «Journalist des Jahres 2019» ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Mirco Taliercio
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01090-1
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Vorwort
«Heute hat man den Eindruck, dass der Interviewer nicht hört, was gesagt wird. Es ist ihm gleich, weil er glaubt, das Aufnahmegerät würde alles hören. Er irrt sich. Denn er hört die Schläge des Herzens nicht, das Wertvollste an einem Gespräch.»
Gabriel García Márquez
Es heißt ja, die Menschen würden immer mehr reisen. Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, das Gegenteil stimmt. Die Menschen fahren mehr weg, steigen häufiger ins Flugzeug, aber zum Reisen haben sie keine Zeit mehr. Deshalb wurde bekanntlich der Tourismus erfunden, die große Irritationsbeseitigungs-Industrie für den modernen Menschen.
Ich kann nachvollziehen, dass man in den Urlaub fährt und als oberstes Ziel Überraschungsminimierung ausruft. Ich mache solche Urlaube auch. Daran ist nichts verkehrt. Aber Reisen sind etwas anderes. Die Bedingung ist, wie angesprochen, dass man Zeit hat. Zeit schafft Nähe, und Nähe schafft Einblick. Manchmal auch Schrecken, wenn man mehr erfährt, als einem lieb ist. Aber wenn man sich fragt, wie manch tolle Dokumentation es schafft, dass Menschen sich öffnen, obwohl eine Kamera läuft – das Geheimnis ist immer Zeit. Erkenntnis ist eine Funktion der Zeit, erste Regel. Die andere Regel ist, dass der Antrieb für eine Reise stets Interesse sein sollte. Ich möchte wissen, wie ein anderes Leben ist. Damit geht es los, mit dieser Frage, der Rest ergibt sich. Hinfahren, fragen, zuhören, lernen, darum reise ich.
Darüber hinaus habe ich meine Beweggründe nie wirklich hinterfragt. Ich kann nicht sagen, warum ich sonst reise. «All die Reisen, wovor fliehst du?», hat mal eine Ex-Freundin gefragt. Tue ich das? Der große Cees Nooteboom glaubt, dass man reist, «um mit der fremden Bevölkerung» eins zu werden. Reisen sei die «Hebamme neuer Gedanken», sagt Alain de Botton. Ich kann nur sagen, dass mich Reisen glücklich macht. Es erfüllt mich. Von einem Urlaub kann ich enttäuscht sein, von einer Reise nicht. Es ist nicht mal so, dass ich mich zu Beginn immer auf eine Reise freue. Manchmal nervt mich der Gedanke, schon wieder loszufliegen und zu wissen, dass ich mich die nächsten Wochen von grausigem Zeug werde ernähren müssen, aber wenn ich einmal unterwegs bin, werde ich nie, wirklich nie enttäuscht. Selbst wenn es Reisen gibt, einige davon in diesem Buch, die ich nicht wiederholen würde, weil ich mittlerweile alt genug bin, um zu erkennen, dass sie lebensgefährlich sind.
Mit anderen Worten, auf die Frage, was dieses Buch ist, lautet meine Antwort: Es ist eine Sammlung meiner glücklichsten Momente.
Fischen wie Hemingway (Kuba)
Wie sich zeigen wird, ist Carlos, der keinen Nachnamen hat und vermutlich auch nicht Carlos heißt, genau der richtige Mann, wenn man etwas Unmögliches auf Kuba braucht. Genau das ist bei mir der Fall. Etwas Banales, das völlig unmöglich ist. Aber vielleicht der Reihe nach.
Carlos sitzt vor dem besseren der beiden Fischrestaurants Cojímars, einem kleinen Küstendorf, unweit von Havanna. Es ist ein schwüler Karibikmorgen. Der Wind kommt von Norden. Das Meer, auf das wir beide blicken, wirkt unruhig. Carlos nippt an seinem zweiten Cristal, seinem bevorzugten Frühstücksbier. Ihm gegenüber sitzt Rosita, die kräftig gebaute, ausgesprochen sympathische örtliche Puffmutter. Rosita strahlt, als sie mich sieht. Ich, Europäer, mittleres Alter, nicht in Begleitung einer Frau, sehe wie Kundschaft aus. Aber Rosita ist Profi, sie spricht mich nicht sofort an.
Carlos und Rosita, das muss man verstehen, sind Freunde und Konkurrenten. Beide warten auf Kunden, auf Einnahmen, also auf westliche Touristen, die etwas suchen, was nicht in den Hotelprospekten steht: junge Frauen, junge Männer, Marihuana, Koks, solche Dinge. Gerade ist keine gute Zeit. Nebensaison. Vor mir waren nur ein paar Radtouristen hier. Enge Trikots in Leuchtwestenfarben, dazu Helme und Räder, die wie Mondfahrzeuge aussehen. Carlos versteht diese Spinner nicht. Fliegen um die Welt, um den Urlaub schwitzend auf dem Fahrrad zu verbringen. Essen keinen Hummer, trinken keinen Rum, nehmen kein Taxi, machen keine Liebe. Leute, die kein Geld ausgeben. Als gäbe es davon auf Kuba nicht schon genug.
Ich kann anfangs nicht einschätzen, ob Carlos der Richtige ist. Dafür muss man eines wissen: Jedes Dorf auf Kuba, jede Straße in Havanna hat einen Carlos. Auf Kuba ist wie in jedem sozialistischen Land, das etwas auf sich hält, sehr vieles verboten: freie Wahlen, der Besitz zweier Handys, Streiks, der Privatimport von Zündkerzen und Druckerpatronen, die eigene Meinung und noch vieles mehr. Aber unmöglich, wirklich unmöglich ist deutlich weniger. Ganz gleich, was man in diesem Land braucht – wenn man es in Dollar bezahlen kann, findet sich meist jemand, der es besorgt. Ich bin mit der Zeit zu der Überzeugung gekommen, dass der Kapitalismus nirgendwo so gut funktioniert wie in sozialistischen Ländern. Und Leute wie Carlos, die es überall auf Kuba gibt, sind diejenigen, die all diese verbotenen Dinge besorgen können. Makler des Unmöglichen. Ich habe höchsten Respekt vor ihren Fähigkeiten.
Mein Carlos ist ein kleiner, drahtiger Mann mit blauer Schirmmütze und einer etwas zu engen Badehose. Er sieht aus wie ein Stenz, der seine besten Jahre hinter sich hat. Als er bemerkt, dass ich mich der Restaurantterrasse nähere, scheint er Witterung aufzunehmen. Die Jagd beginnt. Es ist einer der Reize Kubas. Du kannst als Europäer noch so plan- und initiativlos durch den Urlaub wanken, irgendwann kommt ein Kubaner und erfüllt Wünsche, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast.
Carlos fängt unverfänglich an. Er fragt mich, woher ich komme, und freut sich, dass ich Spanisch spreche. Die zweite wichtige Frage, die er stellen muss: «Und, zum ersten Mal hier?» Ganz gleich, was, das erste Mal ist immer teurer. Noch so ein Gesetz. Bevor ich geantwortet habe, winkt er Rosita heran.
Carlos und Rosita sind routinierter im Smalltalk als jedes diplomatische Korps. Als klar ist, dass ich zwar Tourist, aber nicht völlig ahnungslos bin, kommen sie zum Punkt.
«Ich habe Freundinnen. Wie viele brauchst du?», fragt Carlos. «Zwei, drei, jung, alt, dick, dünn?» Und weil Carlos Dienstleister ist, fügt er hinzu, dass er seine Wohnung für «die Party» anbieten könne, dazu etwas Rum und Koks, und falls man Hilfe brauche «mit so vielen Damen», auch sonst gern zur Hand gehe. Filmen sei übrigens gar kein Problem. Dann habe man etwas für zu Hause.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihm zu sagen, dass ich etwas ganz anderes suche. Carlos redet immer weiter.
«Viagra», auch das kein Problem.
Wahnsinnig hilfsbereit, dieser Carlos, denke ich.
Die lächelnde Rosita, hundertdreißig Kilo kubanische Lebensfreude, würde die ihr eigene Dralligkeit anbieten und ebenfalls mitmachen, sagt sie.
«Ich will fischen», sage ich.
Rosita verdreht die Augen, sie sagt nichts, aber es ist klar, was sie denkt: Schon wieder so ein Hemingway-Idiot.
Das wichtigste Buch Kubas ist meiner Meinung nach nicht «Das Kommunistische Manifest». Das wichtigste Buch ist «Der alte Mann und das Meer». Hemingways grandioser Roman über den alten, hageren Fischer Santiago. Vierundachtzig Tage in Folge kehrt Santiago, der alte Mann, ohne Fang zurück. Dann schließlich, am fünfundachtzigsten Tag, fängt er einen riesigen Marlin im Golfstrom. 5,50 Meter lang. Doch auf dem Weg zurück zum Hafen und nach drei Tagen heroischen Kampfes verliert Santiago seinen Schwertfisch an die Haie.
Das Buch ist eines der schönsten Denkmäler, die je einem Verlierer gewidmet wurden. Bei der Veröffentlichung 1952 im «Life»-Magazin wurden in zwei Tagen fünf Millionen Exemplare verkauft. 1953 gewann Hemingway den Pulitzer-Preis für die Geschichte, ein Jahr darauf den Literaturnobelpreis. Sein bestes Werk, würde ich sagen. Es hat ihn unsterblich gemacht. Vor allem auf Kuba.
Hemingway lebte gut zwanzig Jahre auf der Insel, mit Unterbrechungen von 1938 bis 1961. Fidel Castro ließ Münzen mit Motiven aus dem Roman drucken. Hemingways alte Villa ist heute ein Museum. Es gibt nicht einen Touristen, der nach Havanna reist und nicht weiß, dass der Hochseefischer, Großwildjäger und Frauenheld seine Mojitos in der «Bodeguita del Medio» trank und die Daiquiris in der «Floridita». Die berühmteste Sauftour der Literaturgeschichte. Abend für Abend von Touristenarmeen, die sich durch Habana Vieja schieben, wiederholt.
Was nicht ganz so viele wissen, ist, was Hemingway vor dem allabendlichen Besäufnis in der «Bodeguita» und der «Floridita» so machte: fischen. Fast immer mit seinem Freund Gregorio Fuentes, einem Fischer aus Cojímar. Dieser ruhige, bescheidene Mann diente als Vorlage für «den alten Mann» in Hemingways Roman. Gregorio ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Er saß in der «Terraza», dem anderen, mittlerweile sehr touristischen Restaurant Cojímars, und erzählte jedem die unglaubliche Geschichte seiner Freundschaft mit dem Nobelpreisträger. Carlos ist mit Gregorios Enkel befreundet. Er wohnt ein paar Häuser weiter. Nicht weit vom Hafen, der am Ende eines zugemüllten Strandes liegt.
Carlos schaut mich mitleidig an. Er hatte mit einer größeren Herausforderung gerechnet. Ein Angelausflug, das ist so leicht zu organisieren, es ist geradezu beleidigend trivial. Aber gut, auch da wird er eine Provision verdienen, wenn er mich an einen der staatlich zugelassenen Anbieter von Bootsausflügen verweist. Carlos bittet den Kellner um mehr Bier.
Er ahnt noch nicht, dass ich alles andere als ein einfacher Kunde bin. «Ich will hier fischen. In Cojímar, mit kubanischen Fischern. Nicht auf einem Touristenboot mit dicken Amerikanern, die fünfhundert Dollar am Tag zahlen. Ich will mit Kubanern fischen.»
Immer wieder kommen Leute ins winzige, verstaubte Cojímar, das praktisch nur aus einer breiten Straße besteht, die zum Meer führt, und wollen fischen. So wie Hemingway. So, wie sie es in «Der alte Mann und das Meer» gelesen haben.
Carlos schaut mich an. Rosita steht auf. Sie hat genug gehört. Wie immer dieses Gespräch endet, gevögelt wird offensichtlich nicht, also ist das alles für sie Zeitverschwendung.
«Das ist schwierig», sagt Carlos und schaut aufs Meer, wo einige Fischerboote zu sehen sind.
«Schwierig oder unmöglich?», frage ich.
Unmöglich, das Wort mag Carlos nicht. Er nimmt sein Handy und ruft einige Leute an. Carlos spricht eine seltsame Mischung aus kubanischem Spanisch, Miami-Englisch und mexikanischem Slang. Er ist erst seit gut einem Jahr wieder zurück. Mit achtzehn hat er Kuba verlassen, eine Weile in Florida gelebt und in der «dortigen kubanischen Logistikbranche» gearbeitet, was nicht bedeutet, dass er Lkw fuhr. Vielmehr erklärt es, warum er problemlos «Partyzubehör in Pulverform» organisieren kann. Die letzten Jahre war er in Mexiko. Acapulco, um genau zu sein. Er hat dort eine Wohnung, kann aber derzeit nicht zurück, aus Gründen, die nichts zur Sache tun, wie er findet. Nur so viel: Er wurde von einem amerikanischen Geländewagen über den Haufen gefahren, als er mit seinem Mofa vor der Ampel stand. Reiner Zufall, schwört Carlos. Er habe nichts gemacht. Nur auf Grün gewartet. Er hat dann überstürzt das Land verlassen. Verrückt, dieses Mexiko.
Carlos legt das Handy weg. «Es geht nicht», sagt er schließlich.
Jeder in Cojímar weiß, warum das nicht geht. Man kann hier als Tourist nicht zum Fischen aufs Meer rausfahren. Es gibt zwei Gründe dafür. Der erste: Es ist verboten. Normalerweise nehmen Kubaner Verbote ungefähr so ernst wie die Fünfjahrespläne der Inselregierung. Also gar nicht. Wenn es aber um Touristen auf kubanischen Booten geht, ist das anders. Als Nicht-Kubaner darf ich nur mit staatlichen Anbietern aufs Meer fahren. Ich könnte in Miramar, dem Nobelviertel Havannas, in der Marina Hemingway, dem weitläufigen wie ziemlich leeren Yachthafen, eine Crew samt Boot mieten. Fünfhundert Dollar pro Tag, Mojitos und Sonnenbrand inklusive. Das ist, was mir Carlos vorschlagen wollte. Diese Möglichkeit hätte ich auch in den Touristenfallen Varadero und Cayo Coco. Organisierte Fischreisen auf Kuba gibt es viele. Es gibt sehr gute Anbieter, phantastische Fischgründe, und wenn man im Dezember kommt, ist nicht mal ausgeschlossen, einen Marlin zu fangen. Wie der alte Mann im Roman.
Der zweite Grund ist entscheidend: Die kubanische Regierung kontrolliert das Verbot. Sehr, sehr genau, sonst nicht wirklich ihre Art. In diesem Fall aber verständlich. Vereinfacht könnte man sagen, dass Kuba und Boote nicht sonderlich gut zusammengehen. Gewissermaßen historisch. Jahr für Jahr haben in der Vergangenheit Zehntausende Kubaner die Insel verlassen. Die meisten Richtung USA. Ziemlich genau 97 Meilen von Cojímar entfernt liegt Florida. Generationen von Kubanern haben mit allem, was auch nur ansatzweiße schwimmt, die Flucht versucht. Flöße, Schwimmreifen, mit Bauschaum isolierte Kühlschränke, 59er Chevys mit Schiffsschrauben. Die Behörden haben über Jahre versucht, die Flucht zu stoppen. Eine offene Wunde für Kubas Regierung. Kubaner waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um die Insel zu verlassen. Anders ausgedrückt: Es ist einfach eine verdammt schlechte Idee, auf Kuba nach einem illegalen Bootstransport zu fragen. Regierungsbeamte verstehen in diesem Punkt keinen Spaß.
Rosita, die sich wieder zu uns gesetzt hat, nimmt noch mal Anlauf, sie will noch nicht aufgeben. «Ich habe wunderschöne Freundinnen», säuselt sie und legt mir sanft die Hand auf den Oberschenkel. Carlos, der ins Reden kommt, hat das Gefühl, dass man jemandem, der so einen Unfug verlangt, vielleicht sogar ein Apartment verkaufen könnte.
«Meine Wohnung mit Meerblick für fünfzehntausend Dollar. Heute unterschrieben, morgen gehört sie dir.»
Er vergisst zu erwähnen, dass kubanische Gesetze es Ausländern faktisch unmöglich machen, Immobilien zu kaufen.
«Ich will fischen. In Cojímar. Mit Fischern aus Cojímar.» Dann sage ich den Satz, der die Dinge immer leichter macht. «Geld ist kein Problem.»
Carlos stellt das Bier weg. Der Satz liegt in der Luft. «Morgen, hier um zehn Uhr», sagt er irgendwann.
Er wird am Ende zwei Treffen benötigen. Beim ersten Mal, am nächsten Tag, wird er überrascht sein, dass ich wirklich zum besagten Termin komme. Sein Apartment bietet er mir trotzdem noch mal an. Für zehntausend Euro. Nachdem ich erneut ablehne und wiederhole, dass ich nur am Fischen mit einem Fischer aus Cojímar interessiert bin, schickt er mich weg. Auch das zweite Treffen kurz darauf ist nur Carlos’ Versuch, mich umzustimmen. Ich biete ihm ein paar hundert Euro an. Sehr viel Geld auf Kuba, aber billiger als der Trip mit dem offiziellen Anbieter.
Einen weiteren Tag später ruft mich Carlos an. Er hat das richtige Telefonat geführt. Ich soll wieder nach Cojímar fahren und dort jemanden unweit der Restaurantterrasse treffen.
«Hallo, ich bin Pedro, ich bin Fischer in Cojímar», sagt ein Mann mit graumelierten Haaren und einem freundlichen Lächeln. Pedro ist fünfzig Jahre alt, Carlos hat ihn lange überreden müssen. Für rund zweihundert Dollar und eine Flasche Whiskey hat er zugesagt. Davon bezahlt Pedro den Schiffsdiesel, seinen Partner José, mit dem er jeden Morgen rausfährt, und den Hafenchef, der «offiziell» von dem Ausflug nie gehört hat.
Carlos hat einen Traktor mit einem Anhänger organisiert, der sonst für den Viehtransport genutzt wird. Ich bin nicht alleine gekommen, sondern habe meinen besten Freund mitgebracht, Mirco, ein Fotograf. Wir müssen uns ducken und werden damit in das Hafengelände gefahren. Das Areal ist nicht sehr groß, etwa so wie ein Fußballplatz. Am Eingangsgebäude prangt ein großes Gemälde. Darauf Kubas berühmteste Maskottchen: Fidel Castro und Ernest Hemingway.
Pedro führt uns über das Hafengelände. Die Anlage muss schon zu Hemingways Zeiten so ausgesehen haben. Die ausgebauten Schiffsmotoren sind uralt, von den kleinen Holzhäuschen blättert die Farbe, die Stege am Ufer, offenbar von purem Optimismus zusammengehalten, sind aus verrotteten Planken. Die Boote liegen aufgereiht an einem kleinen Kanal, der zur Hafenbucht führt.
Pedros Boot ist erstaunlich groß. Dreißig, fünfunddreißig Fuß. Er bittet uns an Bord und versteckt uns unter Deck, damit der Hafenmeister, der ja weiß, dass wir da sind, wenigstens schwören kann, nie einen Touristen auf dem Boot gesehen zu haben. Langsam fährt das Boot aus der Bucht. Auf dem Meer kommt Pedro nach unten und sagt: «Bitte sag mir nicht, dass du nach Florida willst.»
Es ist ein Scherz, aber erst gestern sei ein Häftling in Havanna aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Polizei war am Morgen am Hafen, weil sie fürchtete, dass er einen Fischer entführen könnte, um sich nach Florida abzusetzen.
«Früher durchaus passiert», sagt Carlos.
Pedro ist einer dieser Männer, die an Land immer ein bisschen ruhiger sind als auf dem Meer. Er ist gern Fischer. Für nichts auf der Welt würde er die Insel verlassen. Nicht mal für Amerika. «Ich bin glücklich», sagt er und nimmt einen kräftigen Schluck Whiskey.
Mittlerweile hat sich auch bei einigen Kubanern herumgesprochen, dass Amerikas Glücksversprechen Schranken kennt. Was will man mit einem SUV und kiloweise Fertigpizzas, wenn man sich das Herzmittel für die kranke Tochter nicht leisten kann? Was ist Luxus? Kabellose Kopfhörer oder eine Physiotherapie nach einer Verletzung, auf die jeder Kubaner zumindest ein Anrecht hat?
Pedro kennt viele, die gegangen sind. Er wollte das nie, seinen Traum konnte er auch hier verwirklichen. Da er kein Geld für ein Boot hatte, fuhr er fast zwanzig Jahre lang jeden Morgen mit einem kleinen Netz und einer Angel auf einem großen Schwimmreifen aufs Meer hinaus. Man muss nur ein paar Kilometer von Havanna Richtung Westen fahren. Dort sieht man diese Männer immer noch. Ein paar hundert Meter vor der Küste. Dutzende Fischer ohne Boot. Männer, die auf einem Lkw-Reifen sitzen und eine Angel ins Wasser halten. Sie sehen aus der Ferne wie Vögel aus, die im Meer treiben.
Anfangs reichte es gerade mal fürs Überleben, sagt Pedro. Kubaner essen lieber Fleisch als Fisch. Als aber die Sowjetunion zusammenbrach und die sozialistische Bruderhilfe für Kuba auslief, kollabierte auch die kubanische Wirtschaft. Das war schlecht für die Insel, aber für Pedro die Chance seines Lebens. «Es waren die besten Jahre.» Pedro verkaufte massenweise Fisch. Die Lebensmittel wurden knapp auf Kuba, Fleisch wurde rationiert. Pedro konnte seinen Fisch deutlich teurer verkaufen als früher. Hinzu kam, dass immer mehr Privatrestaurants für Touristen öffneten. Spanier, Italiener, Franzosen aßen gern Fisch, und die Köche der neuen Restaurants bezahlten für gute Qualität in Devisen. «Irgendwann sah ich ein Boot, das in Frage kam», sagt Pedro. Er hatte genug Geld zusammen und kaufte es. Er angelte nicht mehr, er fischte. Wieder zehn Jahre später konnte er sich das große Boot leisten, in dem ich jetzt sitze. Es ist uralt, müsste gestrichen werden. Es leckt ein wenig, und der Motor läuft unrund. Er steckte mal in einem japanischen Laster. Aber Pedro hat ihn schon so oft auseinandergenommen, dass er ihn auch in einem Sturm reparieren könnte.
Pedro ist ein lustiger, geselliger Kerl, und weil eine Sturmfront im Norden es nicht erlaubt, wirklich weit rauszufahren, fragt er per Funk einen Kollegen, ob er nicht etwas von seinem Fang «rüberwerfen» könnte. So könnte ich wenigstens behaupten, etwas gefangen zu haben.
Ich mache Fotos. Es gibt ein Bild von mir auf Pedros Boot, hinter mir Cojímar. Ein Kuba-Motiv, das nicht viele haben.
Es ist ein schöner Tag, den wir gemeinsam verbringen. Die Whiskey-Flasche ist schnell geleert, Pedro holt noch irgendwas Kubanisches raus, das ich in Deutschland zum Desinfizieren von Wunden nutzen würde. Wir trinken weiter, Pedro erzählt von der Marlin-Saison. Eigentlich machen wir nichts Besonderes. Männer auf einem Boot, die reden. Ich fange an, mich über Carlos’ bunte Badehose lustig zu machen. Er habe auf der Terrasse wie ein Triebtäter ausgesehen, Pedro lacht, Carlos erwidert, dass er, anders als ich, wenigstens nicht wie ein Mädchen trinken würde. Pedro erzählt von den Spinnern, die in alten, mit Styropor isolierten Badewannen versucht hätten, nach Florida zu gelangen, dann erzählt er von den Fischen, die er aus dem Wasser zieht, sie werden immer größer, je länger er redet. Es sind keine tiefgreifenden Gespräche, wir reden einfach über die Welt, sind albern. Ich spüre die Wirkung des Alkohols.
Ich habe Hemingways Faszination fürs Fischen nie geteilt. Angeblich verliebte er sich in Vigo, in Nordspanien, in die Thunfischjagd. Er sah einen riesigen Fisch am Haken und wollte wissen, wie man so ein Monster aus dem Wasser zieht. Mehrere Meter lang, mehrere Zentner schwer. Als er erfuhr, dass ein einzelner Mann so ein Tier aus dem Wasser ziehen kann, war es um Hemingway geschehen, denn natürlich war es nicht die Besinnlichkeit des Angelns, die ihn reizte. Ihm gefiel der Kampf zwischen Mensch und Tier. Das zähe Ringen, wenn man einen großen Brocken am Haken hat und nicht weiß, wer am Ende aufgeben wird: Fisch, Angler oder Leine. Im «Toronto Star Weekly» schrieb er: «Es ist rückenzerstörende, sehnenspannende Männerarbeit, selbst mit einer Rute, die wie ein Hacke-Griff aussieht. Aber wenn du nach einem sechsstündigen Kampf einen großen Thunfisch landest, nach einem Kampf ‹Mann gegen Fisch›, deine Muskeln von der unaufhörlichen Belastung schwach geworden, und du bringst ihn schließlich neben das Boot, grünblau und silber im ruhigen Ozean, wirst du gereinigt sein und in der Lage sein, unverfroren in die Gegenwart der alten Götter einzutreten, und sie werden dich willkommen heißen.»
Ich glaube, dass Hemingway ein Mann war, der einfach nicht wusste, wohin mit dem ganzen Testosteron. Er liebte den Stierkampf in Spanien, die Ballerei in Afrika, den Krieg in Europa. Er konnte nicht einfach nur angeln, er musste sich genau die Disziplin suchen, das Hochseeangeln, in der Angeln zum Zweikampf wird. Mann gegen Tier.
Mir ist das alles fremd. Die Fische haben mir nichts getan. Aber ich liebe Hemingways Bücher, gerade «Der alte Mann und das Meer», und mir gefällt die Idee, dass vor vielen Jahren Hemingway genau an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, mit seinem Freund Gregorio Fuentes aufs Meer fuhr. Gregorio, ein gebürtiger Spanier, war Analphabet, er hat das Buch nie gelesen, aber es war auch nicht nötig. Hemingway und er verbrachten viele Tage auf See, redeten, tranken und fühlten sich frei. So wie ich mit Pedro, José, Carlos und Mirco gerade. Ein Journalist und ein Fotograf aus Deutschland, zwei Fischer und Carlos, von dem ich überhaupt nicht genau wissen will, womit er sein Geld verdient. Uns verbindet nichts. Es spielt keine Rolle. Auch sie werden nie einen Text von mir lesen, und es könnte nicht unwichtiger sein. Wir schauen aufs Meer und fühlen uns frei. Ich für meinen Teil bin ziemlich betrunken.
Pedro posiert jetzt mit den Fischen. Mirco macht Fotos. Carlos, der Makler des Unmöglichen, hat für seine Verhältnisse kaum gesprochen. Er hatte lange auf Pedro geschaut, als der von seinem Traum erzählte, davon, wie er sich langsam hochgearbeitet hat.
Carlos ist in Cojímar aufgewachsen und wollte immer nur weg. Nach Amerika. Auch er hatte einen Traum. Mittlerweile ist er wieder da und schlägt sich mit halbseidenen Geschäften durch. Die beiden Leben könnten kaum unterschiedlicher sein.
«Mein Vater war Fischer», sagt er schließlich, «er hat immer gesagt, dass es der beste Beruf der Welt sei. Ich habe ihm nie geglaubt.»
Der gefährlichste Ort der Welt (Panama – Darién Gap – Kolumbien)
Comandante Ramirez vom «Batallón Central» hockt in einem grünen, bunkerartigen Steinbau am Ende einer zerschundenen Straße und scheint nicht zu wissen, ob er mich ausreden lassen soll – oder gleich wegsperrt. Seit einigen Minuten blättert er in meinem Pass und schlägt ab und zu nach Mücken am Hals.
«Setzen», sagt Ramirez.
Ich nehme Platz auf einer Holzbank und versuche, entspannt zu wirken. Ramirez befehligt den Stützpunkt von Panamas Grenzpolizei Senafront in Yaviza. Er soll mir einen Passierschein geben, mit dem ich Richtung kolumbianischer Grenze reisen darf. Solche Passierscheine gibt es eigentlich nicht.
Ramirez beugt sich noch tiefer über meinen Pass. Er scheint jede Zeile lesen zu wollen.
Es ist kurz nach vier am Nachmittag. Draußen ist es heiß, weit über dreißig Grad, und schwül. Es ist keine lästige Sommerschwüle, wie man sie in Europa nach einem Platzregen im Juli kennt. Es ist Regenwaldschwüle. Sie nimmt einem den Atem.
Seit einer Stunde bin ich in Yaviza, einer kleinen, verlorenen Grenzstadt, drei Autostunden südlich von Panama City. Sie besteht aus vier, fünf Straßenzügen, einigen Dutzend Wellblechhütten und einer betonierten Bootsanlegestelle am Rio Chucunaque, an der Bananen und Holz gelöscht werden. Yaviza ist für eine einzige Sache bekannt. Hier endet der nördliche Teil der «Panamericana», der 25750 Kilometer langen Landverbindung zwischen dem Norden und dem Süden des Kontinents, zwischen Alaska und Feuerland. Nordamerikaner nennen sie den «Pan-American-Highway», auch wenn von einem Highway in Yaviza keine Rede sein kann. Hier ist die Panamericana eine müde Schlaglochpiste, die unvermittelt vor einer Hängebrücke am Chucunaque endet.
«Also, was genau wollen Sie hier?», fragt Comandante Ramirez.
Ich stehe auf und mache ein paar Schritte auf seinen Schreibtisch zu. Wenn ich ihm sage, was ich vorhabe, ist die Reise vorbei.
«Comandante, hier ist die schriftliche Einladung der Kuna-Indianer in Paya und Púcuro, den zwei Dorfgemeinschaften flussaufwärts. Ich möchte dort einige Tage verbringen, sie kennenlernen und etwas über ihre Kultur erfahren. Ich bin Journalist.»
Ramirez schaut auf meinen Pass, während ich rede.
«Und das ist alles, ja?»
Das ist nicht alles. Nicht einmal ansatzweise.
Ich möchte den Darién Gap auf dem Landweg durchqueren. Zu Fuß von Panama nach Kolumbien. Von Yaviza sind das sechzig, vielleicht siebzig Kilometer Luftlinie. Klingt ganz einfach. Dennoch bin ich meines Wissens in den letzten drei Jahrzehnten der erste europäische Journalist, der das versucht. Zwei kolumbianische Kriegsfotografen, denen ich das erzählt habe, nennen mein Vorhaben einen «Todeswunsch».
Südlich von Yaviza erstreckt sich ein riesiger, fast unberührter Regenwald, ein grünes, hügeliges Elysium zwischen Atlantik und Pazifik aus Bergketten, Lagunen und Schluchten, der berühmte Darién Gap. Mit Gap, dem englischen Wort für Lücke, ist allerdings nicht nur die Unterbrechung der panamerikanischen Straße gemeint. Gap meint, dass es überhaupt kein Weiter gibt. Nicht für Autos, nicht für Boote, für niemanden.
«Sie wissen, wo Sie hier sind?», fragt Ramirez.
Natürlich weiß ich das.
Der Darién Gap ist ein als Paradies getarntes Kriegsgebiet. Eine wilde, magische Gegend, die 1980 zum Naturpark erklärt wurde und weitgehend intakt ist. 2440 Pflanzenarten, 170 Säugetierarten, 500 Vogelarten, 100 Reptilienarten, ein Viertel dieser Tiere und Pflanzen existieren nur hier, wo die Flora und Fauna Süd- und Mittelamerikas zusammentreffen. Es gibt Jaguare, Ozelote, Pumas, Boas, Tapire, Papageien, Iguanas. Ein Garten Eden, in dem man jederzeit einen Tarzan-Film drehen könnte.
Gleichzeitig ist der Darién einer der gefährlichsten Orte des Planeten. In den letzten dreißig Jahren hat sich dieser Regenwald in ein grünes Schlachtfeld verwandelt. Es gibt praktisch keine Staatsmacht. Was das Gesetz ist, machen linke Guerilleros aus Kolumbien, rechte Paramilitärs und gewöhnliche Drogenkartelle unter sich aus. Als sei das nicht Chaos genug, ist der Darién auch ein bekannter Rückzugsort für Mörder, Vergewaltiger, Räuber, Schmuggler, Betrüger, für alle, die einen Ort brauchen, an den sich kein Polizist, kein Soldat traut.
Über sie alle legt sich der Darién wie eine Schutzglocke, denn an die Stelle des Staates ist hier schon lange das Recht einer geladenen AK-47 getreten.
Ramirez schaut mich an.
«Als Tourist durch den Darién zu spazieren, das geht für uns als Selbstmordversuch durch», sagt er ernst.
Er ist nicht der Erste, der mir das sagt. Er klappt meinen Pass zu und stempelt die Einladung der Kuna-Indianer ab. Der Kommandant ist sichtlich verärgert, dass er mir die Weiterreise nicht verbieten darf. Aber ich habe einen Zettel, auf dem steht, dass mich der Häuptling der Kuna-Indianer in sein Dorf einlädt. Und das liegt mitten im Darién Gap.
«Wenn die Sie eingeladen haben, können Sie fahren. Keine Ahnung, ob Sie wissen, was Sie tun, aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Schauen Sie sich Ihre Indios woanders an.»
Der Morgen ist die schönste Zeit in Yaviza. Die ersten Männer verlassen kurz nach sechs mit ihren langen, schmalen Booten das Flussufer. Die Luft ist abgekühlt, Nebelschwaden ziehen über den Chucunaque, der hier mit dem Rio Yaviza zusammenfließt und einen breiten, sandfarbenen Strom bildet. Es gibt keine Autos von hier an, der Transport läuft über das Wasser.
Die Armee Panamas hat auf den Zufahrtsstraßen nach Yaviza Checkpoints errichtet. Die Kolumbianer auf der anderen Seite der Grenze handhaben das ähnlich. Wer Richtung Darién Gap unterwegs ist, wird auf Militär treffen und braucht einen guten Grund, um nicht abgewiesen zu werden. Die Einzigen, die sich mehr oder weniger frei bewegen dürfen, sind die Kuna. Die Ureinwohner dieser Gegend. Über einen Fotografen in Bogotá bin ich an die Einladung des Dorfältesten gekommen. Und vor meiner Ankunft in Panama war ich in Bogotá in zwei Gefängnissen und habe mit Vertretern der linken Farc-Guerilla und der rechten Paramilitärs gesprochen. Alte Kontakte eines anderen befreundeten Fotografen. Der linke Guerillero und der rechte Narcoterrorist, beide hatten abgeraten, den Darién zu betreten. Sie versprachen dennoch, die Leute vor Ort zu informieren.
Púcuro, mein erstes Ziel, liegt acht Stunden von Yaviza. Ich fahre auf einer Piragua, einem schmalen Einbaum mit Außenbordmotor. Der Regenwald wird deutlich dichter. Ich sehe die ersten Cuipos, mächtige Bäume, um die vierzig Meter hoch, die den Dschungel überragen. Dazwischen Königspalmen, Gummi- und Balsabäume und Sterculien, auch Panama-Baum genannt. Etwa alle halbe Stunde kommen wir an kleineren Orten vorbei: El Real, Pinogana, Vista Alegre, Yapeì. Im Darién leben verschiedene indigene Völker, Embera, Wounann und Kuna, dazu noch «Colonos», die Nachfahren afrikanischer Sklaven. Die winzigen Siedlungen bestehen aus schiefen Holzbauten und einem Posten der Grenzpolizei Senafront. Ich muss jedes Mal das Boot verlassen und mich beim Checkpoint melden, wo ein aufgeregter Soldat jedes Mal Ramirez anfunkt und fragt, ob der komische Europäer wirklich weiterfahren darf.
Mein Bootsführer findet das übertrieben. Meine Anwesenheit sei doch längst an alle wichtigen Stellen weitergegeben worden.
«Die Grenzpolizei weiß, dass ich komme», sage ich.
«Nein, nicht Senafront, ich meine die wichtigen Stellen.»
Er meint den «Frente 57», so heißt die Einheit der kolumbianischen Guerilla, die im Darién operiert. Den Chef nennen sie «El Pana», weil er aus Panama stammt. Er war mal Polizist und hat gute Kontakte zu den Drogenkartellen von Sinaloa und «Los Zetas» in Mexiko. Beide Gruppen haben im Darién Verbindungsleute, die den Kokaintransport überwachen. Die Region ist ideal, um Kokain auf Lasteseln Richtung Norden zu schmuggeln. Der Darién ist ein riesiges unbewachtes Einfallstor, um Stoff von Südamerika Richtung USA zu bringen. Vor einigen Monaten wurden nicht weit von hier hundertzwanzig Indios festgenommen, die, von Guerilleros begleitet, 1,4 Tonnen Kokain durch den Urwald schleppten. Jeder Schmuggler bekam umgerechnet dreihundertachtzig Euro. In den USA war die Ladung dreihundert Millionen Euro wert.
Man muss nicht lange im Darién Gap sein, um zu verstehen, dass der wirkliche Herrscher über das Gebiet die Farc sind, die marxistische Guerilla, die seit 1964 gegen den kolumbianischen Staat kämpft und das Grenzgebiet als Rückzugsgebiet nutzt. Die Farc behaupten noch immer, das Volk befreien zu wollen. Die meisten Kolumbianer, die ich kenne, glauben, dass sie nur noch eine Bande Mörder sind, die ins Gefängnis gehört. Als Narcoterroristen werden sie von den USA bezeichnet. Die Farc sind der größte Drogenproduzent Kolumbiens, sie kontrollieren Anbau und Produktion des Kokains und kooperieren mit den Ubareños, die früher mal rechte Paramilitärs waren und heute wenigstens den Anstand besitzen, sich als das zu bezeichnen, was sie sind: Drogendealer.
Es ist später Nachmittag. Den Rio Púcuro, den wir stromaufwärts fahren, hätte ein Set-Designer aus Hollywood nicht besser entwerfen können. Zehn, fünfzehn Meter ist der Fluss breit, dicht bewachsene Böschung an den Ufern. Die Kronen der mit Lianen behangenen Bäume beugen sich zum Wasser hin, so tief, dass man das Gefühl hat, durch einen Bogengang zu fahren. Im Hintergrund hallt das irre Schreikonzert der Brüllaffen. In den Ästen sitzen scharlachrote Aras. Blaue Morphofalter, die alle in perfekter Synchronisation hintereinander herfliegen, begleiten meine Piragua.
Ich muss an Comandante Ramirez denken, den Türsteher des Darién Gap. Für ihn ist das alles nur Wald, der Kriminelle versteckt. Aber auch Ramirez weiß, dass die Mörder und Diebe dieses Paradies gerettet haben. Weder die Holzfäller und Goldgräber noch die Großgrundbesitzer mit ihren Viehherden trauen sich in diesen Dschungel. Alle umliegenden Provinzen, in Panama wie in Kolumbien, wurden zerstört. Dort ist vom Regenwald nur noch eine niedergewalzte Graslandschaft übrig, auf der Vieh weidet. Es ist die Gewissheit, dass man den Darién Gap ohne Einladung nicht lebend verlässt, die den Wald gerettet hat.
Am Abend, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, komme ich in Púcuro an. Ein kleiner, unscheinbar aussehender Mann in schwarzen Regenstiefeln sitzt am Ufer. Er scheint auf mich gewartet zu haben. Er heißt Luís Tobar und ist der Cazique, der oberste Repräsentant Púcuros. Er hat ein weißes Hemd angezogen und sagt mir in einem freundlichen und leicht feierlichen Ton, dass die Frauen des Dorfes gekocht haben.
Luís führt mich auf einen schmalen Zementstreifen. Der Streifen sei neu, sagt er, und in Púcuro seien sie einigermaßen stolz darauf. Wenigstens versinke man in der Regenzeit nicht mehr knietief im Matsch, wenn man zum Fluss wolle. Strom und Wasser gebe es aber nicht, werde es nie geben, dafür liege man einfach zu weit weg.
Luís hat einen aufrechten, eleganten Gang. In seiner Hand hält er einen Stock. Diesen darf nur er, der Cazique, besitzen. Er ist aus Casoal, einer dunklen Holzart, die es laut Luís nicht mehr gibt. Die Oberfläche ist blank geschliffen. Sie soll die Geradlinigkeit symbolisieren, die von einem Cazique verlangt wird.
Der gut zweihundert Meter lange Zementweg sei ein Symbol, habe der Gesandte der Regierung gesagt. Dass man das Dorf nicht vergessen habe. «Natürlich haben die uns vergessen, wir sind die vergessenen Kuna», sagt Luís Tobar. «Du bist der erste Journalist, der uns besucht.»
Wer schon einmal in Panama war, hat zumindest von den Kuna gehört. Sie sind die größte indigene Bevölkerungsgruppe des Landes. Die meisten Touristen lernen sie als bunt gekleidete Indios kennen, die auf vorgelagerten Atlantikinseln leben. San Blas heißt der Archipel, ein karibisches Paradies aus über dreihundertsiebzig Inseln.
Die Molas, bestickte Stoffe, die sich Kuna-Frauen auf die Vorder- und Rückseite der Bluse nähen, sind als Souvenir mittlerweile so beliebt wie der Panama-Hut. Es gibt kaum einen Reiseführer, auf dem nicht eine schöne Kuna mit Nasenring von der Titelseite lächelt. Allerdings leben die Kuna erst seit hundertfünfzig Jahren auf diesen Inseln. Ihren Ursprung haben die Olotule, die «Goldmenschen», wie sie sich selbst nennen, im Darién. Von dort sind sie erst von den Spaniern und später von Nachfahren afrikanischer Sklaven vertrieben worden. Heute leben in Panama rund sechzigtausend Kuna. Es waren mal über eine halbe Million. Im Darién sind es keine tausend mehr.
Luís und ich gehen einen kleinen Hügel hinauf, von wo ich das Dorf sehen kann. Púcuro ist auf einer Lichtung gebaut, die auf zwei Seiten vom Fluss umspült wird. Fünfhundert Menschen leben hier, in rund fünfzig Holzhäusern. Reis und Bananen werden in kleinen Parzellen rund um das Dorf angebaut. Fleisch gibt es genug im Urwald.
Wir gehen in eines der Häuser, wo eine Familie um eine kleine Feuerstelle hockt und mir einen Teller in die Hand drückt. Es ist Ñeque, ein Nagetier, ein kleiner Verwandter des Stachelschweins. Luís sitzt mir gegenüber und schaut zu, wie ich ins Fleisch beiße. Er ist Anfang sechzig, hat feine, dunkle Züge und die Neigung, leise zu sprechen, weil man ihm dann aufmerksamer zuhört.
Ich hatte gelesen, dass 2003 in Púcuro und der Nachbargemeinde Paya fünf Kuna von rechten Paramilitärs getötet wurden. Sie wurden der Kooperation mit der linken Guerilla verdächtigt. Die Mörder sind nie gefasst worden. Ich frage Luís, wie man als Ureinwohner in einer solchen Hölle überlebt.
«Man lernt in dieser Gegend früh, Dinge nicht zu sehen und über die Dinge, die man nicht gesehen hat, zu schweigen.»
Er ist seit vielen Jahren der Anführer des Ortes. Der weise Mann Púcuros. Er hat den Männern verboten, im Dorf Alkohol zu trinken, hat der Provinzverwaltung einen windschiefen Schulbau abgetrotzt und dafür gesorgt, dass alle drei Monate ein Ärzteteam eingeflogen wird.
Das Dorf verspricht sich viel von meinem Besuch. Die Kuna im Darién möchten ein eigenes Reservat haben, in dem sie sich selbst verwalten können. Seit neunzehn Jahren verhandelt Luís mit den Behörden. Bisher ohne Erfolg. Die Regierung erkennt ihn zwar als Repräsentanten der Kuna in der Region an, macht aber keine Zugeständnisse. Luís wünscht sich, dass ich «über die vergessenen Menschen im Darién» berichte. Über den Skandal, dass die Kuna auf dem Gebiet ihrer Vorfahren praktisch keine Rechte haben. «Alles, was du hier siehst, der Fluss, der Wald, das Dorf, es gehört uns nicht.» Dass sie als Ureinwohner zwischen Horden von Mördern und Drogendealern leben und sich niemand darum schert. «Erzähle der Welt, dass es uns gibt.»
Ich überlege, ob ich ihm sagen soll, was ich über die US-amerikanische Firma OTS Latin America LLC weiß. Dieses Unternehmen hat vor drei Jahren Bodenproben ausgewertet und die Erdölvorkommen im Darién-Gebiet auf neunhundert Millionen Barrel geschätzt. Die Einnahmen für die Regierung wurden mit zwanzig Milliarden Dollar veranschlagt. Mit anderen Worten, die Kuna werden das Land nie bekommen. Dafür erhöhen sich gerade die Chancen, dass die seit Jahrzehnten geplante Straße durch den Darién Gap gebaut und die Lücke der Panamericana geschlossen wird. Die meistdiskutierte Route würde von Yaviza über Púcuro bis nach Guapá auf der kolumbianischen Seite führen.
Luís möchte die Straße nicht. Sie würde all jene anlocken, die bisher den Darién gemieden haben: Viehzüchter, Holzkonzerne, Landwirte. Der Darién gilt neben dem Amazonas als die zweite Lunge des Kontinents. Es ist aber eine kleine Lunge. 21000 Quadratkilometer. Einer massiven Rodung würde sie nicht lange standhalten.
«Vor einigen Monaten war jemand von der Uno da», sagt Luís. Der Mann habe sich das Dorf angeschaut und lange zugehört. «Er sagt, dass unser Kampf Erfolg haben könnte. Er will sich in der Hauptstadt für Púcuro einsetzen.»
Die Frauen, die das Essen gekocht haben, nicken fröhlich. Die Uno hat sich jetzt der Sache angenommen. Die Vereinten Nationen. Es klingt nach Durchbruch. Nach großem Sieg. Es ist der Moment, in dem ich beschließe, Luís nichts von der amerikanischen Firma zu erzählen, nichts von den neunhundert Millionen Barrel Öl unter seinen Füßen, nichts von dem, was fünfhundert Urwaldindianer zu erwarten haben, wenn zwanzig Milliarden Dollar im Spiel sind.
Am nächsten Morgen breche ich zusammen mit zwei Männern auf. Der ältere, ein hagerer Typ mit einer Affenzahnkette um den Hals, stellt sich als «Schildkrötenbrust» vor. Milton Etxeberri, wie er wirklich heißt, ist vor Jahren mal auf einen Hobo geklettert, einen Stachelbaum, um Iguanas, grüne Leguane, zu jagen. Noch Wochen später hat man ihm Dornen aus dem Körper gezogen. Er kennt die Gegend wie kaum ein anderer.
Mein anderer Begleiter ist ein junger Kerl, der nicht viel redet. Vielleicht hat er keine Lust auf sechs Stunden Dschungelmarsch, vielleicht liegt es auch an der Bommelmütze aus Wolle, die er wie viele hier auch bei fünfunddreißig Grad und hundert Prozent Luftfeuchtigkeit trägt. Wir setzen mit einem Einbaum über den Fluss und suchen im Dickicht den Pfad Richtung Süden. Der Boden ist mit Laub und rötlichem Matsch bedeckt. Auf beiden rutscht man leicht aus. Es hat zum Glück wenig geregnet in den letzten Tagen. Von Mai bis November, in der Regenzeit, versinkt man hier an manchen Stellen bis zur Hüfte im Schlamm.
Unser Ziel ist Paya, das letzte Dorf vor der Grenze. Von da ist es nur noch ein halber Tag bis Kolumbien. Ich habe bisher niemandem gesagt, was ich vorhabe. Für die Kuna mache ich diese Reise, um über sie zu berichten. Sie würden nicht verstehen, dass man einfach nur durch den Urwald marschieren will. Einfach so, weil es gefährlich ist und sich kaum einer traut. In ihrer Welt geht es immer darum, Gefahr zu vermeiden. Nicht, sie zu suchen. Darum hält sich auch ihr Mitleid mit dem «wahnsinnigen Schweden» in Grenzen, über den gestern im Dorf einige redeten.
Ich kannte die Geschichte bereits. Der Name des Schweden war Jan Philip Braunisch. Er versuchte im Frühjahr 2013, allein durch den Darién zu kommen. Braunisch wurde sechsundzwanzig Jahre alt. Sein Bild hängt an allen südlichen Stützpunkten von Senafront. Am 10. Mai verließ er Bogotá und kam fünf Tage später in Riosucio an, unweit der Grenze zum Darién. Dort wurde er zuletzt gesehen. In sein Reisetagebuch im Internet schrieb Braunisch, dass er einen Weg gefunden habe, durch den Dschungel nach Panama zu kommen. Seiner Frau teilte Senafront mit, dass man eine zerstückelte, aber unvollständige Leiche gefunden habe, die «europäisch» aussehe. Meine beiden Begleiter gehen davon aus, dass ihn jemand für die paar Dollar in seiner Tasche umgebracht hat.
Es ist vermutlich genau dieser Wahnsinn aus Kokain, Krieg und Dschungelromantik, der den Darién zur Legende gemacht hat. In einer Zeit, in der Entdecker ausgestorben sind und die Werbung den Menschen einhämmert, dass es keine Grenzen gibt, sondern nur noch Möglichkeiten, in dieser Zeit strahlt der Darién wie eine der letzten Verheißungen. Das Außenministerium Österreichs nennt seine Durchquerung «eines der letzten großen Abenteuer». Der Satz steht unter den Reisewarnungen für Panama. Er klingt wie ein Lockruf.
Es werden sich immer genügend Menschen finden, die es versuchen. Leute wie mich oder wie Robert Pelton, Autor des Buches «The World’s Most Dangerous Places». Pelton ist Berufsabenteurer. Er war in Mogadischu, Grosny, Bagdad, Port-au-Prince, Kabul und hat für CNN berichtet. Den Darién Gap nennt er «den Everest», den er nie besiegt hat. Pelton hat es 2003 probiert. Zehn Tage war er in Gefangenschaft von Paramilitärs, verlor zehn Kilo, kam durch blankes Glück frei und versuchte es nie wieder.
Mein Begleiter Milton, der vermutlich ahnt, was ich vorhabe, weil ich auffällig viele Fragen über Kolumbien stelle, sagt etwas unvermittelt: «Also, die Somalier brauchen eine Woche, um den Darién zu durchqueren.»
Ich bleibe stehen.
«Was denn für Somalier?»
«Sie kommen ein-, zweimal die Woche aus Kolumbien in Paya an. Mal sind es drei, mal fünf, manchmal auch zwanzig. Somalier, Chinesen, Kubaner, alles Mögliche. Wollen alle in die USA.»
Wir halten an einer kleinen Flussbiegung. Der Fluss heißt Tapaliza, und bevor wir ihn überqueren, möchte Milton sich ausruhen. Er setzt sich auf einen Baumstumpf und nimmt nach drei Stunden den ersten Schluck aus seiner Wasserflasche. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon über vier Liter getrunken.
«Seit gut einem Jahr kommen sie», sagt er, «Hunderte arme Hunde, Illegale. Sie sagen, sie wollen bis Nordamerika. Zu Fuß.»
Milton erzählt mir, dass die Farc-Guerilla und die Kartelle die verschiedenen Transportwege durch den Darién aufgeteilt haben. Die Route auf der Pazifikseite wird für Kokain genutzt. Wer da durchgeht, ist so gut wie tot. Wahrscheinlich hat Braunisch diesen Weg gewählt. Der Weg durch den Darién auf der Atlantikseite, der Weg, den wir gerade gehen, ist zum großen Teil für illegale Einwanderer reserviert, die von Südamerika nach Nordamerika gelangen wollen. Eine Schmugglerroute für Menschen. Die Reise beginnt in Turbo, an der kolumbianischen Küste, und endet im Dorf Paya auf der Seite Panamas. Für fünfhundert Dollar bekommt man einen Führer und das Versprechen, bei der Überquerung wahrscheinlich nicht erschossen zu werden.
«Und in Paya rennen wirklich Typen aus Mogadischu herum? Mitten im mittelamerikanischen Urwald?», frage ich.
«Warte, bis wir ankommen.»