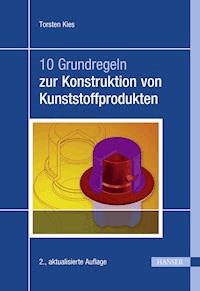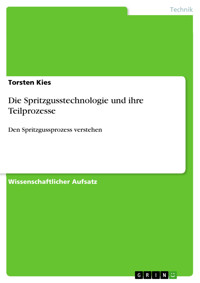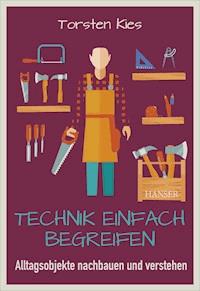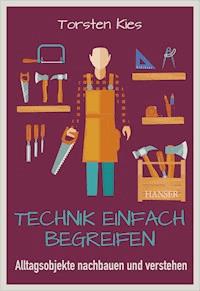
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Beim eigenen Gestalten lernen, wie technische Aspekte umgesetzt werden.Dieses Buch beschreibt anhand von konkreten Beispielen zum Eigenbau die Herangehensweise und die technischen Prinzipien, nach denen ein Ingenieur arbeitet. Dabei reicht die Vielfalt der Beispiele mit dem Grundstoff Holz von der einfachsten Anwendung bis zu komplexeren Gestaltungen. Konkrete Beispiele zu Fragen nach- der Gestaltung von Erzeugnissen in harmonischen Proportionen,- dem Abstimmen von mehreren Bauteilen und deren Zusammenfügen,- der effektive Herstellung von vielen gleichen Teilen,- der Abstimmung der Einzelteile aufeinander bei komplexen Baugruppen und - die Bedeutung von Passungen und Toleranzen.Die Erklärung von technischen Prinzipien mit konkreten Beispielen dient vor allem Studierenden vor oder in der Eingangsphase ihrer Ausbildung. Für besonders interessierte Jugendliche können die Beispiele als konkrete Bauanleitung gesehen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Torsten Kies
Technik einfach begreifen
Alltagsobjekte nachbauen und verstehen
Der Autor:
Prof. Dr.-Ing. Torsten Kies, Zentrum für IngenieurwissenschaftenMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.
Ebenso übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr dafür, dass beschriebene Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt deshalb auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2016 Carl Hanser Verlag Münchenwww.hanser-fachbuch.de
Lektorat: Ute Eckardte Herstellung: Katrin Wulst Umschlagrealisation: Stephan Rönigk
ISBN 978-3-446-44276-4 E-Book ISBN 978-3-446-45146-9
Verwendete Schriften: SourceSansPro und SourceCodePro (Lizenz) CSS-Version: 1.0
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Vorwort
Danksagung
1 Viele Wege führen zum Ziel ‒ Das Beispiel Flaschenöffner
1.1 Funktionsanalyse
1.1.1 Allgemeine Vorgehensweise und Begriffserklärung
1.1.2 Varianten zum Öffnen von Flaschen
1.2 Korkpfropfen
1.2.1 Aufbau und Prinzip der Abdichtung
1.2.2 Öffnungsvorgang durch innere Krafteinwirkung
1.2.3 Öffnungsvorgang durch äußere Krafteinwirkung
1.3 Kronkorken
1.3.1 Aufbau und Prinzip der Abdichtung
1.3.2 Öffnungsvorgang durch äußere Krafteinwirkung
1.3.3 Gestaltung eines einfachen Öffnungswerkzeuges für Kronkorken
1.4 Schraubverschluss
2 Wie wichtig Proportionen sind ‒ Ein Frühstücksbrettchen entsteht
2.1 Länge und Breite eines Frühstücksbrettchens
2.1.1 Proportionen bei flächigen Anwendungen
2.1.2 Proportionen bei mechanischer Belastung
2.1.3 Proportionen aus ästhetischer Sicht
2.1.4 Auslegungsfehler und deren Konsequenzen
2.1.5 Ableitung von Proportionen nach objektiven Kriterien
2.1.6 Möglichkeiten der Begutachtung
2.1.7 Festlegung der Abmessungen
2.1.8 Materialauswahl
2.2 Umsetzung des Entwurfs
2.3 Mehraufwand bei schönen Formen
2.4 Nachbearbeitung
3 Teile die zusammengehören ‒ Eine Starteinrichtung für Silvesterraketen entsteht
3.1 Funktionsanalyse
3.2 Proportionen der Einzelteile
3.3 Möglichkeiten zur Verbindung von Einzelteilen
3.3.1 Übersicht
3.3.2 Schweißverfahren
3.3.3 Kleben
3.3.4 Nageln und Krampen zum Verstiften von Bauteilen
3.3.5 Schrauben
3.3.6 Klemmen
3.4 Montage der Raketenstartrampe
3.5 Variationsformen
4 Serienfertigung im Beispiel ‒ Eine Schlange mit vielen gleichen Segmenten
4.1 Aufbau aus einzelnen Segmenten
4.2 „Serienfertigung“ der Segmente
4.2.1 Fertigungsaspekte am Beispiel Schlangenbau
4.2.2 Allgemeines zur Fertigung
4.2.3 Handwerkliche Produktion
4.2.4 Industrielle Fabrikation
4.2.5 Industrielle Serienfertigung
4.2.6 Auf das Erzeugnis fokussierte postindustrielle Produktion
4.2.7 Anwendungen der Produktionsweisen
4.3 Herstellungsprozess
4.3.1 Herstellung der Einzelteile
4.3.2 Zur Farbgestaltung
4.3.3 Montage
4.3.4 Zusammenfassung von Produktionsweisen am Beispiel
5 Möbelbau in Kastenbauweise
5.1 Konstruktiver Aufbau
5.1.1 Überblick
5.1.2 Entwerfen von Kastenelementen für Stapelmöbel
5.1.3 Entwerfen eines Cajóns
5.1.4 Entwerfen eines Kastenregals
5.2 Grundsätzliches zur Bemaßung
5.2.1 Messaufwand
5.2.2 Regeln für das Technische Zeichnen
5.2.3 Bemaßung zur Festlegung der Geometrie
5.3 Entwürfe für konkrete Kastenmöbel
5.3.1 Vorgehensweise
5.3.2 Auslegung der Stapelmöbel
5.3.3 Auslegung des Cajóns
5.3.4 Auslegung des Kastenregals
5.4 Stückliste ‒ Übersicht über viele Einzelteile
5.5 Montage
5.6 Zur Oberflächenbehandlung
6 Alles muss zusammenpassen ‒ Eine Kegelbahn für jeden Ort
6.1 Grundidee
6.2 Technische Umsetzung
6.3 Passungen und Toleranzen
6.3.1 Einführung
6.3.2 Erwünschte Toleranzen und technologisch bedingte Maßabweichungen
6.3.3 Konstruktiv notwendige Passung
6.3.4 Technologische Streuung
6.3.5 Festlegung der Toleranz
6.3.6 Möglichkeiten zum konstruktiven Toleranzausgleich
6.4 Herstellung der Kegelbahn
6.5 Weitere Projektvorschläge
6.5.1 Schutzschild aus Holz
6.5.2 Boot aus zwei Hälften
7 Aus zwei Dimensionen mach drei ‒ Ein 3D Puzzle entsteht
7.1 Grundidee
7.2 Computergestützte Konstruktion und Fertigung
7.2.1 Computergestützte Konstruktion
7.2.2 Computergestützte Fertigung
7.2.3 Konsequenzen und Bedeutung der computergestützten Konstruktion und Fertigung
7.3 Konstruktion
7.4 Herstellung
7.5 Arbeit mit dem 3D-Drucker
Bildung ist ein hohes Gut. Sie ist in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland die Grundlage des Wohlstandes. Diese Grundaussage ist in unserer Gesellschaft unumstritten. Bei der Frage, was eine gute Bildung ausmacht, gehen die Meinungen aber weit auseinander. Elemente dieser Diskussion sind die Schulnoten, die soziale Kompetenz und andere Eigenschaften des Bildungsempfängers, aber auch äußere Faktoren wie das Fachgebiet des Betrachters oder die organisatorischen und fiskalischen Gegebenheiten.
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bildung ist die Pluralität ‒ nicht nur in fachlicher, auch in methodischer Hinsicht. Die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte setzt nach wie vor auf eine abstrakte Wissensvermittlung. Bei der Erarbeitung des Zugangs zu dieser Welt werden die Wissensempfänger ‒ von einem Fachgebiet mehr vom anderen weniger ‒ sich selbst überlassen.
In meiner Zeit als Hochschullehrer kam von den Studierenden immer die Frage nach einem Beispiel, wenn ihnen die Vorlesungsinhalte zu abstrakt erschienen. Gerade bei der Wissensvermittlung auf dem Gebiet der Technik bietet sich die Arbeit mit Beispielen geradezu an. Anhand einer Aufgabenstellung kann man das Abstrakte erklären ‒ so haben die Hörer oder Leser eine Motivation und verstehen das vermittelte Wissen nicht mehr abstrakt, sondern als Werkzeug zur Problemlösung. Die unmittelbar Anwendung des Vermittelten in einer Übung ist Praxis der Hochschullehre. Das vorliegende Buch bietet nun zusätzlichden Luxus, diese Übung nicht mehr allein auf dem Papier, sondern unmittelbar praktisch an einem Erzeugnis umzusetzen.
Einige Dozenten werden diese Vorgehensweise vielleicht als unwissenschaftlich ablehnen, vielleicht weil ähnliche Prinzipien in der gewerblichen Ausbildung angewendet werden. Gleichzeitig beklagt man sich darüber, dass der Wissenstand der Studienanfänger scheinbar von Jahrgang zu Jahrgang abnimmt.
Im Rahmen der angemahnten Pluralität muss man natürlich nicht jeder der hier skizzierten Methodik zustimmen, aber sie sollte als eine Möglichkeit des Wissenserwerbs auch mit dem Ziel einer akademischen Laufbahn akzeptiert werden. So richtet sich dieses Buch speziell an potenzielle Studierende technischer Fachrichtungen mit einem Bezug zum Maschinenbau. Sie können ihre Neugier an technischen Lösungen befriedigen und vertiefen. Auch Studentinnen und Studenten mit einer technischen Ausrichtung im Nebenfach möchte ich mit diesem Buch motivieren, einen Zugang zum Ingenieurwesen zu finden. Als ergänzende Literatur verwendet, bietet das Buch Anregungen und Motivation, um die an der Hochschule angebotenen Inhalte besser einordnen zu können.
Mit einem gewissen Erstaunen bemerkte ich, dass die Umsetzung der hier angeführten Beispiele bereits von Jugendlichen ausgeführt werden kann. Hier eröffnet sich eine Möglichkeit, bereits im Schulalter technische Grundlagen zu vermitteln. Nachdem lange Zeit von einem Fachkräftemangel geredet wurde, finden sich nun mehr und mehr Träger, die außerschulische Aktivitäten zur technischen Bildung von Kindern und Jugendlichen unterstützen. Vielleicht bietet dieses Buch Ansätze, um auch diesen Initiativen inhaltliche Orientierungspunkte zu geben.
Schließlich möchte ich getreu der Idee vom lebenslangen Lernen auch Menschen ansprechen, die sich auch außerhalb ihrer beruflichen Motivation für Technik interessieren, und vielleicht im Heimwerkerbereich Freude an der kreativen Umsetzung praxiserprobter Projekte haben. Auch sie werden beim Lesen des Buches Neues entdecken und Anregungen für eigene Projekte finden.
Unabhängig von der Motivation zum Kauf oder Ausleihen des Buches wünsche ich Spaß und Vergnügen beim Lesen.
Halle, im Sommer 2016
Torsten Kies
Beim Schreiben des Buches habe ich von vielen Seiten Unterstützung erfahren. Aus dem Kollegenkreis kam während des Entstehungsprozesses viel Motivation meist durch offene Zustimmung, mitunter auch durch verhaltene Bedenken, die ich mit der Buchherstellung nun gern ausräumen möchte. Besonderer Dank gilt meinem Kollegen Prof. Dr.-Ing. Ullrich für die technische Unterstützung beim Schreiben des Buches.
Starke Motivationsgeber fand ich in den Mitstreitern vom Halleschen Bezirksverein des VDI: Dr. Schmidt, Herrn Brüsehaber und Frau Prof. Dr. Hartmann. Vor allem die Zukunftspiloten Jamil, Niclas, Sebastian und Alexander sowie der Mitbetreuer Siegfried Blaudt testeten die dargestellten Projekte auf Herz und Nieren. Weitere Unterstützung bei der Umsetzung einiger Projekte kam von Roberto Hofmann vom Eigenbaukombinat Halle e. V., der mit Sonderschichten nach Feierabend einiges ermöglichte.
Ganz besonderer Dank gilt meinem familiären Umfeld. Meine liebe Frau suchte und fand viele meiner Rechtschreibfehler, die Kinder zeigten meist Verständnis, wenn der Familiencomputer blockiert wurde und ihnen nicht für Spiele zur Verfügung stand. Nun ist es geschafft und ich verspreche einige Säumnisse aus der letzten Zeit nachzuholen.
Halle, im Sommer 2016
Torsten Kies
Charakteristisch für uns Menschen ist der Gebrauch von Hilfsmitteln bei der Verrichtung unserer Tätigkeiten. Die wie auch immer gearteten Hilfsmittel erfüllen mindestens eine bestimmte Funktion. Die meisten unserer Tätigkeiten sind aber komplex und erfordern die Erfüllung mehrerer Funktionen nacheinander oder gar gleichzeitig. Und umgekehrt ist die Komplexität unserer Tätigkeit unmittelbar von der Funktionalität der verwendeten Hilfsmittel abhängig.
Die Funktionalität eines Hilfsmittels wird durch einzelne Elemente charakterisiert. Um eine gewünschte Tätigkeit ausführen zu können, müssen bestimmte, definierte Elemente der Funktionalität erfüllt werden, die als Funktionsanforderungen bezeichnet werden.
Eine Funktionsanforderung ist ein einzelnes Element zur Erfüllung eines Funktionsaspekts.
Neben der rein technischen Funktionalität ist ein Beispiel für eine immer wieder zu erfüllende Funktionsanforderung, die nach angenehmer Haptik, das heißt die Sicherstellung eines positiven Gefühls bei der Berührung des betreffenden Gegenstands.
Aufgrund der Fülle der menschlichen Tätigkeiten ist ebenfalls eine begriffliche Einschränkung sinnvoll.
Man bezeichnet eine bestimmte beabsichtigte Handlung oder Nutzung als „technische Aufgabe“.
Um eine technische Aufgabe zu erfüllen, wendet man ein bestimmtes Funktionsprinzip an. In den meisten Fällen können mehrere Wege beschritten werden, um eine bestehende technische Aufgabe zu erfüllen; es können mehrere Funktionsprinzipien alternativ angewendet werden.
Ein Funktionsprinzip ist ein möglicher Weg zur Erfüllung einer technischen Aufgabe.
Die Erfüllung der meisten technischen Aufgaben verknüpfen wir allerdings in unserer Vorstellung meist mit genau einem Funktionsprinzip. Soll ein Fahrzeug vor Wind und Wetter geschützt werden, denkt jeder zunächst an die Nutzung einer Garage. Nur wenn diese Bauleistung nicht realisiert werden kann, überlegen wir aus der Not heraus weiter und kommen vielleicht auf die Möglichkeit einer Faltgarage oder eines zeltartigen Unterstandes.
In unserem Denken scheint sich zunächst eine Blockade aufzubauen, wenn eine Möglichkeit zur Erfüllung der technischen Aufgabe gefunden wurde.
Wenn es einigermaßen zielführend ist, wird gleich diese erste Idee weiter verfolgt, ohne Alternativen zu hinterfragen.
Diese Vorgehensweise hat durchaus Vorteile. So kann man sehr schnell eine Lösung herbeiführen und das betreffende Problem ohne Verunsicherung und Entscheidungsnotstände lösen.
Vor allem für technische Aufgaben, die sehr häufig erfüllt werden müssen, lohnt es sich aber durchaus nach Alternativen zu suchen, um die optimale Lösung des Problems zu entdecken. Mit etwas Erfahrung und Routine sind wir in der Lage, unser Denken durch unser Bewusstsein zu steuern und wir können nach weiteren Funktionsprinzipien suchen, um die für den jeweiligen Fall am besten geeignetsten zu finden.
Bei vielen technischen Aufgaben sind alternative Lösungen bekannt, aber es dominiert ein bestimmtes technisches Prinzip den Markt. Bei anderen Aufgaben verzichtet man zum Teil ganz bewusst darauf, nach alternativen Lösungen zu suchen. Das drückt sich in der Weisheit aus, dass man das Fahrrad nicht neu erfinden muss. Zwischen den dreißiger und den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde dieser Spruch sehr wörtlich genommen und es wurden kaum alternative Lösungen zum bekannten Drahtesel mit Diamantrahmen angeboten, der die Form des 1885 vorgestellten Sicherheitsrads durch die Jahrzehnte brachte.
Nach der Ölkrise in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bezog man in die Überlegungen zu alternativen Verkehrsmitteln auch Fahrräder als geeignete Fortbewegungsmittel ein. Motiviert durch Abenteuerlust und sportlichem Eifer einiger Jugendlicher erlaubte der technische Fortschritt die Entwicklung von Mountainbikes in Kalifornien und daraus abgeleitet von All-Terrain-Bikes, die neben den verbreiterten Reifen neue Impulse bei der Schaltung und den Bremsen auch für andere Fahrradklassen implizierten. Neben den Rädern mit aufrechter Sitzposition hat sich aber auch seit den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ein Markt für Liegefahrräder gefunden.
Schließlich gibt es Anwendungsbereiche, bei denen durch die Anwendung von ganz unterschiedlichen mehr oder weniger gleichberechtigten Lösungsprinzipien eine technische Aufgabenstellung erfüllt werden kann. Das Zusammenspiel aller Verkehrsmittel zum Personentransport kann hier als Beispiel dienen.
Neben den rein anwendungstechnischen Aspekten spielen auch sich verändernde technische Möglichkeiten, ökonomische Aspekte, der jeweilige Zeitgeist und nicht zuletzt die Mode eine Rolle bei der Akzeptanz eines technischen Lösungsprinzips.
Bei der Entwicklung von technischen Produkten ist es die Aufgabe des Ingenieurs, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe am besten geeignete technische Lösung zu finden. Dazu muss er akzeptieren, dass man ein Ziel auf mehreren Wegen erreichen kann und mehrere alternative Varianten zur Lösung der technischen Aufgabe erarbeiten. Einige der Varianten sollten alternative Funktionsprinzipien realisieren (Bild 1.1).
Bild 1.1 Mehrere Varianten zur Erfüllung einer technischen Aufgabe
Die Abgrenzung der Varianten sollte so erfolgen, dass nicht nur unterschiedliche Modifikationen eines technischen Lösungsweges ausgeführt werden, sondern tatsächlich alternative Funktionsprinzipien angewendet werden. Für das im Bild 1.1 gewählte Beispiel wurden stellvertretend für das Funktionsprinzip 2 mehrere ähnliche Varianten benannt. So funktionieren die dort beispielhaft genannten Damen- und Herrenrädern nach dem gleichen Funktionsprinzip, genauso wie Straßenfahrräder oder Mountainbikes. Liegefahrräder und Tretroller setzen dagegen echte alternative Funktionsprinzipien um (Funktionsprinzip 1 beziehungsweise 3 in Bild 1.1).
Charakteristisch für die Tätigkeit eines Ingenieurs ist neben der Modifikation bestehender Lösungen und deren stetiger Verbesserung die Entwicklung von neuen, bisher unbekannten Produkten. Besonders zur Lösung solcher Aufgabenstellungen benötigt man eine spezielle Vorgehensweise, mit deren Hilfe technischen Lösungen gefunden werden, die den Anforderungen bestmöglich entsprechen.
Bei der Anwendung dieser Vorgehensweise beginnt man zunächst mit der Funktionsanalyse. Der Begriff wird nicht allein in der Technik, sondern auch in anderen Bereichen verwendet und teilweise mit anderen oder zusätzlichen Inhalten verbunden. Daher ist eine Definition für das hier zugedachte Verständnis angebracht:
Die Funktionsanalyse ist ein Instrument zur Ermittlung der technischen Aufgabenstellung für ein Erzeugnis und benennt alle angestrebten Teilaspekte der Aufgabenstellung vollständig.
Die Funktionsanalyse ist also ein Werkzeug, mit dem ein Ingenieur die Zielstellung für sein Handeln im Entwicklungsprozess festlegt. Im Gegensatz zu vielen anderen Tätigkeitsgebieten ist es meist nicht zielführend, wenn die Aspekte der Aufgabenstellung allein aus den Wünschen des Kunden generiert werden. In einigen Fällen handelt der Entwickler aus eigenem Antrieb und möchte seinen (potenziellen) Kunden ein Erzeugnis präsentieren. Auch wenn ‒ wie bei der Mehrheit der Entwicklungsprojekte ‒ die Entwicklung mit der Beteiligung eines oder mehrerer Kunden ausgeführt wird, müssen und können bestimmte Aspekte aufgrund seiner Kompetenz nur allein vom Ingenieur eingebracht und berücksichtigt werden. Hierzu gehören beispielsweise die Aspekte einer günstigen und modernen Fertigung. Die Funktionsanforderungen sind also keine eindimensionale skalare Größe, man kann sie mit einem mehrdimensionalen Vektor vergleichen, der unterschiedliche Aspekte der Entwicklungsziele beschreibt (Bild 1.2).
Bild 1.2 Schema zu den Begrifflichkeiten beim Produktentstehungsprozess
In den meisten Fällen widersprechen sich einige der mithilfe der Funktionsanalyse erkannten Aspekte. So sind die Wünsche nach möglichst geringen Kosten und eine hohe Wertigkeit und Beständigkeit des Erzeugnisses ein immer wieder anzutreffender Widerspruch, für den ein gut akzeptierbarer Kompromiss gefunden werden muss.
Bei der Funktionsanalyse müssen möglichst viele Aspekte der Anforderungen an das gewünschte Erzeugnis aufgefunden werden, damit sie beim weiteren Fortgang des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden können. Die Kompetenz, die Erfahrung und die Sorgfalt bei der Ausführung der Funktionsanalyse ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Marktgängigkeit des Erzeugnisses.
Die schöpferische Aufgabe des Ingenieurs besteht nun darin, eine Gestalt für das Erzeugnis zu finden, mit der möglichst viele während der Funktionsanalyse ermittelte Wünsche erfüllt werden. Das damit realisierte Produkt soll den Erwartungen nicht nur entsprechen ‒ es muss sie übertreffen, damit der Kunde nicht nur zufrieden, sondern begeistert ist und eine feste Beziehung zu seinem Auftragnehmer eingeht.
Weil unterschiedliche Funktionsprinzipien eine andere Gestalt des Erzeugnisses bedingen und selbst ein und dasselbe Funktionsprinzip durch mehrere unterschiedliche Gestalten umgesetzt werden kann, sind in dieser frühen Phase des Entwicklungsprozesses mehrere Entwürfe zumindest für das grobe Aussehen des geplanten Erzeugnisses nötig. Auch bei sehr erfahrenen Konstrukteuren und vermeintlich einfachen technischen Aufgaben sollten mindestens drei Entwürfe vorliegen, um alternative Varianten zu garantieren. Dagegen sind mehr als ein Dutzend unterschiedliche Varianten schwer handhabbar. Überflüssig sind Varianten, die von vornherein nicht geeignet sind, die technische Aufgabe zu erfüllen. Die einzelnen Varianten müssen in diesem frühen Stadium der Erzeugnisentwicklung mehrere unterschiedliche Funktionsprinzipien repräsentieren und dürfen nicht nur leichte Abwandlungen und Variationen zur Realisierung eines Funktionsprinzips darstellen. Die Auffindung von alternativen Funktionsprinzipien fällt vor allem gestandenen Entwicklern schwer, weil sie aus ihrer Erfahrung heraus in eingefahrenen Bahnen denken und so schon einen mehr oder weniger vorgefertigten Lösungsweg für die Konstruktion sehen.
Auch wenn nun eine Vielzahl von Varianten vorliegt, kann das geplante Produkt nur in einer Form realisiert werden. Folglich muss eine Auswahl getroffen werden. Das etablierte Werkzeug zur Auswahl der geeigneten Variante wird als Variantenvergleich bezeichnet:
Der Variantenvergleich ist das Auswahlverfahren, um eine Vielzahl von technischen Lösungsvorschlägen für eine technische Aufgabe auf eine geeignete zu reduzieren.
Zum Variantenvergleich stehen mehrere Werkzeuge zur Verfügung:
Subjektive Auswahl
Objektive Messung einer Größe
Gewichtete Messung mehrerer Größen
Die einfachste Art des Variantenvergleichs ist die rein subjektive Auswahl, bei der entweder der Entwickler selbst oder ein anderer sachkundiger Kollege die Auswahl nach eigenem Ermessen mehr oder weniger emotional trifft. Das kann auch durch ein Kollegium erfolgen, dessen Mitglieder sich beraten und anschließend ihre Auswahl im Konsensprinzip treffen oder unabhängig voneinander entscheiden und dann die Variante mit den meisten Stimmen wählen. Diese Vorgehensweise ist beispielsweise bei mehreren Designvarianten eines Erzeugnisses sinnvoll, wenn keine klaren abzählbaren Größen zur Funktionserfüllung abgeleitet werden können.
Bei rein technischen Aufgaben kann häufig eine genau messbare Größe, wie mögliche Kraftaufnahme, die erforderliche Masse des Systems oder der Energieverbrauch zur Erfüllung einer Aufgabe bestimmt werden. Dann sind objektive Auswahlverfahren anwendbar. Die Bewertung der Eignung einzelner Varianten erfolgt entsprechend vorher festgelegten Kriterien, welche die Erfüllung einzelner Funktionsanforderungen widerspiegeln.
Bei den meisten technischen Systemen müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig und mehr oder weniger gleichberechtigt erfüllt werden. Um den Überblick über die Eignung der Varianten zu behalten, sind zur Auswahl abstrakte Werkzeuge für den Variantenvergleich notwendig.
Im einfachsten Fall wählt man diejenige, mit der die größte Anzahl der Funktionsanforderungen erfüllt wird. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Qualität der Erfüllung von Funktionsanforderungen durch die einzelnen Varianten zu bewerten. Hier haben sich Punktsysteme zwischen null und zehn Punkten oder prozentuale Abschätzungen bewährt. Bekannt sind auch Vorgehensweisen, bei denen die Eignung mit Schulnoten bewertet wird. Komplexe Systeme betrachten die einzelnen Funktionsanforderungen gewichtet, sodass die Erfüllung von besonders wichtigen Funktionsanforderungen auch besonders stark in die Bewertung eingeht. Allerdings wird wiederum die Bewertung der Gewichtungsfaktoren subjektiv vorgenommen.
Unabhängig davon, welches Werkzeug zum Variantenvergleich gewählt wird, besteht das Ziel darin, sich für die am besten geeignete technische Lösung zu entscheiden und weniger zweckdienliche Alternativen auszusortieren. Dabei ist es durchaus sinnvoll, die einzelnen Varianten bis zu einer bestimmten Tiefe zu entwickeln, um die Entscheidung mit verlässlichen Fakten zu unterlegen (Bild 1.3). Unter Umständen können auch wenige alternative Varianten bis zur Produktionsreife fortentwickelt werden. Das ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn nicht nur unterschiedliche Funktionsprinzipien, sondern auch Fertigungstechnologien für die Erzeugnisse eingesetzt werden sollen. Für eine genaue Kalkulation als Entscheidungsgrundlage ist dann oft erst bei oder nach der Herstellung der Nullserie eine genaue Kostenanalyse möglich.
Bild 1.3 Durch Variantenauswahl verschlankt man die Entwicklungstätigkeit bis zur endgültigen Lösung
Auch im Alltag führen wir eine Art des Variantenvergleichs aus, wenn wir Kaufentscheidungen treffen und das am besten geeignete Angebot finden müssen. Dies geschieht meist rein subjektiv, bei größeren Anschaffungen wünschen sich aber einige Konsumenten, verschiedene Angebote vergleichen zu können. Von Zeit zu Zeit schließen wir auch bisher ungewohnte Möglichkeiten ein und führen als Alternativen zum klassischen Einkauf im Fachgeschäft einen Preisvergleich durch oder überlegen einen Gebrauchtkauf mithilfe des Internets. Vielleicht finden wir auch eine alternative Konsumart und leihen uns den betreffenden Gegenstand aus.
Auf der anderen Seite der Konsumgesellschaft besteht für einen Ingenieur die Aufgabe darin, die für den jeweiligen Anwendungsfall am besten geeignete technische Lösung dem Kundenkreis zur Verfügung zu stellen.
Ähnlich wie bei der Kaufentscheidung sollte der Techniker beim Variantenvergleich von Zeit zu Zeit neue Möglichkeiten ins Auge fassen, die bisher nicht infrage kamen und für die nur geringe Erfahrungen vorliegen.
1.1.2 Varianten zum Öffnen von FlaschenBetrachten wir nun das Beispiel „Verschließen und Öffnen von Getränkeflaschen“, um den Ablauf von der Aufgabenstellung hin zur technischen Lösung zu verstehen. Dazu werden wir auch die unterschiedlichen Werkzeuge zum Öffnen der Flaschen untersuchen.
Aus dem Alltag kennen wir eine Vielzahl von Anwendungen, um Flaschen zu öffnen, die mehr oder weniger gut funktionieren, unterschiedlich teuer sind und uns mehr oder weniger gut gefallen.
Weil uns bereits mehrere Prinzipien zur Lösung der technischen Aufgabe bekannt sind, ist unserem Denken ein anschaulicher Vergleich der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten möglich, um die für den Anwendungszweck am besten geeignete Variante zu erkennen.
Bestehende Lösungen erfüllen die gewünschte Aufgabe mehr oder weniger gut. Unabhängig davon muss für den Anwendungsfall der Öffnung einer Flasche hinterfragt werden, welche alternativen Möglichkeiten zur Erfüllung der technischen Aufgabe bestehen.
So ist zu klären, an welcher Stelle die Öffnung der Flasche erfolgen soll. Grundsätzlich könnte man neben der Entfernung des Verschlussteils von der Flasche auch das Glasgefäß auftrennen, um an den Inhalt heranzukommen. Wir kennen dieses Vorgehen ja von Konservendosen. Realisieren ließe sich dies bei Flaschen mit einer Lösung, die das Prinzip des Glasschneiders anwendet. Sinnvoll wäre es, den Hals oder den Boden der Flasche abzutrennen. Der Vorteil des Systems wäre, dass die Verschlussart der Glasverpackung nicht beachtet werden muss und sich so mit einem Öffnungsgerät alle Flaschen öffnen ließen.
Die Einführung dieses Prinzips verbietet sich aber, weil aufgrund des Öffnungsvorgangs Glasscherben oder -splitter der Verpackung in das enthaltene Lebensmittel gelangen würden und so die Gesundheit der Verbraucher gefährdet ist. Aus diesem Grund ist die Anwendung dieses Prinzips nur von bestimmten Ritualen der Corpsstudenten bekannt, wenn schäumende alkoholische Getränke mit einem Säbel geöffnet werden.
Wenn die Öffnung am Glasbehältnis sich offensichtlich nicht sinnvoll verwirklichen lässt, bleibt neben der Abtrennung des Deckels dessen Zerstörung als alternative technische Lösung, um an den Inhalt der Flasche zu gelangen. Auch hier muss hinterfragt werden, ob bei diesem Vorgang Teile des Deckels mit dem Inhalt in Berührung kommen könnten und welche Konsequenzen dies hat. Das Öffnungssystem könnte relativ unabhängig von der Gestalt der Flasche ausgelegt, müsste aber auf den konkreten Verschluss hin abgestimmt werden.
Alternativ zum Zerschneiden der Glaswand kann das Öffnen der Flasche durch die Trennung der Verbindung zwischen Flasche und Verschlussteil erfolgen. Wendet man die eingangs beschriebene Herangehensweise nun an, muss man zunächst hinterfragen, welche Verschlussverfahren traditionell für das Glasbehältnis verwendet wurden. Hier kommen vor allem drei Prinzipien infrage, auf die sich die anschließend angestellten Überlegungen beziehen werden. Diese sind:
Verschlussstopfen aus Kork, wie wir sie von Weinflaschen kennen,
Kronkorken, mit denen Bierflaschen verschlossen werden und
Schraubkappen, wie sie bei Mineralwasserflaschen zum Einsatz kommen.
Damit erfolgt die Funktionsanalyse des Gesamtsystems. Um die im Konstruktionsprozess getroffenen Entscheidungen nachvollziehen zu können, bietet sich hier die Darstellung in einem Schema an (Bild 1.4).
Bild 1.4 Schema zu den Möglichkeiten eines Flaschenverschlusses
Die Dokumentation der alternativen Lösungsmöglichkeiten ist ein ganz wesentliches Element der Entwicklungsarbeit. Auch wenn bestimmte Lösungen auf den ersten Blick vollkommen unrealistisch erscheinen, können in einigen Fällen auf diese Art neue Wege eröffnet werden. So ergeben sich vielleicht die entscheidenden Marktvorteile für ein bestimmtes Produkt. Zumindest sensibilisiert diese Vorgehensweise die Entwickler für die Komplexität und Vielfalt des technischen Handelns.
In vielen Fällen verschafft man sich bei einer entsprechenden Aufgabenstellung vor der Funktionsanalyse des technischen Systems einen Überblick über möglichst viele Konkurrenzprodukte und versucht, diese ingenieurtechnisch zu analysieren. Diese Vorgehensweise ist einfach und wird auch häufig angewendet.
Die besonders intensive Auseinandersetzung mit Konkurrenzprodukten hat in einigen Kulturen außerhalb von Mitteleuropa eine bedeutend längere Tradition. Beispielsweise sieht man im Fernen Osten eine mehr oder weniger deutliche Kopie eines Erzeugnisses als Verehrung des Urhebers und qualifiziert vielleicht sogar den betreffenden Gegenstand zum Bestandteil der Schöpfung. Die materiellen Befindlichkeiten unserer westlichen Welt übernimmt man in diesem Zusammenhang nur nach und nach. Auf der anderen Seite müssen wir Mitteleuropäer uns eingestehen, dass wir für das Nachempfinden technischer Erzeugnisse nicht die besten Voraussetzungen im internationalen Wettbewerb haben. So sollten wir Alternativen zu den bekannten technischen Lösungsmöglichkeiten suchen und uns so durch Wissensvorsprung, Spezialwissen aber auch durch wirksame Schutzrechte langfristig Marktvorteile sichern.
Das technische System Flaschenverschluss wird in Bild 1.5 dargestellt. Die Abdichtung kann an unterschiedlichen Bereichen der Flaschenöffnung erfolgen. Als Dichtflächen sind die Stirnfläche oder die Innenwand der Flaschenöffnung möglich (Bild 1.5).
Bild 1.5 Abdichtung am Flaschenhals
Die drei folgenden Varianten eines Flaschenverschlusses verwenden unterschiedliche Prinzipien der Abdichtung. Die jeweiligen Öffnungswerkzeuge müssen natürlich auf das jeweilige Dichtungsprinzip abgestimmt sein.
1.2 Korkpfropfen1.2.1 Aufbau und Prinzip der AbdichtungDie vielleicht älteste eingesetzte Verschlussart findet sich heute noch bei Laborflaschen, die mit einem Glaskolben verschlossen werden. Hier wählt man eine schräg gehaltene Dichtungsfläche am Flaschenhals, auf die ein darauf abgestimmter kegelstumpfförmiger Glaskolben aufgesetzt wird (Bild 1.6).
Der Verschluss des Gefäßes wird hier im Gegensatz zu formbaren Pfropfen nicht durch Pressung aufgrund eines Übermaßes erreicht, sondern durch die Reibung zwischen den Körpern.
Bei einer zu geringen oder gar fehlenden Einführschräge ist es nur mit großem Kraftaufwand möglich, den Kolben weit genug in den Flaschenhals einzuführen. Wenn bei einer zu geringen Einführschräge das Verschließen der Flasche gelungen sein sollte, stellt sich das Öffnen als kräftiges Problem dar.
Bild 1.6 Dichtungsprinzip bei einem Glaskolben
Wählt man die Einführschräge zu groß, können sich die Mikrostrukturen nicht mehr miteinander verhaken (Bild 1.6 ‒ Detailkreis oben). Man könnte den Deckel, ohne Widerstand zu spüren, von der Flasche abnehmen.
Charakteristisch für Reibungsphänomene ist, dass zum Start der öffnenden Bewegung eine größere Kraft notwendig ist als zur Fortführung. Das erklärt sich daraus, dass zunächst die Verhakungen der Mikrostruktur untereinander gelöst werden müssen. Wenn dies erfolgt ist, gleiten bei der Bewegung die mikroskopischen Erhebungen über die Oberfläche des Reibpartners, ohne dass ein Reibschluss in dessen vertieften Strukturen vorkommt. Stoppt die Bewegung, erfolgt durch ein Ineinandergreifen der Mikrostrukturen eine Verankerung beider Teile.
Das Lösen von Systemen, deren Zusammenschluss auf dem Prinzip der Reibung funktioniert, muss aus diesem Grund immer mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit erfolgen, um einen kontinuierlichen Bewegungsablauf zu gewährleisten.
Allgemein ist bekannt, dass man die Reibung durch den Einsatz eines Schmiermittels vermindern kann. Diese Idee auf einen Flaschenverschluss zu übertragen, kann unangenehm werden. Das Schmiermittel bildet einen Film zwischen Flaschenhals und Glaskolben und führt so zu einem luftdichten Verschluss. Der konisch gestaltete Flaschenhals funktioniert ähnlich wie ein Ventil. Befindet sich im Behältnis ein höherer Druck als in der Umgebung, bewirkt ein leichtes Anheben des Kolbens einen Druckausgleich. Ein entgegengesetztes Druckverhältnis zieht den Kolben weiter in den Hohlraum hinein. So liegt im Inneren der Flasche seit dem Zeitpunkt des Verschlusses der geringste jemals wirkende Druck vor. Beim Öffnen muss dann zusätzlich zur Reibung dieser Unterdruck überwunden werden.
Ein Gefäßverschluss mit Glaskolben ist nur im Laborbereich sinnvoll, weil dieses Material chemikalienbeständig ist. Im Konsumbereich findet man solche speziellen Flaschen nur im Bereich der Kosmetik, wo solche Verpackungen Bestandteil der Präsentation des Inhalts sind und der Eindruck von Exklusivität vermittelt werden soll.
Eine andere und bereits sehr lange angewendete Möglichkeit, Glasflaschen zu verschließen, ist das Einpressen eines Korkkegels oder -zylinders. Für technische Anwendungen in der Chemie und der Pharmazie werden auch Stopfen aus Gummi verwendet.
Im Bereich der Getränkeindustrie wird eine Korkabdichtung vor allem für Weinflaschen angewendet. Das Dichtungsprinzip für diese Verschlussart ist in Bild 1.7 dargestellt.
Bild 1.7 Dichtungsprinzip bei einem Stopfenverschluss mit einem Korkzylinder
Die einfachste und älteste Art, eine Glasflasche oder ein Tongefäß mit einem anderen Material zu verschließen, ist die Versiegelung mit einem (zäh)flüssig eingebrachten und dann aushärtenden Material wie Teer oder Wachs. Allerdings vermindert sich beim Aushärten das Volumen des Verschlussmaterials. Bei geringen Adhäsionskräften zwischen Behälter- und Pfropfenmaterial führt die schwindungsbedingte Volumenverminderung zu einem Ablösen des Pfropfens von der Behälterwand. Das Gefäß wird undicht.
Damit der Austritt der Flüssigkeit aus dem Behältnis vermieden wird, muss die Außenseite des Stopfens am Flaschenhals fest an der Innenwand anliegen. Das erreicht man, indem man den Stopfen aus einem festen und elastischen Material wählt. Der Außendurchmesser des Stopfens muss größer sein als der Innendurchmesser am Flaschenhals, sodass beim Einpressen eine Verformung auftritt, die eine feste Anlage am Flaschenhals garantiert (Bild 1.8).
Bild 1.8 Verformung eines elastischen Stopfens
Bestens geeignet sind Kork- und Gummistopfen, die eine entsprechend geringe Steifigkeit haben, sodass über den gesamten Umfang der Abdichtung am Flaschenhals keine Stelle frei bleibt, durch die Flüssigkeit entweichen könnte. Beim Naturmaterial Kork besteht allerdings das Risiko, dass bei einer jahrelangen Lagerung aufrecht stehender Flaschen der Stopfen aufgrund der Wasserabgabe austrocknet und dadurch sein Volumen vermindert. Das kann zu einem Flüssigkeitsaustritt führen. Die Getränkeindustrie reagiert darauf mit dem Überzug einer Kappe aus Metallfolie oder Kunststoff über den Flaschenhals und die Korken. Lagerwein sollte unabhängig davon in liegenden Flaschen aufbewahrt werden.
Wie schon in der Vergangenheit gibt es heute immer wieder Bestrebungen, das Verschlusssystem zu ersetzen. Aber offensichtlich spielen für die Verbraucher neben den rein funktionalen Aspekten vor allem traditionelle Vorstellungen eine Rolle. Der Genuss von Wein ist nicht nur eine funktionale Angelegenheit, sondern sollte schon mit einer gewissen Kultur betrieben werden. Dazu gehören die traditionelle Verpackung in Glasflaschen und der ansprechende Korkverschluss.
Oft werden Verpackungen als äußere Markenzeichen wahrgenommen. So wird mit dem Fränkischen Weinanbaugebiet die Flaschenform des Bocksbeutels verbunden. Alternative Verpackungen wie Tetrapacks garantieren objektiv gleiche Produktqualität und haben logistische Vorteile, werden aber vom Verbraucher nicht angenommen und mit schmachvollen Begriffen tituliert.
Etwas mehr Toleranz bringt der Konsument alternativen Verschlussformen entgegen. Allerdings können sich die Versuche von großen Lieferanten, Schraubverschlüsse am Markt zu platzieren, bisher nur für einige Produkte durchsetzen.
Damit man den Wein genießen kann, muss der Kork aus der Flasche entfernt werden. Um effektive technische Lösungen für diese Aufgabe zu finden, nutzt man die Funktionsanalyse.
Bei der Entfernung eines Korkpfropfens aus einer Weinflasche bestehen grundsätzlich zwei denkbare Vorgehensweisen:
Entfernung durch eine äußere Kraftwirkung
Entfernung durch eine innere Krafteinwirkung auf den Korkpfropfen
1.2.2 Öffnungsvorgang durch innere KrafteinwirkungEine Kraftwirkung kann erzeugt werden, indem im Inneren der Flasche ein Druck zur Wirkung kommt. Dieses Prinzip des Ausstoßens eines Verschlusses ist uns von Sektflaschen her bekannt (Bild 1.9).
Bild 1.9 Kraftwirkung bei der Entfernung eines Korkpfropfens durch Druckaufbau
Bei den Schaumweinen entsteht der Überdruck im Behältnis aufgrund der Flaschengärung und liegt permanent an. Um ein unerwünschtes Öffnen zu vermeiden, muss der Stopfen fixiert werden.
Möchte man eine Weinflasche mit einem Überdruck aus den Flaschen heraus öffnen, müsste in geeigneter Form eine Gasphase erzeugt werden, mit der ein Druckaufbau im Innern der Flasche realisiert wird.
Das wäre durch die Erhitzung des Inhaltes realisierbar, wenn durch das Verdampfen von Teilen der Flüssigkeit ein entsprechender Überdruck im Inneren eine Kraftwirkung auf den Pfropfen erzeugen würde. Von der Behälterwand müssten diese Kräfte aufgenommen werden. Das bedeutet, dass die Flaschen stabiler ausgelegt werden müssten, so wie wir es von den Sektflaschen her kennen. Dann müsste man ein schlechteres Gewichtsverhältnis zwischen Verpackung und Inhalt in Kauf nehmen. Das endgültige Ausschlusskriterium für diese Lösungsvariante bei Weinflaschen ist, dass bei der Erhitzung des Inhaltes die Produkteigenschaften in einer vom Verbraucher nicht mehr akzeptierten Art und Weise beeinflusst würden. Aufgrund des geringeren Siedepunktes würde zuerst der im Wein vorhandene Alkohol die Gasphase bilden und sich beim Öffnen der Flasche während des Druckausgleichs verflüchtigen.
Als denkbare Alternative könnte man den Kork mit einem außen angelegten Vakuum ziehen. Weil aber ein luftleerer Raum bestenfalls Druckunterschiede bis zum atmosphärischen Druck ermöglicht, sind für diesen Fall die Auszugskräfte begrenzt. Größere Kräfte könnte man durch die Verwendung von Flaschen mit einer größeren Öffnung erreichen.
Weiterhin ist es denkbar, die Massenträgheitskraft des Inhalts als Quelle der auf den Korkpfropfen einwirkenden Kraft zu nutzen. So kann ein Kork auch durch kurze permanent ausgeführte Schläge auf den Flaschenboden gelockert und danach entfernt werden. Dies ist allerdings sehr mühsam. Wirken die Schläge auf das Glas ein, besteht immer die Gefahr des Splitterbruchs, der zu ernsthaften Handverletzungen beim Ausführen der Schläge führen kann. Auch ist es sehr unangenehm, wenn ein bereits gelockerter Kork aus der Flasche ausgeschlagen wird und sich dann der Inhalt ungewünscht ergießt.
Bei allen Prinzipien, die auf einer äußeren Kraftwirkung basieren, bleibt der Kork unzerstört. Insgesamt erscheint die Entfernung des Korkpfropfens durch eine äußere Kraftwirkung für eine Überführung in eine technische Lösung nur für Sekt und Schaumweine anwendbar. Für Wein, der keine Gasphase ausbildet, ist dieses Öffnungsprinzip wenig geeignet.
1.2.3 Öffnungsvorgang durch äußere KrafteinwirkungBei der Entfernung eines Pfropfens aus dem Flaschenhals durch eine äußere Krafteinwirkung muss eine axiale Zugkraft am Pfropfen angreifen und auf den Ring des Flaschenhalses eine Druckkraft wirken (Bild 1.10).
Bild 1.10 Kraftwirkung bei der Entfernung eines Korkpfropfens
Die wirkende Zugkraft und die abstützende Kraft haben den gleichen Betrag, sind aber entgegengesetzt gerichtet. So besteht ein Kräftegleichgewicht, das bei einem hinreichend großen Betrag der Kraft ein Herausziehen des Pfropfens ermöglicht. Wenn das Kräftegleichgewicht gestört ist, werden beide Körper im Richtungssinn der größeren Kraft bewegt.
Die Aufgaben, die ein solches System zur Öffnung von Flaschenverschlüssen zu erfüllen hat, sind:
das Eindringen und Verankern des Öffnungswerkzeugs im Pfropfen,
das Ausziehen des Pfropfens,
das Lösen des Werkzeugs aus dem entnommenen Pfropfen.