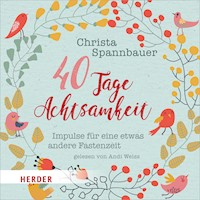Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer teilt, hat mehr vom Leben. Was kann geteilt werden? Wer teilt mit wem? Warum teilen? Wo sind die Grenzen des Teilens? Wie lernen wir das Teilen? Es gibt so vieles, was geteilt werden kann, wenn die Bereitschaft zum Teilen da ist und wenn es jemanden gibt, mit dem man teilen möchte. Das lässt sich vom Großen bis ins Kleine übertragen, von der Weltpolitik über Arbeit und Familie zum Ich. Christa Spannbauer lädt dazu ein, über das Teilen nachzudenken. In ihren Geschichten erzählt von der Bereicherung, die wir erfahren, wenn wir teilen. Und ihre Reflektionen regen dazu an, das Teilen Bestandteil des eigenen Lebens werden zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Titel der Originalausgabe: Teile – und werde mehr
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © tomka – shutterstock
E-Book-Konvertierung: Arnold & Domnick, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81515-7
ISBN (Buch): 978-3-451-07210-9
Inhalt
Impressum
Ein Wort vorab
Mitgefühl & Mitmenschlichkeit
Selbstwerdung & Selbstentfaltung
Kooperation & Verbundenheit
Über die Autorin
Ein Wort vorab
„Nur der ist froh, der geben mag.“
Johann Wolfgang von Goethe
Der Wunsch, glücklich zu sein, verbindet uns mit allen Menschen auf dieser Welt. Und das beste Rezept für ein glückliches Leben, so belegen Studien aus der Positiven Psychologie, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Geteiltes Leid wiederum ist halbes Leid. Und wer teilt, hat mehr vom Leben: mehr Zusammenhalt, mehr Zufriedenheit, mehr Freude, mehr Unterstützung, mehr Liebe.
Dass Großzügigkeit das eigene Leben bereichert, bestätigt uns auch die Hirnforschung. Immer dann, wenn wir anderen Gutes tun, schüttet unser Gehirn Opioide und Oxytocin aus, die wie ein natürliches Rauschmittel wirken. Wir machen also nicht nur andere, sondern auch uns selbst glücklich.
Mit diesen Texten möchte ich sichtbar machen, dass wir unser Leben dann als erfüllt erleben, wenn es im regen Austausch mit anderen ist, wenn es sich mitfühlend und nährend in den Dienst der Welt und seiner Menschen stellt. Wer gerne gibt und gerne teilt, erlebt sich als reich. Die Tugend des Schenkens öffnet die Herzen um uns herum und macht das eigene Herz weit und warm. Dass die Großherzigkeit im Menschen angelegt ist, sehen wir bereits bei Kleinstkindern. Sie teilen bereitwillig, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten.
Da neben dem Altruismus aber auch der Eigennutz Bestandteil unseres genetischen Programms ist, empfahl Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik, sich in der Tugend der Freigiebigkeit zu üben. Denn je öfter wir sie praktizieren, desto leichter fällt sie uns.
Niemand ist eine Insel. Wir leben in einer Welt, in der alles miteinander verwoben ist und wechselseitig voneinander abhängt. Immer mehr Menschen erkennen, dass alles, was wir tun, Auswirkungen auf das Ganze hat. In einer Welt, in der die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter aufgeht, suchen zugleich immer mehr Menschen nach innovativen Lösungen, um die Ressourcen gerechter zu verteilen. Diese neue „Wir-Kultur“ hat den empathischen Menschen zum Leitbild, der das Gemeinwohl aller im Auge behält. Und der Nährboden dieser neuen Ethik der Verbundenheit und Kooperation ist die Freude am Teilen.
Mitgefühl & Mitmenschlichkeit
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Erich Kästner
Die Bürsten meiner Mutter
Die wichtigsten Lektionen über das Teilen lernen wir bereits in früher Kindheit. Ich selbst bin in den 1960er-Jahren in einer fränkischen Kleinstadt aufgewachsen. Meine Eltern gehörten der sogenannten Aufbaugeneration an. Sie hatten als Kinder den Krieg erlebt und wussten, was Entbehrung bedeutet und wie sich Hunger anfühlt. Wie viele andere ihrer Generation gaben sie diese Erfahrungen an ihre eigenen Kinder weiter. Und das nicht nur in den Geschichten, die sie uns erzählten, sondern mehr noch durch ihr Verhalten. Erklärtes Ziel meiner Eltern war ein bescheidener Wohlstand, der sie gegen die Gefahren des Lebens absichern sollte. Und so sparten sie sich ihr kleines Eigenheim zusammen. Jeder Pfennig floss in die Tilgung der Kredite. Doch obwohl das Haushaltsgeld meiner Mutter denkbar knapp bemessen war, konnte ich als Kind immer wieder das Gleiche beobachten: Sobald ein Hausierer mit seinem schweren Rucksack vor unserer Tür stand oder eine Roma-Frau mit ihrem Kind an der Hand –meine Mutter kaufte etwas. Meistens brauchten wir diese Dinge gar nicht. Doch für meine Mutter war es unvorstellbar, einem bedürftigen Menschen die Tür zu weisen. Meinen Vater ärgerte es jedes Mal gewaltig, wenn er die nutzlosen Dinge in einer Schublade entdeckte. Was meine Mutter jedoch nicht davon abhielt, dem nächsten Hausierer, der an unserer Tür klingelte, wieder eine kratzige Bürste abzukaufen.
Mit ihrer Großherzigkeit lebte mir meine Mutter eine ethische Grundregel vor, für die ich ihr bis heute dankbar bin: Teile das Wenige, das du hast, mit Menschen, die noch weniger haben.
Wie eine Karotte die Menschlichkeit rettete
Nie hat mich die Geschichte dieser kleinen runzeligen Karotte losgelassen. Erzählt hat sie mir eine alte Dame aus Israel vor laufender Kamera. „Was gibt einem die Kraft, solch schreckliche Erfahrungen als Mensch zu überstehen?“, hatte ich Batsheva Dagan damals gefragt. Woraufhin die Shoah-Überlebende umgehend zu erzählen begann: von der Solidarität unter den Frauen in ihrer Baracke, die nur umso stärker wurde, je verzweifelter ihre Situation wurde; von dem Trost, den sie sich gegenseitig spendeten; von der Bereitschaft, bis zum Letzten füreinander einzustehen; und von Frauen, die sich mit aller Entschlossenheit gegen die Entmenschlichung und Entwürdigung zur Wehr setzten.
Eines Tages, so erzählte sie, fand sie eine Karotte auf dem Weg von der Lagerküche zur Baracke. Blitzschnell bückte sie sich, um diese aufzuheben. Doch anstatt sie nun hungrig hinunterzuschlingen, umschloss sie diese heimlich mit der Faust und brachte sie in ihre Baracke, wo das Kleinod mit größter Sorgfalt in acht Teile geteilt wurde. Eine verschrumpelte Karotte für acht hungernde Frauen! Wie groß, wie fast übermächtig muss die Versuchung für die junge Batsheva gewesen sein, diesen kostbaren Fund an Ort und Stelle alleine zu vertilgen. Doch dem Überlebensimpuls stand offensichtlich ein noch stärkerer Lebenswille entgegen: das Gemeinschaftsgefühl. Denn gegenseitige Unterstützung und Kooperation gelten von jeher als die wirksamsten Überlebenselixiere in Zeiten der Not.
Diese und viele andere Erzählungen, die mir von Überlebenden der Shoah anvertraut wurden, machen mir seit vielen Jahren Mut. Doch auch die Frage hat mich seither nicht mehr losgelassen: Hätte ich die Kraft gehabt, die Karotte zu teilen?
Mitfühlend geboren
„Jedes Kind kennt Gut und Böse.“ Zu diesem Schluss kam der Entwicklungspsychologe Paul Bloom, der Langzeitstudien mit drei Monate alten Babys an der amerikanischen Yale-Universität durchführte. Dabei konnte er beobachten, wie bereits die Kleinen Mitgefühl mit anderen Menschen, die schlecht behandelt wurden, zeigten. Wie sie weinten, wenn andere weinten, wie sie gutes Verhalten belohnten und wie sie mit Unbehagen darauf reagierten, wenn Menschen Ungerechtigkeit widerfuhr. Kaum auf der Welt, haben Kinder offensichtlich nicht nur ein feines Gespür dafür, was richtig und was falsch ist, sie verfügen auch über die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und mit diesen mitzufühlen. Und nicht nur das: Kinder reagieren auf Schwierigkeiten anderer mit spontaner Hilfsbereitschaft. Dies belegen die Experimente des Verhaltensforschers Michael Tomasselo mit Kleinkindern, die unbekannten Erwachsenen auf vielerlei Art und Weise dabei halfen, Probleme zu lösen. Für ihn stellt die Kooperationsbereitschaft von Kindern im vorsprachlichen Stadium den Beweis dafür dar, dass Empathie und Mitgefühl essenzielle Bestandteile der menschlichen Evolution sind. Er ist überzeugt: „Kinder sind von Natur aus altruistisch.“
Dass diese angeborenen Fähigkeiten jedoch auch wieder schwinden können, zeigen Versuchsanordnungen mit älteren Kindern, bei denen das frühe mitfühlende und hilfsbereite Handeln bereits keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Für Paul Bloom ist dies ein Beleg dafür, dass Babys zwar einen Sinn für Gut und Böse mitbringen, dass sich deren ethisches Handeln aber nur dann verfestigen kann, wenn es gefördert wird. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht liebevolle Beziehungen und inspirierende Vorbilder, damit sich die Gabe des Mitgefühls entfalten und reifen kann. Wächst ein Kind jedoch in einem Umfeld auf, in dem menschliche Wärme, Fürsorge und Mitgefühl rar sind, dann fehlen ihm nicht nur diese wichtigen Vorbilder, es wird sich auch Schutzmechanismen zulegen, um die emotionale Kälte zu bewältigen. Genau diese frühen Schutzmechanismen sind es, die es Menschen später so schwer machen, ihr Herz vertrauensvoll für andere zu öffnen und sich von deren Leid berühren und anrühren zu lassen.
Das stellt uns natürlich vor die Frage, wie wir das in uns angelegte Mitgefühl wieder zum Leben erwecken können. Und wie es möglich ist, Schutzmechanismen und Verhärtungen wieder aufzuschmelzen, mit denen wir uns vor dem frühen Schmerz schützen wollten. Die Forschungsarbeiten der Neurowissenschaftlerin Tania Singer am Leipziger Max-Planck-Institut weisen darauf hin, dass wir Mitgefühl bis ins hohe Alter aktivieren und gleichsam wie einen Muskel trainieren können. Denn alles, was evolutionär in uns angelegt ist, geht niemals ganz verloren und kann reaktiviert werden. Bereits nach einer Woche intensiven Mitgefühlstrainings konnte sie an ihren Probanden eine deutliche Stärkung des pro-sozialen Verhaltens und der Fürsorge für andere beobachten. Menschen, denen es anfangs noch schwerfällt, das Mitgefühl des Herzens zu aktivieren, rät die Wissenschaftlerin, erst einmal die kognitive Empathie zu stärken, indem sie sich etwa mental in einen leidenden Menschen hineindenken und vorstellen, wie die Situation aus dessen Sicht aussehen mag. Unterstützend hierfür sind Geschichten, Filme und Bücher, die Mitgefühl mit den Protagonistinnen und Protagonisten erwecken und Vorbilder mitfühlenden Verhaltens zeigen, die zum Nachahmen einladen.
Als förderlich für die Entwicklung von Mitgefühl hat sich auch die bewusste Stärkung von verwandten Tugenden wie Großzügigkeit, Versöhnlichkeit und Dankbarkeit erwiesen. Wichtigster Bestandteil des Mitgefühlstrainings jedoch sind die täglichen Mitgefühlsmeditationen, die Tania Singer aus der buddhistischen Geistesschulung adaptierte und deren positive Wirkungen wissenschaftlich belegt sind. Ihr herzöffnender Effekt fördert die Mitmenschlichkeit und stärkt zugleich das Gefühl der Verbundenheit mit anderen Lebewesen.
Was hat der Penner mit mir zu tun?
Die Winter in New York sind extrem kalt. Und für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, extrem gefährlich. Und doch entschied sich der Zen-Meister Bernard Glassman dazu, gerade in dieser Jahreszeit und an diesem Ort seine Street-Retreats durchzuführen. Gemeinsam mit seinen Schülern ging er jedes Jahr für eine Woche auf die Straßen der Großstadt, wo sie ohne Geld, ohne Kreditkarte und einzig mit dem bekleidet, was sie am Körper trugen, das Schicksal von Obdachlosen teilten.
Weshalb mutete er sich selbst und anderen dies zu?, fragen Sie sich nun vermutlich. Nun, Zen-Meistern eilt von jeher der Ruf voraus, nicht gerade zimperlich mit ihren Schülern umzugehen. Die spirituelle Tradition des Zen ist streng und fordert den Praktizierenden viel an Willensstärke ab. Ausschlaggebend für Bernard Glassman war jedoch die Erkenntnis, dass Weisheit und Mitgefühl – die beiden Grundpfeiler des Zen – weniger in der Abgeschiedenheit des Zen-Klosters als in der unmittelbaren Begegnung mit dem Leid anderer Menschen zu erlangen sind. Deshalb forderte er seine Schüler auf, die spirituelle Komfortzone des Meditationskissens mit dem harten und kalten Asphalt der Straße einzutauschen. Durch die Begegnung mit Obdachlosen, die diesem Leben täglich schutzlos ausgeliefert sind, sowie durch die eigene Erfahrung, zum Überleben auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein, schmolz die Trennung zwischen Ich und Du. Und genau das ist es, was wahres Mitgefühl erst möglich macht.
Für alle, die an solch einem Retreat teilnahmen, war es eine eindrückliche Lektion. Nie mehr, so berichteten die Teilnehmer danach, würden sie nun gedankenlos an einem obdachlosen Menschen vorübergehen. Die Trennung zwischen ihnen selbst und dem anderen existiere nicht mehr. Gewachsen sei damit auch das Gefühl von Verantwortung für ihre Mitmenschen in Not und die Bereitschaft, sich engagiert für eine gerechte Verteilung materieller Güter einzusetzen.