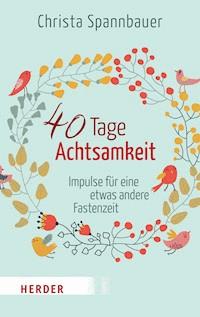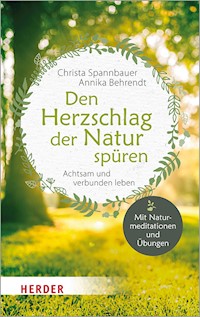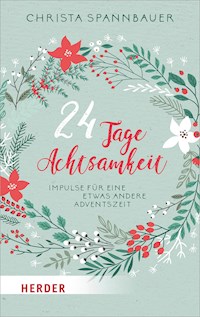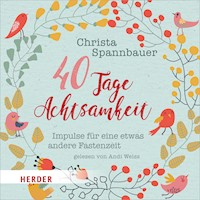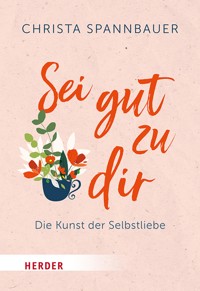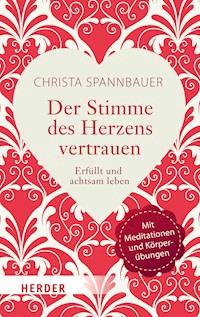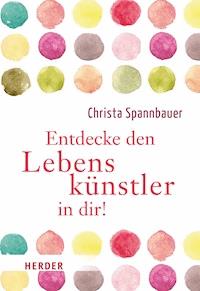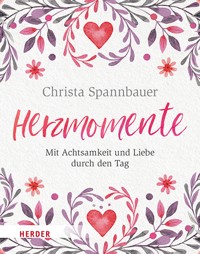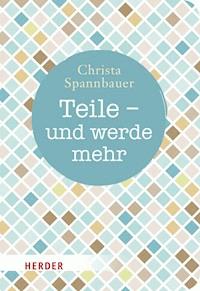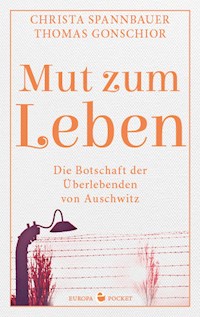
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Überlebende von Auschwitz gingen Esther Bejarano, Yehuda Bacon, Éva Pusztai und Greta Klingberg durch die Hölle der Unmenschlichkeit. Wie gelang es ihnen, diese Erfahrung zu überstehen? Was gab ihnen die Kraft zum Weiterleben? Das beeindruckende Porträt von vier Menschen, die bezeugen, dass neben dem Leiden des Holocaust noch etwas anderes existiert: der Triumph der Menschlichkeit über die Unmenschlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTA SPANNBAUERTHOMAS GONSCHIOR
MUT ZUM LEBEN
Die Botschaft der Überlebenden von Auschwitz
1. eBook-Ausgabe 2022
Vollständige Taschenbuchausgabe 2022
© 2014 Europa, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-494-1
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Begleitworte
Einleitung Auf den Spuren der Menschlichkeit
MenschenLeben
Esther Bejarano. Wir leben trotzdem
Éva Pusztai. Wir trugen das Haupt aufrecht
Yehuda Bacon. Mensch, wo bist du?
Greta Klingsberg. Es ist ein Lied in allen Dingen
Epilog Das Vermächtnis der Überlebenden
Anhang
Kurzbiografien
Anmerkungen
Literaturhinweise
Bildnachweis
BEGLEITWORTE
Um zu verhindern, dass Menschen jemals wieder so etwas angetan wird, wie es im Holocaust geschehen ist, reicht es nicht, die Erinnerung an das unvorstellbare Leid wachzuhalten. Wir brauchen auch den Mut, uns gegen jede Form von Unmenschlichkeit zu wehren. Und wir brauchen die Zuversicht, dass Mitgefühl und Nächstenliebe stärker sind als Macht und Unterdrückung. Beeindruckender und berührender als in diesem Buch lässt sich dieses Gefühl von Mut und Zuversicht kaum wecken. Vier Zeitzeugen, die durch diese Hölle der Unmenschlichkeit gegangen sind, machen auf eindringliche Weise deutlich, was es heißt, Mensch zu sein.
Prof. Dr. Gerald Hüther, Hirnforscher
»Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung«, sagte Theodor W. Adorno. Das Buch stärkt und ermutigt uns in diesem Auftrag. Wenn wir die heranwachsende Generation mit Verantwortung und Gemeinsinn in das 21. Jahrhundert begleiten wollen, dann wird dies nur so gelingen, wie es Christa Spannbauer und Thomas Gonschior gemacht haben: das Vermächtnis der Überlebenden für uns und nachfolgende Generationen zu bewahren, weiterzuerzählen und die Zukunft mitzudenken.
Margret Rasfeld, Reformpädagogin und Schulleiterin
EINLEITUNGAuf den Spuren der Menschlichkeit
In Auschwitz fand einer der schwersten Angriffe auf die Menschlichkeit in der Geschichte der Zivilisation statt, dem weit mehr als eine Million Menschen zum Opfer fielen. Wie gelang es den Überlebenden, diesen Angriff als Mensch zu überstehen? Was gab ihnen die Kraft zum Leben, Überleben und Weiterleben?
Mit diesen Fragen im Gepäck begaben wir uns Ende 2011 für unseren Film Mut zum Leben auf eine Spurensuche. Die Reise währte zwei Jahre lang. Wir begegneten vier außergewöhnlichen Menschen, der Hamburger Sängerin Esther Bejarano, der ungarischen Autorin Éva Pusztai, dem israelischen Maler Yehuda Bacon und der israelischen Sängerin Greta Klingsberg, die wir in der Folgezeit bei ihren vielfältigen Aktivitäten, ihren Vortragsreisen, Konzerten und Kunstausstellungen mit der Kamera begleiteten. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie Auschwitz überlebt haben. Wir besuchten sie in ihren Heimatstädten in Hamburg, Budapest und Jerusalem und lernten dabei ihre Familien und Freunde kennen. Unsere Reise führte uns aber auch an dunkle Orte der Menschheitsgeschichte: das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und die Konzentrationslager Buchenwald und Ravensbrück. Gemeinsam mit den Überlebenden besuchten wir Stätten, die die Erinnerung an das Geschehene bewahren: die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und in Erfurt den Erinnerungsort »Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz«.
In vielen intensiven Gesprächen wurden wir Zeugen tief greifender Verletzungen ebenso wie der heilenden Kraft der Versöhnung. Wir erhielten Antworten auf Fragen, die uns seit vielen Jahren beschäftigt hatten. Und es wurden neue Fragen in uns aufgeworfen, die uns noch lange begleiten werden.
In diesem Buch blicken Esther Bejarano, Éva Pusztai, Yehuda Bacon und Greta Klingsberg heute, sieben Jahrzehnte nach der Befreiung von Auschwitz, mit der Weisheit des Alters zurück auf das, was geschah, und erzählen von dem, was ihnen half, nicht nur zu überleben, sondern weiterzuleben und das Vertrauen in das Leben und die Menschen wiederzuerlangen. In ihren Erfahrungen verdichten sich grundlegende Fragen des Menschseins: Was können die Überlebenden uns heute lehren über die Widerstandskraft des Menschen, seinen unzerstörbaren Lebensmut und Lebenswillen, seine Würde, die er selbst unter unwürdigsten Bedingungen nicht preisgibt, seine Fähigkeit zu Mitgefühl und Mitmenschlichkeit unter schwierigsten Voraussetzungen? Dieses Wissen für uns und nachfolgende Generationen zu bewahren ist die Absicht dieses Buches.
Der Wille zur Menschlichkeit
Der Name Auschwitz-Birkenau ist wie kein anderer mit einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte verknüpft: dem Völkermord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden. Wie kein anderer Ort ist Auschwitz assoziiert mit dem Schrecklichsten, was der Mensch seinem Mitmenschen anzutun vermag. Ausgerechnet hier, an diesem Ort der Unmenschlichkeit, wollten wir uns auf die Suche nach dem Mut zum Leben und dem Überleben der Menschlichkeit machen? War dies nicht ein irrwitziges, von vornherein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen?
Wer sich Auschwitz nähert, blickt in den Abgrund des Menschseins, er wird Zeuge der Qualen und Leiden der Opfer und der Brutalität und Grausamkeit der Täter. Und doch: Inmitten all dessen trafen wir immer wieder auf unauslöschliche Spuren der Menschlichkeit. Die vielen kleinen und großen Gesten der Hilfsbereitschaft und Solidarität in den Erzählungen der Überlebenden ließen uns aufhorchen: der letzte Bissen Brot, der trotz nagenden Hungers mit anderen geteilt wurde, die Schüssel Suppe, die trotz Lebensgefahr den verhungernden Kindern auf der anderen Seite des elektrischen Zauns gereicht wurde. »Wir haben einander geholfen. Die Solidarität hat eine sehr große Rolle gespielt, in sämtlichen Lagern«, erinnerte sich Esther Bejarano. Für den Psychoanalytiker Arno Gruen, der dem Holocaust durch die Emigration nach New York in letzter Minute entkam, ist dies ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich der Mensch, selbst wenn er an seine äußersten Grenzen getrieben wird, immer noch ein grundlegendes Potenzial von Mitgefühl und damit den Kern seines Menschseins bewahren kann. In einem Interview mit uns sagte er: »Das Aufrechterhalten der Würde, die unzähligen kleinen Gesten des Helfens und Teilens und das Überleben selbst waren in den Todeslagern die kollektivste Form des Widerstands gegen unsagbares Grauen.«
Auschwitz-Birkenau, September 2013
Erschüttert, aber nicht zerbrochen
Doch aus welchen Quellen bezogen die Überlebenden die Fähigkeit, das Vertrauen in das Leben und den Glauben an die Liebe nicht zu verlieren? Woher nahmen sie die Kraft, erfahrenem Leid einen Sinn abzuringen und dieses sogar noch menschlich und künstlerisch für das Positive zu transformieren? Diese Fragen sind für uns alle und insbesondere auch für die moderne Resilienzforschung von großem Interesse. Denn es waren Überlebende des Holocaust, die Anfang der 1970er-Jahre einen grundlegenden Paradigmenwechsel innerhalb der Medizin initiierten. Als der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky eine Untersuchung an einer weiblichen Kontrollgruppe durchführte, in der sich auch Überlebende der Konzentrationslager befanden, stellte er überrascht fest, dass sich ein hoher Prozentsatz dieser Frauen trotz der immensen physischen und psychischen Belastungen, denen sie ausgesetzt gewesen waren, in einem guten seelischen und körperlichen Zustand befanden. Das ließ den Mediziner aufhorchen und führte ihn zu einer grundsätzlich neuen Fragestellung in der Medizin: Was erhält den Menschen körperlich gesund und seelisch heil? Damit war die Salutogenese geboren, die die gesundheitsfördernden und -erhaltenden Faktoren beim Menschen in den Mittelpunkt rückt. Das von Antonovsky entwickelte Konzept sollte in den kommenden Jahren völlig neue Maßstäbe in der Medizin setzen und die Sichtweise von Gesundheit und Krankheit grundlegend revolutionieren. Aus ihm ging die moderne Resilienzforschung hervor, die nach den Ressourcen und Widerstandskräften im Menschen Ausschau hält, die ihn im Ernstfall dazu befähigen, zerrüttende und traumatische Lebenserfahrungen nicht nur zu überstehen und zu meistern, sondern gegen alle Wahrscheinlichkeit sogar noch menschlich daran zu wachsen.
In dieser Widerstandskraft erblickte der Psychologe und Auschwitz-Überlebende Viktor Frankl den unzerstörbaren Kern des Menschseins und die letztendliche Freiheit des Menschen. Im Zentrum der von ihm begründeten Existenzanalyse steht die Überzeugung, dass der Mensch über das Potenzial verfügt, allen Lebenssituationen – und seien sie auch noch so unerträglich – einen Sinn abzuringen. »In der Art, wie ein Mensch sein unabwendbares Schicksal auf sich nimmt, darin eröffnet sich auch noch in den schwierigsten Situationen und noch bis zur letzten Minute des Lebens eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll zu gestalten.«1 Dies bezeugen die Menschen, denen Sie in diesem Buch begegnen. Sie haben es – wie viele andere Holocaust-Überlebende – trotz unsagbaren Leidens geschafft, körperlich und seelisch am Leben zu bleiben; sie haben bei aller Hoffnungslosigkeit und allem Entsetzen nicht den Willen verloren, als Mensch zu überstehen.
Die Botschaft der Überlebenden
Vielleicht werden Sie sich bei den Begegnungen mit den vier Menschen in diesem Buch wiederholt die Frage stellen, weshalb in ihren Worten keine Bitterkeit und kein Hass zu finden sind. Die Güte und Wärme, die sie ausstrahlen, stehen in starkem Kontrast zu dem, was sie an menschlicher Grausamkeit gesehen und am eigenen Leib erfahren haben. Wer ihnen heute begegnet, trifft auf ungebrochenen Lebenswillen, unzerstörte Hoffnung, tiefe Mitmenschlichkeit. Wie kommen sie zu solch einer lebensbejahenden Haltung? Diese Frage wird uns in diesem Buch beschäftigen.
Zweifellos können wir viel lernen von Menschen, die sich von leidvollen Lebenserfahrungen zwar erschüttern, nicht aber zerbrechen lassen. So antwortete Yehuda Bacon auf die Frage, ob denn ein Sinn in solch einem Leiden zu finden sei, dem er als junger Mensch ausgesetzt war: »Es kann Sinn haben, wenn es einen Menschen so tief erschüttert, bis zu den Wurzeln seines Seins, und er dann erkennt, dass der Nächste wie er selbst ist.« Das künstlerische Lebenswerk des Malers bringt diese auf Versöhnung ausgerichtete Haltung nach außen, die auf einer Verwandlung des Leides im Inneren gründet. Erfahrenes Leid nicht zu verdrängen, sondern es auszuhalten, es zu durchschreiten und nach Möglichkeiten der Transformation Ausschau zu halten, darin liegt die menschliche Größe der Porträtierten.
Nie wieder soll ein Mensch das erleben müssen, was ihnen widerfahren ist – dafür treten die vier Zeitzeugen bis heute mit großem Engagement ein. Sie gehen an Schulen, um junge Menschen vor den Gefahren des Neonazismus zu warnen, sie halten Lesungen und Vorträge über ihre eigene Lebensgeschichte, sie engagieren sich politisch gegen Faschismus und Fremdenfeindlichkeit, sie bringen ihren Willen zur Versöhnung und ihre ungebrochene Widerstands- und Schöpfungskraft in ihren Büchern, in Gemälden und der Musik nach außen. Ihre Botschaft ist klar: Liebe statt Hass, Versöhnung statt Verbitterung, Widerstand statt Resignation.
Mit diesem Buch stellen wir dem Wissen von der Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus Erzählungen vom Überleben der Menschlichkeit an die Seite. Nicht um das, was geschehen ist, in irgendeiner Weise zu bagatellisieren. Sondern ganz im Gegenteil: um in uns allen den Willen zur Bewahrung der Menschlichkeit zu stärken. Um uns Mut zu machen zu Zivilcourage und Widerstand. Und um uns vor Augen zu führen, wie kostbar, wie einzigartig und zugleich verletzlich das menschliche Leben ist.
MenschenLeben
Zeigt uns langsam eure Sonne.
Nelly Sachs
ESTHER BEJARANOWir leben trotzdem
»Wenn ich das schon überlebt habe, dann muss ich doch wieder anfangen zu leben und alles dafür tun, dass so etwas nie wieder geschieht.«
Hamburg, 10.11.2011
Einst musste Esther Bejarano im Mädchenorchester von Auschwitz um ihr Leben spielen. Heute steht die 89-Jährige mit Musikern der nächsten Generationen auf der Bühne und ruft zum Widerstand gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit auf. Mit ihrer Musik tritt sie an gegen all jene, die aus der Geschichte nichts gelernt haben. Deswegen steht sie bis heute auf der Bühne. Und ist mit ihren 89 Jahren sogar noch unter die Rapper gegangen. »Es ist ja nicht so, dass ich diese Musik besonders liebe, doch mit ihr kann ich die Jugend einfach viel besser erreichen«, sagt sie und lacht verschmitzt. Und das gelingt ihr. Mit der Hip-Hop-Band »Microphone Mafia« und ihrem Sohn Joram jagt sie von einem Konzerttermin zum nächsten. Gemeinsam setzen sie mit ihrer Musik ein sichtbares Zeichen für Toleranz und Völkerverständigung. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus hat sie sich damit als unermüdliche Kämpferin für Menschenrechte einen Namen gemacht. 2012 wurde ihr in Hamburg, wo sie seit vielen Jahrzehnten lebt, das Große Bundesverdienstkreuz verliehen.
Die Musik spielte von Anfang an eine große Rolle in ihrem Leben. Und sie ist bis heute ihr Lebenselixier. »Ohne Musik ging bei uns zu Hause gar nichts«, erinnert sie sich an ihre Kindheit, eine glückliche Zeit, die 1935, mit dem Einmarsch von Hitlers Truppen im Saarland, abrupt enden sollte. Es begannen Jahre der Ausgrenzung und Entrechtung, denen die Deportation und Ermordung vieler geliebter Menschen folgten. 1943 wurde sie selbst nach Auschwitz deportiert.
Damals konnte sie sich nicht wehren gegen das Unrecht. Heute schon. Als Vorsitzende des deutschen Auschwitz-Komitees engagiert sie sich seit vielen Jahren überall dort, wo die Würde des Menschen und die Menschenrechte bedroht sind. Wo immer Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sich zeigen, stellt sie sich ihnen entgegen. Sei es die aktuelle Flüchtlingspolitik der EU, sei es die Ausgrenzung der Sinti und Roma in vielen Ländern Europas oder die Diskriminierung muslimischer Mitbürger – sie ist zur Stelle und erhebt ihre Stimme. Wie ein Seismograf spürt sie Unrecht viel früher auf als andere und schlägt Alarm. Nicht weggucken. Hinschauen, handeln – das ist ihr Lebensmotto. Damit wird sie gerade für uns Jüngere, die wir den weltweiten Katastrophenmeldungen allzu oft nur ein laues »Wir können doch sowieso nichts tun« entgegensetzen, zur Mahnerin und zum aktiven Vorbild.
Natürlich wollten wir diese engagierte Frau für unseren Film gewinnen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme lud Esther Bejarano uns ein, anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht nach Hamburg zu kommen. Dort würde sie zwei Konzerte geben, sagte sie uns im Vorfeld, die wir mit der Kamera aufzeichnen könnten.
Die erste Begegnung verlief holprig. Gerade erst war sie von einer anstrengenden Konzertreise zurückgekommen. Sie war schwer erkältet und wusste nicht, ob ihre Stimme für ein weiteres Konzert durchhalten würde. Daher war sie alles andere als erfreut, unsere erwartungsvollen Gesichter hinter der Kamera zu sehen. »Ihr habt mir gerade noch gefehlt!«, sagte sie in wenig einladendem Ton. Und wer es bis dahin noch nicht wusste: Esther Bejarano ist eine außergewöhnlich starke Persönlichkeit. Authentisch, direkt, völlig unverstellt. Wer ihr gegenübertritt, muss wissen: Wegducken oder Aufgeben gibt’s nicht. Denn Charakterstärke erwartet sie auch von ihrem Gegenüber. Wie humorvoll und herzlich sie darüber hinaus ist, durften wir bald schon erfahren.
Kaum hatte sie zu singen begonnen, schien alle Erschöpfung von ihr abzufallen. Wer sie auf der Bühne erlebt, wird förmlich elektrisiert von ihrem Widerstandsgeist und angesteckt von ihrem Lebensmut. Mit ihrem Charisma zieht sie die Menschen umgehend in ihren Bann. »Wir werden leben und erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben trotzdem! Wir sind da!«, singt sie am Ende des Abends und wirft triumphierend ihre Arme in die Luft. Ja, sie hat überlebt. Und dass sie heute noch auf der Bühne steht, ist ihr persönlicher Triumph über den Vernichtungswillen des Nationalsozialismus. Es ist ein Sieg über die Unmenschlichkeit, den sie auch zum Gedenken an all die unzähligen Menschen zelebriert, die dieser Unmenschlichkeit zum Opfer fielen.
Am nächsten Vormittag stehen wir mit unserem Kamerateam und einem etwas mulmigen Gefühl in der Magengrube vor ihrer Wohnungstür. Würde es ihr gesundheitlich gut genug gehen, um sich auf das anstrengende Gespräch vor der Kamera einzulassen? Entgegen allen Befürchtungen empfängt sie uns herzlich und ist uns trotz schwerer Erkältung eine hoch konzentrierte Gesprächspartnerin, die mit großem emotionalem Engagement zu erzählen beginnt.
»Ich bin in einem wohlbehüteten und liberalen Elternhaus groß geworden. Geboren bin ich in Saarlouis, doch nach einem Jahr sind meine Eltern nach Saarbrücken gezogen, weil mein Vater dort eine Stelle als Oberkantor in der Synagoge erhalten hat. So habe ich die ersten zehn Jahre meiner Kindheit in Saarbrücken verlebt. Es war eine schöne und unbeschwerte Kindheit.
Da mein Vater Oberkantor war, haben wir uns an die religiösen Traditionen gehalten und auch einen koscheren Haushalt geführt. Das mussten wir allein schon wegen unserer Gäste tun. Wir Kinder gingen regelmäßig in die Synagoge, und das hat uns meist sogar Spaß gemacht. Vor allem, weil wir in Saarbrücken einen bezaubernden Rabbiner hatten, in den wir Mädchen alle verliebt waren.
Die Musik hat in unserer Familie immer eine sehr große Rolle gespielt. Ich bin so aufgewachsen, dass ich mir ein Leben ohne Musik einfach nicht vorstellen kann. Wir haben viel gemeinsam gesungen, und mein Vater hat dazu Klavier gespielt. Er selbst hatte eine wunderbare Stimme und hat ganze Arien für uns gesungen. Oft haben wir Hauskonzerte gegeben, und ich kann mich gut daran erinnern, dass Menschen sich draußen auf der Straße versammelten und zuhörten. So war unser Leben. Meine Eltern sorgten auch dafür, dass alle Kinder ein Instrument spielten. Ich lernte Klavier spielen. Als mein Großvater starb, der bei uns gelebt hatte, durften wir im Trauerjahr keine Musik machen. Das war sehr hart für uns. Die Musik hat uns schrecklich gefehlt – gerade in dieser schweren Zeit, die nun für uns begann. Denn 1935 war Hitler in Saarbrücken eingezogen, und das Saarland wurde in das Deutsche Reich integriert. Wir hatten zwar schon vorher etwas Antisemitismus zu spüren bekommen, doch das war kein Vergleich zu dem, was nun geschah. Es wurden immer mehr Gesetze erlassen gegen die Juden. Wir durften viele Geschäfte nicht mehr betreten, nicht mehr ins Kino oder Theater gehen, nicht mehr an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Überall stand: ›Juden ist der Zutritt verboten.‹ Wir Kinder mussten die Schulen verlassen, in die wir bis dahin gingen, und wurden in jüdische Schulen geschickt. Dadurch wurden wir von unserer Umgebung sehr isoliert. Unsere Spielkameraden wollten plötzlich nichts mehr mit uns zu tun haben und weigerten sich, mit uns zu spielen. Diese Ausgrenzung war für uns Kinder sehr hart. Wenigstens gab es in Saarbrücken noch einen jüdischen Kulturbund, in dem mein Vater aktiv war. So hatten wir Zugang zu kulturellen Veranstaltungen. Und wir haben in der jüdischen Schule Theaterstücke aufgeführt.
Saarbrücken 1928: Esther (Mitte) mit ihren Geschwistern Ruth, Gerdi und Tosca (von links) beim gemeinsamen Spielen. »Ich war als Kind ziemlich wild. ›Frech wie Oskar‹, sagte mein Vater immer zu mir.«
1936 sind wir nach Ulm umgezogen, weil mein Vater dort eine neue Stelle als Kantor angenommen hat. Zu dieser Zeit sind sehr viele jüdische Bürger ausgewandert. Wir konnten das leider nicht, weil wir nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu hatten. Mein Vater hat sich zwar um Arbeitsstellen im Ausland bemüht, doch vergeblich, und so mussten wir notgedrungen in Deutschland bleiben.
In Ulm hatte ich das große Glück, dass ich in eine fortschrittliche jüdische Schule außerhalb der Stadt gehen konnte. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und bin jeden Morgen zum Unterricht gefahren. Wir lernten dort viele Fremdsprachen, denn alles war darauf ausgerichtet, uns auf die Emigration in andere Länder vorzubereiten. 1937 gelang es meinen Eltern, meine beiden älteren Geschwister ins Ausland zu schicken, um sie vor dem Terror der Nazis in Sicherheit zu bringen. Meiner Schwester Tosca gelang die Ausreise nach Palästina, und mein Bruder Gerdi fuhr zu einer Tante in den USA. Meine Mutter konnte den Verlust ihrer Kinder und die ganze Unsicherheit nicht verkraften und wurde schwer depressiv. Währenddessen spitzte sich die Lage um uns herum zu. Nach den entsetzlichen Ausschreitungen in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde meinem Vater klar, dass er alles versuchen musste, um seine gesamte Familie ins Ausland zu bringen. Auch er war zusammen mit anderen jüdischen Männern in dieser Nacht verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden. Nach drei Tagen kam er wieder nach Hause. Wahrscheinlich, weil er ›Halbjude‹ war. Die anderen Männer wurden nach Dachau verschleppt.
Mich schickte mein Vater anschließend in ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina. Das lag in der Nähe von Berlin. Diese Vorbereitungslager waren damals noch erlaubt. Den Nazis war es recht, wenn wir das Land verließen. Hauptsache, wir waren weg. Doch als der Krieg ausbrach, wurden Arbeitskräfte gebraucht, und so wurden diese Lager geschlossen und wir sind alle in Zwangsarbeitslager verschleppt worden. Ich hatte Glück, ich wurde in ein Lager nach Neuendorf gebracht, wo ich tagsüber in einem Blumengeschäft arbeiten musste. Die Inhaber waren keine Nazis und haben mich sehr gut behandelt. Aber 1943 wurden auch die Arbeitslager geschlossen, und wir sind im April auf Lastautos nach Berlin verfrachtet worden. Dort war in einem vormals jüdischen Altenheim ein riesiges Sammellager eingerichtet worden für alle Juden, die noch in Berlin und Umgebung lebten. Und von dort aus sind wir mit Viehwaggons Richtung Osten deportiert worden. Tagelang saßen wir eingepfercht in diesem überfüllten Viehwaggon, in dem es kaum genug Luft zum Atmen gab. Es war eine unvorstellbare Tortur. Alte und kranke Menschen starben auf dieser Fahrt. Nach Tagen schließlich hielt der Zug, und die Waggontüren wurden geöffnet. Als wir ankamen, wussten wir noch gar nicht, wo wir überhaupt waren. Es standen da diese Lastautos am Gleis und es wurde gesagt, dass all diejenigen, die nicht mehr gut laufen könnten, Mütter mit Kindern und Schwangere, auf die Lastautos steigen sollten, weil sie ins Lager gefahren würden. Da dachten wir noch, so schlimm kann das ja nicht werden, wenn die auf Schwangere und Gebrechliche Rücksicht nehmen. Erst später, als die Menschen ihre Verwandten suchten und nicht mehr fanden, haben wir erfahren, dass diese auf den Lastwagen direkt in die Gaskammern gebracht wurden. Anfangs hatten wir ja noch keine Ahnung gehabt, was uns erwartet. Wir hatten zwar schon gehört, dass es ein schreckliches Lager in Auschwitz gibt, aber wir wussten nicht, dass es ein Vernichtungslager ist.
Esther mit ihren Eltern Margarethe und Rudolf Loewy im Jahre 1939
Auschwitz ist unbeschreiblich, unvorstellbar. Ich kann nicht erzählen, was ich dort alles gesehen habe. Ich kann es auch nicht vergessen. Ich lebe damit. Ich bin ja schon heilfroh, dass ich heute nicht mehr diese grauenhaften Träume habe, die ich viele Jahre Nacht für Nacht hatte. Träume, in denen die SS mit ihren schrecklichen Stiefeln auf mir herumtrampelt.
Trotzdem kann ich sagen, dass ich großes Glück hatte. Denn ich bin nicht allein, sondern mit einer ganzen Gruppe von Freunden und Freundinnen dort angekommen. Das war ein großer Halt für uns alle. Wir haben uns gegenseitig sehr geholfen. All die Unmenschlichkeit, die wir dort gesehen und erlebt haben, haben wir nur ertragen können, weil wir zusammengehalten haben. Die Solidarität hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. In sämtlichen Lagern. Der Zusammenhalt war das, was die Menschen zum Leben und zum Weiterleben gebracht hat. ›Wir müssen unbedingt durchhalten‹, haben wir uns gegenseitig immer wieder gesagt. Es gab natürlich auch Menschen, die diese Unmenschlichkeit nicht ausgehalten haben. Viele von ihnen haben sich das Leben genommen, indem sie in den elektrischen Zaun gelaufen sind. Ich selbst hätte das nie gemacht. Ich wollte unbedingt am Leben bleiben. Allein schon, um mich zu rächen an diesen furchtbaren Nazis. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich da wieder rauskomme. Dass ich das überlebe. Denn ich wollte bezeugen, was ich an diesem Ort gesehen habe. Ich glaube, das hat mir beim Überleben geholfen.
Und natürlich auch die große Solidarität untereinander. Ich bin einmal schwer an Typhus erkrankt und in das Krankenrevier gekommen. Dort konnte man eigentlich nur sterben. Oder man ist in die Gaskammer gekommen. Doch eine polnische Krankenschwester hat sich sehr um mich bemüht. Ich kannte sie gar nicht und sie mich auch nicht, doch sie hat mir das Leben gerettet. Ich war schon im Delirium und konnte nichts mehr essen. Da hat sie von irgendwoher Knoblauch besorgt und etwas davon auf mein Brot gerieben. Das war etwas ungeheuer Kostbares. Der Geruch weckte meine Lebensgeister und brachte mich dazu, wieder mit dem Essen anzufangen. Das sind die Erlebnisse, die einem in dieser Zeit sehr geholfen haben. Dieses Zusammenstehen und Füreinander-Einstehen.«
»Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt, ein ganz großes Glück, ein unheimliches Glück«, schrieb Esther Bejarano in ihrem autobiografischen Buch »Erinnerungen«. Auch in unserem Gespräch fällt immer wieder das Wort »Glück«. Sogar in Zusammenhang mit ihrer Zeit in Auschwitz. Esther Bejarano besitzt die seltene Gabe, selbst den schrecklichsten Ereignissen ihres Lebens etwas Positives abringen zu können. Ihr unanfechtbarer Lebensmut und der Wille, unter keinen Umständen aufzugeben, befähigte sie immer wieder dazu, Risiken einzugehen und sich extremen Herausforderungen zu stellen.