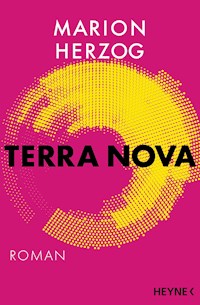
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kurz nachdem Kaja und die Rebellen aus der unterirdischen Bunkeranlage Hope of Tomorrow entkommen sind, stellen sie fest, dass sie vom Ältestenrat belogen wurden: Es gab immer Menschen an der Erdoberfläche. In riesigen Siedlungsanlagen leben die Bewohner in Wohlstand und Sicherheit. Doch wie die Archianer bezahlen auch sie einen hohen Preis dafür. Citizen One regiert mit eiserner Faust über seine Untertanen. Die einzigen, die in relativer Freiheit leben, sind die Outlaws, die sich in ein ausgeklügeltes Höhlensystem zurückgezogen haben, das sie vor den radioaktiven Stürmen, die immer wieder über die Erde tosen, schützt – und vor Citizen One, der sie gnadenlos verfolgt. Die Archianer schließen sich den Outlaws an und werden in einen brutalen Konflikt verstrickt. Kaja ist innerlich zerrissen, denn einerseits möchte sie für die gerechte Sache kämpfen und andererseits will sie unbedingt Liam retten. Denn ihre große Liebe sitzt noch immer in der Hope im Gefängnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Das Buch
Plötzlich tauchten am Horizont schemenhaft zwei Figuren auf. Liam und Samuel. Erleichtert atmete Kaja auf. Es war ihnen nichts zugestoßen, und vielleicht hatten sie etwas gefunden. Wasser oder sogar Nahrung? Mühsam stemmte sie sich auf die Beine, die unter ihrem Gewicht sofort wieder zu zittern anfingen. Ohne die elektrischen Impulse, die der Biose-Suit an ihre Muskeln sendete, war das Gehen eine echte Herausforderung.
Nachdem sie ihr ganzes Leben in einer virtuellen Scheinsicherheit der unterirdischen Arche Hope of Tomorrow verbrachten, gelingt Kaja und Liam mit einer Gruppe Rebellen die Flucht. An der Erdoberfläche angekommen, stellen sie fest, dass sie von Präsidentin Anna Smith, die mit eiserner Faust über die Hope herrscht, belogen wurden: Die Archianer sind keineswegs die letzten Menschen auf der Welt. An der Oberfläche führen die Outlaws ein freies Leben. Sie haben sich in ein ausgeklügeltes Höhlensystem zurückgezogen, das sie vor den radioaktiven Stürmen, die immer wieder über die Erdoberfläche tosen, zu schützen.
Angeführt von Kaja und Liam schließen sich die Rebellen den Outlaws an und kommen so schließlich einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur: Die Bewohner der Hope of Tomorrow sind dem Untergang geweiht. Kaja und Liam setzen alles daran, die Archianer zu befreien und bereiten die Erstürmung der Archen vor. Doch sollte ihr Plan scheitern, ist nicht nur ihre Liebe in Gefahr, sondern auch alles Leben auf der Erde …
Die Autorin
Marion Herzog studierte Literaturwissenschaften und Anglistik in München und verbrachte einige Zeit in London und Auckland. Sie betreute viele Jahre als Redakteurin erfolgreich Buchprojekte, bevor sie ihre eigene Liebe zum Schreiben entdeckte. Unter anderem Namen hat sie bereits mehrere Krimis veröffentlicht, mit ihren Science-Fiction-Debüt Algorytmica wagte sie den Aufbruch in die ferne Zukunft. Die Autorin lebt mit ihrer Familie auf dem Land.
MARION
HERZOG
TERRA NOVA
Roman
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 12/2022
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2022 Regina Denk
Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München
Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss
ISBN: 978-3-641-26368-3V001
www.diezukunft.de
Erster Teil
Der Exit –
Sechs Monate später
1
Als Kind hatte Sandra vor nichts mehr Angst gehabt als vor der Finsternis. Hunderte Meter unter der Erde, in einer gigantischen Bunkeranlage geboren zu sein, bedeutet früh zu begreifen, dass Energie lebenswichtig ist: Licht ist gleich Leben, Dunkelheit ist der Tod. Doch dieser Glaube hatte sich als trügerisch erwiesen. Alles hätte Sandra jetzt dafür gegeben, für immer im Dunkel verharren zu dürfen. Ihre Augen waren weit aufgerissen, doch sie konnte nichts sehen. Ihre krächzende Stimme war kaum zu hören, leise zählte sie: »Neunhundertsiebenundneunzig, neunhundertachtundneunzig, neunhundertneunundneunzig«, dann schloss sie die Lider. Wie lange konnte man einen Menschen auf diese Weise quälen, bevor er verrückt wurde? »Eintausend.«
Grelles Licht erfüllte plötzlich die kleine Zelle. Sandra schlug die Hände vors Gesicht, sie wimmerte wie ein verletztes Tier. Auf keinen Fall durfte sie die Augen öffnen. Diesen Fehler hatte sie zu oft gemacht. Ein weiteres Mal würde sie es nicht ertragen, die Leichen zu sehen. Du bist in einem Hologramm, das hier ist nicht die Wirklichkeit, flüsterte die Stimme der Hoffnung in ihrem Kopf. Sie wollte es glauben, klammerte sich mit aller Kraft an diesen Gedanken. Doch die Bilder, die sie sehen würde, sollte sie es wagen, die Hände vom Gesicht zu nehmen, brannten auf den geschlossenen Lidern. Die leeren, glasigen Augen ihrer Mutter, ihr vom Schmerz der Folter weit aufgerissener Mund, für immer eingefroren in kalter Totenstarre. Neben ihr auf dem Boden, die Glieder unnatürlich verrenkt, Arme und Beine gebrochen, lag ihr gemeinsamer Freund Thore. Weiße Knochensplitter hatten die dünne Membran seines Biose-Suits zerschnitten, die Ränder des Stoffs waren dunkel von getrocknetem Blut. Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate hatte Sandra damit verbracht, die Details der Verwesung an den Körpern der geliebten Menschen zu studieren. Eintausend Sekunden lang würde sie nun wieder Gelegenheit haben, ihre früheren Mitgefangenen zu betrachten, bis das Licht erneut ausging. Eintausend Sekunden konnte sie in der dann folgenden Dunkelheit versuchen, das Gesehene zu vergessen. Ein immer gleicher Rhythmus, der nur unterbrochen wurde, wenn die Folterknechte des Rats der Zehn der Meinung waren, es wäre an der Zeit, Sandra einer weiteren Befragung zu unterziehen. Die Schmerzen, die sie in diesen Sitzungen erleiden musste, waren völlig anderer Art. Unzählige Narben und Wunden bedeckten ihren Körper als Beweis dafür, wie lange sie schon schwieg. Wie oft es ihr gelungen war, die geflohenen Darksurfer nicht zu verraten. Vorsichtig tasteten ihre Finger über die geschundenen Stellen an ihren Beinen. Die jüngsten Erinnerungen an ihren Folterknecht: Dort, wo sich der glühende Stahl in ihr Fleisch gefressen hatte, konnte sie nichts mehr spüren. Ein schwacher Trost, verglichen mit dem beißenden Brennen, das die Wunden umrahmte. Wie lange würde sie noch durchhalten? Wie viel Vorsprung konnte sie Liam verschaffen? Liam.
Der Gedanke an den verlorenen Freund schmerzte mehr als alle Verletzungen. Irgendwo dort oben war er jetzt mit Kaja zusammen, während sie selbst gefangen und einsam in diesem Bunker ausharren musste. Sie wusste nicht, was schlimmer war, die Eifersucht, die immer noch in ihrem Herzen brannte, oder die Sehnsucht. Vielleicht sollte sie ihren Peinigern einfach alles verraten. Vielleicht hätten diese Qualen dann endlich ein Ende, und man würde sie in Frieden lassen? Ergab ihr Leid noch Sinn? Wer konnte schon sagen, ob die Flucht tatsächlich von Erfolg gekrönt gewesen war? Hätte nicht längst ein Zeichen, irgendein Signal, dass Liam und die anderen noch am Leben waren, die Arche erreichen müssen? Was, wenn die Geflohenen längst tot waren? Oder sie ihre Pläne geändert hatten und die Archianer gar nicht befreien würden? Gab es überhaupt noch Darksurfer oder Widerstand gegen die Regierung in ihrer Arche, der Hope of Tomorrow? Oder war sie die Letzte ihrer Art? Warum kam ihr niemand zu Hilfe? Hatte man sie in dieser Zelle vergessen? Als Antwort auf ihre Fragen hörte sie genau in diesem Moment das Schloss der schweren Bunkertür. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, blankes Entsetzen machte sich in ihr breit. Sie wusste, ihre Folterknechte waren gekommen, um sie ein weiteres Mal zu holen. »Das ist nur ein Traum, nur ein Hologramm, ich lebe, mein Körper ist unversehrt«, wimmerte sie leise. Doch ihre Gedanken konnten die Tränen nicht aufhalten. Warm und salzig liefen sie ihr in Strömen übers Gesicht, als die Tür geöffnet wurde. Sie hob den Kopf, zwang sich, den Blick nicht auf die beiden Leichen zu richten, sondern fixierte mit harter Miene die Soldaten, die gemeinsam den Raum betraten. Sie presste die Lippen fest aufeinander. Sie würde Liam nicht verraten. Eher würde sie sterben. Doch sterben lassen würde man sie hier unten nicht. So viel stand fest. Wenigstens nicht, bevor sie all das preisgegeben hätte, was der LifeChip in ihrem Kopf nicht aufzeichnen konnte. Dank den digitalen Mauern, die ihre Darksurfer-Freunde Smith Young und Victoria Silver zu ihrem Schutz bei allen wichtigen Meetings errichtet hatten, hatte ihre Regierung kaum etwas über den geheimen Widerstand innerhalb der Hope aus den Daten in ihrem Kopf auslesen können. Die Revolution gegen den Rat war lange ein Geheimnis geblieben. Bis zu dem Tag, als die Darksurfer einen Auserwählten und die Tochter des obersten Ratsherrn entführt hatten. Seitdem wusste die ganze Arche darüber Bescheid, dass die Darksurfer ihrer Regierung den Krieg erklärt hatten und vorhatten, die Archen zu zerstören. Wollte man ELSA, dem staatlichen Nachrichtendienst, weiter Glauben schenken, dann waren sie zudem schuld an den gehäuften Energieausfällen der letzten Monate und den damit verbundenen Engpässen, was die Grundversorgung der Bürger betraf. Sandra selbst hatte die Welle der falschen Beschuldigungen nur für einen kurzen Moment aus dem Parentes Paradisum verfolgen können. Ein paar Stunden, während Präsidentin Anna Smith, der Rat und seine Soldaten mit den Nachwehen des Ausbruchs beschäftigt gewesen waren, hatte sie in dem Homeholo der neuen Elterngeneration als Liams Avatar seinen Platz eingenommen, bevor man sie enttarnt und festgenommen hatte. Seitdem hielt man sie in dieser Zelle gefangen. Trotz ihres jahrelangen Trainings, was digitale Welten betraf, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich gerade in einem Hologramm oder der Wirklichkeit befand. Die beiden Soldaten in schwarzer Uniform, die ohne zu zögern auf sie zusteuerten, waren beängstigend real. Wortlos packten sie Sandras Arme und zerrten sie auf die Beine. Sie versuchte gar nicht erst, Widerstand zu leisten. Ob Hologramm oder nicht, machte keinen Unterschied. Hier unten gab es kein Entrinnen.
»Du solltest reden, Kleines«, brummte der ältere der beiden Männer. Sein Ton war nicht freundlich, aber auch nicht feindselig. Vielleicht hatte der Mann selbst eine Tochter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einem einfachen Soldaten irgendwann im letzten Jahrzehnt die Freigabe zur Reproduktion erteilt hatte, war sehr gering. Womöglich hatte er nur Mitleid mit dem halb verhungerten, verletzten Mädchen. Einen Staatsfeind stellte man sich Furcht einflößender vor. Sandra reagierte nicht auf die Worte des Soldaten. Sein Kamerad hingegen schon. »Halt die Klappe, Ansgar. Wir haben Anweisung, nicht mit ihr zu sprechen.«
»Ach Anweisung, Anweisung«, knurrte der Ältere. »Glaubst du tatsächlich, dieses armselige Ding könnte uns gefährlich werden?«
»Hast du ELSA nicht zugehört?«, erwiderte der andere scharf. »Wir dürfen uns nicht von Aussehen und Verhalten täuschen lassen; jeder und jede könnte einer von ihnen sein.«
»Von ihnen? Wer sind denn diese ›ihnen‹ eigentlich? Das klingt gerade so, als würde sich hier unten eine ganze Armee verstecken, die es auf die Arche abgesehen hat. Das ist doch Unfug.«
»Vorsicht, was du sagst«, zischte der Jüngere zornig. »Oder ich muss dich wegen Hochverrats anzeigen, wenn es deine ELSA nicht ohnehin schon längst getan hat.«
Seine Worte verfehlten ihren Zweck nicht. Der Ältere wurde plötzlich blass, und seine Stimme bekam einen unsicheren Unterton. »Hey, hey, immer langsam. Ich wollte damit nur sagen …«
»Ich will nichts mehr hören«, fiel ihm der Kollege ins Wort. »Lass uns die Schlampe zum Verhör bringen, und dann ab nach Hause. Verstanden?«
Der Alte nickte stumm. Alles an dieser Konversation deutete darauf hin, dass sie sich tatsächlich in der Arche und nicht in einer digitalen Kopie bewegten. Trotzdem konnte Sandra nicht davon ausgehen, dass es auch so war. Sie selbst hatte mehrfach ebenso perfekt konstruierte Hologramme besucht. Ohne die Hilfe ihrer ELSA, dem digitalen Assistenten, den alle Bewohner der Arche bei der Geburt implantiert bekamen, war es nahezu unmöglich, den Unterschied zu erkennen. Ihre eigene ELSA war Sandra in der Nacht des Ausbruchs von ihrer Mutter extrahiert worden. Stattdessen hatte man ihr den Lifechip von Liam Turner eingesetzt, um sein Verschwinden so lange wie möglich vor dem Rat geheim zu halten. Warum sie so schnell entdeckt worden war, wusste Sandra nicht. Eigentlich hätte die Technik ihre wahre Identität wenigstens ein paar Stunden, vielleicht sogar Tage verschleiern sollen. Aber irgendetwas war schiefgelaufen. Kaum hatte sich das Holovit nach dem forcierten Blackout wieder hochgefahren, waren die Wachen zur Stelle gewesen und hatten die Auserwählten im Parentes Paradisum zusammengetrieben. Zwar war es ihr für ein paar Minuten gelungen, Lora Bonnet, Liams per künstlicher Intelligenz zugeteilte Partnerin, zu täuschen, aber irgendjemand musste sie verraten haben. Wie sonst war es zu erklären, dass die Wachen gezielt Liams Avatar und niemanden sonst verhaftet hatten?
Sie war auf der Krankenstation der Hope of Tomorrow aufgewacht, wo, diesmal in der realen Welt, weitere Soldaten das medizinische Personal und ihre Mutter Dr. Rebecca Goldstein bereits in Gewahrsam genommen hatten. Die entsetzten Blicke ihrer Verbündeten waren Beweis genug dafür, dass irgendetwas an ihrem ohnehin riskanten Plan nicht funktioniert hatte. Todesangst war allen ins Gesicht geschrieben gewesen. Doch was genau passiert war, wusste niemand. Und es gab auch keine Möglichkeit mehr, sich auszutauschen. Allesamt waren sie abgeführt worden, ihre Lifechips standen seitdem unter der Kontrolle des Rats. ELSA war kein persönlicher Assistent mehr, sondern Wächter im eigenen Kopf. Von ihr würde Sandra niemals erfahren, ob sie sich in einem Code befand. Umgekehrt aber zeichnete Liams ELSA weiterhin jede Reaktion ihres Körpers haargenau auf. Hatte sie Angst, verspürte sie Schmerz, Trauer oder Hass? Sprach sie die Wahrheit, oder versuchte sie, etwas zu verbergen? Die biochemischen Prozesse ihres Körpers verrieten mehr über Sandra, als ihr lieb war. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben, während sie zwischen den beiden Soldaten durch die Bunkeranlage schritt. Atmete bewusst ein und aus, und versuchte nicht an das zu denken, was sie am Ende des Wegs erwarten würde. So sehr sie sich auch anstrengte, es gelang ihr nicht, die Panik zu unterdrücken. Ihre Hände, Avatar hin oder her, waren nass vor Schweiß und zitterten.
»Du könntest dir das alles hier ersparen.« Mit einem knappen Nicken deutete ihre Wache auf die schwere Eisentür vor ihnen. Sie hatten ihr Ziel erreicht. »Oder es wenigstens schnell beenden.«
Sandra antwortete nicht.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Wie du meinst.« Er tippte seinen Passcode in das Zahlenschloss neben dem Durchgang, und die Tür öffnete sich. Es war immer derselbe Raum, der hier auf sie wartete, und immer derselbe Mann, dessen Gesicht sie noch nie gesehen hatte, aber dessen Stimme sie nie mehr vergessen könnte, egal, wie lange dieses Leben noch dauern würde.
»Hallo, Sandra«, begrüßte er sie freundlich. Sie konnte das Lächeln, das sich hinter der schwarzen Maske versteckte, in seiner Stimme hören. »Schön, dich wiederzusehen. Hast du mich vermisst?«
Ein eiskalter Schauer lief Sandra den Rücken hinab. Instinktiv machte sie einen Schritt zurück, aber die beiden Wachen versperrten den Ausgang. »Tut mir leid, Mädchen, falsche Richtung.« Der Blick, den der Alte ihr zuwarf, war voller Mitleid. Trotzdem schob er sie sanft, aber fest weiter in den Raum hinein.
Mitten in der Zelle stand ein Stuhl aus Eisen auf dem Betonboden fixiert. Sandra wusste, wie sich das kalte Metall durch den dünnen Stoff ihres Suits anfühlte, noch bevor die Soldaten sie mit Armen und Beinen darauf fixierten, je eine Metallfessel an den Oberarmen, Handgelenken, Schenkeln und Waden. Sie schlossen einen Ring aus Eisen um ihre Stirn, der verhinderte, dass sie den Kopf drehen konnte. Nach getaner Arbeit verließen die beiden Männer die Folterkammer. Keine unnötigen Zeugen sollten sehen, was als Nächstes geschah. Sandra war ein weiteres Mal allein mit dem Monster.
Ihr Peiniger war nicht viel größer als sie selbst und von schmaler Statur. Die Uniform des Rats und seine Maske machten es unmöglich, sein Alter zu bestimmen. Langsam, beinahe als würde er jeden Schritt genießen, näherte er sich dem Folterstuhl.
Sandra begann am ganzen Körper zu zittern. Sie konnte nichts dagegen tun.
»Aber, aber, du hast doch nicht etwa Angst vor mir?«, fragte er mit zärtlicher Stimme. »Wir haben doch gerade erst begonnen, uns näher kennenzulernen.« Mit seinen Fingern, die in schwarzen Handschuhen steckten, streichelte er die offenen Wunden an ihren Oberschenkeln.
Sandra zuckte unter der Berührung zusammen. Sie konnte spüren, wie der Mann dabei hinter der Maske lächelte. Im übergroßen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand war ihr eigenes, vor Angst verzerrtes Gesicht zu sehen. Ihr blondes Haar, auf das sie früher einmal stolz gewesen war, war verfilzt und blutverkrustet. An mehreren faustgroßen Stellen war dunkelrote Haut zu sehen. Dicke Strähnen hatte der Inquisitor ihr während der letzten Befragung mit bloßen Händen vom Kopf gerissen. Ihr Gesicht war bleich, die Augen von roten Adern durchzogen, ihre Lippen trocken und aufgesprungen. Sie hatte schon besser ausgesehen. Erneut fragte sich Sandra, ob ihr zerschundener Körper mehr Eindruck auf Liam machen würde als der alte, nahezu perfekte, auch wenn das keine Rolle mehr spielte. Er hatte sich für Kaja entschieden. Er war unerreichbar weit entfernt und hatte sie hier unten zurückgelassen.
»Sie werden nicht zurückkommen«, flüsterte der Maskenmann an ihrem Ohr, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Vielleicht hatte er das. »Niemand wird dich retten. Die Einzige, die das hier beenden kann, bist du selbst.«
Lag es an den nicht enden wollenden Schmerzen oder an der Zeit, die seit dem Ausbruch vergangen war? Langsam begann Sandra den Worten des Soldaten Glauben zu schenken. Niemand in der ganzen Hope war einsamer als sie. Und keiner würde sie je aus diesem Loch befreien.
»Du musst uns nur sagen, was du über den Ausbruch weißt. Wer gehört noch zu den Darksurfern? Wo trefft ihr euch? Was habt ihr vor?« Wie eine Spinne wanderten die Handschuhe an ihrem Hals entlang. »Wo sind Liam Turner und Kaja Andersson?«
Sie wissen es immer noch nicht, dachte Sandra und konnte ihre Freude nicht verbergen. Ihre zersprungenen Lippen formten sich zu einem Lächeln.
Als Antwort schlug ihr die Hand mit einem lauten Klatschen ins Gesicht. Ihr Kopf dröhnte, und sie konnte das Blut in ihrem Mund schmecken. Aber der Schmerz war es wert. Liam war nicht entdeckt worden, weder tot noch lebendig. Die Hoffnung, dass ihre Freunde ein sicheres Versteck an der Oberfläche gefunden hatten, gab ihr erneut Kraft. Die würde sie auch brauchen. Der Folterknecht machte sich daran, sein Werkzeug zu wählen. Auf einem metallenen Tisch neben ihrem Stuhl reihten sich diverse Messer, Haken, Nadeln und Zangen. Mit den meisten davon hatte Sandra in den letzten Monaten Bekanntschaft gemacht. Keine der Begegnungen war gut verlaufen, aber sie hatte durchgehalten. Sie würde es auch diesmal schaffen. Nach kurzem Zögern griff der Teufel nach einem kleinen, handlichen Skalpell. Die dünne Klinge blitzte im Licht der Neonröhre, als er damit zu ihr trat.
»Eigentlich schade um dieses hübsche Gesicht«, flüsterte er und setzte die kalte Stahlspitze an ihrer rechten Schläfe an. Sandra verspürte einen leichten Druck, gefolgt von heißem Brennen, als er das Messer vorbei an ihrem Ohr über die Wange bis zum Hals nach unten zog. Sofort trat warmes Blut aus der Wunde und folgte der schmerzenden Spur in einem dünnen Rinnsal. Sie zog scharf die Luft ein, gab aber ansonsten keinen Laut von sich.
Der Teufel nickte anerkennend. »Du wirst besser und besser, Sandra. Ich werde mir wohl bald neue Dinge für dich einfallen lassen müssen. Aber keine Sorge, noch habe ich ein paar Tricks auf Lager.« Er wandte sich von ihr ab und suchte auf seinem Tisch nach einem anderen Werkzeug.
Der Spiegel zeigte Sandra ihr Gesicht, die linke Hälfte war von der Stirn abwärts dunkel vor Blut. Rote Tropfen liefen über ihr Kinn und färbten den verdreckten Suit an neuen Stellen. Während sie ihr Spiegelbild betrachtete, fuhr plötzlich eine wellenartige Bewegung durch das Glas. Keine Sekunde später wiederholte sich das schwingende Zittern auf der glatten Oberfläche. Sandra kniff die Augen zusammen, versuchte, Blut und Tränen wegzublinzeln. Die Scheibe bebte ein drittes Mal, als hätte jemand von der anderen Seite mit großer Wucht dagegen geschlagen.
»Keine Sorge, deine Augen spielen dir keinen Streich«, erklärte der Teufel und kicherte leise. »Wir haben heute Zuschauer auf der anderen Seite. Unsere Show scheint den gewünschten Effekt zu haben.«
»Wer ist hinter der Scheibe?«, fragte Sandra, ohne nachzudenken. Eine kalte Angst legte sich um ihr Herz. Wen hatte der Rat gefangen genommen?
»Ah, du kannst also doch reden. Vielleicht ist unser kleines Experiment tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg.«
Sandra presste die Lippen fest zusammen. Sie musste sich besser in den Griff bekommen. Durfte der Angst in ihrem Kopf nicht das Kommando überlassen.
»Nur verständlich, dass du dein Publikum kennen willst. Und es spricht auch wirklich gar nichts dagegen, unsere Überraschung zu präsentieren.« Im selben Moment verwandelte sich der venezianische Spiegel in reguläres Glas. Sandras Gesicht verschwand, stattdessen konnte sie durch die Scheibe hindurch in den Raum neben ihrer Zelle blicken. Das Blut gefror in ihren Adern. Es war immer noch ihr eigenes Gesicht, in das sie blickte. Ohne Blut, dennoch vor Schrecken und Angst zu einer Fratze verzerrt, die Hände gegen die Scheiben gepresst, brüllte ihre eigene Mutter Rebecca ihren Schmerz über die Folter der Tochter lautlos gegen das Glas. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken: Ihre Mutter lebte, ihr Kerker und die Leichen darin waren also nur Projektionen gewesen. War dies hier dann die Realität? Oder nur eine weitere Illusion, um ihr den Verstand zu rauben? Wann hatte man sie ausgeloggt? Oder eingeloggt? Ihr Kopf schmerzte. Sie wollte so sehr glauben, dass ihre Mutter noch am Leben war, aber zugleich wusste sie, was für unerträgliche Pein es sein musste, dabei zuzusehen, wie man ihrer Tochter Schmerzen zufügte.
»Freust du dich, sie zu sehen?«, flüsterte der Teufel in ihr Ohr. Er war hinter sie getreten, hatte die Hände auf ihre Schultern gelegt. Gemeinsam beobachteten sie Rebeccas Verzweiflung. »Freust du dich, dass sie noch am Leben ist?«
»Lasst sie gehen«, erwiderte Sandra kaum hörbar. »Bitte.« Der Mann in ihrem Rücken gluckste amüsiert. »Aber sie will gar nicht gehen. Sie will bei dir bleiben, koste es, was es wolle. Das hat sie mir selbst gesagt. Und wer könnte einer liebenden Mutter den Wunsch verwehren, bei ihrem Kind zu sein? Du etwa? Ich nicht. Ich bin doch kein Unmensch.«
Sandra schloss für einen Moment die Augen. Verzweiflung machte sich in ihr breit. Was sollte sie tun? Wie sollte sie das hier ertragen? Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken. Hatte plötzlich nicht mal mehr die Kraft, ihren eigenen Körper zu kontrollieren.
»Das kann ich gern tun, Sandra. Ich kann sie gehen lassen. Und weil ich dich so sehr ins Herz geschlossen habe, kann ich sogar noch mehr tun: Ich kann euch beide gehen lassen. Was meinst du? Wäre das nicht wunderbar? Du und deine Mutter, frei wie die Vögel am Himmel. Vereint und ohne eine einzige Sorge. Ich kann das alles für euch in die Wege leiten. Ich will nur eine kleine Sache von dir, Sandra, nur einen winzigen Gefallen als Gegenleistung: Erzähl mir, was du über den Ausbruch weißt. Wohin sind die Darksurfer geflohen? Wer gehört noch zu euch hier in der Arche? Sag es mir, und du bist frei. Sag es mir, und ihr seid beide frei.«
Sandra schluchzte, sie ballte die Hände zu Fäusten und presste die Lider so fest zusammen, dass weiße Sterne auf ihren Augen tanzten. Sie wusste, dass jedes Wort gelogen war, dass weder sie noch ihre Mutter dieses Loch jemals lebend verlassen würden. Sie wusste nur nicht, wie lange sie das alles hier noch ertragen würde. Ohne die Augen zu öffnen, schüttelte sie den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich kenne keine Darksurfer, ich weiß nichts von einem Ausbruch.«
Derselbe Satz, den sie dem Teufel seit ihrer ersten Begegnung antwortete. Auch Rebeccas vermeintliche Anwesenheit konnte daran nichts ändern.
»Schade, Sandra, wirklich schade. Ich glaube, deine Mutter wäre gern heute mit dir nach Hause gegangen. Sieh dir an, wie sehr sie weint. Sieh nur …«
Sandra hielt die Augen fest geschlossen. Auf keinen Fall würde sie sich dazu verleiten lassen, Rebeccas Verzweiflung ein weiteres Mal anzusehen.
»Nun gut, wenn du deine Augen nicht freiwillig öffnen willst, werde ich wohl oder übel nachhelfen müssen.«
Sie hörte metallisches Klimpern, als der Teufel sich ein weiteres Mal an seinem Werkzeugtisch bediente. Wenig später spürte sie die Lederhandschuhe an ihrem Gesicht. Unsanft riss er ihr den Kopf nach hinten und hielt ihr Kinn in einem eisernen Griff. Ein schneller Schnitt, ein Riss, und das Lid ihres rechten Auges war verschwunden. Diesmal konnte Sandra die Schmerzensschreie nicht unterdrücken. Sie kreischte und versuchte vergebens, die fixierten Hände vors Gesicht zu schlagen. Der Schmerz war unbeschreiblich, das noch vorhandene Lid blinzelte panisch.
Hinter der Scheibe konnte sie sehen, wie ihre Mutter fester und fester gegen die Scheibe schlug, bis zwei Wachen sie schließlich an beiden Armen festhielten. Eine blonde Frau in Uniform trat zu ihr und sagte einige Worte. Unter Tränen schüttelte Rebecca den Kopf. Auch sie schlug das falsche Angebot ihrer Peiniger aus. Die Soldatin zuckte mit den Schultern, und die beiden Männer drehten Rebecca wieder zur Scheibe, ohne aber ihre Arme loszulassen.
»Deiner Mutter liegt offenbar nicht viel an deinem Augenlicht«, kommentierte der Teufel. Mit einer schnellen Bewegung, die Sandra nur aus dem Augenwinkel erhaschte, trennte er auch das zweite Lid ab. Der Schmerz raubte ihr beinahe den Verstand, sie heulte wie ein Tier. Ihre Mutter wand sich verzweifelt im Griff der Wachen.
»Was für ein Drama«, seufzte der Teufel. »Besser, du siehst dir das nicht mehr länger mit an.«
Er beugte sich über sie und drückte die Spitze des Skalpells mitten in ihr ungeschütztes Auge. Sandra verspürte einen unerträglichen Druck in ihrem Vorderkopf, dann verschwand alles Licht aus ihrem linken Auge. Eine tiefe Ruhe ergriff plötzlich Besitz von ihr. Das war es also. Sie würde sterben, hier und jetzt. Traurigkeit mischte sich mit Erleichterung – es war geschafft, sie hatte ihren Teil erfüllt. Sie hatte geschwiegen bis zum Schluss. Vielleicht würde sie tatsächlich irgendwo in einem nächsten Leben auf ihre Mutter treffen. Vielleicht könnten sie dem Rat mit dem Tod ein Schnippchen schlagen. Ihr verbliebenes Auge suchte nach ihrer Mutter.
»Nein!«, schrie sie aus Leibeskräften, als sie sah, wie sich Rebecca flehend an die Frau neben ihr wandte, ihre Lippen bewegten sich schnell, sie redete hektisch auf die Fremde ein. »Nein! Mum, du darfst nicht reden, du darfst uns nicht verraten…«
Doch Rebecca konnte sie nicht hören. Erschöpft, mit tränenüberströmtem Gesicht und auf den Arm eines Wächters gestützt, erzählte sie der Soldatin eine Geschichte. Die uniformierte Frau lächelte, nickte immer wieder und strich Rebecca beruhigend über den Arm.
In diesem Moment wusste Sandra, dass ihr eigenes Leid völlig umsonst gewesen war. Ihre Mutter hatte sie verraten, hatte Liam verraten und alles, wofür sie in den letzten Jahren gekämpft hatten. Und nun würden sie alle sterben.
2
Kaja rannte durch den langen, engen Stollen. Wenn sie sich nicht beeilte, würde sie zu spät zum Treffpunkt kommen. Sie war müde und bekam nur schwer Luft. Ihre Lunge kämpfte wie der Rest ihres Körpers immer noch mit der Anpassung an das Leben hier oben. Trotzdem versuchte sie, schneller zu laufen. Morgen würden ihre Muskeln von der Anstrengung schmerzen, aber hier und jetzt erfüllten sie zuverlässig ihren Dienst. Selbst nach sechs Monaten in Freiheit war sie fasziniert, wie schnell ihr Körper gelernt hatte, genau das zu tun, wofür er gemacht war. Das Muskelgedächtnis funktionierte, ohne auch nur eine Erinnerung an Bewegung, auf die es hätte zugreifen können. Der Preis aber waren schlimme Muskelkater und unzählige blaue Flecken vom ständigen Stolpern und Hinfallen. Doch sie lebte, sie konnte tatsächlich essen und trinken, hören, riechen und sehen, sie konnte schlafen und träumen, in einer realen Welt. Der neue Rhythmus von Tag und Nacht war vermutlich die größte Umstellung gewesen. Ihr analoger Körper brauchte deutlich mehr Ruhephasen als der Avatar im Holovit der Hope of Tomorrow. Acht bis zehn Stunden musste sie täglich schlafen, um etwa die gleiche Zeit wach verbringen zu können. Im Holovit hatte eine Stunde Charching für etwa vierzig Stunden Aktivitätsphase ausgereicht. Die ersten realen Tage hatte Kaja beinahe panisch auf diese biologischen Blackouts ihres Körpers reagiert. Schweißgebadet war sie mitten in der Nacht aufgewacht. Träume, die sie nicht kontrollieren konnte, hatten sie immer wieder zurück in die Arche gebracht. Meist waren es Erinnerungen aus ihrer Kindheit, an ihre Eltern, Agnes und Björn Andersson, und an ihre Freundin Lora, die ihr Unterbewusstsein nach oben gespült hatte. Oft aber brachte der Schlaf auch Bilder einer vermeintlichen Gegenwart: Lora, die im Parentes Paradisum auf Rache sann, ihre Mutter, die vor Kummer und Enttäuschung verrückt geworden war, wie Marie Bonnet in einem früheren Leben. Es gab keine ELSA mehr in ihrem Kopf, die solche Visionen hätte verhindern können, keine Shots, die ihre Angst eindämmten. Dafür aber gab es Liam, dessen warme Arme um ihren Körper eine völlig andere Wirkung hatten.
Liam. Ihr schlechtes Gewissen hätte sie um ein Haar umkehren lassen. Wenn Liam wüsste, wohin sie unterwegs war und wen sie hier mitten in der Nacht treffen würde, dann wären seine Umarmungen erst mal Vergangenheit. Hoffentlich würde er nicht aufwachen und ihre Abwesenheit bemerken. Sollte sie vielleicht doch lieber umkehren? Aber es stand zu viel auf dem Spiel. Die Gefahr, in der sie sich befanden, in die sie sich erneut begeben würden, war zu groß. Dafür Liams Zorn auf sich zu ziehen war ein Risiko, das sie bewusst einging. Für einen Moment war sie dermaßen in Gedanken versunken gewesen, dass sie nicht mehr auf die vielen verzweigten Biegungen und Gänge geachtet hatte. Erschrocken hielt sie an und sah sich um. In der Dunkelheit war es noch schwieriger als sonst, sich in dem Tunnelsystem der Outlaws zurechtzufinden. Wie konnten sich diese Menschen ohne eine ELSA hier unten orientieren?
Kaja bezweifelte, dass es ihr in diesem Leben noch gelingen würde, sich den Irrgarten aus Stollen und Gängen einzuprägen. In regelmäßigen Abständen verirrte sie sich und musste dann peinlich berührt darauf warten, dass irgendjemand sie fand und ihr den Weg zu einem der Meetingpoints zeigte. Die meisten Outlaws waren den Neuen, wie man die Archianer selbst ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft immer noch nannte, freundlich und hilfsbereit gesinnt. Aber es gab auch Menschen, die weniger erfreut über ihre Ankunft und die Konsequenzen daraus gewesen waren. Die Ereignisse der jüngsten Zeit hatten die Fronten zusätzlich verhärtet. Nicht jeder in diesem Stollen wollte eine verloren gegangene Archianerin wohlbehalten nach Hause bringen. Und selbst der besondere Schutz, unter dem Kaja und ihre Freunde standen, würde ihr dann nicht mehr helfen.
Sie konnte ihr Herz rasen hören, während sie sich ratlos um die eigene Achse drehte. Links, rechts, wieder links? Oder war sie an der Abbiegung, die zum Ostteil der Anlage führte, schon vorbeigelaufen? Sollte sie nochmals ein paar Minuten in die Richtung laufen, aus der sie gerade gekommen war? Dann würde sie aber in jedem Fall zu spät kommen. Es konnte nicht mehr weit sein. Unsicher machte sie ein paar Schritte in den nächsten dunklen Tunnel hinein. Winzige Dioden leuchteten auf dem Boden und verhinderten gerade so, dass man gegen eine Wand rannte, mehr aber auch nicht. Eine kleine Taschenlampe hatte Kaja für den Notfall eingesteckt, doch bis jetzt hatte sie es nicht gewagt, sie zu benutzen. Sie würde dann zwar besser sehen, aber auch gesehen werden, und mit dieser Kostbarkeit durfte sie sich auf keinen Fall erwischen lassen. Es war streng verboten, nachts in den Stollen unterwegs zu sein. Ebenso verboten war es, sich eigenmächtig aus dem Techniklager zu bedienen. Zum wiederholten Male fragte sie sich, warum sie sich auf dieses Treffen eingelassen hatte.
»Kaja«, zischte plötzlich eine leise Stimme aus der Dunkelheit. »Kaja, ich bin hier.«
Eine warme Hand legte sich fest um ihren Oberarm und zog sie aus dem Tunnel, den sie eben betreten hatte. »Kannst du mir bitte sagen, wo um Himmels willen du hinwillst?«
Kaja spürte, wie sie rot anlief. Ein Vorteil der ewigen Dunkelheit: Ihr Körper konnte sie nicht so einfach verraten. »Ich …« Sie hatte keine Antwort auf seine Frage, es lag klar auf der Hand, dass sie wieder einmal kurz davor gewesen war, sich heillos zu verlaufen. Im Zwielicht konnte sie Nathaniels weiße Zähne sehen, der Schalk blitzte in seinen Augen. Trotz der hundert Regeln, die sie gerade brachen, schien er sich köstlich zu amüsieren.
»Wir dürften gar nicht hier sein«, fuhr sie ihn erbost an.
Er grinste unverändert weiter. »Und doch sind wir es.«
»Weil du mich dazu überredet hast.«
»Überredet, nicht gezwungen. Du hättest nicht kommen müssen, Kaja, aber du bist hier.«
Den Triumph in seinem Gesicht konnte sie sogar in der Dunkelheit des Stollens erkennen. Für einen Moment wünschte sie, sie wäre nicht zu diesem Treffen erschienen, dann aber fiel ihr ein, warum sie sich hatte überreden lassen.
»Du hast gesagt, unser Leben hängt davon ab, dass ich dich heute hier treffe.«
»Und das hat dir vor mir noch kein Typ erzählt?« Sein Schmunzeln war nicht zu überhören.
»Nathaniel!«
»So nennt mich nur meine Mutter. Und nur, wenn ich was ausgefressen habe.«
»Na, dann hast du diesen Namen sicher öfter gehört, als die Sonne aufgegangen ist. Was willst du, Nate? Was ist so wichtig, dass du uns beide in Gefahr bringst?«
Plötzlich war seine Stimme ernst. »Ich würde dich nie in Gefahr bringen, Kaja, das schwöre ich. Ich würde mein Leben dafür geben, dich zu schützen … im Gegensatz zu anderen.«
»Nate, ich bitte dich, fang nicht wieder damit an. Liam würde mich niemals absichtlich in Gefahr bringen, das weißt du so gut wie ich.«
»Nein, das weiß ich nicht. Ganz im Gegenteil, Kaja. Was ich weiß, ist, dass euer Vorhaben reiner Selbstmord ist. Es wird niemals gut gehen. Ihr werdet alle sterben, und das bedeutet, früher oder später auch wir.«
»Nate …«
»Nein, Kaja, du verstehst nicht. Ihr habt die Armee der Citizens nicht gesehen, ihr wisst nicht, wozu sie in der Lage sind. Ich schon …« Für einen Moment war aller Schalk, aller Leichtsinn aus seiner Stimme verschwunden. Sein Gesicht wurde hart, der Griff an Kajas Arm fester.
»Nate, du tust mir weh.« Sofort ließ er sie los und trat einen Schritt zurück.
»Wir sind hierhergekommen, um ein neues Leben zu beginnen, Kaja, ebenso wie ihr. Was ihr jetzt plant, zerstört jede Hoffnung auf eine Zukunft, für uns alle. Selbst wenn ihr davonkommt und es zurückschafft, was dann? Glaubt ihr tatsächlich, ihr habt eine Chance gegen die Townships und alle Archen zusammen?«
»Wir, wir zusammen haben eine Chance«, erwiderte sie mit fester Stimme.
Nate lachte nur höhnisch als Antwort. »Wir? Das ist doch nicht dein Ernst, Kaja, weißt du, was du redest? Das Wir von dem du sprichst, sind ein paar Tausend Menschen, verstreut über den Kontinent, die seit Jahren unter der Erde vegetieren. Sieh uns doch an. Wir haben kaum genug zu essen, keine Waffen, keine Technik. Wie sollen wir es mit den Soldaten eurer Präsidentin und den Truppen der Townships aufnehmen? Du weißt so gut wie ich, dass sie uns einfach abschlachten werden.«
»Nicht, wenn wir vorher die Archianer befreien.«
»Ha, die Archianer, dass ich nicht lache. Du bist eine Archianerin, Kaja, wie lange hast du gebraucht, um länger als dreißig Minuten auf den Beinen zu stehen, zu laufen, zu essen und zu trinken? Du bist heute noch blinder als ein Maulwurf, allein würdest du dich hier unten niemals zurechtfinden. Glaubst du wirklich, wir öffnen einfach die Tore, und die Zombies steigen aus ihren Särgen und eilen uns mit Waffen in den Händen zu Hilfe? Ich hätte dich für intelligenter gehalten.«
Kaja kaute auf ihrer Unterlippe. Sie wusste, dass Nate nicht unrecht hatte, sie wusste aber ebenfalls, dass sie wenige Möglichkeiten hatten, wenn sie am Leben bleiben wollten.
»Du hast die Soldaten der Townships gesehen, du hast geliebte Menschen an sie verloren, du weißt, wozu sie in der Lage sind und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und keine Alternative. Selbst deine Mutter hat sich für den Einbruch ausgesprochen«, antwortete sie zögernd.
»Meine Mutter würde sich für alles aussprechen, was Liam Turner vorhat«, antwortete Nate bitter. »Sie würde ihm sehenden Auges in den sicheren Tod folgen. Genau wie du.«
»Nate …« Kaja streckte den Arm nach ihm aus und berührte vorsichtig seine Schulter.
Er zuckte unter ihrer Hand zusammen, als hätte sie ihm einen Stromschlag versetzt.
»Ist es nicht so?«
Er lachte, doch diesmal fehlte jede Spur der üblichen Leichtigkeit, und Kajas Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Sie schwieg und senkte den Kopf. Ihr Verhältnis zu Nathaniel hätte nicht komplizierter sein können. Sie wollte ihm mindestens ebenso häufig den Hals umdrehen, wie er sie zum Lachen brachte. Sie würde ihn niemals in Gefahr bringen, aber würde sie ihr Leben für ihn geben? Sie hoffte, diese Frage niemals beantworten zu müssen. Liam aber … ihm würde sie in den Tod folgen, wieder und wieder.
»Kaja, ich habe kapiert, dass du ihn liebst. Wenn ich es auch nicht verstehe, denn der Typ ist ein arroganter Besserwisser, der dich nicht verdient hat. Trotzdem, sein Plan ist Wahnsinn, und er wird damit scheitern. Und du solltest für einen Moment deine Gefühle zur Seite schieben und an den Rest von uns denken. Wenn Kayne Cole den Weg nach Beartooth findet, sind wir verloren.«
Kaja verdrängte die Bilder, die Nates Worte in ihrem Kopf hervorriefen: Frauen, Kinder, alte Menschen, ein blutiges Massaker unter der Erde. »Wir werden nicht scheitern«, erwiderte sie mit fester Stimme. »Wir werden es schaffen, Nate, vertrau mir, bitte.« Ihre Worte hatten einen wunden Punkt getroffen. Sie konnte spüren, wie er sie in der Dunkelheit beobachtete, und dass er mit seinen eigenen Gefühlen rang.
»Kaja, du weißt nicht, was du von mir verlangst.«
»Doch, das weiß ich. Nate, du sagst, du würdest mich nie in Gefahr bringen, du würdest dein Leben für mich geben. Dann beweis es mir.« Sie schluckte. Die Ungerechtigkeit dieses Schachzugs war ihr mehr als bewusst, aber sie hatte keine Wahl, sie brauchten Nate auf ihrer Seite. »Wenn du wirklich mein Freund bist, wenn du meinst, was du sagst, dann vertrau mir. Nicht Liam, sondern mir. Dann sei an meiner Seite und hilf mir, uns alle zu retten. Das ist es, was ich von dir verlange. Beweis mir, dass das alles nicht nur leere Worte sind. Vergiss Liam, tu es für mich!«
Mit diesen Worten machte sie auf dem Absatz kehrt und rannte durch den leeren Tunnel davon. Weg von Nathaniel und der ausweglosen Situation, in die sie ihn gebracht hatte. Übelkeit stieg in ihr hoch, und sie konnte die Tränen der Scham nur mit Mühe unterdrücken. Sie hatte getan, was sie tun musste. Nun war es an Liam, dafür zu sorgen, dass ihr aller Einsatz nicht umsonst war. Er würde den Einbruch in die Townships verantworten, auf seinen Schultern lag die Verantwortung für alles, was jetzt geschehen würde.
Zweiter Teil
Die Ankunft –
Sechs Monate zuvor
1
Kaja hatte Durst. Im Lauf der letzten Stunden war ihr Mund erst trocken, dann pelzig geworden. Ihre Zunge fühlte sich riesig und unangenehm rau an, ihr Hals kratzte. Müde lehnte sie den Kopf gegen das Wrack des abgestürzten Flugzeugs. Der Schatten, den die Überreste des Flügels spendeten, bot wenig Schutz gegen die Hitze. Sie schloss die Augen und fuhr mit dem Handrücken über den Schweißfilm, der ihre Stirn bedeckte. Wasser, das ihr Körper dringend benötigte. Im Rumpf hörte sie Jasper leise wimmern. Seine Schmerzen hatten sie die letzte Nacht hindurch bis in den Morgen begleitet. Mittlerweile war er ruhiger geworden – kein gutes Zeichen. Sie hatten keine Medikamente mehr, um seine Wunden zu versorgen oder ihn zu betäuben. Immer wieder verlor er das Bewusstsein und konnte nur mit Mühe geweckt werden. Wenn ihnen nicht bald etwas einfiel, würde er diesen Tag nicht überleben. Aber was sollten sie tun, um ihm zu helfen? Ratlos blickte Kaja auf den Trümmerhaufen, der ihre Absturzstelle markierte. Überall lagen Überreste ihrer Ausrüstung im Sand verteilt. Kaum etwas davon war noch zu gebrauchen. Bis zum letzten Sonnenstrahl hatten sie am Vortag nach brauchbaren Dingen gesucht, ihre Arbeit mit dem ersten Tageslicht wieder aufgenommen. Dennoch war ihre Ausbeute kaum der Rede wert: ein paar Flaschen Sauerstoff, die sie nicht benötigten, ein medizinisches Notfall-Kit, das sie beinahe komplett aufgebraucht hatten, und ein paar nutzlose Solardecken. Die Nutri-Reserven waren nicht mehr brauchbar, ebenso wenig ihre kostbaren Wasservorräte. Versickert im Sand der roten Erde. Sie hatten noch einen einzigen Ersatz-Suit, in dessen Membran sich ihre letzte Nahrung befand. Alles Übrige war restlos zerstört.
Kaja konnte Allison leise reden hören, sie versuchte, Jasper wach zu halten. In ein paar Minuten würde sie die Technikerin ablösen müssen. Dann war es für weitere zwei Stunden ihre Aufgabe, ihn vor dem Einschlafen zu bewahren. Plötzlich tauchten am Horizont schemenhaft zwei Figuren auf. Liam und Samuel. Erleichtert atmete Kaja auf. Es war ihnen nichts zugestoßen, und vielleicht hatten sie etwas gefunden. Wasser oder sogar Nahrung? Mühsam stemmte sie sich auf die Beine, die unter ihrem Gewicht sofort wieder zu zittern anfingen. Mit beiden Händen an das Flugzeug gestützt, stapfte sie in Richtung Nase und des Einstiegs, jeder Schritt erforderte höchste Konzentration. Ohne die elektrischen Impulse, die der Biose-Suit an ihre Muskeln sendete, war das Gehen eine echte Herausforderung. Sam hatte ihnen geraten, diese Unterstützung zu deaktivieren, um die Energie des Anzugs so lange wie möglich zu erhalten. Kaja war zum ersten Mal in ihrem Leben auf die analogen Fähigkeiten ihres Körpers angewiesen und stellte sich dabei um einiges schlechter an als der Rest ihrer Crew. Sam, Allison und Jasper waren in der Arche, aufgrund ihrer Berufe regelmäßig in der Bunkeranlage unterwegs gewesen und beherrschten ihre Körper auch außerhalb des Holovits ausreichend gut. Liam hatte seit Monaten für den Exit trainiert. Kaja gab sich alle Mühe, den Vorsprung der anderen aufzuholen, aber Durst und Hunger machten die Sache nicht leichter. Ihr Körper wollte ihr nicht gehorchen.
»Kaja?« Allison war an die Türöffnung des Flugzeugs getreten, sie sah müde aus und verzweifelt.
Kaja wusste, wie eng ihre Verbindung zu Jasper war, wie groß ihre Angst, ihn zu verlieren.
»Irgendeine Spur von Liam und Sam?«
Kaja nickte und hob den Arm in Richtung der beiden langsam näherkommenden Gestalten. »Da vorne, siehst du?«
Allison nickte stumm, ihre Miene verhärtete sich. Kaja konnte sich denken, warum. Mittlerweile war auch auf die Distanz zu erkennen, dass die beiden mit leeren Händen zurückkehrten. Voller Tatendrang hatten sie bei Sonnenaufgang aus einem abgerissenen Trägerteil und zusammengeknoteten Sitzgurten einen behelfsmäßigen Schlitten gebaut, in der Hoffnung, irgendwo irgendetwas zu finden, das sie damit transportieren konnten. Aber der Schlitten war leer. Aus der Ferne blitzte das silberne Metall beinahe höhnisch in der Sonne. Die Frauen wechselten besorgte Blicke, sie wussten, welche Entscheidung nun bevorstand. Einer von ihnen würde den letzten unbenutzten Suit bekommen und sich in die entgegengesetzte Richtung aufmachen, um erneut nach Hilfe zu suchen. Kaja war klar, dass sie als Einzige nicht für den gefährlichen Job infrage kam. Samuel oder Liam, einen der beiden würde das Los treffen. Trotz stechender Gewissensbisse hoffte Kaja, dass Liam bei ihr bleiben würde.
»Wie geht es Jasper?«, fragte sie Allison, doch die schüttelte traurig den Kopf.
»Es wird schlimmer. Die Wunde an seinem Bein hat sich entzündet, sein Fieber steigt. Ich konnte ihn nicht mehr länger wach halten. Er muss zu Kräften kommen, sonst hat er keine Chance. Und vielleicht spürt er im Schlaf die Schmerzen nicht so schlimm.«
Und was, wenn wir ihn nicht mehr wecken können, wollte Kaja fragen, schwieg aber. Allison hatte darauf genauso wenig eine Antwort wie sie selbst. Sie nickte nur stumm und setzte sich zurück in den heißen Sand. Schweigend warteten sie zusammen auf die beiden Rückkehrer, jede in ihre eigenen Gedanken versunken, beide mit der gleichen Frage im Kopf: Würden sie dieses Abenteuer überleben?
»Nichts«, schnaubte Liam, als die beiden Männer ihre provisorische Lagerstätte endlich wieder erreicht hatten. »Da draußen gibt es weit und breit nichts.« Sein ganzer Körper war mit rotem Staub überzogen. Die Kontrolllampen an seinem Suit blinkten warnend, wie bei Samuel. Fluchend zog der sich die Pilotenbrille vom Kopf und versuchte vergeblich, das Visier zu säubern. »Dieser verdammte Sand, diese verfluchte Wüste, das da draußen ist die Hölle. Wir werden da niemanden finden, weil dort nichts und niemand überleben kann.«
»Lasst mich mal sehen.« Allison war aus dem Wrack geklettert und überprüfte die Verkabelung an Liams Anzug. Mit geschickten Fingern steckte sie die Verbindung neu und murmelte dabei leise vor sich hin. Nach zwei, drei Versuchen schüttelte sie wütend den Kopf, schob Liam von sich und machte sich an Sams Kleidung zu schaffen. Es dauerte nicht lange, und sie seufzte verzweifelt auf.
»Nichts mehr zu machen, es tut mir leid.« Sie zuckte mit den Schultern. »Diese Dinger sind einfach nicht für hier draußen gemacht. Ebenso wenig wie wir selbst. Die halten dem Sand nicht stand. Ich kann das nicht reparieren, und ohne nötiges Werkzeug schon gar nicht.«
Für einen Moment herrschte betretenes Schweigen.
Liam fasste sich als Erster ein Herz: »Die Suits waren ohnehin leer und nicht nützlicher als stinknormale Kleidung. So oder so, wir müssen hier weg und irgendwo Wasser finden.«
Allison nickte gefasst. »Habt ihr entschieden, wer den letzten Anzug bekommt? Wenn einer von euch noch mal aufbrechen will, sollte er vorher eine Pause machen. Wenn ihr zu erschöpft seid, dann kann auch ich?«
Kaja hielt den Atem an. Wer von ihnen würde erneut ins Ungewisse ziehen?
»Wir werden alle gehen«, antwortete Liam stattdessen, und Allison sog scharf die Luft durch die Nase.
»Was meinst du damit?«, fragte sie.
»Ich meine, dass wir alle gehen – etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Sam und ich waren fast sieben Stunden unterwegs und haben nichts gefunden. Jeden Schritt, den wir in eine Richtung gehen, müssen wir auch wieder zurück. So kommen wir nicht weit genug, um es aus dieser Wüste zu schaffen. Wir würden uns völlig sinnlos verausgaben.«
»Liam hat recht, Allison«, unterstützte Sam Liams Argumentation. »Wir haben keine Zeit und keine Kraft mehr. Wir müssen hier weg, und zwar alle zusammen.«
Kaja versuchte, das Zittern in ihren Händen und Beinen zu ignorieren. Panik stieg in ihr auf. Sie konnte kaum das Flugzeug umrunden, ohne eine Pause einzulegen. Wie sollte sie den anderen durch diese Sandwüste folgen?
»Und Jasper? Wollt ihr ihn einfach hier zurücklassen?«, fragte Allison wütend. »Das ist sein Todesurteil. Und Kaja? Sie kann nicht allein laufen. Willst du sie auch hierlassen, Liam?«
Liam schüttelte den Kopf. »Nein, Allison, wir werden niemanden zurücklassen. Wir gehen gemeinsam, alle zusammen. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie weit wir von dem Reservat entfernt sind. Die Chance, dass wir es rechtzeitig hierher zurückschaffen, wenn wir Hilfe gefunden haben, ist zu gering. Wir müssen Jasper mitnehmen.«
»Falls wir Hilfe finden, Liam. Falls … Du sagst selbst, wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben auch keine Ahnung, in welche Richtung wir laufen sollen. Diese verdammte Wüste könnte sich noch meilenweit um uns ziehen. Was, wenn wir niemanden finden, dann laufen wir in den sicheren Tod.«
»Der wartet auch hier«, fiel ihr Sam ins Wort. »Wenn wir noch länger hierbleiben, finden uns die Drohnen der Arche, bevor uns irgendjemand anderes findet. Der Sturm hat sich gelegt. Mittlerweile ist vermutlich die halbe Hope hinter uns her, und ich habe keine Ahnung, wie gut Riley uns schützen kann. Im schlimmsten Fall sitzt er mittlerweile selbst in einer Zelle.« Die Sorge um seinen Freund und Co-Piloten stand Samuel ins Gesicht geschrieben. Allisons Züge wurden weicher, aber ihre Skepsis blieb bestehen.
»Können wir nicht wenigstens versuchen, uns zu orientieren? Vielleicht kann ich aus den Resten der Ausrüstung etwas bauen?«
»Allison, versteh doch, wir haben keine Zeit«, flehte Liam. »Unsere Anzüge sind leer und defekt, ihr beide habt kaum noch Reserven, und für Jasper zählt jede Minute. Wir sind auf uns gestellt und haben nur diese eine Chance, Hilfe zu finden, bevor uns der Rat findet. Kaja …« Sein Blick wanderte zu ihr. »… glaubst du, du kannst laufen? Wir werden den Schlitten für Jasper brauchen. Mit seinem Gewicht müssen wir zu zweit ziehen, um ihn zu bewegen. Einer von uns kann dich stützen, so gut es geht, aber den Großteil wirst du laufen müssen.«
Kaja hatte keinen blassen Schimmer, ob sie es wirklich schaffen würde, bezweifelte stark, dass sie mit ihren schwachen Muskeln weit kommen würde, trotzdem nickte sie tapfer. »Ich werde es irgendwie schaffen.«
Liam nickte lächelnd. »Also gut, dann lasst es uns versuchen. Allison, schnapp dir den letzten Suit, du wirst Kaja helfen müssen, dafür brauchst du Energie aus dem Anzug. Sam und ich versuchen diesen Schlitten noch etwas gemütlicher zu machen, dann holen wir Jasper und brechen auf.« Er winkte ab, bevor Allison widersprechen konnte. »Wir haben keine Zeit mehr, lange zu diskutieren. Wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht.«
Es dauerte keine halbe Stunde, bis sie aufbruchsbereit waren. Die Sonne hatte ihren Höchststand überschritten, brannte aber immer noch gnadenlos auf sie herab. Liam und Sam waren schweißgebadet. Gemeinsam hatten sie den Schlitten zum Krankentransporter umgebaut. Ein Flugzeugsitz war nun mit den restlichen Gurten auf der Metallplatte fixiert, aus herumliegenden Stangen und einer Plane aus dem Laderaum hatten sie eine Art Baldachin gespannt, um Jasper vor der Sonne zu schützen. Hoffentlich war die Arbeit nicht umsonst gewesen, dachte Kaja, als die beiden Männer den Verletzten mit vereinten Kräften aus dem Flugzeug holten, um ihn auf die Bahre zu schnallen. Jasper hatte bei jeder Bewegung vor Schmerzen gestöhnt, war aber nicht mehr aus seinem Delirium erwacht. Selbst Allison, die ihm eindringlich erklärte, was gerade geschah, war es nicht mehr gelungen, ihn aus seinem komatösen Zustand zu holen. Liam hatte nicht übertrieben: Für Jasper zählte jede Minute.
»Seid ihr bereit?«, fragte Samuel mit ernstem Blick in die kleine Runde.
Alle nickten.
»Alles klar, dann auf zu unbekannten Abenteuern.« Er rang sich ein Grinsen ab, und gemeinsam mit Liam packte er die Gurte des Schlittens. Tiefe Sorgenfalten erschienen auf Allisons Stirn, und Kaja schluckte beim Anblick der beiden. Mit aller Kraft stemmten sie sich nach vorne in ihre Zügel. Aber das Gewicht des Schlittens zusammen mit Jasper war einfach zu schwer. Nach wenigen Schritten stolperte Samuel über einen Sandhaufen und ging in die Knie. Sofort zog Liam ihn auf die Beine, und die beiden kämpften sich weiter. Im Schneckentempo, die Zähne zusammengebissen, war deutlich zu sehen, was für ein Kampf jeder Schritt sein musste. Die beiden Frauen gingen schweigend hinterher. Kaja stützte sich fest auf Allisons Arm. Beide atmeten schwer, aber sprachen kein Wort. Alle vier wussten, dass sie keine Chance hatten, doch niemand von ihnen wollte es aussprechen. Zentimeter für Zentimeter mühten sie sich weiter. Kaja konnte sehen, wie stumme Tränen über Allisons Wangen liefen, doch es fehlten ihr die Worte, die Frau an ihrer Seite zu trösten. Zehn Schritte, zwanzig Schritte, dreißig Schritte, dann gaben Kajas Beine nach, und sie stürzte in den heißen Sand. Allison half ihr aufzustehen, aber nach einigen Metern stolperte Kaja erneut.
»Das ist Irrsinn«, rief Allison verzweifelt. »Seht ihr nicht, dass wir in den sicheren Tod marschieren?«
Sam und Liam stoppten den Schlitten und ließen die Gurte sinken.
»Was sollen wir deiner Meinung nach machen?«, fragte Liam entnervt und ratlos. »Sollen wir den Weg wieder zurück? Oder willst du dich einfach hier auf den Boden legen und warten, bis es vorbei ist?«
»Ich …«, setzte Allison zu einer Antwort an. »Ich …«
Doch sie konnte den Satz nicht beenden. Ein weißer Lichtkegel erschien plötzlich mitten auf ihrem Gesicht und blendete sie. Von Allison sprang er zu Liam, Samuel und Kaja, verweilte einen Moment auf dem schlafenden Jasper und verschwand. Die vier wechselten verwirrte Blicke und drehten sich im Kreis, doch sie fanden nichts, was auf den Ursprung des Lichts hätte schließen lassen.
»Was war das?«, fragte Kaja.
»Sah aus wie ein Schweinwerfer«, antwortete Samuel, und im selben Moment hüpfte der grelle Schein ein weiteres Mal in schneller Folge über die fünf Archianer. Ratlos starrten die vier in die Ferne, sich im Kreis drehend, auf der Suche nach der Quelle.
»Dort! Da hinten, am Horizont, seht doch«, rief Liam plötzlich und zeigte aufgeregt in ihre Marschrichtung.
Kaja kniff die Augen zusammen und blinzelte gegen die Sonne. Tatsächlich, am Horizont konnte sie mehrere dunkle Punkte ausmachen, die sich in hohem Tempo näherten. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. War das ihre Rettung oder eine neue Bedrohung? Ihr Blick suchte Liam. In seinem Gesicht war dieselbe Mischung aus Hoffnung und Sorge zu sehen.
»Was ist das?« Allison war näher an den Schlitten getreten und hatte wie zum Schutz ihre Hand auf Jaspers Schulter gelegt.
»Keine Ahnung«, antwortete Sam, »aber sie sind verdammt schnell.«
Die Punkte waren größer geworden. Kaja konnte sechs Stück zählen, die über den Sand auf sie zuschossen. Je näher sie kamen, desto deutlicher konnte man sie identifizieren.
»Sind das Motorräder?«, fragte Samuel. Mit der Hand schirmte er die Sonne ab, um besser sehen zu können. »Aber wie können sie auf dem Sand so schnell vorankommen?«
»Kufen«, vermutete Liam. Auch er hatte die Augen gegen das Sonnenlicht zusammengekniffen. »Das sind Schlitten, die Dinger haben Kufen.«
Nun konnte Kaja sie ebenfalls erkennen. Immer wieder blitzte Metall aus dem Sand, wenn einer der Jets über eine Anhöhe schoss. Die Fahrer hatten Übung, sie beherrschten ihre Gefährte selbst auf dem schwierigen Untergrund perfekt. Der Widerstand in den Archen hatte recht behalten: Hier oben gab es Leben. Aber war es ihnen freundlich oder feindlich gesinnt?
Die Chronik des Untergangs LXIII/12
Etwa zwei Monate, nachdem der UN-Klimabericht von 2050 durch mehrere unabhängige Fachausschüsse bestätigt worden war, bezogen die ersten Regierungen Stellung. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Indien und Russland gehörten zu den hartnäckigsten Zweiflern, was Timing und Ausmaß der Katastrophe anging. Selbst Wissenschaftlern aus den eigenen Reihen gelang es zunächst nicht, ihre Führung von den notwendigen Konsequenzen zu überzeugen.
In Europa hatte die Verkündung der bevorstehenden Umweltkatastrophe völlig andere Auswirkungen: Präsidenten, Minister, aber auch Religionsführer und CEOs von großen Unternehmen legten ihr Amt nieder. Sie fühlten sich der Aufgabe, die Menschheit zu retten, nicht gewachsen. Konfrontiert mit dem bevorstehenden Ende, war ein Großteil schlichtweg geflüchtet, um die verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen. Berichterstattungen von damals dokumentierten überdurchschnittlich viele Vermisstenanzeigen, aufsehenerregendes Verhalten von öffentlichen Amts- und Würdenträgern, einen enormen Konsumanstieg sowie eine Vielzahl an Wiederaufnahmeanträgen in den Großkirchen.
Wie vorhergesagt kam es im Spätsommer 2055 zu einer nie dagewesenen Hitzeperiode in Mitteleuropa, Südafrika und Südamerika. Trotz aller Bemühungen war es in den Jahren seit 2030 nicht gelungen, die Klimaerwärmung zu stoppen. Der ungebremste Fortschritt von Digitalisierung und Alltagstechnologie hatte die Energiebilanz stetig nach oben getrieben. Jeder Haushalt, der sich zum Smart-Home rüstete, wurde zum eigenen kleinen Kraftwerk. Die steigenden Mieten in den Metropolen führten zu einer breiten Landflucht der Mittel- und Unterschichten und hatten ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen zur Folge. Die Massen an Pendlern verbrachten mehr und mehr Zeit in Autos, Zügen und in Flugzeugen. Mitte der Dreißigerjahre hatte der globale CO2-Ausstoß ein absolutes Hoch erreicht. In Vorbereitung ihres Berichts schlugen Klimaforscher weltweit Alarm, korrigierten die Zahlen der Erderwärmung deutlich nach oben, wurden aber kaum beachtet. 2051 hatte sich die Temperatur der Erdatmosphäre bereits um acht Grad erhöht; ein Vielfaches mehr als erwartet. Während in den Äquator-Regionen endlose Dürre zu verheerender Wasserknappheit führte, bedeuteten die steigenden Meeresspiegel für viele Insel- und Küstenregionen das Ende aller Vegetation. Überall auf der Erde setzten sich Ströme von Klimaflüchtlingen in Bewegung, in der Hoffnung, in den letzten bewohnbaren Ländern eine neue Heimat zu finden.
Die Frage nach dem Umgang mit den Scharen von Hilfesuchenden konnte in den sogenannten Safe States niemand beantworten.
2
Angespannt blickten die vier Archianer auf die Wolke aus Sand und Staub, die sich ihnen näherte. Schützend hoben alle die Arme vors Gesicht, Kaja schloss die Augen. Das Dröhnen der Motoren wurde lauter und lauter, bis es plötzlich verstummte. Die Fahrzeuge waren zum Stehen gekommen. Kaja blinzelte, um in der trüben Luft besser sehen zu können. Die sechs Jets standen dicht vor ihnen. Bei den Fahrern handelte es sich um Menschen, das war trotz der schweren Vermummung zu erkennen. Schmutzige Anzüge, die Kaja entfernt an ihre eigenen Biose-Suits erinnerten, blitzten unter dunklen, bodenlangen Capes hervor. Alle sechs hatten die Kapuzen tief in die Gesichter gezogen. Ihre Hände steckten in Handschuhen, an den Füßen trugen sie schwere Stiefel. Es war nicht zu erkennen, ob sich Frauen oder Männer unter der Kleidung verbargen. Kaja konnte ihr eigenes Herz in ihrer Brust schlagen hören. Niemand bewegte sich, bis sich plötzlich der vorderste Jet-Fahrer von seinem Gefährt schwang und die letzten Meter zwischen ihnen und seiner Crew zu Fuß zurücklegte. Liam, der sich an ihrer Spitze positioniert hatte, überragte er um gut eine Kopflänge. Der Hüne schob seinen Umhang zurück, ein verspiegeltes Visier verdeckte die Augen. Unter seiner Nase war ein kleines Ventil befestigt, von dem aus ein dünner schwarzer Schlauch über seinen Hals bis in die Kleidung führte. Sauerstoff, dachte Kaja, die Luft hier oben war vielleicht doch nicht so sauber, wie sie gehofft hatten. Ein dichter grauer Bart verdeckte den Rest des Gesichts. Das einzige Anzeichen, das auf Geschlecht und Alter schließen ließ. Plötzlich begannen die schmalen, stark ausgetrockneten Lippen unter den Haaren zu sprechen:
»Was ist der Preis für die Freiheit?«
Tief und klar schallten seine Worte in die Weite der Wüste hinaus. Angestrengt rätselte Kaja, was er von ihnen wollte. Was ist der Preis für die Freiheit? Was meinte er damit? Sollte das eine tatsächliche Frage sein? Sie klang wie eine Art Orakelspruch. Ratlos blickte sie zu den anderen. Allison hatte die Stirn in Falten gelegt, Samuels Mund stand offen vor Staunen. Keiner wusste, wie sie reagieren sollten oder was der Mann von ihnen erwartete.
»Was ist der Preis für die Freiheit?«, wiederholte der Fremde seine Frage mit genau derselben Betonung.
»Ich weiß es nicht«, gab Liam zu.
Kaja konnte an seiner Stimme hören, wie nervös er war.
»Wir sind noch nicht lange frei. Ich befürchte, wir kennen den Preis noch nicht. Aber egal, wie hoch er ist, wir sind bereit, ihn zu bezahlen.«
Ein Raunen ging durch die fünf Jet-Fahrer hinter ihrem Anführer, kaum dass Liam seinen Satz beendet hatte. Dem aufgeregten Flüstern war zu entnehmen, dass seine Antwort, wenn nicht falsch, zumindest nicht richtig gewesen war. Der Bärtige lauschte dem Gemurmel in seinem Rücken für einen Moment, dann hob er die rechte Hand. Sofort verstummten seine Begleiter. Einen Moment lang musterte er ihre armselige Formation schweigend. Kaja spürte seinen vom Visier verdeckten Blick. Länger als sie alle betrachtete er den verletzten Jasper auf ihrem notdürftigen Schlitten, blickte in die Ferne, hin zu dem, was von ihrem Flugzeug noch übrig war, dann wandte er sich wieder an Liam, den er offensichtlich als ihren Anführer akzeptiert hatte.
»Archianer«, stellte er trocken fest.
Liam nickte, schüttelte aber gleich darauf den Kopf. »Du hast recht, das waren wir in unserem alten Leben. Jetzt sind wir freie Menschen, so frei wie ihr selbst, und diese Freiheit werden wir nie wieder aufgeben.«
Der Riese sog scharf die Luft ein, seine Gefährten verfielen in eine zischende Diskussion. Kaja konnte zwar nicht verstehen, was gesprochen wurde, aber sie spürte, dass man ihnen nicht freundlich gesinnt war. Wieder brauchte es nur eine Geste des Sprechers, um für Ruhe zu sorgen. »Wie lange seid ihr schon hier draußen?«
Liam zuckte mit den Schultern. »Einen Tageslauf? Vierundzwanzig Stunden vielleicht. Schwierig zu sagen, unsere Ausrüstung ist beim Absturz zerstört worden. Wir haben die Sonne einmal auf- und einmal untergehen sehen.«
»Ihr kommt aus der Hope of Tomorrow?«
Liam nickte.
»Warum seid ihr hier?«
»Wir sind geflohen. Seit vielen Monaten planen wir diesen Exit. Wir glauben nicht mehr an die Lügen des Rats. Es gibt Widerstand in den Archen, nicht nur in der Hope. Dort unten sind Menschen, die zurück an die Oberfläche wollen. Die ein neues Leben führen wollen, ein freies Leben.«
»Hier gibt es kein freies Leben«, sprach ein weiterer Fahrer oder eine Fahrerin. Die Stimme hinter dem schwarzen Stoff war hell und feindselig. Die zugehörige Gestalt war die kleinste und zierlichste von allen.
»Hier an der Oberfläche gibt es keine Freiheit und keinen Platz für Archianer«, wiederholte sie ihre Worte mit Nachdruck.
»Elisa«, herrschte sie der Riese an. »Nicht hier und nicht jetzt.« Ohne ihr Gesicht sehen zu müssen, konnte Kaja spüren, wie die Frau mit sich rang, kein zweites Mal zu widersprechen. Letztlich reichte die Autorität des Mannes, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Widerstand in den Archen«, richtete er seine Worte wieder an Liam. »Was bedeutet das konkret?«
»Schon lange hat unsere Präsidentin nicht mehr die komplette Arche in ihrer Gewalt«, begann Liam zu erklären. »Darksurfer, wie wir uns in den Archen nennen, haben vor Jahren angefangen, das Holovit zu untergraben und sich eigene, sichere Orte im Netz geschaffen. Es ist uns gelungen, einen Großteil der Überwachung zu umgehen und verborgen vor den Augen des Rats Informationen über die Oberfläche zu sammeln.«
»Informationen? Was für Informationen?«
»Bilder, Daten, Veränderungen in Gesteinsformationen«, mischte sich Samuel ein. »Wann immer es ging, haben wir die Drohnenflüge dazu genutzt, unsere eigenen Augen nach oben zu richten.«
»Und was habt ihr entdeckt?« Kaja konnte sich täuschen, aber der Riese wirkte plötzlich nicht mehr ganz so ruhig und souverän.





























