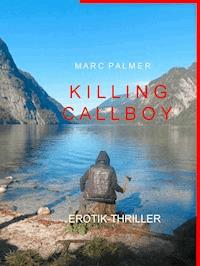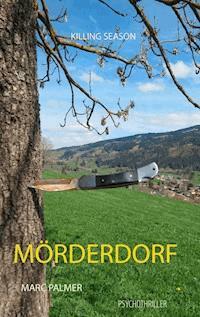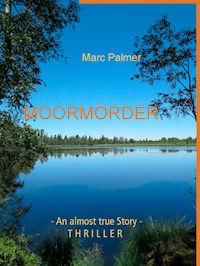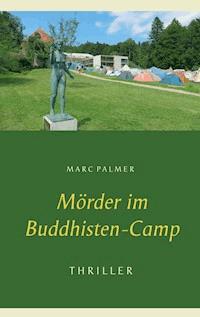Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Teufel im Kopf" ist die Geschichte eines Mannes, der auf der Suche nach der Story seines Lebens ist. Er will einen Bestseller schreiben und besucht dazu einen Schreib-Zirkel. Zur selben Zeit ereignen sich in seinem Umfeld mehrere mysteriöse Morde. Eine Teufels-Gestalt, die ihn in seinen Fantasien und Träumen heimsucht, und die in seiner (geklauten) Geschichte eine entscheidende Rolle spielt, scheint mit den Morden was zutun zu haben. Immer mehr kann er die Realität und Fiktion nicht mehr auseinanderhalten. Dann ist auch die Polizei davon überzeugt, dass nur er hinter den teuflischen Morden stecken kann. Aber nirgendwo lassen sich konkrete Beweise finden. Gänsehaut ist garantiert bei diesem unheimlichen Psychothriller!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die zu Unrecht Eingesperrten
Zum Autor:
„Marc Palmer“, ist das Pseudonym eines Allgäuer Autors. Er hat in den letzten Jahren einige Sachbücher und drei Romane veröffentlicht. „Teufel im Kopf“ ist sein dritter Thriller. Für 2015 sind zwei weitere Neuerscheinungen geplant. Die Nächste: „Der Fall KALINKA“, nach einer wahren Begebenheit, ab voraussichtlich April 2014.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Vorwort:
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
Einige Schauplätze wurden aus dramaturgischen Gründen dazu erfunden oder geändert. Das gleiche gilt für einige Firmennamen, Personen in diversen Firmen und Kliniken.
PROLOG
Nikolaustag, 6. Dezember 2014.
Mein Name ist Peter Kelly und neben mir im Auto sitzt meine achtjährige Tochter. Ich wusste noch gar nicht, dass meine Sophie anhand der Sterne die Himmelsrichtung be‐ stimmen konnte. Sophie hinterließ Nasenabdrücke auf dem Beifahrerfenster, während wir auf der Fahrt von Isny Richtung Bad Hindelang zum Weihnachtsmarkt waren. Sie zählte die Sternenbilder auf und murmelte: „Süden, Osten oder Norden“, wenn ich abbog.
„Wo hast du das gelernt?“, fragte ich sie.
„Wo hab ich was gelernt?“
„Na, die Sternenbilder.“
„In Büchern.“
„In welchen Büchern?“
„Einfach Bücher.“
Ich wusste, dass ich von Sophie nicht mehr erfahren würde. Das lag daran, dass wir beide Vielleser sind. Nicht unbedingt aus reiner Leidenschaft, sondern weil wir nicht anders konnten. Wir waren von Natur aus Beobachter, Deuter und Kritiker. Wir lasen nicht nur Bücher sondern auch Comics, Reiseprospekte, Wanderbücher, Zeitschriften, ja sogar Rezepte. Egal was, Hauptsache wir würden dadurch die Welt besser verstehen.
„Osten“, sagte Sophie und presste wieder ihre Nase an die Scheibe. Beide spähten wir auf die weithin sichtbare, zauberhafte Beleuchtung des vielleicht schönsten Christ‐ kindlmarktes im Allgäu. Es war kurz vor achtzehn Uhr, und langsam wie bestellt, fielen leichte dicke Schneeflocken vom Himmel um dem Weihnachtsmarkt die richtige winterliche Atmosphäre zu verleihen. Nur wenige Meter vom Kurhaus entfernt, konnte ich meinen Ford Focus parken. Ich war wie jedes Jahr seit 2010, auf Sophies Wunsch hin, hierher gefahren. Aber nicht nur ihr, auch mir gefiel der besinnliche und hübsch dekorierte Markt, wie auch Zehntausenden von anderen Besuchern aus Nah und Fern. Es gab sogar Touristen, die jedes Jahr ihren Urlaub genau zum Zeitpunkt des Marktes hier verbrachten. Julia – Sophies Mutter, meine (Ex) Frau – ist zehn Monate nach Sophies Geburt gestorben. Seitdem ziehe ich die Kleine mit Hilfe meines Kindermädchens Alexa alleine auf. Wie alle kleinen Kinder liebte sie die Weihnachtsfiguren, die vielen Süßigkeiten, und natürlich auch den Nikolaus, der heute kam um die braven Kinder zu beschenken. Wir stiegen aus dem Auto aus und ich nahm Sophie an die Hand. Die Kleine sah mich erwartungsvoll aus ihren rehbraunen Augen an. Jetzt wo ihr Gesicht halb im Schatten lag, erkannte ich ihre Mutter darin. Von ihr waren auch ihre Freundlichkeit und Verletzlichkeit. Sie in ihren Zügen zu sehen, weckte das Gefühl in mir, jemanden zu vermissen, der noch immer da war, zumindest in meinem Herzen und Kopf.
„Papi, was ist los? Wollen wir nicht weitergehen?“, fragte mein kleiner Schatz und riss mich aus meinen wehmütigen Gedanken, als ich sie solange anstarrte. Immer mehr Besucher strömten jetzt von allen Seiten auf den Weihnachtsmarkt. Dutzende von Bussen, aus ganz Süd‐ deutschland, luden tausende von Besucher aus. Heute am Samstag war der vorletzte Tag. Ich zog Sophie die Kapuze hoch, dass ihre Pudelmütze nicht gleich nass war, da der Schneefall etwas stärker wurde. Dann gingen wir weiter und am Rundbogen vor dem Kurhaus zahlte ich für uns beide Eintritt. Der süße Duft gebrannter Mandeln sowie von Bratwurst und Pommes, erweckte unsere Hungergefühle. Sophie und ich hatten weitestgehend den gleichen Geschmack, weniger nach Lebkuchen oder Mandeln, sondern vielmehr auf Currywurst und Pommes mit reichlich Ketchup. Ich bestellte zwei normale Portionen, schließlich aß Sophie genauso viel wie ich, und musterte die herbeiströmenden Menschenmassen. Zu Weihnachtlichen Klängen, verschlangen wir wenige Minuten später unser Lieblingsgericht. Das sollte jetzt aber nicht heißen, dass es das fünfmal in der Woche bei uns daheim gab. Alexa war eine ausgezeichnete Köchin, die uns fast jeden Abend mit genügend Vitaminen und Ballaststoffen versorgte. Während ich uns noch an der Bude zwei Cola light besorgte, entdeckte ich drei Stände weiter, Monika Ehret, eine Kollegin die in dem gleichen Verlag arbeitete wie ich, bei den „Schwäbischen Nachrichten“. Seit wenigen Wochen war sie aufgestiegen zur stellvertretenden Chefredakteurin, manch einer munkelte, sie hätte sich hoch geschlafen.Zuzutrauen wär`s ihr, auch bei mir hatte sie nach dem Tode meiner Frau, diverse Annäherungsversuche gestartet. Sie war Mitte dreißig, vier Jahre jünger als ich und bereits zweimal geschieden. Das sagte fast alles, dachte ich mir, als sie mir mit einem Glühweinbecher zuprostete und lächelte. Sie war mit einer weiteren Frau hier, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich nickte ihr nur kurz zu, sonst würde sie womöglich noch unseren Platz ansteuern. Als wir unseren Hunger gestillt hatten, schlenderten wir weiter. Wir mussten uns Richtung Rathausplatz orientieren, da dort in zehn Minuten, die Geschenke verteilt wurden. An einem Krippenstand mit kunstvoll geschnitzten Figuren und Krippen blieb ich kurz stehen. Ich nahm einen schönen Engel in beide Hände und musterte ihn. Ich stellte ihn wieder ab und griff an die Innenseite meiner Jacke, um nachzusehen, wie viel Geld ich noch dabei hatte. Nachdem ich sah, dass es noch für mehrere Kostbarkeiten dieser Art reichen würde, wollte ich noch meine kleine Maus nach ihrer Meinung fragen. Ich blickte nach unten und bekam einen Schreck.
Sie war weg!
Ich schrie nach Sophie und drehte mich mehrfach um die eigene Achse. Außer den nassen Schneeflocken, die mir in die Augen flogen und grinsende Leute die schon vom Glühwein angetrunken waren, sah ich nichts. Ich hatte sie keine zwei Minuten aus den Augen gelassen und jetzt war sie wie vom Erdbeben verschluckt. Trotz der Kälte wurde mir heiß und ich begann nervös zu zittern. Wo war sie, verdammt noch mal? Sie ging nie einfach weg wenn wir was unternahmen. Wie ein Irrer durchstreifte ich den Markt, fragte die Standbetreiber nach dem kleinen süßen Mädchen mit der pinkfarbenen Pudelmütze.
Nichts. Mein Blutdruck stieg in bedenkliche Höhen.
Als ich den Markt verließ, rempelte ich vor lauter Hektik noch eine Frau an, die daraufhin ihren Glühwein verschüttete. Ihr Freund beschimpfte mich wüst und drohte mir Schläge an. Dann war ich außerhalb der Menge und atmete erst einmal tief durch. Ich lief ohne Sinn und Verstand im Schneetreiben umher, als ich auf einmal eine Entdeckung machte. Vor mir auf dem Boden lag unverkennbar einer ihrer beiden roten Handschuhe. Ich erkannte sie sofort, da Sophie sie zum Geburtstag von ihrer Oma bekommen hatte. Wieder brüllte ich ihren Namen, vernahm aber nichts außer dem leicht pfeifenden Wind der mir die Flocken ins Gesicht peitschte. Hektisch lief ich weiter, bis ich Abdrücke von Spuren von ihr im Schnee sah. Hechelnd wie ein Hund trottete ich weiter Richtung Wald. Von einem Bauernhof aus, sah ich eine alte Frau die mich misstrauisch durch die Fenster beäugte. Als ich am Bauernhof vorbei war, wurde es immer dunkler und das Schneetreiben intensiver. Keuchend hielt ich kurz inne und stützte die Hände auf meine Knie. Panik befiel mich, und düstere Fantasien. Dann verlor ich ihre Spur vor einem Wiesenhang. Ich stapfte weiter bei beißender Kälte und benutzte die integrierte Taschenlampe meines Handys. Ich war jetzt ungefähr einen halben Kilometer außerhalb der Gemeinde, um mich herum eine gespenstische Stille. Der Halbmond verbreitete etwas Licht, sodass ich auf einmal einen Schatten wahrnahm, vielleicht dreißig Meter vor mir. „Sophie!“, brüllte ich wie am Spieß. Aber das konnte unmöglich Sophie sein, der Schatten war riesig wie von einem Monster das über zwei Meter groß war. Dann sah ich einen zweiten kleineren Schatten mit einer pinkfarbenen Mütze auf dem Boden liegen. Sophie! Mein Gott, sie lag wie tot im Schnee und der große Schatten kam auf mich zu. Verzweifelt tastete ich meinen Körper ab, auf der Suche nach einer möglichen Waffe. Der Schatten wirkte über‐ mächtig, bedrohlich. Der Mann verfügte bestimmt über Bärenkräfte. War es überhaupt ein Mann? Noch fünfzehn Meter Distanz zwischen uns.
„Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht?“
Außer dem Stapfen seiner Fußspuren vernahm ich keinen Laut. Verzweifelt sah ich auf den Boden auf der Suche nach einem Stein oder Holzprügel. Nichts, außer diesem verdammten Schnee, der mich immer mehr bezuckerte. Kurzzeitig hatte ich die Hoffnung, dass ich mich in einem Albtraum befand, aus dem ich jeden Moment aufwachten würde. Oder hatte ich nur den Verstand verloren, das würde erklären warum ich hier hinter etwas herjagte, was es vielleicht gar nicht gab?
Der Bauernhof!
Er war doch nicht weit weg von hier, höchstens drei‐ hundert Meter. Ich musste fliehen und Hilfe holen, dem Ungetüm war ich wahrscheinlich nicht gewachsen. Aber wie gelähmt blieb ich stehen. Meine Beine wollten mir nicht mehr gehorchen, dass Unheil kam erbarmungslos näher. Noch fünf Meter. Dann gaben meine zitternden Beine nach, ich sank mit den Knien auf den Schnee, mit dem dringenden Bedürfnis jetzt zu beten. Aber das hatte schon bei dem Tod meiner Frau nichts geholfen, Gott ließ mich erneut im Stich. Da bekam ich eine Eingebung, eine Erkenntnis. Etwas, dass ich aber niemals würde beweisen können, wenn es mir überhaupt noch möglich war. Ich wusste jetzt, wer meine Tochter entführt hatte, wer mir das alles antat. Ich kannte seinen Namen. Aber meine Stimme versagte, nicht einmal meine Hände konnte ich mehr zum Gebet falten. Ich blickte flehentlich nach oben, sah in das Gesicht einer fürchterlichen Fratze. Nichts Menschliches mehr war in dem Antlitz zu erkennen. Aus der Stirn ragten spitze Hörner in die Luft. Die Gestalt mit der Teufelsfratze grinste mich höhnisch an, als sie ihre mächtigen Pranken hob, mit einer fürchterlichen Waffe in der Hand. Mein letzter Gedanke galt meiner verstorbenen Frau mit der ich vielleicht wieder vereint sein konnte, als die Sense auf mein Haupt hernieder sank.
1. Kapitel
Ostern 2010. Vier Jahre und acht Monate zuvor.
„Osterkarten!“ Das war Sophie, meine vierjährige Toch‐ ter, die in mein Zimmer rannte und selbst bemalte Osterkarten auf mein Gesicht regnen ließ.
„Heute ist der Tag des Osterkorbes mit seinen Geschenken“, antwortete ich und streichelte über ihr hellbraunes Haar.
„Wer ist dein Schatz Papi?“
„Das bist du und Mami.“
„Aber Mami ist doch schon lange nicht mehr da?“
„Nur nicht mehr sichtbar Sophie, aber immer noch in meinem Herzen.“
„Wirklich?“
„Auf jeden Fall.“
„Und ist Alexa auch dein Schatz?“
Alexa war seit dem Tod meiner Frau unser Kindermädchen oder auch Mädchen für alles.
„Sie ist auch ein Schatz, aber nicht so wie du und Mami es gewesen ist.“
Ich war froh, dass ihr die Antwort reichte. Tage wie diese, die unvermeidlichen kalendarischen Feste – Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Muttertag ‐ waren schlimmer als andere. Sie erinnerten mich immer daran, wie einsam ich war. Und wie diese Einsamkeit sich im Laufe der Zeit immer tiefer in meine Seele gegraben hatte. Eine Krankheit die zwar nicht akut war, sich aber noch verschlimmern konnte. Paul meinem besten Freund, hatte ich mich vor drei Jahren anvertraut. Er sagte, und meinte es bestimmt gut damit, ich sollte einen Therapeuten aufsuchen. In letzter Zeit hatte sich nämlich noch mehr verändert. Die Leere trat noch mehr als bisher zutage, das volle Gewicht, des Verlustes meiner geliebten Julia. Ich dachte, ich hätte in den vergangenen Jahren genug getrauert. Aber vielleicht begriff ich erst jetzt wie wertvoll sie für uns war. Womöglich kam die eigentliche Trauer aber erst noch. Sophie ist alles was ich habe. Nur sie hat mir geholfen zu überleben. Ich verbot mir zwar zu träumen, aber wie will man Albträume verhindern? Aber vielleicht war es auch ein Fehler, nicht wieder nach einer Frau zu schauen, sonst lebt man irgendwann gar nicht mehr. Auf Julias letzte Tage will ich hier jetzt nicht näher eingehen, aber ich gestehe jede Art von Fehlverhalten und falschen Einschätzungen. Aber ich werde nicht erzählen, wie es war, dem Leid meiner Frau zuzusehen. Zuzusehen wie sie gestorben ist. Eines möchte ich aber noch sagen: Sie zu verlieren hat mir die Augen geöffnet. Die vielen Stunden, die ich mich über enttäuschten Ehrgeiz, banalen Ärger bei der Arbeit und eventuellen Ungerechtigkeiten aufgeregt habe. Die ganzen vergeudeten Chancen, etwas zu verändern, oder zu erkennen, dass ich mich hätte ändern können. Als Julia starb war ich kurz zuvor zweiunddreißig geworden. Noch nicht einmal ein halbes Leben. Als sie mich verlassen hatte, wurde offensichtlich, wie vollkommen dieses Leben hätte sein können. Wie vollkommen es gewesen wäre, wenn ich es nur rechtzeitig erkannt hätte.
2. Kapitel
Jungholz/Tirol, Dezember 2010, kurz vor Weih‐ nachten.
Norbert Bahrmann schmiss mehrere Scheitel Holz in seinen Kachelofen im Wohnzimmer. Ihm grauste schon vor dem bevorstehenden langen Winter hier auf 1000 Meter Meereshöhe. Oft lag hier der Schnee bis Ende April. Aber ohne den Schnee und den langen Skibetrieb wäre der kleine Tiroler 300‐Seelen‐Ort tot. Jetzt kurz vor Weihnach‐ ten waren die Nächte schon bis zu minus 15 Grad kalt, die Schneedecke war schon fast einen halben Meter hoch. Bahrmann war fünfundsechzig und wohnte mit seiner Partnerin Karin seit einem Jahr in dem kleinen Einfamilienhaus am Waldrand bei Jungholz‐Habsbichl. Warum musste er auch vor eineinhalb Jahren hier ausgerechnet Skiurlaub machen und dann seine jetzige Lebensgefährtin kennenlernen? Nur wegen ihr kam er vom schönen Freiburg, auf seinen letzten Lebensabschnitt in die Allgäuer Alpen. Außer drei Banken, einem Skilift und acht Hotels war hier nicht allzu viel geboten, eigentlich gar nichts außer schöner Bergsicht. Nur seiner Karin zu Liebe war er in dieses Kaff gekommen. Bis vor einem Jahr war er noch Leiter der Bodenwaldschule in Titisee‐Neustadt, einer Privatschule für schwer erziehbare Jungendliche. Sollte er es hier in der ländlichen Provinz aushalten, war im nächsten Frühjahr die Hochzeit geplant. Für beide wäre es die zweite Ehe. Seine zukünftige Frau war bei den Nachbarn am anderen Ortsende eingeladen. Er hatte heute keine Lust gehabt mitzugehen, und kümmerte sich um das Haus, dass seine Karin geerbt hatte. Morgen wollte er das erste Mal auf die Piste. Seit vier Stunden, und wahrscheinlich noch die ganze Nacht, liefen unentwegt die Schneekanonen. Morgen am Samstag war geplante Ski‐Eröffnung in Jungholz. Bahrmann hörte das Knacken und Prasseln des Holzes, setzte sich zufrieden mit einem kühlen Bier vor den Kachelofen und schaltete den Fernseher ein. Es war kurz nach neunzehn Uhr, als er die Jalousien runterließ, und auf einmal einen Schatten draußen vorbeihuschen sah. Angestrengt sah er aus dem Fenster oder hatten ihm seine Nerven einen Streich gespielt? Vielleicht war es auch nur ein Fuchs, Rehe trauten sich nie so nah ans Haus, obwohl sie unmittelbar am Waldrand wohnten. Er presste sein Gesicht noch mal an die Scheibe und sah angestrengt ins Freie. Normal würde durch den installierten Bewegungs‐ melder das Außenlicht angehen, sollte jemand draußen stehen oder laufen. Er holte aus der Küche ein zwanzigZentimeter langes Fleischmesser und ging zur Haustür. Sollte seine Frau vorzeitig zurückkommen, würde er sie mit ihrem Fiat Punto hören. Bei der Gelegenheit könnte er noch einen Korb Holz mitnehmen aus der Garage, wo die linke Wandseite aufgestapelt war bis zur Decke. Es wehte ein leichter Wind und Flockenwirbel als er ins Freie trat. Auf einer Hangseite beim „Sorgschrofen“ hörte er die Pisten‐ raupen und Schneekanonen. Er steckte den Türschlüssel ein und zog die Eingangstür zu. Dann lief er zur großen Garage, die sich zehn Meter neben dem Haupthaus befand. Beim Anblick den er auf einmal auf dem zehn Zentimeter hohen Schnee sah, sträubten sich seine Nackenhaare und sein Puls schoss in die Höhe. Profilierte Schuhabdrücke eines ungewöhnlich großen Fußes. Instinktiv umklammerte er den Messergriff fester, sodass seine Knöchel weiß hervortraten. Die Abdrücke waren absolut frisch, sie konnten keine fünf Minuten alt sein, bei dem Schneetreiben seit einer Stunde. Er stapfte mit Größe 44 großen Thermostiefeln in die Spur, und sah aufgrund der Ausmaße, dass der Abdruck eine Schuhgröße zwischen 48 – 50 hatte. Dann riss er abrupt seinen Kopf herum als er den knirschenden Laut eines Schrittes vernahm. Was er sah, machte ihm Angst, große Angst. Keine fünf Meter entfernt, stand eine hünenhafte Gestalt vor ihm, bestimmt zwei Meter groß. Schwarz gekleidet, mit einer Kapuze über dem Kopf. Es sah aus, als sei das Gesicht im Schein der Beleuchtung, rötlich. Was ihm aber noch viel mehr Gänsehaut bereitete und seinen Körper zittern ließ, war das was der Mann in seinen Händen hielt. Ein Arbeitsgerät das vor vielen Jahrzehnten in der Landwirtschaft noch häufig eingesetzt wurde, jetzt eher seltener. Eine Sense!
„Was wollen Sie hier?“, fragte Bahrmann und musste sich konzentrieren diese Worte überhaupt aus seiner trockenen Kehle hervorzubringen. Unbewusst ging er leicht rückwärts Richtung Hauseingang. Die Gestalt sah ihn nur an und schritt langsam auf ihn zu.
„Verdammt, was soll das?“. Bahrmann hielt sein langes Messer vor seinen Körper. „Kommen Sie keinen Schritt näher!“
Unbeeindruckt von seinen Worten war der Hüne nur noch drei Meter vor ihm. Mit seinen eins fünfundsiebzig war Bahrmann um einen Kopf kleiner, sodass er zu dem Hünen hochsehen musste. Er versuchte ein letztes Mal seine Haut zu retten.
„Ich hab im Haus Geld und Schmuckstücke, Sie können alles mitnehmen.“ Kaum hatte er ausgesprochen passierte ihm ein Missgeschick. Er geriet ins straucheln und fiel auf den Hintern. Verzweifelt brüllte er in die kalte Nachtluft;
„H I L F E!“
Dann war der Mann über ihm, holte aus und schlug zu. Das letzte das Bahrmann sah, waren die Hörner der Gestalt der wie ein Teufel aussah, bevor die Sense seinen Kopf abtrennte.
Als eine halbe Stunde später, Karin Wiedemann ihren zukünftigen Mann suchte, bekam sie einen Schock, als sie den zugeschneiten, blutigen Kopf neben dem Garagentor liegen sah. Die noch offenen Augen des Schädels starrten sie wehklagend an, als begriffen sie immer noch nicht warum das geschehen war.
3. Kapitel
Gegenwart.
Das Haus in der Argenstrasse in Burkwang, hatten wir als frisch verheiratetes Ehepaar gekauft. Der kleine Weiler mit fünf Häusern, gehört zu Kleinhaslach, einem Ortsteil von Isny im Allgäu. Ich hatte mir die Anzahlung damals kaum leisten können, nur weil Julias Eltern einen stattlichen Betrag dazu sponserten, war eine Realisierung überhaupt möglich. Nach ihrem Tod kam ich nur deshalb über die Runden, weil wir nach den Flitterwochen eine Lebens‐ versicherung auf Gegenseitigkeit über 200.000 Euro abge‐ schlossen hatten. Dadurch konnte ich mir ein Kinder‐ mädchen für Sophie leisten. Und ich wollte hier auch weiter wohnen bleiben. Zum Gewerbegebiet wie auch zur Stadt‐ mitte war es nicht weit, und auch mit den Nachbarn hatten wir ein gutes Verhältnis. Sophie wurde entweder von mir oder Alexa zur Schule gefahren. Meinem Kindermädchen hatte ich den alten Golf meiner Frau zur Verfügung gestellt. Rein dienstlich versteht sich, an ihren freien Tagen blieb das Auto bei uns stehen. Ich selbst fuhr einen Ford Focus, knapp acht Jahre alt in Silber. Völlig ausreichend um damit tagtäglich meinen zwanzig Kilometer entfernten Arbeitsplatz in Leutkirch bei den „Schwäbischen Nachrichten“ anzusteuern. Leutkirch mit knapp zwanzig‐ tausend Einwohnern, ist etwas größer als Isny und hat mehr Gewerbe und weniger Tourismus. Der Kurort Isny, lebt hauptsächlich von den vielen großen Reha – und Kur‐ kliniken, die im Ortsteil Neutrauchburg für Belebung sor‐ gen. Allerdings erlebte Isny in den letzten Jahrzehnten einen kleinen Bauboom. Immer mehr Bauprojekte und immer mehr Menschen die hier leben wollten, bis sich vor zehn Monaten immer mehr merkwürdige Zwischenfälle hier häuften. Immer mehr Angst‐Geschichten von will‐ kürlicher Gewalt machten die Runde, von Überfällen auf Privathäuser und auch von Einbrüchen hörte und las man viel. Die Spannung war inzwischen fast überall spürbar, eine Aggressivität aus unstillbaren Bedürfnissen war geboren. Gemeinsam war allen der Wunsch nach mehr. Aber das Wünschen hat auch dunkle Seiten, Menschen die zuvor Freunde waren, könnten zu Konkurrenten werden. Als ich meinen Focus an diesem Tag hundert Meter von unserem Verlagsgebäude entfernt abstellte, kam langsam die Sonne zum Vorschein. Dort hatte ich vor dreieinhalb Jahren angefangen, ein Jahr nachdem ich Julia kennenlernte. Ich wurde als stellvertretender Chef‐Redakteur für ein monatlich erscheinendes Freizeitmagazin eingestellt. Zuvor war ich nach einem abgebrochenen Politik‐Studium fast vier Jahre bei einem privaten Rundfunkhaus in Stuttgart als Nacht‐Moderator tätig gewesen. Geboren bin ich in Biberach an der Riß, einer kleinen Stadt, zwanzig Kilometer von Ulm entfernt. Ich suchte mir deshalb im westlichen Allgäu einen Job, weil ich hier mit Julia eine Familie gründen wollte. Sie war gebürtig aus Isny, und wir lernten uns kennen, als ich selbst vier Wochen auf Reha war, in einer Psychosomatischen Klinik in Neutrauchburg. Julia war dort als Krankenschwester tätig gewesen. Damals war ich noch voller Ehrgeiz und sah den Job bei den „Schwäbischen Nachrichten“ nur als Sprungbrett zum Literaturkritiker. Ich wollte werden, wie der altehrwürdige Marcel Reich‐Ranicki, der im Jahr 2013 verstarb. Mit gnadenlos hohen An‐ sprüchen, gestützt von der Überzeugung, dass all die Leuchten, die ich niedermachen würde, noch erkennen würden, dass ich sie zu Recht verrissen hatte. Aber dazu zählte nicht nur viel lesen und Jahrelange journalistische Arbeit, sondern was ganz Besonderes: Ein eigenes Buch schreiben! Oder besser gesagt, nicht nur eines schreiben, es müsste ein Bestseller werden. Das die, die man später kritisieren würde, erkennen, dass sie es nicht nur mit einem nörgelnden Kritiker zu tun haben, sondern mit einem erfolgreichen Besteller‐Autor, der weiß was die Leute lesen wollen. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich schon immer das Gefühl, dass etwas in mir schlummerte, das irgendwann einen Ausdruck finden würde. Wahrscheinlich hatte das alles mit meiner Kindheit zu tun, mit der Einsamkeit eines Einzelkindes, dessen einzige Freunde oft Bücher waren. Und mit den Wochenenden, an denen ich mich zu Hause verkroch, wie eine Katze zusammengerollt auf den sonnigen Flecken des Teppichs. Nie jedoch zweifelte ich daran, dass ich eines Tages ein großer Schriftsteller werden würde. Meine Horrorstorys und Krimis würden bestimmt ein Millionenpublikum finden. Ich akzeptierte, dass ich vielleicht nicht von Anfang an gut sein würde. Es gab schließlich auch Lektoren und Kritiker. Rückblickend wurde mir bewusst, dass die Idee vom Schreiben so etwas wie eine Religion für mich war. Totale Hingabe und aufrichtige Offenbarung, und trotz der Gottlosigkeit nicht weniger heilig. Schließlich gab es die Aussicht auf Erlösung. Die Möglichkeit, eine Geschichte zu schaffen, die für mich sprach, die besser sein würde als ich. Zwingender, fantasievoller, geheimnisvoller.
So viel zu der Theorie und meinen Absichten.
Aber das Problem bisher war, es gab kein Buch von mir! In einer stillen Nische meiner Seele wartete ich immer noch. Auf den ersten Satz, auf den Einstieg. Aber es kam kein erster Satz. Und was machte ich? Ich bastelte jeden Monat an einem Freizeit‐Magazin, wo mir gesagt wurde, wenn die Skiliftpreise sich verteuerten, wenn der Alp‐Abtrieb war oder welche Radrunde die schönste im Allgäu sein sollte. Bestimmt keine üble Aufgabe, aber ich war zu höherem bestimmt. Nach meiner Hochzeit und der Geburt unserer Sophie, dachte ich nicht mehr so sehr an das Buch. Eher an meine Familie, Reisen, Haus und weitere Kinder. In meinem tiefsten Inneren kam aber dann doch wieder häufiger das Verlangen ein Buch zu schreiben. Auf den Titel, auf den ersten Satz, auf den ersehnten Einstieg. Aber es kam nichts davon, dafür kam Sophie. Ich war Anfang dreißig, Julia neunundzwanzig als es soweit war. Kurze Zeit verschwand die Sehnsucht nach einem Buch. Ich war verliebt – in meine Julia, in meine neugeborene Tochter, sogar in die Welt, die ich vorher nicht besonders gemocht habe. Ich hörte auf, mir den Kopf darüber zu zerbrechen über was ich schreiben sollte. Ich war zu beschäftigt mit Beruf, Familie und Glücklichsein. Dann die Tragik: Neun Monate nach Sophies Geburt war meine Julia –Sophies Mutter – nicht mehr da. Vor Verzweiflung wollte ich mich umbringen, düstere Visionen über‐ fielen mich, nur Sophie hielt mich am Leben. Sophie war zu jung, um zu verstehen, dass ihre Mutter fehlte. Erst als sie sprechen und lesen lernte, fragte sie immer häufiger danach. Warum andere Kinder eine Mutter hätten, aber sie „nur“ einen Vater? Ich musste ihr immer wieder von ihr erzählen, bis mich die Gefühle übermannten und ich weinen musste. Aber ich wollte die Erinnerung für uns beide bewahren, auf Ewigkeit. Kurz darauf kehrte mein alter Glaube an das Buch wieder zurück. Ich begann, auf die Chance zu lauern, die eine wahre Geschichte zu erzählen, welche die Toten zurückbringen würde. Die Degradierung, De‐ mütigungen und das Mobbing begannen, als ich nach dem unbezahlten Urlaub, den ich wegen dem Tod meiner Frau und Sophie genommen hatte, in die Firma zurückkehrte. Wir hatten einen neuen Verlagschef bekommen, der im Mittelalter lebte und nicht ver‐ stand, wie ein Mann alleine sein Baby aufziehen wollte. Dann wurde meine Position als Stellvertreter des Chefredakteurs einfach an eine neue Mitarbeiterin vergeben, die zuvor in der Anzeigenabteilung war. Mein Schwiegervater – Julias Vater – der mir näher stand als mein Eigener, kam auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben. Ich bekam einen Nervenzusam‐ menbruch und brauchte therapeutische Hilfe, bis ich mich wieder gefangen hatte. Gott sei Dank fand ich Alexa, die sich rührend um die Kleine kümmerte und mich wiedermoralisch aufrichten konnte. Um es auf den Nenner zu bringen: Es kamen harte Zeiten auf mich zu. Die hinter mir liegenden Monate beruflichen Niedergangs hatten dazu geführt, dass ich mehr Zeit damit verbrachte auf dem Sessel meines Therapeuten zu verbringen. Glücklicherweise wirkte sich das nicht auf das Kind aus. Sophie war ein braves, kluges und folgsames Kind und war überall beliebt. Das Problem lag bei mir: Beinahe unbemerkt war mein Kindheitstraum zurückgekehrt, mein Buch. Wie ein irres Flüstern im Ohr, verfolgte es mich auch im Schlaf. Ein Fluch, ein Versprechen des Teufels. Eine Obsession, mit der Besessenheit, einen Bestseller zu landen, wenn ich nur die richtigen Wörter in die richtige Reihenfolge bringen könnte, dann ging es mir besser. Vielleicht konnte ich meine Sehnsucht bald in Kunst umwandeln.
4. Kapitel
Dezember 2010, kurz nach Weihnachten.
Edmund und Sabine Fleck, hatten sich ihren Traum vom Eigenheim im Allgäu wahr gemacht. Ohne ein Darlehen aufzunehmen kauften sie sich jetzt mit Mitte sechzig ein schickes Einfamilienhaus in Kleinhaslach, dem schönsten Ortsteil von Isny, nur dreihundert Meter vom Burkwanger Waldsee entfernt. Bevor sie umzogen, schafften sie es, ihr bisheriges Domizil in ihrer Heimat Freibug mit kleinem Gewinn zu veräußern. In Isny engagierte sich Sabine Fleck, ehrenamtlich, um Osteuropäern Deutsch beizubringen. Ihr Mann gab einige Kurse an der Volkhochschule für Rhetorik und Bewerbungsgespräche. Beide waren vor ihrem Umzug fast vierzig Jahre Lehrer an verschiedenen Schulen in Baden‐Württemberg. Ihre beiden Kinder waren auch schon über dreißig, längst aus dem Haus und hatten gut bezahlte Jobs in der IT‐Branche. Als Sabine Fleck an einem Freitag‐ abend im Dezember, nach einem langen Telefonat mit ihrer Tochter den Hörer auflegte, beschloss sie noch eine Runde mit Stirnlampe um den See zu laufen. Ihr Mann war noch bis 20.30 Uhr bei einem Dia‐Vortrag in der VHS in Isny. Bis dahin hatte sie noch eine Stunde Zeit. Sie liebte diesen See, im Sommer lagen sie bei schönem Wetter immer beim Nacktbaden hier. Im Winter wurde der See gern von Joggern, Spaziergängern oder Hundebesitzern genutzt. Sie zog sich einen warmen Anorak an, streifte sich die Stirnlampe über und nahm noch zusätzlich eine Taschenlampe und Handy mit. Es war eisig kalt mit Temperaturen um 10 Grad unter Null und das ganze Allgäu, wie auch der See, lagen unter einer geschlossenen Schneedecke. Der See war seit zwei Wochen vollständig zugefroren und die weiße Pracht die die Bäume um den See bedeckt hatten, verliehen dem Gewässer und der Region ein bezauberndes und geheimnisvolles Winterkleid. Sabine liebte diese Jahreszeit, genauso wie den Sommer. In Freiburg, wo sie früher wohnten, lag selten länger als zwei Tage Schnee.