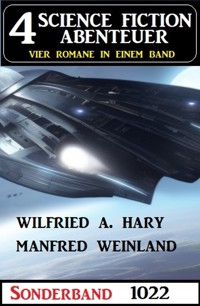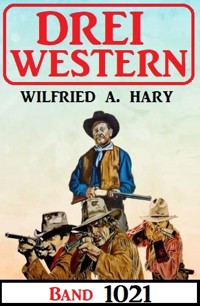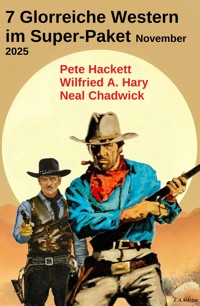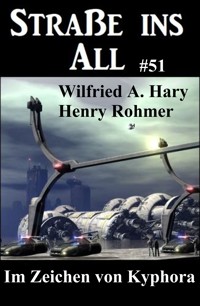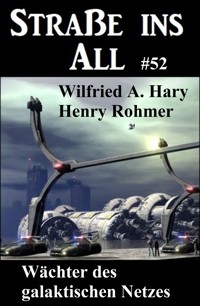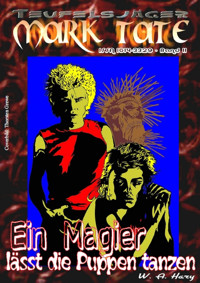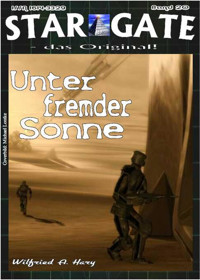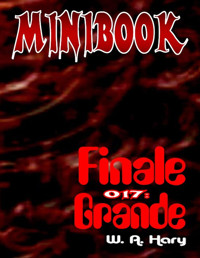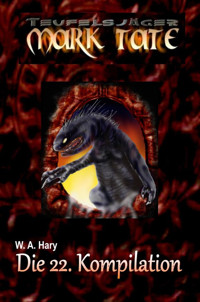3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
TEUFELSJÄGER: Die 18. Kompilation
- A. Hary (Hrsg.): „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 111 bis 120 der laufenden Serie!“
Enthalten in dieser Sammlung:
111/112 »Wo das Böse wohnt« / »Herberge der frommen Schwestern« W. A. Hary
113/114 »Die Finsternis« / »Armee der Untoten« W. A. Hary
115/116 »Nebel des Todes« / »Die Flucht« W. A. Hary
117/118 »Der Schreckensorden« / »Ich jagte den Geisterhenker« W. A. Hary
119/120 »Der Mann, der zweimal starb« / »Die Geliebte des Henkers« W. A. Hary
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt! Jeder Band ist jederzeit nachbestellbar.
Nähere Angaben zum Autor siehe auf Wikipedia unter dem Suchbegriff Wilfried A. Hary!
Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie Teufelsjäger Mark Tate: Wilfried A. Hary!
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch)
by HARY-PRODUCTION
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TEUFELSJÄGER: Die 18. Kompilation
„Diese Kompilation beinhaltet die Bände 111 bis 120 der laufenden Serie!“
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt! BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTEUFELSJÄGER: Die 18. Kompilation
TEUFELSJÄGER:
Die 18.
Kompilation
W. A. Hary (Hrsg.)
Impressum:
Diese Kompilation beinhaltet Bände aus der laufenden Serie rund um Mark Tate, natürlich für das Buchformat optimiert.
Alleinige Urheberrechte an der Serie: Wilfried A. Hary
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen
(einschließlich eBook, Print und Hörbuch) by www.haryproduction.de
Copyright dieser Fassung 2018 by www.HARYPRODUCTION.de
Canadastr. 30 * D66482 Zweibrücken
Telefon: 06332481150
eMail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von HaryProduction.
Covergestaltung: Anistasius
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt!
Es ist kein Wunder, dass sich Kompilationen, also Sammlungen von mehreren Büchern und Texten in einem einzigen Band vereint, immer größerer Beliebtheit erfreuen. Immerhin bieten sie eine Fülle von Lesestoff für einen kleineren Geldbeutel. Unsere Kompilationen gibt es für jede Serie, und darin sind die Romane und Texte in ihrer richtigen Reihenfolge geordnet, so dass jeder seine Lieblingsserie nach Belieben zusammenstellen und sie am Ende vollständig besitzen kann. Sowohl als eBook, erhältlich über wirklich alle relevante Plattformen, als auch (natürlich!) als gedruckte Bücher, ebenfalls über alle maßgeblichen Plattformen erhältlich.
Wie zum Beispiel dieser Band aus der Serie rund um Mark Tate:
TEUFELSJÄGER: Die 18. Kompilation
W. A. Hary (Hrsg.): „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 111 bis 120 der laufenden Serie!“
Enthalten in dieser Sammlung:
111/112 »Wo das Böse wohnt« / »Herberge der frommen Schwestern« W. A. Hary
113/114 »Die Finsternis« / »Armee der Untoten« W. A. Hary
115/116 »Nebel des Todes« / »Die Flucht« W. A. Hary
117/118 »Der Schreckensorden« / »Ich jagte den Geisterhenker« W. A. Hary
119/120 »Der Mann, der zweimal starb« / »Die Geliebte des Henkers« W. A. Hary
TEUFELSJÄGER 111:
W. A. Hary
Wo das Böse wohnt
Es gibt Schlimmeres als der Tod!
Es lag zwar schon Jahre zurück, doch es war für uns von so gegenwärtiger Wichtigkeit wie es gar nicht mehr wichtiger werden konnte. Wir ahnten es mehr als dass wir es wussten – bis uns klar wurde, dass es unsere einzige und letzte Chance überhaupt sein konnte...
*
Ich erwachte wie aus einem bösen Traum. Aber es war keineswegs nur ein Traum, den man nach dem Erwachen besser gleich wieder vergessen sollte, denn ich hatte genau das in meine Erinnerung zurückgerufen, was mir damals der Schavall von der Geschichte regelrecht aufgepfropft hatte. Dabei hatte er wirklich keine noch so kleine Kleinigkeit, die etwa hätte von Wichtigkeit sein können, ausgelassen.
Ich hatte es neu nacherlebt, als wäre ich unsichtbarer Beobachter bei alledem gewesen. Und der Elementargeist hatte, genauso wie der Werwolf und meine Lebensgefährtin May Harris, dasselbe nacherlebt wie ich.
„Unfassbar!“ Der Werwolf konnte nicht sprechen. Wenn er uns etwas mitteilen wollte, hörten wir eine Art Gedankenstimme in unseren Köpfen. Er knurrte abgrundtief. Ein sehr bedrohlicher Laut, der sich allerdings nicht gegen uns richtete.
Irgendwie erschien er jetzt leicht unsicher. Und er begründete es sogleich:
„Ganz eindeutig handelt es sich um dasselbe Gebiet! Hier, in dieser Sphäre, gibt es eine Art Abbild des Teufelsmoors von damals. All die Jahre wurde es von Untoten bevölkert, doch die hatten keinen eigenen Willen. Sie wurden von den Kräften immer wieder ins untote Leben gerufen und wie Marionetten gesteuert – von Kräften, die überhaupt das ganze Gebiet ausmachen. Ohne jetzt dem Bericht vorgreifen zu wollen: Irgendwie muss es doch damals gelungen sein, am Ende die Gefahr zu bannen?“
Ich nickte.
„Ja, irgendwie. Damit schien alles erledigt zu sein. Aber ich habe mich im Nachhinein schon sehr darüber gewundert, dass der Schavall mir alles so detailliert übermittelt hatte. Ich konnte zwar in einem entscheidenden Moment eingreifen – aus der Ferne sozusagen -, aber eine kurze Erklärung über die Zusammenhänge hätte eigentlich genügt. Es war übrigens nicht das erste und einzige Mal, dass der Schavall solches veranstaltete mit mir. In diesem speziellen Fall jedoch war alles irgendwie anders als sonst üblich.“
„Vielleicht deshalb“, sinnierte May laut, „weil der Schavall damals schon wusste, wie wichtig alle Erkenntnisse heute noch sein könnten?“
Abermals knurrte der Werwolf abgrundtief, und über seine Gedankenstimme sagte er:
„Zumal das Teufelsmoor zurzeit wieder ziemlich aktiv ist. Ich meine, ich kenne es schon seit vielen Jahren, aber irgendetwas hat die Geschehnisse dort wieder enorm angeheizt.“
Er wandte sich an den Elementargeist, der nur als tanzendes, zitterndes Irrlicht erschien.
Nur May stand mit dem Elementargeist in so direkter Verbindung, dass sie an mich übermitteln konnte:
„Er hat es ebenfalls bereits wahrgenommen. Es ist, als würden die Kräfte von damals wieder aktiv werden, und er befürchtet, dass dies nicht allein hier, auf dieses Stück Teufelsmoor, beschränkt bleibt, wie es sich innerhalb der Sphäre befindet. Dieser Teil der Sphäre erscheint ihm wie ein Spiegel des eigentlichen Teufelsmoors.“
„Ja, teils, teils“, bestätigte der Werwolf halbwegs. „Ich glaube inzwischen, dass es damals durchaus gelang, die Kräfte zu bändigen, aber nur deshalb, weil sie rechtzeitig sozusagen hierher flohen. Vergesst nicht, der Herr dieser Sphäre, der untote Arnold Wolfit, benötigte Quellen der Magie, um seine Macht zu mehren. Dazu hat er nicht nur mich missbraucht, sondern auch den Zyklopen, Teile des jenseitigen Landes Oran, den Elementargeist und natürlich auch das Teufelsmoor. Wenn ich es aus jetziger Sicht genauer betrachte, ist das Teufelsmoor sogar eine Art Dreh- und Angelpunkt.“
Ich schaute May an. Sie erwiderte meinen Blick, und ich sprach aus, was wir in diesem Moment beide dachten:
„Vieleicht ist ja gerade das Teufelsmoor in seiner Einzigartigkeit die Chance für uns, dieser Sphäre zu entrinnen?“
„Wie sollte das denn geschehen?“, blieb der Werwolf skeptisch.
„Du hast selber gesagt, dass du glaubst, eine Verbindung zwischen dem Teufelsmoor hier, in der Sphäre, mit dem, was davon noch im Diesseits ist seit damals... würde irgendwie neu entstehen“, erinnerte ich ihn. „Oder habe ich da was missverstanden?“
„Nein, eigentlich nicht!“, gab der Werwolf zu. Doch dann schüttelte er den mächtigen, monströsen Körper und knurrte wieder. „Aber vielleicht weiß ich einfach noch nicht genug über die damaligen Vorgänge?“
Eindeutig die Aufforderung, endlich mit dem Bericht fortzufahren. Doch ich hatte noch etwas dagegen: „Wir sollten vielleicht erst einmal dorthin gehen, wo sich das Teufelsmoor befindet? Würdest du uns führen?“
Statt einer Antwort, wandte sich der Werwolf einfach ab und trottete voraus.
Der Elementargeist blieb an seiner Seite. Es war offensichtlich, dass er mit seiner mächtigen Magie den Werwolf unterstützen wollte, denn wir mussten aus der Teilzone, in der wir uns befanden, erst einmal heraus finden. Ohne die gewaltigen Energien des Elementargeistes würde uns das kaum möglich sein. Das war uns inzwischen sonnenklar. Und der Werwolf hatte keinen freien Auslauf mehr, seit er sich so offen gegen seinen einstigen Herrn und Meister, den Beherrscher dieser Sphäre, wandte und endgültig die Seiten gewechselt hatte.
Trotzdem erstaunte es mich, dass wir so schnell unser Ziel fanden. Wir mussten nur zweimal die Zone wechseln.
Nicht nur für uns ein neues Erlebnis übrigens, sondern natürlich auch für den Elementargeist, der lange genug Gefangener seines eigenen Bereiches geblieben war, bis zur Befreiung durch May Harris und mich.
Es war tatsächlich ein identisches Teufelsmoor. Wie in der Geschichte von damals, die dadurch für uns noch viel lebendiger wurde.
Unwillkürlich hielten wir Ausschau nach den Personen, die damals die Hauptrolle gespielt hatten, wohl wissend, dass es diese heute nicht mehr gab – und wenn doch noch, waren sie um Jahre gealtert...
*
Sergeant Olson hatte Cabot nicht alles gesagt. Natürlich glaubte er nicht mehr an Rambos Rückkehr. Aber er wollte nichts unversucht lassen. Deshalb fuhr er mit den beiden Konstablern zur Hauptstraße, die durch Crowlsbury hindurch geradewegs zum Teufelsmoor führte. Wenn Rambo irgendwo auftauchte, dann dort wohl zuerst.
Olson wies die beiden Polizisten an, Posten zu beziehen, während er für Ablösung sorgen wollte.
Er war gerade dabei, wieder in seinen Wagen zu steigen, als ihn Nyl am Arm festhielt. Wortlos deutete er über die Straße.
Ein Morris stand dort geparkt, ein grüner Morris mit Londoner Nummer.
„Glaubst du wirklich, es ist Rambos Auto?“, fragte Olson tonlos.
„Was heißt hier glauben, James, ich bin sicher.“
Christopher Davis trat hinzu.
„Er hat recht“, nickte er. „Ich habe den Wagen vor der Schule stehen sehen. Nachdem Cabot und Rambo weg waren, stand er nicht mehr dort.“
„Hast du die Nummer gesehen?“
„Natürlich nicht, James.“
„Wie kannst du dann so sicher sein?“
„Ich bitte dich“, begehrte Nyl auf. „Warum sollte denn noch so ein Londoner hierherkommen? Wäre es ein anderer und nicht Rambo, wüssten wir das bestimmt längst schon. In der gegenwärtigen Situation wäre dies doch von besonderer Brisanz.“
Olson winkte ab.
„Ihr habt recht. Trotzdem kann ich es nicht recht glauben.“
„Aber warum sollte es dieser Rambo nicht doch geschafft haben?“
„Schon, Davis, aber kannst du mir verraten, warum er sein Auto ausgerechnet hier abstellt und zu Fuß weitergeht?“
Nyl ging zu dem Morris und blickte hinein. Er winkte die anderen herbei.
„Da drin sieht es ja verheerend aus“, sagte Davis. „Alles ist voller Schlamm.“
„Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss ununterbrochen an Georg Konstantin denken“, murmelte Nyl.
Olson befühlte die Motorhaube.
„Das Fahrzeug steht noch nicht lange hier.“ Er nickte Nyl zu. „Vielleicht hast du recht, obwohl ich wünschte, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall müssen wir nach dem Rechten sehen.“
Sie hasteten zu Olsons Wagen.
„Ich habe das Gefühl, dass es bereits zu spät ist“, keuchte Davis beim Einsteigen.
James Olson wartete nicht, bis die Tür ganz zugezogen war. Mit schreienden Pneus wendete er.
*
Wenig später hielten sie vor Konstantins schmalem Ziegelsteinhaus und sprangen hinaus.
Aus dem Innern des Hauses drang Lärm.
Sie hetzten zur Haustür.
Ein furchtbarer Schrei. Ein Mensch in höchster Not!
Die Tür ließ sich nicht öffnen. Olson machte sich nicht die Mühe, zu klingeln. Er nahm einen Anlauf und rammte mit der Schulter gegen die Tür.
Diese krachte auf.
Im Halbdunkel des Treppenhauses stand Mrs. Konstantin. Aus verweinten, weitaufgerissenen Augen starrte sie ihnen entgegen.
Olson schob sie derb beiseite und hetzte zur Treppe.
„Verdammt, der Sergeant!“, rief jemand von oben.
James Olson schüttelte die Faust.
„Wehe, wenn ihr ihm etwas getan habt!“, brüllte er. „Ich zerreiße euch in der Luft!“
Dann war er oben. Nyl und Davis hatten alle Mühe, ihrem Vorgesetzten zu folgen.
Eine makabre Szene bot sich ihnen, als sie das Kinderzimmer betraten. Ein halbes Dutzend Männer stand um den am Boden liegenden Rambo herum. Dessen Kleidung war zerfetzt, und er war über und über mit Schlamm verkrustet. An der linken Brustseite blutete er. Im Bett lag die Leiche des Jungen.
Konstantin schaute langsam auf. Er hatte sich über Rambo gebeugt. Das Messer in seiner Rechten war rot verschmiert.
„Du wirst mich nicht von dem abhalten, was ich tun muss!“, knurrte er Olson an. Blitzschnell stieß er zu.
Aber die Männer, die Rambo festhielten, waren abgelenkt. Cliff konnte sich zur Seite werfen. Das Messer verfehlte ihn zum zweiten Mal und bohrte sich in die Dielen.
Olson packte Konstantin im Genick und riss ihn wie eine Puppe zurück. Georg Konstantin war ein hilfloses Bündel in den fleischigen Händen des Sergeant.
Olson schleppte den sich heftig sträubenden Mann zum Bett mit dem toten Jungen.
„Da, sieh ihn dir an, du Mistkerl“, brüllte er. „Sieh ihn dir gut an.“ Neben dem Bett stand ein niedriger Nachttisch mit mehreren Arzneifläschchen. Darüber hing ein halbblinder Spiegel. Olson drückte Konstantins Gesicht dagegen. „So, und dann betrachte diesen da. Das bist du, Georg Konstantin, du, der du deinem Sohn ausführlich die Schrecken von da draußen geschildert hast. Nein, nicht Rambo hat ihn auf dem Gewissen, sondern du!“ Angewidert stieß er Konstantin von sich.
Rambo erhob sich stöhnend vom Boden.
„Ihr seid keine Männer“, grollte James Olson. „Wie alte Weiber benehmt ihr euch. Ihr kennt kein anderes Thema als den Fluch. Ihr pumpt eure Kinder so mit Angst voll, dass sie schon zu zittern beginnen, wenn die Dämmerung aufsteigt.“
„Aber...“ Der breitschultrige Barry setzte zu seiner Verteidigung an. Olson schnitt ihm mit einer energischen Handbewegung das Wort ab.
„Ich weiß, was hier gespielt wird. Ich bin ebenso ein Kind dieses Städtchens wie ihr. Bisher habe ich das ganze Spiel mitgemacht, aber das wird sich ändern!“ Er deutete mit dem ausgestreckten Arm zum Fenster hinaus. „Da draußen lauert eine Gefahr, das wissen wir. Was aber haben wir bisher dagegen getan? Keiner von uns wagt es, einen Fuß vor die Stadt zu setzen. In Crowlsbury regiert die Angst.“
„Ich war draußen und habe mich der Gefahr gestellt!“, begehrte Georg Konstantin auf.
Olsons Blick traf ihn wie ein Flammenschwert.
„Wahrscheinlich hast du dich damit auch noch vor deinem Sohn gebrüstet, wie?“
„Das war nicht nur mein gutes Recht, sondern auch meine Pflicht. Ich habe ihn gründlich aufgeklärt, ihm alles gesagt, im Rahmen dessen, in dem es mir möglich war.“
„Und hast damit deinen Jungen zugrunde gerichtet!“ Olson klopfte ihm mit der Faust gegen die Stirn. „Will es denn nicht in deinen dämlichen Schädel hinein, woran der Bub gestorben ist? Die Angst und das Grauen haben ihn umgebracht - die Angst und das Grauen, von dir gesät!“
Die Männer redeten empört durcheinander. Rambo drückte sich in eine Ecke des Raumes.
Olson fuhr zwischen die schwatzenden Männer wie ein Orkan. Er wirbelte sie durcheinander und warf sie einen nach dem anderen eigenhändig hinaus, auch Georg Konstantin.
Dann waren er, Nyl und Davis mit Cliff Rambo allein. Olson besah sich die Brustwunde.
„Sie haben mir das Leben gerettet“, keuchte Cliff. „Als Sie unten die Tür aufbrachen, wollte dieser Konstantin gerade zustoßen. Durch die Ablenkung hat er mich nicht richtig getroffen. Es ist, glaube ich, nur eine Fleischwunde.“
„Mann, Sie sehen wirklich schrecklich aus!“, entfuhr es Davis. In seinen Augen stand noch immer das Entsetzen über die Szene, die sich ihm geboten hatte.
Auch Nyl bemühte sich, abzulenken.
„Wir müssen Sie sofort zu einem Arzt bringen.“
Cliff winkte ab.
„Ich glaube kaum, dass das notwendig ist. Bei mir heilen Wunden extrem schnell. In ein paar Stunden, spätestens morgen früh, wird alles vergessen sein.“
Die Polizisten sahen ihn ungläubig an.
„Sie wollen uns wohl auf den Arm nehmen, was?“, grollte Olson. „So etwas habe ich ja noch nie gehört.“
„Sie können mir ruhig glauben, Sergeant.“ Cliff versuchte ein Lächeln. „Es haben sich auch schon andere darüber gewundert.“
Olson schüttelte den Kopf.
„Sie werden mir immer unheimlicher. Bald glaube ich auch, dass Ihre Anwesenheit die dunklen Mächte da draußen herausfordert. Was ist eigentlich an Ihnen so besonders?“
Cliff schaute ihn verständnislos an.
Olson winkte ab.
„Egal, wir gehen jetzt trotzdem zum Doc.“ Er wandte sich zur Tür. Nyl und Davis hakten Cliff unter.
„Einen Moment noch“, rief dieser. „Sergeant, ich habe eine Frage.“
Olson blieb in der Türöffnung stehen und drehte sich um.
„Was ist noch?“
„Ich habe draußen eine verlassene Baustelle gefunden.“
Die Männer blickten sich betroffen an.
„Was - was für eine Baustelle?“, ächzte James Olson endlich.
Cliff erzählte ihnen in groben Zügen, was er gesehen hatte. Den Lastwagen, der auf ihn Jagd gemacht hatte, ließ er allerdings aus.
James Olson fühlte sich äußerst unbehaglich.
„Es stimmt, dass da draußen einmal eine Baustelle war“, rückte er endlich mit der Sprache heraus. „Sie müssen sich dennoch geirrt haben, denn das ist schon Jahre her.“
Cliff blickte ihn skeptisch an.
„Auf mich hat das mehr den Eindruck gemacht, als habe man die Baustelle erst vor Tagen errichtet. Wären Jahre vergangen, hätte die feuchte Luft einen Teil der Geräte zerstört. Außerdem hat mir John Reicher kein Wort davon gesagt.“
„John Reicher hat zu Ihnen gesprochen?“ Olsons Augenbrauen zuckten nach oben. „Ach, das ist ja interessant. Sie haben also auch die Gabe, sich mit einem Toten zu unterhalten?“
Cliff hätte sich am liebsten eine runtergehauen. Jetzt war es aber heraus, und er musste Farbe bekennen. Er erzählte von dem Telefonanruf Reichers vor ein paar Tagen.
„Hören Sie, Mr. Rambo“, sagte James Olson, „ich weiß selbst, dass es unglaubwürdig klingt, aber es stimmt, dass die Baustelle schon vor Jahren da draußen errichtet wurde. Es handelte sich um eine Baufirma aus dem größten Ort in der näheren Umgebung, aus Cansville. Der Besitzer war ein gewisser Joseph Greene. Die Firma war nicht besonders groß. Greene wollte mit den Straßenarbeiten da draußen ein großes Geschäft machen. Da niemand dort arbeiten wollte, kletterten die Angebote in astronomische Höhen. Er sagte zu. Die Arbeiter stammten alle nicht aus dieser Gegend. Vielleicht haben Sie das an den Nummernschildern der Autos gesehen?“ Cliff hatte nicht, nickte aber, damit Olson fortfuhr: „Die Männer fürchteten weder Tod, noch Teufel, außerdem wurde ihnen eine Menge Geld bezahlt.
Ein paar Tage lang ging alles gut. Abends fuhren sie nach Cansville, übernachteten dort und setzten morgens ihre Arbeit fort. Hier in Crowlsbury wäre es natürlich näher für sie gewesen, aber niemand wollte sie beherbergen - auch nicht die Bürger von Solswell auf der anderen Seite des Gebietes.
Als sie eines Abends nicht in Cansville eintrafen, dachte sich niemand etwas dabei. Man hielt es für möglich, dass sie gewesen. Schließlich kehrten sie dorthin nicht wieder zurück. Man nahm zunächst an, dass sie trotz allem entweder bei uns oder in Solswell eine Bleibe für die Nacht gefunden hätten. Erst nach Tagen wurde man misstrauisch. Ich wurde beauftragt, nach dem Rechten zu sehen, lehnte es aus verständlichen Gründen allerdings ab. Das brachte mir ein Disziplinarverfahren ein, ließ mich aber überleben.
In Cansville wurde eine Kommission gebildet. Acht der zwölf Beauftragten kehrten der Sache rechtzeitig den Rücken. Die anderen vier Unverbesserlichen drangen in das Gebiet ein.
Wieder vergingen mehrere Tage. Da fand ein Bauer von Solswell auf seinem Acker zwei Männer. Es waren Joseph Greene und sein Polier. Sie waren beide völlig am Ende und lagen offenkundig schon seit einiger Zeit dort ohnmächtig im Feld - wahrscheinlich sogar seit dem Tag ihres Verschwindens. Bei anderer Witterung wären beide mit Sicherheit tot gewesen. Sie wurden gerettet. Der Polier allerdings hatte seinen Verstand verloren. Er stammelte ununterbrochen unzusammenhängendes Zeug.
Joseph Greene verzichtete offiziell auf weitere Untersuchungen des Falls und verschwand von heute auf morgen von der Bildfläche. Wahrscheinlich lebt er irgendwo unter falschem Namen.“
Olson räusperte sich.
„Sie sehen, Mr. Rambo, dass ich offen bin und Ihnen nichts verheimliche. Hoffentlich halten Sie das von jetzt ab auch so mit mir?“
Cliff nickte geistesabwesend.
„Sagen Sie, was wurde aus den Männern der Kommission und aus den Arbeitern?“
Olson zuckte mit den Achseln.
„Das weiß kein Mensch. Sie tauchten nie mehr auf. Die Presse und die Behörde haben irgendeine halbwegs plausible, wenn auch unzutreffende Erklärung gefunden, und im Übrigen interessierte sich später kein Mensch mehr dafür. Die Verschollenen gelten offiziell als tot.“
„Ich kann es nicht glauben“, schüttelte Cliff den Kopf.
„Nun aber los“, grollte Olson und gab seinen Männern einen Wink.
Sie gingen die Treppe hinunter.
Im Flur waren die Männer versammelt, die Olson aus dem Kinderzimmer geworfen hatte. Erst jetzt kam es Cliff wieder in den Sinn, dass sie die ganze Zeit mit dem toten Jungen zusammen gewesen waren. Er konnte all das, was er in den letzten zwölf Stunden erlebt hatte, einfach nicht begreifen. Noch vor einem Tag hätte er jeden für verrückt erklärt, der ihm etwas Ähnliches erzählt hätte.
Und da war das Gefühl, dass sie erst am Anfang standen, dass ihnen das Schlimmste noch bevorstand.
„Ihr seid also immer noch nicht weg“, sagte Olson angriffslustig.
„James, du machst einen großen Fehler, wenn du dem Mann hilfst“, beschwor ihn Konstantin. „Er ist eine Gefahr, und das weißt du selbst. Wenn wir nichts unternehmen, wird es eine andere Macht tun. Das Teufelsmoor wird uns alle verschlingen!“
In seiner Erregung hatte er es ausgesprochen: Teufelsmoor!
Die Männer erblassten.
Die Küchentür flog auf. Mrs. Konstantin rannte auf den Flur. Sie schrie gellend und fiel ihrem Mann um den Hals.
„Mein Gott, Konstantin“, stammelte Olson, „wie konntest du nur?“ Der starke Mann zitterte.
„Unsinn!“ Cliff versuchte, seiner Stimme Festigkeit zu geben. Es misslang. „Wenn es gefährlich wäre, müsste schon etwas passiert sein. Es ist einfach lächerlich, zu glauben, dass das Aussprechen des Wortes Teufelsmoor...“
„Wenn Sie das noch einmal sagen, schlage ich Ihnen eigenhändig die Zähne ein!“, drohte Olson. Cliff glaubte es ihm aufs Wort. Er hielt den Mund.
Mrs. Konstantin schluchzte laut. Die Gesichter aller waren kalkweiß. Georg Konstantin schaute sich mit schreckgeweiteten Augen um. Er war unfähig, ein Wort zu sagen.
„Los“, kommandierte der Sergeant, „wir gehen.“ Er gab seinen beiden Männern und Cliff einen Wink.
In Georg Konstantin kam plötzlich Bewegung.
„Nein“, stöhnte er auf, „das könnt ihr nicht tun!“
Olson blieb stehen.
„Was können wir nicht?“
„Verdammt, siehst du denn nicht, warum mir nichts passiert? Dieser Rambo ist daran schuld. Seine Anwesenheit schirmt die teuflische Kraft von uns ab. Wenn ihr aber - ihr aber geht, dann...“
„Mach dich nicht lächerlich“, rief der breitschultrige Barry dazwischen. „Hier kann dir nichts geschehen. Vielleicht haben die Teufel da draußen im Moment etwas anderes zu tun? Vielleicht achten sie zu sehr auf diesen Rambo?“ Es klang wenig überzeugend.
Konstantin ging auf Cliff Rambo zu. Seine Frau klammerte sich schreiend an ihn. Er stieß sie zurück. In seinen Augen stand nackte Todesfurcht. Die Frau fiel auf den Boden. Zwei Männer kümmerten sich um sie und stellten sie wieder auf die Beine.
Konstantin packte Cliff hart am Kragen.
„Hören Sie, Sie dürfen nicht von meiner Seite weichen. Ich weiß nicht, was das für eine Kraft in Ihnen ist, aber sie wird mich am Leben erhalten.“
„Vor nicht allzu langer Zeit wolltest du ihn töten“, sagte Olson eisig. Er schob Konstantin weg.
In diesem Augenblick wurde Cliff von der Frau angesprungen. Sie hatte sich blitzschnell von ihren Helfern losgerissen. In ihrer hocherhobenen Rechten blitzte ein Messer. Es sauste auf Cliff nieder.
Geistesgegenwärtig warf sich dieser zurück. Der Stoß ging ins Leere. Aber Mrs. Konstantin gab nicht auf. Wie eine Furie drang sie auf den Yardmann ein. Ihr Gesicht war eine hasserfüllte Grimasse.
Olson hielt sie zurück. Mühelos entwand er ihr das Küchenmesser.
„Dieser Mann bringt Unglück über uns alle!“, geiferte sie. Schaum lag auf ihren Lippen.
Olson sah Cliff an. Dann deutete er mit dem Kopf hinaus.
„Nein, das könnt ihr nicht tun“, schrie Konstantin.
„Du Mistkerl!“ fuhr ihn Christopher Davis an, „siehst du denn nicht, was mit deiner Frau los ist? Und oben liegt dein toter Sohn. Willst du, dass deine Frau genauso endet wie er? Rambo muss raus hier. Erst dann kann sie sich beruhigen.“
„Aber es geht um mein Leben.“ Georg Konstantin sank schluchzend auf die Knie und barg das Gesicht in beiden Händen.
Die tobende Frau wurde Olson abgenommen. Er drängte Cliff und die beiden Konstabler hinaus.
Sie waren gerade dabei, in den Wagen zu steigen, als im Haus Konstantins das Chaos ausbrach.
Die vier Männer standen stocksteif da. Es dauerte eine Weile, bis sie aus der Erstarrung erwachten.
Aber nur Christopher hatte die Überwindungskraft, zum Haus zurückzugehen.
Er blieb nicht lange. Als er wieder zu dem Wagen trat, schien er mit den Nerven am Ende. Er zitterte wie Espenlaub.
„Was ist passiert?“, drängte ihn James Olson, obwohl eine Antwort kaum notwendig gewesen wäre.
„Sie haben Georg regelrecht in Stücke gerissen!“, kam es ächzend über Davis' Lippen.
*
„Nyl und Davis werden das Haus im Auge behalten. Ich muss Sie bitten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, wenn Sie gehen wollen“, sagte der Sergeant. „Wir dürfen kein Risiko eingehen.“ Er räusperte sich. „Außerdem ist die Gegend außerhalb der Stadt für Sie ab sofort tabu. Ich muss Sie im Auge behalten. Es ist nur zu Ihrem Besten.“
„Davon bin ich überzeugt“, sagte Cliff, ohne erkennen zu lassen, ob er es wirklich so meinte.
Sie saßen im Wagen vor dem Haus der Witwe Ballerd. Cliff war inzwischen ärztlich versorgt worden. Seinen Wagen hatte er am Ausgang der Stadt stehenlassen. Zum Sergeant hatte er gesagt, es sei schließlich egal, wo der Morris stehe. Er war dort so gut aufgehoben wie hier. Aber der wahre Grund war natürlich ein anderer.
Cliff stieg aus.
„Was ist, wenn ich nach London zurückkehren will?“
„Das muss ich Ihnen leider untersagen. Sie sind ein wichtiger Zeuge im Fall Konstantin. Wahrscheinlich wird bald Inspektor McCormick hier auftauchen, um den Fall zu untersuchen.“
„Das passt Ihnen wohl nicht ganz, wie?“
„Es passt mir nie, wenn ein Mensch sein Leben hat lassen müssen“, entgegnete der Sergeant eisig.
Cliff biss sich auf die Unterlippe und ging zum Haus.
Christopher Davis postierte sich vor den Eingang, Jack Nyl begab sich hinter das Haus.
James Olson fuhr davon. Cliff sah ihm nicht nach.
Er blieb stehen und schaute nachdenklich zum Fenster Cabots hinauf. Ein seltsames Gefühl war in ihm erwacht. Und hatte sich nicht eben die Gardine bewegt? Nein, er musste sich geirrt haben. In dem diffusen Licht der Straßenbeleuchtung konnte man ohnehin kaum etwas erkennen.
Mit dem Schlüssel, den ihm die Witwe Ballerd überlassen hatte, öffnete er und wollte eintreten.
Jemand kam über die Straße gelaufen.
Es war Roberta Ballerd. Schweratmend erreichte sie ihn.
„Bitte, gehen Sie nicht hinein, Mr. Rambo!“, bat sie eindringlich.
Cliff lächelte amüsiert. Davis kam neugierig näher.
Roberta Ballerd sah ängstlich zu Cabots Fenster empor.
„Bleiben Sie hier, Mr. Rambo“, flehte sie. „Dort drinnen lauert Gefahr.“
„Was ist denn los?“, fragte Christopher Davis. „Was haben Sie? Wer lauert da drin?“
„Cabot“, sagte sie geheimnisvoll.
„Natürlich“, versetzte Cliff, „wer sollte es sonst sein?“
„Aber, Sie verstehen nicht, Mr. Rambo: Cabot ist vom Teufel besessen!“ Ihre Augen waren groß und rund. Ihre Lippen bebten.
„Mrs. Ballerd, was reden Sie denn da?“, meinte der Konstabler kopfschüttelnd. „Ich habe noch am Abend mit ihm gesprochen. Er erschien mir völlig normal.“
„Ich bin nicht mehr die Jüngste, Konstabler, aber immer noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte“, entgegnete sie scharf. „Ich habe es deutlich gesehen. Seine Augen leuchteten von innen heraus, und sein Gesicht war eine dämonische Fratze.“
Christopher Davis konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Die Witwe drohte mit der Faust.
„Das werden Sie bereuen“, zischte sie. Zu Cliff Rambo gewandt, fügte sie hinzu: „Ich wollte Sie nur warnen. Es ist Ihre Sache, was Sie daraus machen.“
„Sie müssen halt nur aufpassen, dass Sie sich nicht an den glühenden Augen verbrennen“, gluckste Davis.
Roberta Ballerd stampfte wütend mit dem Fuß auf. Dann rannte sie über die Straße davon, ängstliche Blicke auf Cabots Fenster werfend.
Sehr nachdenklich betrat Cliff das Haus.
„Ich brauche ja wohl nicht mitzugehen, was?“, fragte Davis.
Cliff antwortete ihm nicht. Er konnte sich nicht helfen, aber die Warnung der Witwe hatte das eigenartige Gefühl in seinem Innern noch verstärkt. Was erwartete ihn wirklich?
Dann schalt er sich einen Narren. Natürlich, er hatte in den letzten Stunden Furchtbares erlebt. War das aber ein Grund, sich verrückt zu machen?
Glühende Augen und eine dämonische Fratze?
Er schüttelte den Kopf und schloss hinter sich die Haustür. Langsam stieg er die Treppe hinauf.
*
Trotz allem musste er zugeben, dass die Witwe vielleicht doch etwas gesehen hatte, was zumindest ungewöhnlich war. Immerhin musste es einen Grund dafür geben, dass sie um diese Zeit noch auf den Beinen war und sich außerdem nicht zu Hause aufhielt, sondern irgendwo anders Unterschlupf gefunden hatte.
Doch er schob diese Gedanken von sich und ging den kurzen Flur entlang zu seinem Zimmer.
Dabei musste er an Cabots Tür vorbei. Unschlüssig blieb er stehen. Sollte er nach dem Lehrer sehen?
Doch dann stellte er sich vor, wie Robert Cabot reagieren würde. Nein, der Mann brauchte seinen Schlaf. Er musste wieder früh auf die Beine.
Langsam ging er weiter.
In diesem Moment wurde die Tür zu Cabots Zimmer aufgerissen. Cliff fuhr herum.
Robert Cabot sah schrecklich aus. Seine Haare hingen ihm wirr ins Gesicht, seine Augen waren entzündet, die Tränensäcke dick geschwollen. Das ganze Gesicht war aufgedunsen.
Cliff erschrak. In der zitternden Rechten hielt Cabot eine Pistole. Die Mündung der Waffe zeigte direkt auf Cliff Rambos Bauchnabel. Langsam krümmte sich der Zeigefinger des Lehrers um den Abzug.
Cliff hatte einen Moment den Eindruck, die kleine, schwarze Öffnung der Mündung würde ihn verschlingen. Er rechnete seine Chancen aus.
Er hatte keine! Cabot stand fast zwei Meter von ihm entfernt in der Tür. Die Entfernung war zu groß. Cabot brauchte nur den Finger krummzumachen.
Nun habe ich in diesem verfluchten Ort soviel überstanden, dachte Cliff erbittert, soll mich jetzt hier das Schicksal ereilen?
*
Die Pistole polterte zu Boden. Mit einem dumpfen Laut brach Robert Cabot zusammen.
Mit zwei Schritten hatte ihn Cliff erreicht. Mit dem Fuß trat er gegen die Waffe. Sie schlidderte über den Flur zur Treppe. Cliff bückte sich nach dem Lehrer.
Der Mann war ohne Bewusstsein.
Cliff wuchtete ihn hoch und trug ihn zum Bett im Innern des Zimmers. Kaum lag der Lehrer, schlug er die Augen auf.
Verständnislos blickte er um sich.
„Was ist passiert?“
„Sie waren gerade drauf und dran, mich zu erschießen!“, antwortete Cliff rau.
„Was?“ Cabot ruckte auf, sank aber im nächsten Moment wieder stöhnend in die Kissen zurück. Mit schmerzverzerrtem Gesicht betastete er seinen Kopf. „Verdammt, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Doch, da war eine seltsame Benommenheit in mir, als Olson mit seinen Männern ging. Ich dachte an Sie und...“
„Was war danach?“
Cabot zuckte mit den Achseln.
„Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ohnmächtig geworden? Wo haben Sie mich gefunden? Hier auf dem Bett liegend?“
„Sie standen in der Tür, mit der Pistole in der Faust.“
„Um Gottes Willen, Mr. Rambo.“ Cabot sah zum Schreibtisch. „Tatsächlich, die Waffe ist weg.“
„Sie liegt draußen auf der Treppe.“
„Aber ich begreife das alles nicht.“
Cliff erhob sich. Er nickte grimmig.
„Ich schon, Mr. Cabot. Mrs. Ballerd wollte mich vor Ihnen warnen, und ich glaubte ihr nicht.“
„Sie glauben, die Teufel da draußen wollten, dass ich Sie umbringe?“
„Denken Sie einmal nach. Sie wären nicht der erste in diesem Ort, der zu einer mordenden Marionette geworden ist.“
„Aber warum habe ich es dann doch nicht getan?“
„Eine gute Frage!“ Cliff erzählte dem Lehrer, was inzwischen passiert war. „Das alles deutet tatsächlich darauf hin, dass irgendetwas in mir ist, gegen das die Teufel im Moor nichts ausrichten können. Ihre Angriffe müssen stets indirekt erfolgen. Über mich selbst haben sie keine Gewalt.“ Er ging hinaus und kehrte mit der Pistole in der Hand zurück. „Wo haben Sie denn das Ding her?“
Cabot sagte es ihm.
„Sie können es behalten“, fügte er hinzu. „Ich möchte nicht ein zweites Mal in eine solche Situation kommen.“ Er setzte sich vorsichtig auf.
„Geht es Ihnen wieder besser?“
„Danke der Nachfrage. Mein Kopf fühlt sich an, als habe ihn jemand mit der Axt bearbeitet, aber ansonsten bin ich gesund.“ Cabot lachte verbittert. „Wenn es nicht schlimmer wird, kann ich zufrieden sein.“
Cliff betrachtete nachdenklich die Pistole.
„Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. Ich bin britischer Polizist. Sie wissen, dass wir keine Waffen besitzen dürfen.“
„Sie sind ein Narr, Mr. Rambo. Entschuldigen Sie, wenn ich es so hart ausspreche, aber denken Sie daran, was inzwischen alles hier passiert ist. Glauben Sie wirklich, dass Sie auf eine Waffe verzichten können - auch wenn Sie dabei gegen das Gesetz verstoßen? Mir wäre jedenfalls mein Leben lieber als die strikte Einhaltung des Gesetzes.“
„Also gut.“ Cliff steckte die Pistole ein. „Sie haben mich überzeugt.“
„Was werden Sie jetzt tun?“
„Erst einmal schlafen. Ich glaube, das habe ich verdient. Wahrscheinlich wird ohnehin bald Inspektor McCormick hier auftauchen und unangenehme Fragen stellen.“
Cliff ging zur Tür.
„Auf jeden Fall wünsche ich eine gute Nacht“, sagte er im Weggehen.
„Ich glaube, die Erfüllung dieses Wunsches hätten Sie mehr verdient als ich“, murmelte Robert Cabot und schaute ihm nach.
Cliff hörte es nicht mehr.
Bevor er zu Bett ging, nahm er ein Bad.
Der Morgen dämmerte schon fast, als er endlich einschlief. Es wurde ein sehr unruhiger und wenig erholsamer Schlaf.
*
Um neun Uhr morgens schreckte er auf.
Cabot hatte also rechtbehalten. Der Inspektor hatte ihn noch nicht so früh besucht.
Cliff Rambo fühlte sich wie zerschlagen. Er warf die Decke zur Seite und begab sich erst einmal unter die Dusche.
Die Witwe war noch nicht zurückgekommen. Er musste sich sein Frühstück selbst zubereiten. Cabot hatte einen Zettel auf den Küchentisch gelegt, auf dem stand, wo er alles finden würde.
Cliff wurde zum ersten Mal bewusst, dass er seit dem Mittag des vorangegangenen Tages nichts mehr gegessen hatte. Der Körper verlangte sein Recht. Roberta Ballerd hätte wohl die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hätte sie ihn beim Plündern des Kühlschrankes sehen können.
Eine halbe Stunde nach dem Aufstehen fühlte sich Cliff wieder einigermaßen als Mensch. Nachdenklich ging er auf sein Zimmer. Er dachte an das Vergangene. Jetzt, nachdem er die Sache einmal überschlafen hatte, erschien ihm alles unwirklich, wie ein schon halbvergessener Albtraum.
Er befühlte die Wunde an der Brust. Sie war tatsächlich so gut wie verheilt.
Früher hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, dass er nie krank wurde und dass sich sein Körper unglaublich schnell regenerieren konnte. Er hatte es einfach als gegeben hingenommen. Jetzt machte es ihn nachdenklich. Was unterschied ihn von den anderen Menschen?
Unwillkürlich musste er an seine Großmutter denken. Sie hatte aus dieser Gegend gestammt. Was war in der Vergangenheit passiert? Gab es vielleicht einen Zusammenhang zwischen ihr und diesem rätselhaften Fluch?
Cliff konnte sich das Hirn zermartern wie er wollte, aber er kam zu keinem vernünftigen Ergebnis.
Er trat ans Fenster und schaute hinaus. Auf der anderen Seite der Straße stand ein Konstabler. Er machte sich keine Mühe, unentdeckt zu bleiben. Olson hatte deutlich genug gesagt, dass er das Haus bewachen ließ.
Cliff hatte seinen Morris abseits von hier stehenlassen, um jederzeit ungesehen mit ihm wegfahren zu können.
Aber zuerst musste es ihm gelingen, unbemerkt das Haus zu verlassen.
Er ging auf den Flur hinaus. Zwei Zimmer befanden sich auf der Rückseite des Hauses.
Im Erdgeschoß waren Küche, Wohnzimmer und eine große Abstellkammer, da das Haus über keinen Keller verfügte.
Cliff betrat das Bad. Auch im Hof stand ein Polizist. Wie konnte es ihm gelingen, unauffällig aus dem Haus zu kommen?
Leise öffnete er das Fenster. Der Polizist blickte nicht herauf.
Vorsichtig beugte sich Cliff hinaus. Eine hohe Mauer trennte auf dieser Seite das Anwesen der Witwe Ballerd vom Nachbargrundstück. Das war Cliffs Chance.
Der Konstabler sah sich gelangweilt um, warf aber gottlob keinen einzigen Blick herauf.
Die Abdeckplatte der Mauer befand sich tiefer als die Fensterbank und war drei Fuß zur Seite versetzt.
Bange Sekunden verstrichen, bis es Cliff endlich gelang, mit dem Fuß die Mauer zu erreichen. Er schaute nach unten. Der Hof war immerhin drei Yard tief. Wenn er abrutschte und unglücklich unten aufkam...
Mit aller Kraft stieß er sich ab. Mit rudernden Armen kämpfte er um sein Gleichgewicht. Dann ließ er sich auf die Knie nieder.
Ein letztes Mal sah er nach dem Polizisten, der nicht ahnte, was über seinem Kopf vor sich ging.
Leise ließ sich Cliff Rambo auf der anderen Seite von der Mauer rutschen. Wie eine Katze sprang er in den Nachbarhof.
Hinter dem Hof öffnete sich ein schmaler Garten.
Cliff musste mehrere Zäune überklettern, bis er es endlich wagen konnte, die Straße zu betreten.
*
Minuten später stand er schweratmend neben seinem Wagen. Olson hatte es versäumt, auch ihn bewachen zu lassen, wie sich Cliff nach einem kurzen Rundblick überzeugen konnte.
Er klopfte den Staub aus dem Jeansanzug, den er für sein Unternehmen angezogen hatte, klemmte sich hinter das Steuer des Morris und wendete.
Er zögerte einen Moment. Dann gab er Gas und brauste in Richtung Teufelsmoor davon.
Hätte er geahnt, was ihn erwartete, wäre er wohl auf der Stelle wieder umgekehrt.
*
Es sah alles so aus wie am Vortag. Ohne Zwischenfall erreichte Cliff Rambo die Baustelle. Die Absperrung war vom Lastwagen durchbrochen worden. Das große Fahrzeug war ins Moor gerollt und zu Zweidrittel untergegangen. Irgendwo hing es fest, was ein Tiefersinken verhinderte.
Cliff bog in den Weg, auf den das Umleitungsschild gedeutet hatte. Jetzt lag das Schild verbogen auf der gepflasterten Straße.
Auf diesem Weg befand sich eine schmale Fahrspur. Ungezählte Räder hatten sich in den glitschigen Boden gegraben. Der kleine Morris schlingerte wild, brach aber dank der Fahrspur nicht zur Seite aus.
Die knorrigen Bäume rechts und links des Weges rückten näher zusammen. Alle hundert Yard befand sich eine Ausweichstelle für entgegenkommende Fahrzeuge.
Plötzlich endete der Weg an einer trüben Wasserfläche. Cliff konnte gerade noch bremsen. Schliddernd kam der Wagen zum Stehen.
Die bizarren Baumkronen verdunkelten den Himmel über ihm. Deshalb hatte Cliff längst schon die Scheinwerfer eingeschaltet. Fluchend stieg er aus.
„Das gibt es doch nicht“, murmelte er vor sich hin. „Wieso endet der Weg im Wasser?“ Erst nach etwa fünfzig Yard tauchte der Weg wieder aus der schlammigen Brühe auf.
Cliff untersuchte die Fahrspuren. Alles deutete darauf hin, dass der Weg einmal häufig benutzt worden war. Offenbar waren alle Verschollenen hier entlanggekommen. Aber waren sie mitten durch das Wasser gefahren? Cliff konnte sich das nicht recht vorstellen.
„Vielleicht ist das wieder eine Finte der teuflischen Mächte, die das Moor regieren?“, fragte er sich halblaut. Er suchte sich einen Stock, mit dem er die Wassertiefe prüfte.
Erstaunt runzelte er die Stirn. Offenbar war er doch etwas zu vorsichtig. Das vor ihm war nichts als eine übergroße Pfütze, nur wenige Zoll tief. Wenn er langsam fuhr, konnte er sie ohne Schwierigkeiten mit dem Wagen überwinden.
Trotzdem ging Cliff weiter, immer wieder mit dem Stock stochernd. Das Wasser drang ihm in die Schuhe. Es quatschte bei jedem Schritt.
Dann war er auf der anderen Seite. Hinter sich sah er das Licht der Scheinwerfer. Achselzuckend kehrte er um.
In diesem Moment rauschte es über seinem Kopf, Äste knackten. Für den Bruchteil einer Sekunde drang das Licht der Sonne bis zum Boden herunter, dann verdunkelte eine Wolke wieder den Himmel.
Cliff legte den Kopf in den Nacken. Ein riesiges Etwas schwebte über den Baumwipfeln. In seinem Schatten war pechschwarze Nacht.
„Verdammt“, entfuhr es Cliff, „was ist das?“
Ein schrecklicher Schrei hallte durch den dichten Wald. Es klang wie der Entsetzensruf einer Gruppe von Menschen.
Menschen?
Es rauschte in den Baumkronen. Wind kam auf, zerrte an Cliffs Haaren. Wie gebannt starrte der Mann nach oben.
Der mächtige Schatten schwebte langsam weiter.
Cliff erkannte einen mächtigen, gebogenen Schnabel, wie der eines Geiers. Daraus drang dieser furchtbare Laut.
Der Schatten entpuppte sich als Vogel, der mit mächtigen Schwingen über den Wald trieb.
„Die Mächte des Teufelsmoors beginnen den Kampf“, sagte Cliff tonlos. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war kurz vor elf Uhr vormittags.
Mit hölzernen Schritten kehrte Cliff zu seinem Wagen zurück und warf sich hinter das Steuer. Brummend zog der Motor an. Die Räder wälzten sich durch die Schlammbrühe. Cliff fuhr vorsichtig.
Als er die Pfütze hinter sich hatte, beschleunigte er etwas. Der Weg machte eine sanfte Biegung. Das Licht der Scheinwerfer stach in das Halbdunkel.
*
Ein kleiner Busch stand zwischen den beiden Fahrspuren. Nachdenklich hielt Cliff an.
Es war ihm unerklärlich, wie die Pflanze hierhergekommen war, wenn der Weg schon seit einem Jahrhundert in unregelmäßigen Abständen benutzt wurde. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass die Natur hier wie tot erschien. Die Pflanzen waren alt. Für junges Leben war offenbar kein Platz. Und jetzt dieser Busch.
Misstrauisch stieg Cliff aus. Der Motor tuckerte im Leerlauf. Der Busch besaß dornige Äste, aber keine Blüten.
Und da sah Cliff das Unglaubliche. Die Wurzeln waren nicht im Boden verankert! Sie bewegten sich zitternd. Langsam wanderte die Pflanze auf ihn zu.
Mit einem erstickten Laut wich Cliff zurück, bis er mit den Beinen gegen den Wagen stieß. Der Busch wurde schneller, hatte ihn fast erreicht.
Die dornigen Zweige begannen zu wedeln. Plötzlich wirkten sie wie knochige Hände, die nach dem Mann griffen.
Der furchtbare Schrei klang wieder auf. Das Vogelmonster rauschte über den Weg hinweg, kehrte zurück, verharrte über Cliffs Kopf.
Dornen gruben sich tief in sein Fleisch. Über ihm brachen Äste und prasselten auf den Weg und auf den Wagen herab. Der Vogel keuchte gierig.
Endlich kam in Cliff Bewegung. Er trat nach dem Busch. Das dünne Holz splitterte wie Glas. Nein, das war kein selbständiges Wesen. Irgendeine Macht beseelte die tote Pflanze.
Cliff warf sich zur Seite. Der mächtige Schnabel des Vogels zischte dicht an ihm vorbei. Es stank bestialisch nach Aas.
Cliff hetzte davon. Das Wesen folgte ihm, die Schwingen dicht an seinen mächtigen Leib gepresst. Es erinnerte tatsächlich an einen Geier, war aber gut fünfmal so groß. Welcher Hölle war es entsprungen?
Cliff rannte um sein Leben. Tatsächlich vergrößerte sich der Abstand. Das dämonische Tier kam auf Grund seiner Größe nicht so schnell voran.
Rambo erinnerte sich an die Pistole, die ihm Cabot gegeben hatte. Er zerrte sie aus der engen Jackentasche und blieb stehen.
Kreischende Laute ausstoßend hüpfte der Vogel auf ihn zu. Die scharfen Krallen wühlten den Boden auf, der mächtige Leib entwurzelte Bäume.
Cliff Rambo lud durch und schoss.
Die erste Kugel verfehlte das Ziel.
Rambo zwang sich zur Ruhe und zielte sorgfältiger.
Es war, als ahnte das Tier etwas von der Gefahr. Es hielt inne und glotzte ihn mit einem seiner triefenden Augen an.
Cliff schoss direkt hinein. Der Kopf des Wesens flog zur Seite. Der Körper zuckte. Das andere Auge fixierte den Mann, während sich der Vogel näherschob.
Jetzt war Cliff eiskalt. Er zielte sorgsam. Die Bestie war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt, als er zum zweiten Mal schoss. Das getroffene Auge lief aus.
Ein röhrender Laut klang auf, umfauchte Cliff wie ein Sturmwind. Der Schnabel hackte blind nach ihm.
Cliff warf sich herum und rannte weiter. Hinter ihm brach die Hölle aus. Dann war plötzlich alles still.
*
Cliff wartete eine Weile. Erst dann wagte er es, zurückzukehren. Er erreichte die Stelle, an der er das Monster zum zweiten Mal angeschossen hatte. Er hatte den Platz über die Biegung des Weges nicht mehr einsehen können, nachdem er weggelaufen war.
Die dämonische Kreatur war verschwunden! Sie hatte sich nicht etwa wieder in die Lüfte erhoben, denn das hätte man sehen können. Nein, der Tunnel, den die Bäume über dem Weg bildeten, war unbeschädigt. Wo aber war die Bestie geblieben?
War er, Cliff, einer Halluzination zum Opfer gefallen?
Nein, die Spuren des Kampfes waren noch vorhanden. Der Weg war übersät mit abgebrochenen Zweigen und kleineren Ästen.
Cliff traf die Erkenntnis wie ein Schlag:
Seine Großmutter, die alte Mary Rambo, hatte eines Abends seinem Vater ein kleines, schwarzes Büchlein gezeigt. Die beiden waren sehr ernst gewesen. Cliff hatte sie durch das Schlüsselloch beobachtet.
Mary Rambo hatte seine Blicke gespürt und ihn beim Lauschen überrascht. Es hatte Hiebe gesetzt, aber Cliff konnte sich genau merken, wo das Büchlein zu finden war. Später hatte er es sich angesehen. Es enthielt viele geheimnisvolle Formeln und skurille Zeichnungen.
Eine der Zeichnungen hatte einen Vogel gezeigt, einen Vogel, wie Cliff ihm begegnet war!
Das Ganze lag viele Jahre zurück. Cliff war zu dieser Zeit noch ein kleiner Junge gewesen. Nie mehr hatte er sich an das schwarze Buch erinnert.
Er grübelte nach. Hatte ihn die Großmutter nicht auch beim Lesen überrascht?
Die zweite Erkenntnis ließ ihn stolpern. Keuchend tastete er nach einem Halt. Plötzlich zweifelte er nicht mehr daran, dass Mary Rambo, seine Großmutter, eine Hexe gewesen war. Sie hatte ihm den hypnotischen Befehl gegeben, alles zu vergessen, was er gelesen hatte. Durch das Erlebnis war nun der hypnotische Block wieder gewichen.
Die Zeit hatte nicht ausgereicht, dem Büchlein viel Wissen zu entnehmen, dennoch konnte sich Cliff sehr deutlich an den Spruch erinnern, der unter der Zeichnung des Vogels gestanden hatte:
„Voltan ist bei Tag die Gestalt,
in der Verfluchte kehr'n zurück!
Doch stört das Licht des Teufels Gewalt,
drum such' am Auge du dein Glück!“
Das war es also! Voltan hieß die Kreatur; sie war nur am Tage verwundbar. Der Vogel war die Erscheinung Verstorbener, die durch den Fluch des Teufelsmoors ihren Tod gefunden hatten.
Nie hätte Cliff den Sinn des seltsamen Spruches erraten, hätte er das Furchtbare nicht selbst erlebt.
Ihn schwindelte.
Was war er doch sein ganzes Leben lang für ein Narr gewesen. Er hatte die Kräfte der Magie geleugnet, aber sie waren furchtbare Wirklichkeit.
Und das Schlimmste war: Seine eigene Großmutter war eine Hexe gewesen!
Aber hatte sie nicht auch ihn einen Teil ihrer Kräfte erben lassen?
Plötzlich war das bislang Unerklärliche glasklar. Mary Rambo hatte alles getan, die Wahrheit vor ihrem Enkel zu verschleiern. Natürlich hatte sie etwas mit dem Fluch hier zu tun. Auf jeden Fall hatte sie versucht, Cliff von hier fernzuhalten. Das musste einen Grund gehabt haben.
Fast glaubte Cliff, diesen Grund zu kennen: Er war gegen den Fluch immun. Die teuflischen Mächte mussten direkt mit ihm kämpfen. Das aber gab ihm eine Chance - eine Chance, die allerdings unglaublich gering war.
*
Er räumte den Weg frei.
Dabei fand er Häufchen bräunlichen Staubes. Er war nicht sicher, glaubte aber, dass sie die Überreste des Dämonvogels waren.
„Die verfluchten Seelen haben ihre ewige Ruhe gefunden“, murmelte er vor sich hin.
Endlich konnte er weiterfahren. Der Morris sah arg mitgenommen aus. Der Schlamm vom Vortag war getrocknet und beschmutzte den Fahrersitz. Der grüne Lack war stark zerkratzt und die Reifen schmutzverkrustet. Cliff achtete nicht darauf.
Nach Minuten erreichte er das zweite Umleitungsschild.
Es hing an einem in den Boden gerammten Pfahl.
Der Weg gabelte sich hier. In der einen Richtung, in die das Schild zeigte, ging es wahrscheinlich zur Straße. Wohin führte der andere Weg?
Cliff hatte das ungewisse Gefühl, seinem Ziel ein erhebliches Stück näher gekommen zu sein.
Er bog ab.
Der Boden wurde weicher. Trotzdem hatte sich die Fahrspur nicht sehr tief eingegraben. Das war wohl ein Zeichen dafür, dass hier noch nicht viele Fahrzeuge vorbeigekommen waren.
Stirnrunzelnd starrte Cliff in das Halbdunkel vor sich. Die Weiterfahrt wurde immer gefährlicher. Wenn er einmal stoppen musste, kam er keinen Schritt mehr weiter. Die Räder würden sich hoffnungslos in den weichen Boden graben. So lange der Wagen rollte, ging es.
Kleine Wasserlachen tauchten auf. Das Gestrüpp rückte näher und näher zusammen, kratzte am Wagen, streifte wie mit gierigen Händen über die Fenster.
Und dann blieb der Wagen stehen. Cliff wollte aussteigen, bekam aber die Tür nicht auf, so sehr er sich auch dagegenstemmte.
Für einen Augenblick hatte er die schreckliche Illusion, für immer in dem Wagen gefangen zu sein. Er riss sich zusammen und öffnete das Fenster. Durch die schmale Öffnung gelangte er ins Freie. Spitze Zweige zerkratzten sein Gesicht und die Hände.
Das Gestrüpp neben dem Wagen war zu dicht. Cliff musste auf das Dach klettern.
Undurchdringlich erscheinende Wildnis umgab ihn. Aber sie war nicht grün und blühend, wie es der Jahreszeit entsprochen hätte. Sie schien tot, skurril, wie die importierte Natur von einem fremden, feindlichen Planeten.
Cliff kletterte über die Motorhaube des Morris auf den Weg. Der Wagen steckte bis zur Achse im Dreck. Der Boden war weich und nachgiebig. Wenn man für einen Moment an einer Stelle stehenblieb, sank man langsam ein.
Cliff zögerte, weiterzugehen. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Für eine Umkehr war es nun zu spät.
Er schaute auf die Uhr. Es war Mittag. Die Sonne musste am Höchsten stehen, aber ihr Licht drang nur mühsam durch dichtes Ästegewirr und verfilztes Gesträuch auf dem Weg.
Cliff hatte vor dem Aussteigen die Scheinwerfer gelöscht. Düsteres Halbdunkel war um ihn herum - Halbdunkel und eine unheimliche Stille, die ihn an den teuflischen Nebel erinnerte.
Er setzte sich in Bewegung. Die Schuhsohlen klebten am Boden. Das Laufen bereitete ihm Mühe.
*
Immer tiefer schlängelte sich der Weg in das Dickicht.
Da vernahm Cliff plötzlich ein Geräusch neben sich.
Es klang wie der rasselnde Atem eines asthmatischen Mannes.
Lauschend hob Cliff den Kopf. Ja, das Geräusch war deutlich. Irgendetwas verbarg sich seitlich des Weges. Was war es? Handelte es sich wirklich um einen Mann?
Cliff überlegte einen Moment. Dann rief er laut: „Hallo, ist da jemand?“
Das Geräusch verstummte abrupt. Dann knackte es im Unterholz. Etwas entfernte sich.
Cliff konnte seine Neugierde nicht mehr zügeln. Rücksichtslos brach er in das Gestrüpp ein.
*
Das Material, aus dem sein Anzug bestand, war gottlob sehr widerstandsfähig. Wenig später hatte Cliff Rambo die Stelle erreicht, von der aus das Geräusch gekommen sein musste. Es war eine kleine Lichtung.
Er bückte sich und untersuchte den Boden.
Mit gefurchter Stirn besah er sich die deutlichen Spuren. Hier hatte ohne Zweifel ein menschliches Wesen gestanden. Der Abdruck zweier Schuhe hatte sich zentimetertief in den Boden gegraben. Der Fremde hatte sich entfernt, nachdem Cliff gerufen hatte.
Cliff Rambo folgte der Spur. Einige Fuß weiter betrat er einen schmalen, ausgetretenen Trampelpfad. Der Boden war fest.
Cliff blieb lauschend stehen. Tatsächlich! Weit vor ihm waren Schritte. In das Geräusch mischte sich asthmatisches Atmen.
Cliff beschleunigte seinen Lauf. Eine gedrungene Gestalt tauchte vor ihm auf. Dann war diese von einem Augenblick zum anderen verschwunden.
Wieder lauschte der Yardmann. Alles war still. Aber das war doch nicht möglich! Den Fremden konnte doch nicht der Erdboden verschlungen haben?
*
Schließlich hatte Cliff Rambo die Stelle erreicht. Der Weg endete hier an einem Schlammloch. In unregelmäßigen Abständen stiegen dicke Blasen auf und zerplatzten mit einem leisen Knall und nachfolgendem Schlürfen. Es stank entsetzlich.
Für einen Augenblick blieb Cliff das Herz stehen. War der Fremde in das Schlammloch gefallen?
Er verwarf den Gedanken sofort wieder. Es war kaum vorstellbar, dass sich der Mann zum ersten Male hier befand. Aber, wenn nicht - wer war er?
Cliff blickte in die Runde. Die Sonne schimmerte durch die Baumkronen. Über dem Schlammloch war es wesentlich heller. Aber diese Helligkeit wurde durch dunstige, wahrscheinlich giftige Dämpfe gemindert.
Rambo schob sich am Rand des Sumpfloches vorbei. Der Schlamm umspülte fast seine Schuhe. Er musste vorsichtig sein, um nicht auszugleiten und hineinzufallen. Das hätte seinen sicheren Tod bedeutet.
Schwindel stiegen in ihm auf. Seine Glieder fühlten sich auf einmal seltsam taub an. In seinen Gedärmen rumorte es. Waren die Dämpfe daran schuld?
Wo war der Fremde geblieben? Irgendwo musste es doch weitergehen.
Plötzlich schoben sich zwei knochige, von den Ärmeln eines grobgewebten Wamses bekleidete Arme auf Cliff zu. Ein teuflisches Kichern klang auf. Die alten, abgearbeiteten Hände packten Cliff an den Schultern und stießen ihn in das Sumpfloch.
Schreiend versuchte Cliff Rambo, sein Gleichgewicht zu behalten. Wieder tauchten die Hände auf. Ein gellendes Lachen drang aus dem Gestrüpp. Die Hände stießen zu.
Cliff bückte sich über das Sumpfloch, um dem Stoß zu entgehen. Langsam kippte er nach vorn.
Es gab nur eine Möglichkeit für ihn: Mit aller Kraft sprang er.
Für den Bruchteil einer Sekunde schwebte er über dem gierig blubbernden Schlamm. Dann klatschte er hinein. Aber sein Sprung war weit genug gewesen, so dass er mit den ausgestreckten Armen das Gebüsch auf der anderen Seite erreichen konnte.
Kräftig zog er daran. Es hielt stand. Cliffs Körper sank schnell ab. Die stinkende Brühe zog ihn mit unerbittlicher Gewalt herunter.
Aber Cliff Rambo setzte all seine Kraft dagegen.
Hinter sich hörte er ein wütendes Fauchen, als es ihm gelang, sich langsam aus dem Sumpf zu ziehen.
Etwas brach durch das Unterholz. Der Fremde war dabei, das Sumpfloch zu umrunden, um Cliffs Rettung zu verhindern. Dieser verdoppelte seine Anstrengung.
Er war schneller als der andere. Keuchend robbte er in Sicherheit.
Für Sekunden war er unfähig, sich zu rühren, so erschöpft war er. Nur allmählich erholte er sich wieder.
Der Fremde hatte seine Bemühungen aufgegeben. Er entfernte sich wieder.
„Na warte, Freundchen“, knurrte Cliff wütend. Er stand auf und folgte den Geräuschen, die der Mann verursachte.
*
Das Moor glich einem toten Dschungel.
Der Boden wurde immer morastiger. Mehr als einmal sank Cliff bis zu den Knien ein und musste sich wieder an den knorrigen Bäumen herausziehen. Inzwischen verwünschte er seinen Entschluss, dem Fremden zu folgen. Er hatte sich hoffnungslos verirrt. Warum nur war er nicht auf dem Weg geblieben?
Es war zu spät, sich Vorwürfe zu machen. Der Fremde war im Moment sein einziger Anhaltspunkt. Er durfte seine Spur nicht verlieren.
Jedes Mal, wenn Cliff aufgehalten wurde, ließ der Unbekannte ein gellendes, teuflisches Lachen hören. Es war ein Lachen, das Cliff durch Mark und Bein ging. Was war das für ein Mann? Was hatte er vor?
Nun, das war indessen nicht schwer zu erraten. Es war seine Absicht gewesen, Cliff in die Irre zu führen.
Also war der Unbekannte ein Handlanger der Dämonen, die das Teufelsmoor regierten!
Die Verfolgung, während der es Cliff mehr dem Glück als seinem Verstand verdankte, dass er nicht umkam, dauerte fast drei Stunden, bis sie ein abruptes Ende fand.
Cliff gelangte zu einer Lichtung, die mit abgestorbenem Gras bedeckt war. Der Boden machte einen festen, stabilen Eindruck. Aber aus irgendeinem Grund war Cliff misstrauisch. Er blieb stehen. Der Fremde stand auf der anderen Seite der Lichtung. Er winkte mit beiden Armen.
Es kam genug Licht durch die Baumkronen, die hier eine Lücke ließen. Cliff konnte den Mann genau sehen.
Er erschien uralt. Ein weißer, filziger Vollbart verbarg sein Gesicht. Auf seinem Kopf saß ein speckiger Hut, der offenbar schon viel erlebt hatte.
Der Mann war mit einem grauen Wams bekleidet. Seine Hosen erschienen viel zu groß und schlotterten um seine Knie. Sie bestanden aus billigem Tuch und wiesen mehrere Flicken auf. Die Schuhe waren nur mehr traurige Überreste, die mit Schnur zusammengebunden waren.
„Wer sind Sie?“, rief Cliff.
Der Alte gab seine Bemühungen auf, ihn über die trügerische Lichtung zu locken.
Cliff nahm einen Stein in die Hand und warf ihn auf den faulenden Grasteppich. Der Stein versank geräuschlos. Die Oberfläche des Moores blieb unbewegt.
Der Alte fauchte wie ein Raubtier. Er wandte sich ab und wollte weiter.
„Wer sind Sie?“, wiederholte Cliff seine Frage. „Warum wollen Sie mich töten?“ Seine Stimme peitschte über die Lichtung.
Der Alte schwang drohend die Faust, bevor er verschwand.
Cliff umrundete vorsichtig die gefährliche Stelle und nahm die Verfolgung wieder auf.
Von einem Schritt zum anderen befand er sich plötzlich auf felsigem Boden. Wenn er alles im Teufelsmoor erwartet hätte, aber keinen Felsen.
Das Dickicht wich immer weiter zurück. Vor Cliff türmte sich ein steiniger Hügel auf.
Und da sah er auch die gebückte Gestalt des Alten, nur dreißig Yards vor ihm. Er kletterte den Hügel empor, zwängte sich durch eine Felsspalte und entzog sich somit Cliffs Blicken.
Der Yardmann beeilte sich, die Spalte zu erreichen.
Fassungslos blieb er stehen. Hinter der Felsspalte öffnete sich ein winziges Tälchen, nur etwa vierzig Yards lang und zehn Yards breit. Alles deutete darauf hin, dass hier ein Mensch lebte!
Cliff zwängte sich hindurch. Benommen betrat er das Tal. Er sah, dass es auf der anderen Seite einen Ausgang gab. Die glatten Felswände ringsum wurden von Höhleneingängen und Nischen unterbrochen.
Ein grunzendes Geräusch ließ Cliff herumfahren.
Der Alte stand hinter ihm, ein Messer wurfbereit in der erhobenen Rechten.
Cliff hob abwehrend die Hände.
„Nein!“, rief er. „Warum wollen Sie das tun?“
Der Alte knurrte nur.
Auf einmal dämmerte es Cliff: Der Mann konnte nicht reden!
Aber er war nicht etwa auch taub. Schließlich hatte er deutlich gehört, dass Cliff auf ihn aufmerksam geworden war und die Verfolgung aufgenommen hatte. In den eisgrauen Augen war ein flackerndes Licht.
Cliff wich mit einem erstickten Laut zurück.
Nein, mit Worten würde er dem Irren nicht beikommen. Er tastete nach seiner Waffe.
Der Alte schüttelte den Kopf und holte mit dem Messer weiter aus. Cliff ließ seine Pistole, wo sie war.
Aufmerksam schaute er umher. Es gab keinen Ausweg. Jede Deckung war zu weit entfernt.
*
Cliff Rambo hatte fast mit dem Leben abgeschlossen. Aber der Irre wollte ihn nicht umbringen - wenigstens vorläufig nicht. Mit dem Kopf deutete er auf eine der Höhlen.
Es dauerte eine Weile, bis Cliff begriff, was der Mann von ihm wollte. Langsam bewegte er sich auf den Eingang zu.
Es ist nun schon das dritte Mal, dass ich dem Tod durch ein Messer knapp entgehe, dachte er in einem Anflug von Galgenhumor bei sich. Eigentlich war es sogar das vierte Mal, wenn man die Bedrohung durch Georg Konstantin zweimal rechnete.
Kurz bevor Cliff die Höhle erreicht hatte, wurde er von dem Verrückten aufgehalten. Unbemerkt war dieser hinter ihn getreten und durchsuchte seine Taschen. Das Messer kitzelte Cliffs Rücken.
Zähneknirschend musste Cliff Rambo zusehen, wie die Pistole den Besitzer wechselte. Der Irre betrachtete sie knurrend, konnte aber offenbar nichts damit anfangen, denn er warf sie achtlos hinter sich.
Cliff bekam einen kräftigen Stoß in den Rücken, der ihn in die Höhle trieb.
In dem Halbdunkel stolperte er über etwas und fiel hin.
Als er sich wieder aufrappeln wollte, berührten seine Hände Papier.
Allmählich gewöhnten sich seine Augen an das Dämmerlicht. Das Tälchen war hell erleuchtet. Ungehindert konnte die Sonne bis zum Grund dringen.
Cliff betastete das Papier, das vor ihm auf dem Boden lag. Es waren Briefe.
Er nahm ein paar Blätter auf und trug sie zum Eingang, wo es heller war. Die Schrift war schon verwaschen und kaum leserlich. Das Papier musste uralt sein. Trotzdem hatte es sich in der trockenen Höhle gut erhalten.
Cliff suchte das Datum. Er erschrak fast, als er es las: Achtzehnhundertdreiundsiebzig.
Hastig ging Cliff zurück und durchwühlte die Briefe. Sie stammten allesamt aus dem neunzehnten Jahrhundert. Die jüngsten waren genau hundert Jahre alt.
Sie waren auch alle an dieselbe Person gerichtet: an einen gewissen Frank Danon!
Cliff wagte ein Experiment. Vorsichtig ging er zum Eingang und wollte hinaus. Aber der Alte war wachsam. Er hatte sich draußen postiert und zeigte drohend auf sein Messer.
„Frank Danon?“, fragte Cliff aufs Geratewohl.
Ein glückliches Lächeln trat in das Gesicht des Irren. Er nickte heftig. Dann wurde er schlagartig wieder ernst. Er deutete in das Innere der Höhle und hob das Messer.
Cliff gehorchte. Er ging zurück.
Jetzt erst widmete er sich dem Brieftext.
*
Die Briefe waren von einem Mädchen oder einer jungen Frau geschrieben worden. Cliff Rambo offenbarte sich ein tragisches Schicksal.
Lilian Danon, die Schreiberin, war durch einen tragischen Unglücksfall Vollwaise geworden. Fünfzehn Jahre alt war sie zu diesem Zeitpunkt gewesen. Frank Danon war ihr leiblicher Onkel und einziger Verwandter. Er war schwachsinnig und arbeitete als Pferdeknecht auf „Devils-Swamp Castle“.
Eigenartig, dachte Cliff bei sich. Er hatte noch nie den Namen gehört.
Offenbar hieß diese Gegend schon vor dem Fluch Teufelsmoor. Er las weiter.
Lilian Danon kam zu dem Castle als Dienstmagd, hielt es aber in der düsteren Umgebung, wie sie schrieb, nicht sehr lange aus und ging weg, um anderswo ihr Glück zu versuchen, das sie, ihren Briefen nach zu urteilen, nie gefunden hatte. Auf jeden Fall schrieb sie in unregelmäßigen Abständen ihrem Onkel.
Frank Danon konnte nicht selbst lesen. Irgendwer musste ihm immer vorlesen. Lilian Danon ließ häufig diese Person grüßen, ohne sie allerdings ein einziges Mal direkt anzusprechen. Nicht einmal der Name stand in den Briefen.
Schließlich geriet ein Schreiben in Cliffs Hände, das kurz vor dem Fluch datiert war. Zum ersten Male las Cliff einen konkreten Hinweis. Da war ein Name: Mary Rambo, seine Großmutter! Lilian Danon bezeichnete sie als gefährliche Hexe, die Unglück über Devils-Swamp Castle bringen würde. Ihr wäre geschrieben worden, dass schreckliche Dinge passiert wären, und sie wollte sofort kommen, um ihren Onkel da herauszuholen.
Cliff suchte fieberhaft weiter, aber der Brief, in dem seine Großmutter erwähnt wurde, war der letzte.
Eine Gestalt verdunkelte den Höhleneingang. Es war der Alte. Er trieb Cliff bis zum Hintergrund der Höhle. Dann sammelte er die Briefe ein und schleppte sie weg. Cliff blieb wieder allein.
Er versuchte, Frank Danon zu folgen, aber dieser scheuchte ihn mit wütendem Fauchen zurück.
Mutlos setzte sich Cliff auf einen Stein. Wie sollte er hier die Nacht überleben?
Plötzlich sprang er auf. Zum ersten Mal wurde ihm richtig bewusst, wie alt dieser Danon inzwischen sein musste. Aber das war doch nicht möglich!
Nun, was war im Teufelsmoor unmöglich?
Etwas kroch in Cliff empor. Es war Angst. Er wusste, dass er hier verloren war. Danon würde ihm keine Chance lassen. Er war ein Bestandteil des Teufelsmoors, gehörte mit zu dem furchtbaren Geheimnis.
*
Sergeant James Olson hatte eine schlimme Nacht hinter sich. Er wusste nicht, wie er den Tod Georg Konstantins kaschieren sollte.
Er hatte Rambo belogen, als er ihm von der bevorstehenden Untersuchung durch Inspektor McCormick erzählte. Natürlich hütete sich Olson davor, seiner vorgesetzten Dienstbehörde den furchtbaren Mord mitzuteilen. Olson hatte Rambo nur zwingen wollen, hierzubleiben, um ihn jederzeit im Auge behalten zu können.
Aber mit dem Auftauchen McCormicks musste dennoch jederzeit gerechnet werden.
James Olson arbeitete mit dem zuständigen Arzt Hand in Hand.
Dr. Bud Erskine war ein Kind Crowlsburys. Er war mit dem Fluch aufgewachsen und unterschrieb jeden Totenschein, um alles, was damit zusammenhing, zu vertuschen. Er hatte einfach Angst, wie alle anderen. Die Erfahrung hatte hinreichend gezeigt, wie begründet diese Angst war.
Trotzdem kam Sergeant Olson nicht gegen seine innere Unruhe an. Die sterblichen Überreste Konstantins waren im Leichenhaus und warteten auf ihre Beisetzung. Diese konnte erst frühestens am folgenden Tag erfolgen. Olson hoffte inbrünstig, dass Detektiv-Inspektor McCormick nicht allzu neugierig war, falls er doch kommen sollte.
Mit Jack Nyl zusammen setzte er den Bericht auf.
Über den Tod John Reichers hatte er einfach geschrieben, der Lehrer sei auf der Schultreppe ausgeglitten und habe sich dabei das Genick gebrochen. Was sollte er über Konstantin berichten?
Die Schwierigkeit war, dass die Unfälle immer selbstverschuldet sein mussten. Kein Bürger Crowlsburys würde sich bereiterklären, seinen Kopf hinzuhalten.
Aber tödliche Unfälle ohne Zeugen fielen in das Ressort der Kriminalpolizei!
*
Es kam, wie es kommen musste: Detektiv-Inspektor McCormick wurde hellhörig, als ihm nun schon der zweite Unfall innerhalb von zwei Tagen gemeldet wurde. Olson hatte sich gegen Morgen zu der telefonischen Meldung überwunden.
Er hatte es tun müssen.
Er und Jack Nyl waren noch beim Aufsetzen des schriftlichen Berichtes, als McCormick mit seinem Assistenten Sergeant Mike Williams auftauchte. Olson und Nyl waren wie vom Donner gerührt. Olson dachte in einem Anflug von Galgenhumor, dass er nun Cliff Rambo doch nicht belogen hatte. Das Unvermeidliche hatte sich nicht abwenden lassen.
Gean McCormick war ungefähr im Alter Rambos, also etwa fünfunddreißig. Ein schmaler Schnurrbart über seiner Oberlippe war sein ganzer Stolz. Sein Gesicht, von pechschwarzem, langem Haar umrahmt, war braungebrannt. Die Augen erschienen Olson stechend und alles durchdringend.
Wortlos reichte McCormick dem Sergeant die Hand. Olson schluckte den Kloß hinunter, der in seinem Hals steckte.
„Ich - ich bin gerade dabei, den Bericht über den Tod von Konstabler Konstantin abzufassen“, sagte er kläglich und deutete auf den Schreibtisch.
McCormick nickte nur. Mike Williams hielt sich diskret im Hintergrund. Der Inspektor ließ seinen Blick in die Runde gehen.
„Ich frage mich, Sergeant“, meinte er gefasst, „welchen Grund Sie haben, mich mit aller Gewalt von hier fernzuhalten.“
Olsons Herz pochte ihm bis zum Hals.
„Aber, Sir“, tat er leicht empört, „wie kommen Sie nur zu dieser absurden Annahme?“
McCormick ging nicht darauf ein.
„Ich hörte, New Scotland Yard sei hier vertreten?“
Olson schluckte schwer.
„Zufall, Sir“, versicherte er. „Mr. Cliff Rambo ist nur auf Urlaub hier.“
„Urlaub?“ McCormicks Augenbrauen zuckten nach oben.
James Olson ballte die Fäuste. Verdammt, warum ließ er sich von dem Inspektor so einschüchtern?
Sofort wurde er ruhiger.
Er strich imaginäre Knitterfalten aus seiner Dienstjacke, die sich über seinen mächtigen Bauch wölbte.
„Ja, im Urlaub! Er kannte John Reicher und wollte ihn besuchen.“
„Vor dessen Tod oder erst danach?“
„Natürlich danach. Was glauben Sie denn?“
„Zunächst einmal gar nichts, Sergeant!“ Das war mehr als deutlich. McCormick zupfte an seinem Schnurrbart. Olson beobachtete ihn feindselig.
Jack Nyl trat vor und wollte etwas sagen. Olson brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
„Vielleicht wollen Sie den Bericht sehen, Sir? Im Konzept ist er bereits fertig.“
„Viel lieber wäre mir die Leiche, Sergeant.“ Der Inspektor lächelte entwaffnend. „Ihre Erklärungen lese ich später.“
James Olson hatte das Gefühl, der Boden drehe sich unter ihm weg.
„Ich verstehe nicht ganz, Sir“, versuchte er, den Kelch von sich abzuwenden. „Warum bestehen Sie darauf?“
„Ganz einfach.“ McCormick verschränkte die Hände hinter dem Rücken und wippte auf den Zehenspitzen. „Seit ich für Sie zuständig bin, häufen sich die mysteriösen Unfälle, Sergeant. Bisher ist es Ihnen erfolgreich gelungen, mich von hier fernzuhalten. Anfangs war es mir nur recht, einen tüchtigen Sergeant in Crowlsbury zu wissen, der solche Dinge selbst erledigen kann. Sie wissen ja, wie das heutzutage ist. Die Arbeit wächst einem über den Kopf.“ Blitzschnell wechselte er den Tonfall. „Was ist nun, Sergeant? Wo befindet sich die Leiche?“
*
Zehn Minuten später standen sie zu viert vor dem geöffneten Sarg: James Olson, Jack Nyl, Detektiv-Sergeant Mike Williams und Detektiv-Inspektor Gean McCormick. Für Nyl und Olson brach eine ganze Welt zusammen.
„Ich warte auf Ihre Erklärung“, sagte McCormick eisig.
Olson wandte sich ab. Er verzichtete auf eine Antwort.
„Ich nehme an, Sergeant, die anderen Fälle, die Sie mir im Laufe der Zeit meldeten, sahen nicht anders aus?“
Wieder keine Antwort.
„Wer hat den Mann so zugerichtet?“
Olson war ganz ruhig. Er schaute aus dem Fenster über den Friedhof. Jack Nyl stand an seiner Seite und zitterte wie Espenlaub.
„Ich habe Sie etwas gefragt!“ McCormicks Stimme überschlug sich fast. Die Leichenhalle dröhnte.
James Olson blieb ungerührt.