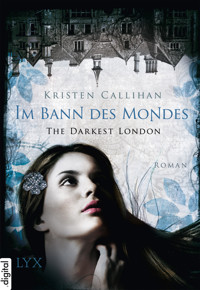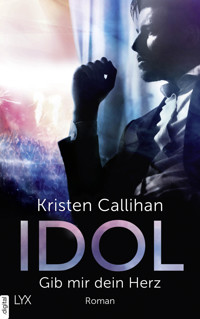3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Darkest-London-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein exklusives E-Book-Prequel mit großen Gefühlen und gruseligen Ereignissen - eine viktorianische Schauergeschichte, die keine Wünsche unerfüllt lässt! Bevor mit "Im Bann des Mondes" die "The Darkest London"-Reihe weitergeht, erzählt Kristen Callihan in einem exklusiven E-Book-Prequel die Vorgeschichte von "Kuss des Feuers". Dabei geht es nicht nur darum, wie für Miranda und Archer alles begann. "Schattenfeuer" füllt die Lücken, schafft Verständnis für Mirandas Situation und gibt tiefe Einblicke in Archers Leben mit Fluch und Krankheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
Die Autorin
Die Bücher von Kristen Callihan bei LYX
Impressum
KRISTEN CALLIHAN
The Darkest London
Schattenfeuer
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Anita Nirschl
Zu diesem Buch
Miranda Ellis besitzt die Gabe, das Feuer zu erwecken. Doch für sie war dies bisher nur ein Fluch, denn ein von ihr verschuldetes Inferno hat einst ihre Familie in den Ruin getrieben. Um dies wiedergutzumachen und nicht in Armut zu versinken, zwingt ihr Vater sie, zu stehlen. Miranda führt ein gefährliches Doppelleben und verheimlicht ihrem Verlobter Martin ihre kriminellen Machenschaften. Ebenso wenig weiß er von dem geheimnisvollen Fremden, der Miranda einst vor Straßenganoven rettete und den sie seitdem nicht mehr vergessen kann. Lord Archer ist stets in ihren Träumen, Träume voller Sinnlichkeit und Leidenschaft, die ihr oft realer scheinen als die Wirklichkeit. Wie kann es sein, dass ein Mann, den sie nur einmal getroffen hat, sie so völlig in seinen Bann ziehen konnte?
Für Amy Pierpont, die mir die Gelegenheit gegeben hat, noch ein wenig mehr Zeit mit Miranda und Archer zu verbringen.
Prolog
»Die Toten wiederzuerwecken ist keine große Zauberei.Wenige sind wirklich tot: Schürt eines toten Mannes Glut, und eine Flamme erwacht zum Leben.«
– Robert Graves
London, August 1869
»Dies ist die Geschichte einer Bestie, so groß und furchterregend, dass sie von allen geschmäht wurde. Und von einer Kaufmannstochter, mutig und schön, die durch ihre Liebe zu dem Biest seine Seele erlöste.«
»Laang-wei-lig«, fiel eine hohe Mädchenstimme dem Jungen ziemlich unsanft ins Wort, worauf dieser dem Mädchen neben ihm einen verärgerten Blick zuwarf. Die beiden lagen Seite an Seite auf einer Zobeldecke, so verborgen in der Dunkelheit zwischen den riesigen Ballen Wolle und Baumwolle, die in dem gewaltigen Lagerhaus auf ihre Verschiffung am Dienstag warteten, dass man sie leicht hätte übersehen können. Sie waren gute Kinder aus gutem Hause, die sich gerne ausmalten, sie wären Waisen in einem unwirtlichen Land oder Schiffbrüchige auf hoher See. Was auch immer der Welt einen Hauch von Abenteuer verlieh.
Sie hatten bereits Piraten gegen Kriegsmarine gespielt, wobei er völlig klar gewonnen hatte – Admiral Nelson schlug Anne Bonny jedes Mal. Dann hatten sie ihr Fort im Wilden Westen erfolgreich gegen angreifende Rothäute verteidigt. Als Nächstes war Geschichtenerzählen an der Reihe.
»Langweilig?« Der Junge rümpfte die Nase, eine Miene, die ihn jünger und alles andere als vornehm aussehen ließ, was ihm gar nicht gefallen hätte, wäre es ihm bewusst gewesen. »Hör lieber gut zu«, riet er ihr streng. »Als Tochter eines Kaufmanns solltest du den Taten anderer Kaufmannstöchter gebührenden Respekt zollen …«
Sie unterbrach ihn mit einem übertriebenen Gähnen. Ihre rotgoldenen Locken ergossen sich über die Zobeldecke, als sie sich tiefer hineinkuschelte. Im hinteren Teil des Lagerhauses war es kalt, trotz der trockenen Augusthitze draußen. Hier würde sie niemand finden, denn es war Sonntag. Nur der alte Dover war noch da, um Wache zu halten, aber er gönnte ihnen ihren Spaß, solange sie sich nicht blicken ließen.
»Das ist ja alles schön und gut«, entgegnete sie und blinzelte mit ihren großen, eulenhaften Augen zu ihm hoch, »aber du hast mir die Geschichte schon ein paar Mal erzählt.« Sie hob den Kopf. »Ein paar Mal.«
Beleidigt setzte der Junge sich auf. »Na schön. Wie es scheint, bin ich zu langweilig, um heute Nachmittag für Unterhaltung zu sorgen.« Er beugte sich vor, und ein übermütiges Funkeln, das Unfug verheißen ließ, glomm in seinen Augen auf. »Es ist kalt hier drin, findest du nicht?«
Sie starrte ihn an. »Nein.«
Doch so leicht gab er sich nicht geschlagen. Schließlich war es das beste Kunststück, das der Junge je gesehen hatte, und sie hatte ihn erst vor Kurzem in ihr Geheimnis eingeweiht. »Ich wette, du kannst das nicht noch mal«, meinte er mit einem abfälligen Schnauben.
Sie fuhr aus ihrem gemütlichen Nest hoch. »Und ob ich es kann!«
»Ich wette mit dir um dein Taschenmesser, dass du es nicht kannst.«
Das Mädchen ballte die kleinen Fäuste. Keine Macht der Erde konnte sie dazu bringen, sich von ihrem Messer zu trennen. Es war ihr kostbarster Besitz. Der alte Dover hatte ihr das Chatellerault geschenkt. Ein vollkommen unangemessenes Geschenk für ein Mädchen, doch Dover hatte ihr erklärt, dass Mädchen mehr Schutz als Jungen benötigten und sie deshalb eines haben sollte. Er hatte ihr sogar beigebracht, wie man damit umging. Seitdem wurde sie von dem Jungen glühend um das Messer beneidet.
Jetzt zog er eine finstere Miene. »Pah, so ein guter Trick war das eh nicht. Dass ich sieben Räder hintereinander geschlagen habe, war viel beeindruckender …«
Ihre kleine, weiße Hand schnappte sich die Lampe vom Fußboden. »Ich mach’s, und dann schuldest du mir Fechtstunden.« Der Vater des Jungen hatte ihn dieses Jahr zum Fechtunterricht angemeldet, und um dieses Können beneidete sie ihn glühend.
»Abgemacht. Und jetzt hör auf, Zeit zu schinden!«
Mit grimmig zusammengekniffenem Blick befeuchtete sie die Finger mit Spucke und löschte die Kerze. Dunkelheit hüllte sie ein. Aufgeregt rückten die Kinder enger zusammen, und ihr Atem ging schneller – keines von ihnen würde es dem anderen gegenüber jemals zugeben, aber sie hatten beide Angst im Dunkeln.
»Na los.« Er versetzte ihrem Knie einen Stups. »Tu’s endlich.«
»Ich mach’s ja schon«, schnauzte das Mädchen zurück. »Und jetzt sei still!«
Unruhig nestelte sie in der Dunkelheit an ihren Rockfalten, ohne zu ahnen, dass sich das Schicksal wirbelnd um sie herum zusammenbraute. Ein Funken flog durch die Luft wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel, erfasste den Kerzendocht und entzündete ihn augenblicklich.
»Siehst du?«, rief sie freudestrahlend. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich es kann.«
Sie hatte ein Recht darauf, stolz auf sich zu sein. Kein anderes Mädchen auf der Welt verstand das Feuer so wie sie. Wie es zum Leben erwachte, wie eine neugeborene Seele. Und wie es – genau wie eine Seele – danach strebte, weiterzuleben, mit aller Macht darum kämpfte, sein Überleben zu sichern. Schon seit sie sich erinnern konnte, war das Feuer ihr Freund. Es sprach zu ihrer eigenen Seele: erschaffe mich, lass mich frei. Feuer machte sie unbesiegbar – nun, beinahe zumindest.
Die winzige Flamme flackerte, als das Mädchen lachte, und ein wenig zu hastig stellte es die Kerze wieder zu Boden. Sie wackelte, verharrte einen quälenden Augenblick lang mitten in der Luft und fiel dann gegen einen hoch aufragenden Ballen Baumwolle. Der verzerrende Schein von Flammen erleuchtete die runden Gesichter der Kinder, auf die sich ein Ausdruck des Entsetzens legte, als der Ballen so schnell Feuer fing wie ein Kleid, das einem Kohlenfeuer zu nahe kam.
Mit einem fast menschlichen Brüllen verschlangen die Flammen die Baumwolle, als wäre sie nur ein kleiner Appetithappen. Den Hunger ungestillt, streckte das Feuer eine rote Zunge aus, um einen weiteren Ballen zu kosten.
»Lauf!«, schrie der Junge, packte seine Spielgefährtin an der Hand und zerrte sie mit sich. Sie war kreidebleich geworden, wie verklärt von dem Feuer, das sie entfacht hatte. Hoch loderte es über ihnen empor, ein gewaltiges Ungeheuer aus der Hölle, das alles in seinem Weg verzehrte, bevor es sich gegen sie wandte, fauchend und wogend, glutschwarz und sengend heiß.
»Lauf, Miranda, lauf!«
Noch während Miranda floh und spürte, wie glühende Funken die zarte Haut ihres Nackens küssten, wusste sie, dass sie durch ihre Eitelkeit alles ruiniert hatte.
1
London, 1. März 1879
Miranda erinnerte sich noch an eine Zeit, in der sie keine Angst gehabt hatte. Als das Leben noch angenehm war, ein warmer Kokon, in dem sie sich aufgehoben fühlte. Als jeden Morgen, wenn sie erwachte, ein munteres Feuer im Kamin prasselte, ihr Dienstmädchen die schweren Satinvorhänge vor ihrem Fenster aufzog, um die Sonne hereinzulassen, bevor es ein silbernes Tablett auf dem Nachttisch neben dem Bett abstellte. Ach, dieses Tablett, gefüllt mit zartem Blätterteiggebäck, saftigen, exotischen Früchten aus beheizten Gewächshäusern und einer Kanne heißer Schokolade. Schon diese Düfte allein hatten es vermocht, ihr einen wohligen, glücklichen Schauer zu versetzen.
Und jetzt? Jetzt war ihr Zimmer dunkel und kalt. Die Satinvorhänge waren verschwunden, ersetzt durch triste Behänge aus Wolle, übersät von einer Konstellation aus Löchern, die silberne Sterne aus weißem Morgenlicht hereinließen. Das Bettzeug unter ihrem Kopf war nicht frisch und flauschig, sondern alt und verklumpt und musste dringend gewaschen und gelüftet werden. Eine Knochenarbeit, um die sie sich später würde kümmern müssen.
Leise setzte sie sich auf und schwang die Beine aus dem quietschenden Bett. Ihre Füße berührten eiskaltes Holz. Die türkischen Teppiche waren schon früh verkauft worden, da solche Dinge stets einen guten Preis erzielten. Sie tastete nach ihren ausgetretenen Pantoffeln, die zum Glück frei von Ungeziefer waren, und schlurfte dann hinüber zum Waschtisch. Am Rand des mit Wasser gefüllten Kruges hatte sich eine dünne Eisschicht gebildet, also beeilte sie sich mit ihrer Morgenwäsche.
Ja, Miranda konnte sich noch gut daran erinnern, wie sich Komfort anfühlte. Wenn es daran fehlte, erkannte sie jetzt, nahmen ständige Angst und Sorge seinen Platz ein, als dumpfer Schmerz in der Magengrube, der nie ganz weichen wollte. Abwesend rieb sie über diese Stelle ihres Körpers, während sie in den Spiegel starrte. Doch sie sah nicht ihr Gesicht darin. Sie sah nichts. Ihre Gedanken kehrten zu ihren Träumen zurück, und der Schmerz in der Magengrube wurde stärker. Sie hatte wieder von ihm geträumt, dem Mann, der sie vor einigen Monaten in einer dunklen Gasse gerettet hatte. Dem Mann, der sich im Schatten gehalten, niemals sein Gesicht gezeigt hatte, und dennoch stets in ihren Gedanken war.
Unwillkürlich wanderte ihr Blick zu der Schmuckschatulle auf ihrem Ankleidetisch. Sie war jetzt leer, bis auf ein paar Ohrringe und eine goldene Münze. Er hatte sie ihr gegeben, diese seltsame Münze, in die das Antlitz des Mondes geprägt war.
»Sie ist aus reinem Gold. Lassen Sie die Münze einschmelzen und verkaufen Sie das Gold, wenn Sie Geld brauchen.«, hatte er gesagt.
Nicht, dass sie je versucht hätte, die Münze zu Geld zu machen. Sie zu verkaufen, würde bedeuten, jede Hoffnung aufzugeben. Ihre Träume aufzugeben.
»Verdammt«, murmelte sie und wandte sich wieder zum Spiegel. Warum musste sie nur von ihm träumen? Von seiner rauen Stimme und den kräftigen, harten Schenkeln. Dem geheimnisvollen Fremden, der ihre Welt auf den Kopf gestellt hatte.
»Wer sind Sie?«, hatte sie ihn gefragt.
»Ein besorgter Untertan der Krone«, war seine Antwort.
Ha! Höchstwahrscheinlich ein steckbrieflich gesuchter Untertan der Krone. Er hatte sie nicht einmal sein Gesicht sehen lassen. Eigentlich sollte sie dankbar sein, dass sie einem solch zwielichtigen Charakter unbeschadet entkommen war. Doch er hatte ihr geholfen und sie nicht daran gehindert, seinen Leib nach Waffen abzutasten. Ihre Handflächen kribbelten, als spürten sie erneut, wie es sich anfühlte, an seinen Schenkeln entlang und dann hoch zu der festen Rundung seines Hinterns zu streichen.
Flammende Röte schoss Miranda ins Gesicht, und mit einem leisen Fluchen tauchte sie die Hände noch einmal ins eisige Wasser. Sie hatte keine Zeit für Träume. Sie hatte viel zu tun. Das laute Knurren ihres Magens unterstrich diese Tatsache. Sie musste Frühstück auftreiben.
Irgendwo.
#
Ägypten, 1. März 1879
Nach Ägypten zu kommen, hatte sich als kolossale Zeitverschwendung erwiesen. Keine Menschenseele besaß irgendwelche Informationen über die Stunden vor Daouds Tod. Eine Tatsache, die Archer innerlich auffraß, bis er am liebsten auf irgendetwas eingeschlagen hätte. Er umklammerte die Zügel fester, worauf sein Pferd, das Archers Unruhe spürte, wiehernd den Kopf hochwarf. Archer lockerte seinen Griff und konzentrierte sich wieder auf das, was vor ihm lag.
Ihm bot sich ein Anblick, der besser in das Reich von Legenden und Mythen gepasst hätte. Roter, welliger Sand erstreckte sich bis zum Horizont, wo die untergehende Sonne, einem großen, pulsierenden Ball aus flüssigem Feuer gleich, zwischen den schwarz emporragenden Silhouetten der Pyramiden von Gizeh versank. Diese großartigen Bauwerke, geometrischen Formen, die sich zum Himmel emporstreckten – nicht flehend, sondern als verkündeten sie laut des Menschen Genialität und Wille –, raubten ihm den Atem. Der Anblick schnürte ihm die Kehle zu.
Wenigstens war Archer hier nicht gezwungen, seine erstickende Maske zu tragen, da er sich wie ein Einheimischer kleiden konnte. Er trug eine Galabija, einen traditionellen muslimischen Kaftan, der locker bis auf die Knöchel fiel. Um seinen Kopf war eine Kufija gewunden, und er hatte sich erlaubt, sie auch um sein Gesicht zu schlingen, sodass nur noch die Augen frei blieben. Ungewöhnlich, zugegeben, aber nicht so ungewöhnlich wie eine Karnevalsmaske, und es ließ sich viel besser darunter atmen. Mit der braunen Farbe, die er sich auf die Haut gerieben hatte, konnte man ihn zumindest vorübergehend für einen Einheimischen halten. Erst wenn man ihm nahe genug kam und seine Augen sah, verblasste die Illusion.
Mit nervöser Aufmerksamkeit beäugte der Führer Archer. Amar war ein ausgekochtes Schlitzohr, ein gewissenloser Grabräuber, geschickt mit dem Messer und äußerst vertraut mit den Gepflogenheiten der hiesigen Verbrecherwelt. Dass Archer ihm ein Vermögen bezahlte, bedeutete nicht notwendigerweise, dass Archer nicht selbst irgendwann einmal Bekanntschaft mit dem falschen Ende von Amars Messer machen würde. Er warf dem Schurken einen harten Blick zu. Der durchtriebene Teufel würde eine unangenehme Überraschung erleben, sollte er es je versuchen.
»Reite voraus und sag unseren Leuten, dass wir hier sind«, wies Archer ihn an. Er wollte hören, was Amar mit diesen Männern redete, ohne dass dieser wegen Archers Anwesenheit seine Zunge im Zaum hielt. Der Führer würde niemals auf den Gedanken kommen, Archer sei in der Lage, jedes Wort zu verstehen, selbst aus einigen hundert Metern Entfernung.
Amar nickte. »Sehr wohl, Sayyid«, antwortete er mit falscher Ergebenheit.
Archer hielt Amars unsteten Blick einen Moment lang fest. »Du wirst als Erster sterben, solltest du mich hintergehen«, versprach er. Dabei wechselte er fließend ins Arabische, denn er wusste, dass es den Mann besonders treffen würde, wenn er in dessen Sprache mit ihm redete. Außerdem klangen auf Arabisch vorgebrachte Drohungen so viel poetischer. »Denn mein Zorn ist ein schrecklicher Sturm, der das Fleisch von den Knochen reißt.«
Die dunklen Augen des Führers blitzten im goldenen Licht auf. Verschlagen, berechnend. Amar hatte behauptet, dass eine kleine Gruppe von Dieben Daouds Leiche zuerst entdeckt hatte. Und da sie Diebe waren, hatten sie Daouds Kleidung durchsucht. Archer kümmerte es nicht, wie viel Geld sie genommen hatten, aber wenn sie einen Hinweis darauf gefunden hatten, wo Daoud gewesen war, dann wollte er es wissen.