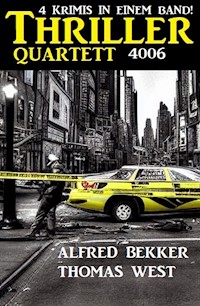
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dieses Buch enthält folgende Krimis: Thomas West: Tödliche Predigt Thomas West: Scharfe Bombe, die nicht tickt Alfred Bekker: Stirb, McKee! Alfred Bekker: Kubinke und die Verschwundenen Er ist der Chef einer wichtigen Ermittlungsbehörde - aber in seiner Vergangenheit scheint es ein dunkles Geheimnis zu geben. Ein wahnsinniger Killer hat es auf ihn abgesehen und präsentiert eine alte, blutige Rechnung. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit dem Tod...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Thomas West
Inhaltsverzeichnis
Thriller Quartett 4006 - 4 Krimis in einem Band!
Copyright
Tödliche Predigt
Scharfe Bombe, die nicht tickt
Stirb, McKee!
Kubinke und die Verschwundenen
Thriller Quartett 4006 - 4 Krimis in einem Band!
Alfred Bekker, Thomas West
Dieses Buch enthält folgende Krimis:
Thomas West: Tödliche Predigt
Thomas West: Scharfe Bombe, die nicht tickt
Alfred Bekker: Stirb, McKee!
Alfred Bekker: Kubinke und die Verschwundenen
Er ist der Chef einer wichtigen Ermittlungsbehörde - aber in seiner Vergangenheit scheint es ein dunkles Geheimnis zu geben. Ein wahnsinniger Killer hat es auf ihn abgesehen und präsentiert eine alte, blutige Rechnung.
Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit dem Tod...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https//twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https//cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Tödliche Predigt
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 125 Taschenbuchseiten.
Waffendiebstähle, selbst bei der Army, machen das FBI ebenso hellhörig wie ein ungezügelter Anstieg der Morde in den weißen Stadtteilen. Als ein schwarzer FBI-Agent getötet wird, ist klar, dass alle Spuren nach Harlem führen, wo es bei Immobiliengeschäften um viel Geld geht. Was haben die Mitglieder der Black Temple Gemeinde mit diesen Vorfällen zu tun? Der Reverend ist eifriger Verfechter eines aktiven Glaubens, auch mit Gewalt. Jesse Trevellian fordert eine schwarze Kollegin zur Unterstützung an, und für die FBI-Agenten geht es plötzlich um Leben und Tod.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Das Schachbrett stand auf einer Obstkiste. Davor ein alter Mann und ein Halbwüchsiger. Beides Schwarze. Der Alte saß auf der ersten Stufe einer Vortreppe. Der schlaksige Teenager ihm gegenüber auf einem orangenen Basketball.
Henry beugte sich über die Schulter des Jungen. „Wirf mal einen Blick auf deinen Turm‟, flüsterte er ihm ins Ohr. Der Alte hob seinen grauhaarigen Schädel und musterte ihn mürrisch. „Wenn du ihn da stehen lässt, erstickt dein König, und du bist in drei Zügen matt.‟
„Verflucht, Portman!‟, schimpfte der Alte. „Es geht um fünf Dollar! Halt den Rand oder verpiss′ dich!‟
„Ist ja gut, ist ja gut!‟ Henry hob beschwichtigend die Hände. Er zwinkerte dem Jungen zu und machte, dass er weiterkam.
Er drückte sich am Stand eines Fischhändlers vorbei, wich einer Gruppe Inlineskater aus, fing einen Ball auf, mit dem ein Rudel Kids Volleyball über ein, zwischen zwei Straßenlaternen improvisiertes, Netz spielte, und lauschte einigen Mädchen, die unter dem Torbogen zu einem Hinterhof einen Rap zum Besten gaben.
„Bist du bereit, dem Herrn zu begegnen?‟ Henry blickte in ein verdrossenes Gesicht links neben sich. „Der Tod kommt wie ein Dieb in der Nacht.‟ Der kleine Mann sprach mit Grabesstimme. „Und dann stehst du vor dem Gericht Gottes.‟ Er reichte Henry ein religiöses Traktat.
„Klar bin ich vorbereitet, Samuel!‟ Henry schlug dem Mann auf die Schulter. Sein aufgesetzter Ernst amüsierte ihn jedes Mal aufs neue. „Ehrlich, Samuel! Von mir aus kann er kommen!‟ Er winkte und überquerte tänzelnd die Straße. Kaum ein Tag, an dem er dem verhinderten Propheten nicht über den Weg lief.
Henry grinste vergnügt. Das pralle Leben auf den Straßen Harlems turnte ihn an.
Kurz darauf blieb er wieder an einem Schachbrett stehen. Die beiden Jugendlichen standen mit verbissenen Mienen um den Papierkorb, auf den sie das Brett gestellt hatten. Ein halbes Dutzend Männer scharten sich schweigend um sie.
Kaum Straßenzüge in Harlem, in denen man die Leute nicht plaudern, spielen, Biertrinken oder einfach nur auf den Vortreppen oder den Bordsteinkanten herumhängen sah.
Um die Zeit aber, am späten Nachmittag, konnte das Straßenleben volksfestartige Züge annehmen. Die Schüler und Studenten waren nach Hause gekommen, die Männer mit Arbeit machten Feierabend, die Kids schwärmten aus, und die Frauen suchten die Nachrichtenbörsen an den Straßenecken und vor den zahllosen kleinen Geschäften auf. Großen Wohnzimmern glichen manche Teile des Viertels um diese Zeit.
Und jedes Mal, wenn Henry auf dem Heimweg von der Columbia University am Columbuspark aus der U-Station ins Freie trat, hatte er das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Er brauchte nicht lange, um die Stellung auf dem Brett zu analysieren.
„Hey, was meinst du, Buddy?‟, raunte er dem Mann neben sich zu. „Noch drei Züge, dann nimmt Weiß den schwarzen König mit Läufer und Springer in die Zange.‟ Der Mann machte eine skeptische Miene und wiegte den Kopf.
Schwarz machte nach Henrys Einschätzung einen völlig unsinnigen Zug. „Oh, Mann!‟, stöhnte er. „Rochade! Wann um alles in der Welt machst du deine Rochade!?‟
Böse Blicke trafen ihn. Er verkniff sich weitere Ratschläge und setzte seinen Heimweg fort. Ein paar Minuten später schlenderte er über den Frederic-Douglass-Boulevard.
Das Straßenbild veränderte sich. Dichter Verkehr rollte an belebten Bürgersteigen vorbei, Jugendliche scharten sich um mannshohe Boxen, aus denen die neusten Raps bellten.
Kaum noch spielende Kinder, dafür schwarze Männer in dreiteiliger Bankerkluft. Statt Sandalen und afrikanisch anmutenden, bunten Tüchern – übergroße Basketballschuhe, enge Lederröcke und viel zu weite Hosen um die schlaksigen Beine der Kids.
Eine Gruppe junger Burschen kam ihm entgegen. Die Gesichter hinter verspiegelten Sonnenbrillen versteckt. Auf den schwarzen T-Shirts die Konterfeis eines Kumpels. Henry kannte das Gesicht aus der Zeitung – der Junge war letzte Woche in seiner Wohnung in der hundertfünfundzwanzigsten erschossen worden. Vorsichtshalber wechselte er die Straßenseite.
Dann hinein in die Hunderteinunddreißigste, vorbei an dem Haus, in dem vor über neunzig Jahren der Mord passierte, der dafür sorgte, dass Harlem schwarz wurde. Schwarz und wild.
Schon von weitem sah Henry die große Parklücke vor dem Mietshaus in dessen Dachmansarde er seit zwei Jahren lebte. Ein groß gebautes Bürgerhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert. Bevor er in der offenen Haustür verschwand, las er das Pappschild an der Latte, die hier jemand wie eine Schranke auf zwei Mülltonnen gelegt hatte: Umzug, nicht parken.
Auf der Straße schwenkten zwei Mädchen ein Seil. Ein Junge hüpfte auf und ab.
„Wer zieht denn hier aus?‟, rief Henry. Die Kids zuckten mit den Schultern, ohne ihn anzusehen.
Er drehte sich um und stieg das breite Treppenhaus hinauf. Die heisere Klage eines Saxophons drang von oben herab. Jimmy Chicorea, sein Nachbar, probte mal wieder. Und, wie meistens, stand seine Wohnungstür sperrangelweit offen.
Eine alte Frau kam ihm entgegen. Die halbblinde Mrs. Elliot. Sich ängstlich am Geländer festklammernd tastete sie mit den Schuhspitzen nach den Stufen.
„Tag, Mrs. Elliot‟, grüßte Henry.
Die Frau stutzte und sah auf. Dann ging sie weiter, ohne seinen Gruß zu erwidern.
Henry runzelte die Stirn. Vor drei Tagen noch hatte er sie zum Augenarzt begleitet. Noch nie war sie grußlos an ihm vorbeigegangen. War irgend etwas passiert? War sie es, die ausziehen wollte?
„Hi, Balu!‟, rief Henry während er die Tür zu seiner Mansarde aufschloss. Alle nannten Jimmy Chicorea nur „Balu‟ – weil er groß und massig war, und weil er sich nur schaukelnd und mit den Armen rudernd fortbewegte – ebenso, wie der launige Bär in Disneys Dschungelbuch.
Das Saxophon verstummte.
„Wer zieht denn hier aus?‟, rief Henry, bevor er seine Bude betrat.
„Du.‟
„Witzbold.‟ Henry drückte die Tür zu und ging an den Kühlschrank. Seine Mansarde war so eng, dass er für den Weg von der Wohnungstür zu seinen gekühlten Bierdosen nur drei Schritte benötigte. Eine Falttür trennte das einzige Zimmer vom Bad.
Knallend sprang der Verschluss der Dose auf. Henry trank gierig. Der Tag war heiß. Obwohl es erst Ende Juni war, kündigte sich schon die hochsommerliche Schwüle an.
Seine Wohnungstür ging auf. Im Türrahmen erschien Jimmy Chicorea – fast zwei Meter groß, schwarzes fleischiges Gesicht, kahl rasierter Schädel, Ende zwanzig. Das kindliche Lächeln um seine dicken Lippen, das ihn sonst auf Anhieb sympathisch machte, fehlte heute. Ein unangenehmes Kribbeln zog über Henrys Zwerchfell.
„Was′n los, Dicker?‟ Er drehte sich zum Kühlschrank um. „′ne Dose Bier?‟
Chicorea schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Schweigend starrte er Henry an. Der hielt ihm die Bierdose entgegen. Der massige Mann machte keine Anstalten, sie zu nehmen.
„Teufel auch, Balu – wer ist gestorben?‟ Henry versteckte seine wachsende Unruhe hinter einer gereizten Miene. „Irgendwas stimmt doch nicht. Wer zieht aus – raus mit der Sprache! Du?‟
Die Falttür vor dem Bad bewegte sich. Henrys Kopf zuckte erschrocken herum. Die Kunststofftür faltete sich zusammen. Die hagere Gestalt eines breitschultrigen Schwarzen wurde sichtbar – gelbes Muskelshirt, dichte rot gefärbte Krausmatte auf dem Schädel, eine große Kreole im linken Ohr, knapp über dreißig.
„Hey, Mann ...!‟ Henrys Stimme versagte. „Was treibst du in meiner Bude ...‟ Er kannte den Typen kaum. Erst wenige Tage, bevor er selbst die Gemeinde verlassen hatte, war er auf der Bildfläche erschienen.
„Du ziehst um‟, sagte der Typ und grinste.
Panik überflutete Henrys Hirn. „Seid ihr übergeschnappt?‟
„Du bist ein prima Kumpel gewesen, Henry.‟ Jimmy Chicorea machte einen Schritt auf ihn zu. „Aber du bist ein Naivling. Der Herr lässt niemanden so einfach aussteigen. Und wir auch nicht.‟
„Balu, Mann...‟, flüsterte Henry mit bebenden Lippen. Chicoreas Fausthieb traf ihn mit der Wucht eines Vorschlaghammers. Wie der Kopf einer Stoffpuppe klappte sein Schädel nach hinten weg. Seine Dose prallte neben dem Gelbhemd an die Wand. Ächzend rutschte er am Kühlschrank entlang auf den Boden.
Henry kam nicht mehr zu sich. Und das war gut so. So wurden ihm die quälenden Fragen erspart, die er sich sicher gestellt hätte, wenn er das plätschernde Badewasser und den laufenden Föhn gehört hätte …
2
Der Supermarkt lag in der East Village an der siebenundfünfzigsten Straße. Nicht weit von der Auffahrt zur Queensboro Bridge.
Es war Freitagabend, wir hatten die Siebenundfünfzigste sperren lassen. In den Häusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite lagen Scharfschützen auf Dächern und Balkonen. Eine schwerbewaffnete Einheit der New York City Police hatte sich auf den überfüllten Parkplatz vor dem Supermarkt zwischen den parkenden Fahrzeugen verteilt.
„Okay, Bentlyn!‟, brüllte ich ins Megaphon. „Der Fluchtwagen steht bereit!‟
Ich drehte mich um, und nickte den Hundeführern hinter mir zu. Sie hatten sich hinter der Eisbude versteckt, die direkt vor dem Eingang des Marktes aufgestellt war. Behutsam schnallten sie die ledernen Maulkörbe an den Schnauzen ihrer deutschen Schäferhunde ab und hielten ihnen eine Unterhose hin. Wir hatten das Stück aus einem Korb mit schmutziger Wäsche gezogen, den wir in Bentlyns Wohnung in Queens gefunden hatten. Die Hunde beschnüffelten das appetitliche Stück und wedelten aufgeregt mit den Schwänzen.
„Wo zum Teufel steht die gottverdammte Karre?‟ Bentlyns hohe Stimme jenseits der Glasfront vor dem Supermarkt. „Ich kann sie nirgend sehen. Fahrt sie gefälligst bis auf mindestens zehn Schritte an den Eingang heran!‟
Ich presste den Kopfhörer meines Walkie-Talkie ans Ohr. „Er will, dass wir den Wagen direkt vor den Eingang fahren.‟
„Kann er haben.‟ Caravaggios Stimme in meinem Ohr. Clive Caravaggio leitete den Einsatz.
„Der Wagen fährt sofort vor!‟, brüllte ich.
Keine zehn Schritte entfernt von mir, auf der anderen Seite des Eingangs Supermarkt, drückten sich Milo und Ed gegen die Betonwand des Flachbaus. Sie trugen Helme und kugelsichere Westen.
Edward Yorkham arbeitete seit knapp zwei Jahren für unser District Office. Ein vielversprechender Mann, den ich von einigen Kursen in Quantico kannte. Von Zeit zu Zeit holten sie mich auf die Akademie, um das eine oder andere Seminar zu geben. Ed war mir schon bei unsere ersten Begegnung aufgefallen. Er brillierte damals mit einer seltenen Mischung aus Phantasie und Intelligenz. Außerdem war er einer der wenigen Schwarzen im New Yorker FBI Office.
Der Wagen fuhr vor. Ein roter Ford. Die Beamtin, die ihn steuerte, entfernte sich.
Plötzlich flog etwas durch die offene Glastür des Eingangs und schlug klirrend auf dem Asphalt auf. Ein Schlüsselbund.
„Das habt ihr euch so gedacht!‟ Bentlyns gereizte Stimme. „Ich werde mit einem roten Wagen durch die Straßen fahren, damit ich ja schön auffalle! Na klar! Und wahrscheinlich habt ihr ihn auch mit eurem gottverdammten Bullenspielzeug gespickt!‟
Milo und Ed verdrehten die Augen. Natürlich hatten wir den Wagen präpariert. Aber Bentlyn schien ganz und gar nicht der Hohlkopf zu sein, als den ihn seine Akten schilderten.
„Der Schlüssel passt zu einem grauen Mitsubishi, links in der vierten Reihe von hier aus gesehen.‟ Er nannte das Kennzeichen. „Er gehört einem der Hosenscheißer, denen ich eine Kugel in den Schädel jagen werde, wenn die Kiste nicht in einer Minute vor dem Eingang hält!‟
„Schnell, Clive!‟, flüsterte ich. „Er akzeptiert den Wagen nicht, schick die Beamtin zurück!‟
„Mistkerl!‟, knurrte Clive.
Die Hundehalter hinter mir tuschelten mit ihren Tieren. Die Hunde verhielten sich erstaunlich diszipliniert. Sie waren darauf trainiert, sich solchen Situationen stumm wie Fische zu verhalten.
Die Idee mit den Hunden stammte von Ed. Er hatte aus Bentlyns Akten eine scheinbar unbedeutende Kindheitsepisode ausgegraben. Als kleiner Junge war der Bursche von einem Schäferhund angefallen worden. Er hatte panische Angst vor den Tieren. Wenn unsere Rechnung aufging, würde er gelähmt vor Schrecken die angreifenden Hunde anstarren, während Ed ihn von der anderen Seite unschädlich machte.
Milos Aufgabe war es, den Mann von seinen Geiseln zu trennen.
Für Ed war so ein Einsatz Routine. Raubüberfälle mit Geiselnahme – sein täglich Brot. Allerdings musste er sich in der Regel mit Bankräubern auseinandersetzen. Normalerweise arbeitete er zusammen mit Kollegen der City Police in einer Spezialeinheit für Banküberfälle. Deswegen hatten wir auch wenig miteinander zu tun.
„Die Minute ist ′rum!‟, kreischte Bentlyn. „Ich will den Mitsubishi sehen, oder es kracht hier drin!‟
„Er dreht jeden Moment durch‟, murmelte ich ins Mikro. „Beeilt euch, Clive.‟ Ich ließ meine Augen über die Dächer der parkenden Fahrzeuge wandern. Ein hellgrauer PKW löste sich aus der Blechmasse und rollte auf unseren Standort zu.
„Cool bleiben, Bentlyn.‟ Ich sprach mit gesenkter Stimme, um ihn zu beschwichtigen. „Dein Taxi rollt an!‟
Das war nicht der erste Supermarkt, den Bentlyn überfiel. Exakt sechs solcher Hits gingen inzwischen auf sein Konto. Drei davon in New Jersey, beziehungsweise Massachusetts. Deswegen war der Fall auch auf Jonathan McKees Schreibtisch gelandet.
„Das sei euer Glück, Scheißbulle!‟
Immer freitags schlug er zu, am frühen Abend, wenn die Kassen voll waren. Und er schoss gnadenlos auf jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Drei Menschen hatte seine Raublust schon das Leben gekostet.
„Und du wirst mir jetzt deine Knarre vor den Eingang schieben, Bulle. Oder willst du mir erzählen, dass du unbewaffnet gekommen bist?‟
„So ist es, Bentlyn – ich bin unbewaffnet.‟ Ich zog meinen Revolver und holte das Magazin heraus. Der Mitsubishi hielt vor dem Ford, etwa zwölf Schritte vom Eingang entfernt.
„Waffe her!‟, kreischte Bentlyn.
„Okay, okay!‟ Ich drückte das leere Magazin wieder in den Griff, bückte mich und schleuderte mein gutes Stück über den Asphalt. Die SIG Sauer blieb auf halbem Weg zwischen Fluchtfahrzeug und Eingang liegen.
„So ist es brav, Bulle. Und jetzt hau ab.‟
Im Dauerlauf trabte ich auf den Parkplatz und ging hinter einem Wagen in Deckung. Jetzt kam alles auf Ed und Milos Schnelligkeit an. Und auf die Hunde.
Ich robbte zwei Wagen weiter nach links, wo ich einen Schatten gesehen hatte. Tatsächlich traf ich auf einen Scharfschützen. Ich bat ihn um sein Gewehr. Widerwillig rückte er es heraus. Durch das Zielfernrohr sah ich die Konturen menschlicher Körper hinter der Glasfront sichtbar werden. Dann zeichneten sich deutlich vier Personen ab. Drei Frauen, und eng hinter ihnen Bentlyn. Er bedrohte sie abwechselnd mit der Waffe und schrie Anweisungen, die ich auf die Entfernung nicht verstehen konnte.
Auf der Schwelle zum Parkplatz zögerte er einen Moment. Er beugte sich ein wenig heraus und spähte um sich. Milo und Ed pressten sich dicht an die Wand. Dann kam er zwei Schritte weit heraus.
Im gleichen Moment schossen zwei Schatten auf ihn zu – die Hunde. Bentlyn zeigte keine Reaktion. Einer der Schäferhunde huschte zwischen den Beinen der Geiseln hindurch und schnappte nach Bentlyns Unterschenkel. Der andere sprang ihm sofort an den Hals.
Ed spritzte aus seiner Deckung hervor, entwaffnete den Geiselgangster und riss ihm die Arme auf den Rücken. Milo stellte sich schützend vor die Frauen und drängte sie ein paar Schritte ab. Keine zwei Sekunden später lag Bentlyn in Handschellen auf dem Asphalt. Er heulte vor Wut und stieß alle Verwünschungen und Flüche gegen uns aus, die er in langen Knastjahren gelernt hatte.
Zu dritt standen wir vor dem Supermarkt. Nicht weit von uns Clive, umringt von der unvermeidlichen Presse. Er hatte es übernommen, die gierigen Ohren mit Informationen zu stopfen.
Wir sahen den Kollegen hinterher, die Bentlyn abführten.
„Das war′s dann.‟ Milo klopfte Ed auf die Schulter. „Gut gemacht, Ed.‟
„War mal wieder nett mit dir, Ed.‟ Ich sah auf die Uhr. „Zeit für den Feierabend. Wie wär′s mit einem Drink?‟
Milo nickte eifrig. Ed winkte ab. „Lasst mich ziehen, Jungs. Weib und Kinder warten.‟
„Also, dann.‟ Ich drückte ihm die Hand. „Mach weiter so, Ed. Bis zum nächsten Mal.‟
„Bis zum nächsten Mal!‟ Im Laufschritt eilte er über den Parkplatz und stieg am Straßenrand in einen Dienstwagen.
Bis zum nächsten Mal sollten nur noch wenige Tage vergehen. Und beim nächsten Mal würden zwei von uns dreien unseren Job zum Teufel wünschen.
3
Der Sergeant hob die flache Hand bis zu seinem gebeugten Knie. Die drei Marines hinter ihm duckten sich noch tiefer ins Gras. Er wandte sich um. Die blauen Augen in seinem rußgeschwärzten Gesicht verrieten die Anspannung des Stoßtruppführers.
Jacky hielt sich dicht hinter dem Sergeant und verstand seinen Blick sofort. Auch er hatte die Bewegung drüben am Waldrand gesehen.
Mit einem Handgriff schaltete er das Funkgerät ein, das er seit drei Tagen auf dem Rücken mit sich herumschleppte. „Sind auf feindliche Truppenteile gestoßen‟, flüsterte er. Er drückte den Bügel mit dem Mikro näher an seine Lippen und gab sich alle Mühe, ihren Standort so präzise wie möglich durchzugeben.
Schweigend beobachteten die vier Marines das Gebüsch vor dem etwa dreihundert Schritte entfernten Waldrand. Einer der Büsche löste sich und bewegte sich in das hohe Gras der Wiese hinein. Langsam und ruckartig. Und direkt auf sie zu.
Jacky war froh, dass sich endlich etwas tat. Drei Tage Manöver waren genug. Drei Nächte Ameisen im Schlafsack, drei Tage das nervende Sirren der Mücken im Ohr, drei Tage synthetischen Fraß, und jedes Mal, wenn man sich zum Pinkeln verzog, musste man aufpassen, dass man nicht in die Scheiße der anderen trat.
Jacky träumte von einer kalten Dusche, einem frisch gezapften Bier und einem saftigen Steak.
Der Busch dort drüben in der Wiese war ein gutes Zeichen dafür, dass diese bescheidenen Träume noch heute in Erfüllung gehen könnten. Hinter der Wiese wölbte sich der bewaldete Hügel, den seine Einheit nehmen sollte. Und wenn sie das so schafften, dass der Major zufrieden war, dürfte dieses dämliche Manöver in ein paar Stunden vorbei sein.
„Da bewegt sich noch so ein gottverdammter Busch‟, zischte der Sergeant. Tatsächlich hatte sich ein weiterer gegnerischer Marine vom Waldrand gelöst. Er hielt sich etwa dreißig Schritte hinter dem anderen getarnten Infanteristen.
„Sie scheinen uns nicht zu sehen‟, flüsterte einer der beiden MG-Schützen hinter Jacky. Tatsächlich robbten die beiden Manövergegner so rasch über die Wiese, als würden sie sich völlig unbeobachtet fühlen.
Endlich kam der Befehl aus dem fünf Meilen entfernten Kommandopanzer: MG-Nest aufbauen und feindlichen Spähtrupp unter Feuer nehmen.
Wie der Sergeant legte auch Jacky sein automatisches Gewehr an. Hinter ihm das vertraute Geräusch aneinanderstoßender Metallteile – die anderen beiden brachten das Maschinengewehr in Stellung.
„Das können doch nicht nur die zwei sein, verflucht noch mal‟, flüsterte der Sergeant. Er drehte sich zu Jacky um. „Sobald das MG loshämmert, nehmen wir den Waldrand von zwei Seiten in die Zange.‟
Jacky nickte. Er schob sich vorsichtig voran, bis er neben dem Sergeant im Gras kauerte.
Die beiden Büsche näherten sich langsam.
„MG fertig‟, kam die Meldung von den MG-Schützen. Der Sergeant hob den Arm. Im gleichen Moment bellten Schüsse los. Von hinten. Schüsse aus Sturmgewehren.
Jacky fuhr herum. Einer der MG-Schützen wälzte sich schreiend im Gras. Der andere war aufgesprungen und starrte entsetzt in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Plötzlich riss er die Arme hoch und sank seufzend auf das Maschinengewehr.
Panik tobte durch Jackys Körper. Die Gedanken galoppierten durch seinen Schädel wie eine Herde wild gewordener Pferde. Zu welcher Einheit gehörte der bullige Marine, der von dort hinten aus seinem Sturmgewehr feuernd auf sie zugerannt kam? Wieso konnte man von Übungsmunition zusammenbrechen? Und warum hatte war die rote Flüssigkeit am Hals des MG-Schützen so hellrot, wie echtes Arterienblut?
Nun auch Schüsse aus der Wiese. Ein brennender Schmerz bohrte sich in Jackys Lendenwirbelsäule. Er drehte sich um seine eigene Achse und wurde ins Gras geschleudert. Neben den Sergeant. Dessen Augen starrten blicklos in den wolkenlosen Junihimmel.
„Was für ein Film läuft hier ab ...?‟ Jacky schnappte nach Luft. „Was für ein Albtraum ...?‟
Sekunden später tauchten die Hosenbeine einiger Marines neben ihm auf. Keuchende Männerstimmen wurden laut.
„Lass die Scheiß-Übungs-Munition liegen!‟ bellte einer. „Nur die Waffen!‟
Jackys Blick kroch an den Hosenbeinen hinauf bis zu den Gesichtern der Soldaten. Sie waren rußverschmiert, genau wie seines. Trotzdem sah er, dass es ausschließlich Schwarze waren. Er kannte keinen einzigen von ihnen.
Einer beugte sich zu ihm hinunter und riss das Gewehr unter seinem Körper weg. So grob, dass Jackys Körper auf den Bauch rollte.
„Bullshit! Der lebt noch!‟, fluchte der fremde Soldat.
„Dann erledige ihn!‟, zischte ein anderer.
Jacky spürte die heiße Öffnung eines Gewehrlaufs auf der Haut seines Nackens. Dann explodierte die Welt und versank in bodenlosem Nichts ...
4
„Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr.‟
Der voluminöse Mann auf der Kanzel hielt das große, in der Mitte aufgeschlagenen Buch, aus dem er vorlas, mit der Linken. Dabei schüttelte er die zur Faust geballten Rechten über seinem kraushaarigen Schädel.
„Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen!‟ Beschwörend schraubte sich seine Stimme in die Höhe. Er machte eine Pause und ließ seinen lodernden Blick über die Köpfe der Gemeinde wandern. Etwa hundertachtzig Menschen saßen vor ihm auf den gepolsterten Stühlen – Männer und Frauen, Kinder und Greise, und ausschließlich Farbige. Wie ein Mann hielten sie den Atem an. Man hätte in diesem Augenblick jeden noch so leisen Furz hören können, so still war es in dem weitläufigen, und neu renovierten Gottesdienstraum.
„Ich will zu Fall bringen die Gottlosen ...!‟ Die Gemeindemitglieder in der vorderen Reihe zuckten zusammen, so laut brüllte der Mann. „Amen!‟, rief eine alte Frau aus den hinteren Reihen.
Eine junge Frau in rotem, engem Kostüm und mit rotem Hütchen schlug die Hände vor den Mund. Von links und rechts drückten sich ihre beiden Kinder an ihren Körper. Der Mann neben einem der Kinder starrte seine glänzenden Schuhspitzen an.
„… ja, ich will sie ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr!‟
„Amen!‟, hallte es jetzt vielstimmig aus der schwarzen Gemeinde wider. Ein Mann riss die Arme hoch und brüllte ekstatisch: „Halleluja!‟
Der Prediger legte die Bibel auf der Kanzel ab. Schweiß glänzte auf seiner breiten Stirn. Etwa fünfzig Jahre alt mochte er sein. Vielleicht auch ein bisschen älter. „Glaubt doch nicht, dass dieser Spruch des Propheten Zefanja verstaubtes, antiquiertes Wortgeklimper sei, sinnloses Gerede aus längst vergangenen Zeiten!‟
Er schob den Stoff des dunkelroten Samtumhangs, den er trug, ein wenig zur Seite und zog ein weißes Tuch heraus. Mit einer weit ausladenden Geste wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
Mit gesenkter Stimme und ohne das Tuch wieder wegzustecken sprach er weiter. „Lasst euch das doch von niemandem einreden, Brüder und Schwestern.‟ Die Gemeinde lauschte atemlos.
„Weg mit den Gottlosen!‟, brüllte er los. „Weg mit allen, die sich Gottes Volk in den Weg stellen! Weg mit allen, die es aussaugen und in die Ecke drängen!‟
„Amen! Amen!‟, antwortete die Menschen vor ihm in den Bänken. Einige standen auf.
„Ich will sie ausrotten, spricht der Herr! Nicht – so sprach der Herr –, nein, Brüder und Schwestern, so spricht der Herr!‟ Der Mann wedelte mit seinem Tuch herum und ließ seinen rechten Arm durch die Luft sausen, als führte er ein Schwert. „Jetzt sagt er das! Jetzt tut er das! Um eine bessere Welt zu schaffen! Um Gerechtigkeit zu schaffen! Und wohl dem, der sein Werkzeug sein darf ...!‟
Die letzten Worte des Predigers gingen in einem vielstimmigen Lobpreis unter. „Halleluja! Halleluja!‟
Wie so viele war jetzt auch die junge Frau in dem roten Kostüm aufgestanden und klatschte zum Rhythmus des Liedes, das irgend jemand spontan angestimmt hatte.
Aus den Augenwinkeln beobachtete sie ihren Mann: Immer noch hockte er steif auf seinem Platz, und immer noch beschäftigte er sich mit seinen Schuhspitzen. „Ed‟, zischte sie. Er sah missmutig auf. „Bitte ...‟ Die steile Falte zwischen ihren Brauen sprach Bände.
Edward Yorkham erhob sich widerwillig. Er klatschte in die Hände und versuchte den Rhythmus zu finden. Der Sechsjährige neben ihm strahlte zu ihm hoch. Ed rang sich zu einem säuerlichen Grinsen durch.
Die Gesänge wurden hitziger. Neben der Kanzel gruppierte sich ein Chor. Drei Musiker tauchten auf – ein breiter, großer Schwarzer mit einem abgegriffenen Saxophon, ein Gitarrist mit einer Schlaggitarre, und ein hühnerbrüstiger Jüngling, der ein Paar Bongos auf die improvisierte Bühne schleppte. Ed wusste, dass es der Sohn des Reverends war. Im Handumdrehen war die schönste Musiksession im Gange. Einige Leute fingen an zu tanzen – wild und ekstatisch.
Eine Stunde später schlenderte die Familie Yorkham über den breiten Adam Clayton Powell Boulevard. Über die Seventh Avenue, wie die Straße vom unbedeutenden Rest Manhattans genannt wurde. Die Yorkhams wohnten in der hundertdreiunddreißigsten Straße. Dieser sanierte Teil Harlems war ein schmuckes Dorf mit idyllischen Holzfassaden und Kopfsteinpflaster. Seit einigen Jahren zog es die schwarze Mittelschicht zurück zu ihren Wurzeln nach Harlem. Ganze Straßenzüge waren von ihrer aufgeräumten Bürgerlichkeit geprägt.
Ed war verschwitzt und durstig. „Komm, lass uns was trinken gehen.‟ Ohne die Antwort seiner Frau abzuwarten, betrat er eine Kneipe. Die Kinder folgten ihm vergnügt, seine Frau widerwillig.
Er bestellte ein Bier für sich und Hamburger und Cola für die Kinder, Eddy und Laura. Seine Frau orderte ein Wasser.
„Hör zu, Tina.‟ Ed beugte sich über den Tisch und senkte die Stimme. „Ich find′s ja ganz spaßig in der Gemeinde, und der gute Reverend Chestler hat ohne Zweifel einen hohen Unterhaltungswert. Aber irgendwie übertreibt er mir zu sehr. Er ist mir zu hitzig, zu fanatisch, verstehst du? Das geht mir auf den Sack.‟
„Er nimmt seinen Glauben eben ernst, Ed.‟
Ed betrachtete seine Frau mit einem wehmütigen Grinsen. Ein trotziger Zug lag auf ihrem schönen Gesicht. Er streichelte sie über den Kopf. Sie trug ihr dickes Haar zu einem langen Zopf geflochten. Wie dunkler Samt schimmerte ihre schwarze Haut. „Komm her, Baby.‟ Er zog sie an sich und küsste ihren schlanken Hals. Sie ließ es widerstrebend geschehen.
„Und du nimmst deinen Glauben auch ernst, ich weiß‟, seufzte Ed. „Ich akzeptiere das, auch wenn ich anders drauf bin. Trotzdem – lass uns in eine andere Kirche gehen, ja? Nach St. Andrews oder in die Abyssinian Baptist Church. Irgendwo hin, wo die Leute mit beiden Beinen auf der Erde stehen.‟
„Die meisten Leute aus unserem Viertel gehen in die Black Temple Gemeinde ...‟
„Ist doch nicht wahr ...‟
„Viele unserer Freunde gehen dort hin ...‟
„Viele gehen auch woanders hin ...‟
Sie wurden sich mal wieder nicht einig. „In Harlem gibt′s an jeder Ecke eine Besenkammer oder ein Wohnzimmer, wo irgendein Preacherman eine Kirche aufgemacht hat. Warum, zum Teufel, schauen wir uns nicht einfach mal um?‟
„Reverend Chestler ist nicht irgendein Preacherman!‟, beharrte Tina trotzig.
Ed Yorkham sah seine Frau lauernd an. Er verkniff sich eine weitere Bemerkung über Amos Chestler, die ihm auf der Zunge lag. „Kann sein, dass du demnächst allein in die Kirche gehst, wenn wir keinen Kompromiss finden‟, drohte Ed schließlich.
„Von mir aus‟, fauchte Tina, „du gehst ja sowieso kaum mit.‟
Später, vor der Haustür, sah Ed auf die Uhr. „Es ist erst acht – ich schau mal kurz auf ein Bier bei Henry vorbei.‟
„Henry?‟ Tina machte ein erstauntes Gesicht. „Der ist doch vor drei Tagen weggezogen.‟
Ed sah sie erstaunt an. „Das glaub′ ich nicht! Er hätte sich doch von seinem Billardpartner Ed Yorkham verabschiedet!‟
„Ruf doch seine Nachbarn an, wenn du es nicht glaubst ...‟
5
„Ausziehen.‟ Der blonde Schönling knipste die Beleuchtungsanlage an und schraubte dann seine Kamera auf ein Stativ.
Rose spitzte die Lippen und zog die Brauen hoch. „Ausziehen?‟
Der Blonde stutzte. Verblüfft sah er sie an. Dann hellte sich seine Miene auf. Er lachte meckernd.
„Spiel nicht die Unschuld vom Lande, Baby. Soll ich vielleicht dein Passbild in unsern Katalog kleben? Unsere Kunden wollen sehen, was sie für ihr Geld bekommen. Also zeig, was du hast.‟
Rose legte ihre schwarze Lederjacke auf einen Stuhl. Die Behutsamkeit, mit der sie das tat, fiel dem Mann nicht auf. Rose ärgerte sich über sich selbst.
Bewirbst dich bei einem Begleitservice und wunderst dich, wenn du deine Titten zeigen sollst. Naives Mädchen, du!
Sie zog ihr rotes Muskelshirt aus und stieg aus den Jeans.
„Den Slip natürlich auch‟, sagte der Blonde gleichgültig. Er war so eine Art stellvertretender Geschäftsführer. Soviel hatte Rose herausfinden können.
Splitternackt stolzierte sie auf das beleuchtete Podest mit der hellblauen Kulissenwand.
„Leg dich auf die Couch und räkle dich ein bisschen‟, verlangte der Mann. Rose tat ihm den Gefallen. „Nicht so steif, Baby, du bist doch kein Brett! Du bist eine Frau, du willst gebumst werden, du bist sexy!‟ Er unterbrach sich und tauchte hinter seinem Fotoapparat auf. „Das bist du übrigens wirklich.‟ Sein schmieriges Grinsen bestätigte Rose′ ersten Eindruck – der Mann war weiter nichts als ein dreckiger, geiler Bock. „So eine schwarze Schönheit wie dich hatte ich seit Jahren nicht mehr vor dem Objektiv.‟
Er schoss ein Bild nach dem anderen. „Schon lange in San Francisco?‟
Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern. „Ein Jahr oder so.‟
„Was hast denn so getrieben bis jetzt?‟ Mit einer Handbewegung deutete er ihr an sich hinzulegen.
„Soll ich einen Lebenslauf schicken?‟ Ihre rauchige Stimme klang gelangweilt. „Oder ein polizeiliches Führungszeugnis?‟
„Warum nicht?‟, kicherte er meckernd.
Irgendwann verlangte er, dass sie die Beine spreizen und sich selbst befriedigen sollte. Rose sprang auf und verließ das Podest. „Wenn du dich aufgeilen willst, besuch ′ne Peepshow oder zieh dir ′nen Porno rein. Ich hab′ gezeigt, was ich zu bieten hab′, und jetzt Schicht!‟ Sie griff nach ihrem Höschen.
Der Mann musste ein paar Mal schlucken, bis er seine Verblüffung weggesteckt hatte. „Hey, hey! Du bist ja eine ganz Empfindliche!‟ Er begriff, dass die schwarze Lady mit den nicht mal streichholzlangen Haaren ein anderes Kaliber war, als die bleichen Girls, die sich tagein tagaus bei ihm die Klinke in die Hand gaben. Ein Kaliber, für das in Frisco gut gezahlt wurde. Verdammt gut.
„Hast ja recht.‟ Er montierte die Kamera vom Stativ und spulte den Film zurück. „Ich werd′ mal gleich in der Dunkelkammer verschwinden. Dann zeig′ ich die Fotos dem Boss. Und wenn sie ihm gefallen, wird er dich bestimmt persönlich kennenlernen wollen.‟
Er beobachtete sie, während sie ihr Muskelshirt überstreifte. Wieder das schmierige Grinsen. „Und sie werden ihm gefallen, da hab′ ich keinen Zweifel.‟ Er holte den Film aus der Kamera und öffnete eine schmale Tür neben dem Podest mit der Couch. „Warte draußen an der Theke und trink was auf Kosten des Hauses. ′Ne Stunde kann′s schon dauern.‟ Er verschwand in der Dunkelkammer.
Rose hatte es plötzlich sehr eilig. Hastig stieg sie in ihre Jeans und dann in ihre Turnschuhe. Noch während sie in die Lederjacke schlüpfte, stolperte sie zu dem Regal an der Wand, die dem kleinen Podest gegenüberlag. Mit dem Zeigefinger strich sie über die Buchrücken.
Nach zwei Minuten fand sie, was sie suchte. Sie zog eine daumendicke Hochglanzbroschüre heraus. Ein Katalog. Flüchtig blätterte sie ihn durch. Frauen en masse. Jeder war eine Doppelseite gewidmet. Fotos in den verschiedensten Positionen. Nacktfotos. Links oben Maße, spezielle Dienstleistungen und Vornamen – lauter Olgas, Tatjanas und Nataschas.
„Hast du auch ein Klo hier?‟ Sie stand auf und steckte den Katalog hinten in ihre Jeans unter Muskelshirt und Lederjacke.
„Ja!‟, kam es aus der Dunkelkammer. „Durch die Tür neben dem Waschbecken und dann die dritte Tür links!‟
Rose hätte auch draußen in der Nachtbar auf die Toilette gehen können. Aber der Schnüffelinstinkt hatte sie gepackt. Sie öffnete die Tür neben dem Waschbecken und trat auf einen schummrig beleuchteten Gang hinaus. Vor der Toilettentür blieb sie stehen und lauschte. Von fern hörte sie Männerstimmen.
Am Ende des Ganges eine Treppe. Ein dunkler Läufer auf den Stufen dämpfte ihre Schritte. Die Männerstimmen klangen aggressiv und gemein. Dann schrie eine Frau. Laut und anhaltend. Für Sekunden. Der Schrei brach ab und ging in ein gedämpftes Wimmern über.
Rose spurtete los. Im Obergeschoss wieder eine Zimmerflucht. Sie eilte von Tür zu Tür und lauschte an jeder. Der Raum, aus dem die Männerstimmen und das Wimmern kamen, lag am Ende des Ganges. Rose war nicht die Frau, die sich lange zierte. Ihr Instinkt gebot: „Geh hinein‟, und sie ging hinein.
Der kleine Raum war in grelles Neonlicht getaucht. Ein Bett, ein Schrank, ein kleiner Tisch, zwei Korbsessel. Vier Männer starrten sie an. Zwei Weiße knieten am Kopfende des Bettes und hielten ein Mädchen fest. Es war vollständig nackt. Das blonde Haar klebte feucht auf Stirn und Wangen. Rose sah sofort, dass das Mädchen höchstens siebzehn oder achtzehn Jahre alt war. Aus dunklen Augen starrte es Rose flehend an.
Vor ihr kniete ein lateinamerikanisch aussehender Bursche mit wirrem Wuschelkopf. Ohne Hose. Sein Schwanz ragte steif und wippend nach oben. Selten blöd glotzte er Rose an.
Der vierte Mann war groß und breitschultrig. Er trug einen edlen hellen Anzug. Und er war so schwarz wie Rose selbst.
Das Mädchen stammelte ein paar Brocken in einem Mischmasch aus amerikanisch und einer fremden Sprache. Einer Sprache, die Rose nicht beherrschte. Trotzdem erkannte sie den slawischen Klang der Worte.
„Lasst sie los!‟, verlangte Rose mit rauchiger, gefährlich leiser Stimme.
Die Männer reagierten zunächst nicht. Sie schienen völlig perplex zu sein.
„Wen haben wir denn da?‟, sagte der Schwarze plötzlich. Er machte einen Schritt auf Rose zu und zog ein Messer aus der Innentasche seines eleganten Jacketts.
Das arrogante Lächeln auf seinem Gesicht hielt sich nur wenige Augenblicke. Solange bis Rose blitzschnell unter ihre Jacke griff und ihre sechzehnschüssige P 226 SIG Sauer herausholte.
Statt stehen zu bleiben, stürzte der Kerl sich auf sie. Rose sprang zur Seite und drückte ab. Noch während er zu Boden ging, sah sie, wie die beiden Weißen auf dem Bett kurzläufige Revolver aus ihren Jacken holten. Das Mädchen kniff die Augen zusammen und schrie hysterisch auf. Rose zog durch, ohne nachzudenken.
Eine Stunde später hockte sie auf dem Gang und rauchte. In ihrem Arm das schluchzende Mädchen. Zwischen den Heulkrämpfen erzählte es seine Geschichte. Rose verstand kaum die Hälfte. Aber was sie verstand, verursachte ihr einen Brechreiz. Mit grimmiger Zufriedenheit beobachtete sie die FBI-Männer, die nacheinander vier Leichensäcke aus dem Zimmer trugen.
Am nächsten Morgen das zugeknöpfte Gesicht Edwin Stanfords, ihres Chefs. Vor ihm auf dem Tisch lag der Katalog mit den osteuropäischen Frauen. Die Kollegen neben ihr in der Konferenzecke betasteten die Bügelfalten ihrer Hosen oder betrachteten ihre Schuhspitzen. Zur Feier des Tages hatte Rose ein hellgraues Kostüm und eine weiße Bluse angezogen.
„Ihr Auftrag lautete: Im Milieu ermitteln und Beweise sicherstellen, die für eine Anklage wegen Frauenhandels ausreichen.‟ Stanfords Stimme verhieß mal wieder nichts Gutes. Mit der flachen Hand schlug er auf den Katalog. „Sie hatten den Beweis sichergestellt, Mrs. Warrington, und hätten gehen können. Und was machen Sie? Spielen Rambo und schießen vier Männer nieder.‟
„Ich wollte eine Straftat vereiteln, Sir.‟ Rose blitzte ihn an. „Dabei wurde ich angegriffen!‟
Das speckige Gesicht des SACs lief rot an. „Ihre Verteidigung war auffällig effektiv. Vier Tote.‟
„Auch die Angriffe drohten effektiv zu werden, wie Sie das nennen, Sir!‟ Das Sir spuckte sie regelrecht heraus.
Ihr Chef wurde noch lauter. „Mit was, zur Hölle, hat denn der halbnackte Mann Sie angegriffen?! Man hat keine Waffe bei ihm gefunden! Nicht mal ein Messer!‟
Rose biss die Zähne zusammen und schwieg. Der steife, wippende Schwanz des Kerls fiel ihr ein. Und das wimmernde Mädchen.
Der SAC stand auf und ging zu seinem Schreibtisch. Als wollte er in diesem Augenblick besonders offiziell wirken, setzte er sich kerzengerade in seinen Sessel. „Special-Agent Warrington – Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert.‟
Eisiges Schweigen im Raum. Rose′ Augen suchten Kontakt zu ihren Kollegen. Niemand gönnte ihr einen Blick. Die Firma in Frisco konnte verdammt hart sein.
„Wie lang ist vorläufig?‟, fragte sie mit brüchiger Stimme.
„Das wird das Office of Professional Responsibility in Washington entscheiden.‟
Schöner Mist! Du musst vor der Inquisition erscheinen! O Gott!
„Das Hauptquartier wird Ihnen eine schriftliche Vorladung schicken.‟ Stanford fixierte sie aus schmalen Augen. Rose wusste, dass er froh war, sie endlich loszuwerden. Seitdem sie sich von Birmingham, Alabama, nach San Francisco hatte versetzen lassen, nichts als Ärger mit dem Mann.
Rose spitzte die Lippen. Mit hochgezogenen Brauen betrachtete sie den Katalog auf dem Konferenztisch. Er würde dem Staatsanwalt reichen, um einen Mann wegen Frauenhandels und erzwungener Prostitution anzuklagen. Einen Mann, der den besten Anwalt in der Stadt hatte. Das würde ihm jetzt nichts mehr nützen.
Sie kramte ihre Dienstmarke heraus und warf sie auf den Tisch. Auch die SIG holte sie aus ihrer Handtasche und ließ sie polternd auf die Tischplatte fallen. Einige Kollegen zuckten zusammen.
Dann stand sie auf und ging zur Tür. „Viel Spaß noch‟, sagte sie und warf die Tür hinter sich zu.
6
Am Tag nach dem Gottesdienst machte Ed sich auf den Weg zu Henrys Adresse. Er nahm seinen Sohn Eddy mit. Gemeinsam spazierten sie durch den milden Juniabend in die hunderteinunddreißigste Straße. Dass Henry fortgezogen war, ohne sich noch einmal bei ihm zu melden, wollte Ed nicht in den Kopf.
Sicher – besonders gut hatten sie sich nicht gekannt. Einmal im Monat ein paar Bier und ein Billardabend. Aber manchmal hatten sie auch eine ganze Nacht durchdiskutiert. Henry studierte amerikanische Literatur und Politikwissenschaften und hatte eine ganz spezielle Meinung über die amerikanische Gesellschaft. Eine Meinung, die Ed jedes Mal auf die Palme gebracht hatte.
Sie waren im gleichen Alter. Und Henry hatte nie verstehen wollen, wie man mit Ende zwanzig schon Familie und Kinder haben kann.
Sicher – all das wäre für viele Leute noch kein Grund gewesen, sich zu verabschieden, bevor sie aus dem Viertel ziehen. Aber da war noch etwas: Henry hatte Ed bei ihrem letzten Billardabend vor nicht ganz zwei Wochen ein Buch ausgeliehen. Ein Handbuch über die Software für eine Datenbank. Ein teures Buch. Vierzig Dollar hatte Henry dafür sicher hingelegt.
Ed konnte sich nicht vorstellen, dass ein Student so ein teures Buch einfach im Regal eines Bekannten zurücklässt.
Er sprach ein paar Männer an, die vor dem Haus hockten und würfelten. „Habt ihr Henry Portman gesehen?‟ Sie schüttelten den Kopf. Ed erkannte einige aus den Gottesdiensten wieder. „Er soll umgezogen sein.‟
Sie zuckten mit den Schultern. „Keine Ahnung‟, sagte einer.
„Doch – das hab′ ich auch gehört!‟, ein anderer.
Ed betrat das Haus. Einmal hatte er Henry in seiner Mansarde besucht. Er klingelte bei den Nachbarn und fragte nach ihm. „Ist umgezogen‟, lautete die stereotype Antwort.
Nur eine alte Frau fiel aus der Rolle. „Was geht mich der Kerl an!?‟, fauchte sie. „Keine Ahnung, was mit dem ist.‟ Sie knallte die Tür zu.
Ed las den Namen auf dem Klingelschild – Elliot. Irgendwann hatte er auch sie schon in der Gemeinde gesehen.
Der direkte Nachbar von Henry schien nicht zu Hause zu sein. Am Rahmen der Tür zu Henrys Mansarde klebte ein neues Namensschild – Vincent Bailey. Ed klingelte. Vielleicht wusste der Nachmieter etwas.
Die Tür öffnete sich, ein Mann mit nacktem Oberkörper und in roten Pumphosen trat auf die Türschwelle. Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich gegen den Türrahmen. „Was gibt′s?‟
Ed meinte, seine mahagoni-gefärbte Jimmy-Hendrix-Matte schon einmal gesehen zu haben. Die Kreole am linken Ohr des Mannes half seinem Gedächtnis auf die Sprünge: Es war der Gitarrist aus dem Gottesdienst gestern Abend.
„Ich hab′ erfahren, dass Henry weggezogen ist‟, sagte er. Sein Sechsjähriger starrte fasziniert auf die roten Haare des Burschen. „Ich hab′ noch′n Buch von ihm zu Hause. ′N teures Buch. Hast du seine Adresse?‟
Der Mann schüttelte den Kopf. „Nee, Mann – keine Ahnung, wo der hingezogen ist. Hab′ den Typen kaum gekannt.‟ Er machte eine Kopfbewegung zur gegenüberliegenden Tür. „Frag doch den Nachbarn mal, der war′n Kumpel von ihm. Vielleicht hat der die Adresse.‟
„Danke.‟ Ed drehte sich um und ging an die Nachbartür, um sich den Namen aufzuschreiben – Jimmy Chicorea. Hinter ihm schloss sich die Tür. Jimmy Chicorea – auch den Namen hatte er in der Gemeinde schon gehört. Er würde die Nummer aus dem Telefonbuch heraussuchen und den Mann anrufen.
Seinen Sohn an der Hand ging er die Treppe hinunter. Aufmerksam las er jetzt jeden Namen auf den Klingelschildern. Und fast alle kamen ihm bekannt vor.
Als er aus der Haustür auf die Straße trat, betrachtete er das Straßenbild: Würfelnde Männer, plaudernde Frauen, Seil springende Kids, Ball spielende Jugendliche – Ed hatte das Gefühl, dass sie sich besonders viel Mühe gaben, ihn zu übersehen. Und er hatte das Gefühl, die meisten von ihnen schon einmal in der Black Temple Church gesehen zu haben.
7
Die vergangene Woche hatte gut aufgehört, und die neue genauso gut angefangen. Am Freitag das unblutige Ende der Geiselnahme in der East Village mit Bentlyns Festnahme, und gestern, am Montag, kassierten wir einen Großdealer in der South Bronx. Einer unserer Leute hatte seit Monaten verdeckt gegen ihn ermittelt.
Bestens gelaunt saßen Milo und ich also in der Konferenzecke unseres Chefs und schlürften den vorzüglichen Kaffee seiner vorzüglichen Sekretärin.
„Bald werde ich dich für ein paar Wochen allein lassen, Partner‟, sagte Milo.
„Urlaub?‟
„Korrekt. Mitte Juli schlag′ ich mich für ein paar Wochen in die Büsche.‟ Ein genüssliches Lächeln spielte um Milos Lippen.
„Und wo stehen die Büsche, hinter die du dich absetzen willst?‟ Ich warf einen Blick auf unseren Chef. Der saß noch an seinem Schreibtisch und blätterte in irgend welchen Unterlagen. Sein Gesicht wirkte ernst, er schien uns überhaupt nicht zu registrieren. Ich roch förmlich den neuen Auftrag, und er roch nicht besonders angenehm.
„In den Rocky Mountains. Ich werde mir eine Maschine leihen und ein kleines Zelt kaufen.‟ Milo rieb sich die Hände. Mit leuchtenden Augen sah er an die Decke. Vor seinem inneren Auge schien sich schon das sonnenüberflutete Panorama der Rockys aufzutun. „Und dann geht′s durch Montana, Idaho, Wyoming und Colorado bis hinunter nach New Mexico.‟
„Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du drei Wochen lange allein bleibst.‟
„Hab′ ich das gesagt?‟ Er grinste breit.
Unser Chef erhob sich und kam zu uns in die Konferenzecke. „Sorry, Gentlemen, wenn ich Ihre Gedanken von den angenehmen Dingen ablenken muss.‟ Er setzte sich und legte seine Unterlagen vor sich auf den Tisch. „Ich habe einen Auftrag für Sie.‟ Er zog zwei Kopien heraus. „Hier zunächst mal die Mordstatistik des vergangenen Jahres.‟
Milo und ich sahen uns das Diagramm an. Die Mordrate im letzten Jahr war wieder über 1000 gestiegen.
„Sie wissen, dass New York City noch Ende der neunziger Jahre zu den gefährlichsten Städten der Vereinigten Staaten gehörte‟, sagte unser Chef. „Über zweitausend Morde pro Jahr zählten Statistiker damals bei uns. Vor zwei Jahren sank die Mordrate zum ersten Mal seit 1968 wieder unter tausend. Unsere Stadt gilt seitdem als eine der sichersten in den Staaten. Und im letzten Jahr waren es wieder mehr als tausend.‟
Er entnahm seinem Papierstoß ein weiteres Blatt und reichte es uns. Es war ein Stadtplan von Manhattan. Er differenzierte die Mordfälle des vergangenen Jahres nach Stadtteilen.
„Merkwürdig an der ganzen Sache ist folgendes: Die Mordrate ist nicht etwa in den Stadtteilen gestiegen, in denen sowieso die meisten Morde vorkommen – Lower East Side, Bronx und Harlem – sondern in den vornehmlich weißen Stadtteilen – in Midtown, East Village, Upper East Side, und so weiter. Opfer waren meistens Weiße, und die Aufklärungsrate der Morde in diesen Stadtgebieten ist gleich Null.‟
Er schaute uns mit besorgter Miene an. „Und jetzt kommt′s. Die Kriminalstatistiker haben gleichzeitig ermittelt, dass die Zahl der Waffendiebstähle in unserem Stadtgebiet seit zwei Jahren stetig zugenommen hat. Da wird mal ein Waffengeschäft überfallen, da wird in ein Polizeirevier eingebrochen, da fehlen auf einem Stützpunkt der Army plötzlich automatische Waffen.‟
„Ach du Schande!‟, stöhnte Milo. Auch mir schwante Böses.
„Und jetzt rückt die Army damit raus, dass vor kurzem bei einem Manöver in den Wäldern New Jerseys ein Spähtrupp überfallen wurde. Vier tote Marines. Ein Maschinengewehr und drei Schnellfeuergewehre sind wie vom Erdboden verschluckt. Eines davon ist vor einer Woche bei einer Schießerei in Harlem aufgetaucht.‟
„Das klingt so, als würde irgend jemand aufrüsten‟, dachte ich laut. „Und Sie glauben, dass der Anstieg der Mordrate mit den Waffendiebstählen zusammenhängt, Sir?‟
„Das sollten Sie herausfinden, Gentlemen. Der Bürgermeister und die Leitung der New York City Police sind jedenfalls sehr beunruhigt und haben unsere Vorgesetzten in Washington aufgescheucht. Von dort kam gestern die Anweisung wegen Verdachts auf Terrorismus zu ermitteln.‟
„Das sieht ja nach einer Menge Arbeit aus‟, sagte Milo, „wo sollen wir Ihrer Meinung nach ansetzen, Sir?‟
„An ihrem Schreibtisch.‟ Jonathan McKee lächelte. Er wusste, wie sehr wir beide Schreibtischarbeit liebten. „Sorry, aber Ihr Job besteht zunächst mal aus Recherchen. Durchforsten Sie sämtliche Datenbanken – vergleichen Sie beschlagnahmte Waffen mit der Liste der als gestohlen gemeldeten. Schauen Sie sich die Berichte über Waffendiebstähle an, und so weiter. Sie werden das schon hinkriegen.‟ Er erhob sich. „Viel Glück, Gentlemen.‟
Wir fuhren in unser Büro hinauf. Unsere Stimmung war leicht angeschlagen. „Die Woche hatte so gut angefangen‟, brummte Milo.
„Ja‟, sagte ich, „es konnte eigentlich nur noch schlechter werden.‟
8
Der Rauch der Zigarette kroch über die dunkelblauen Kacheln, zog an dem geöffneten Fensterflügel vorbei, kletterte wabernd die gusseiserne Stange des Fenstergitters hinauf, und löste sich in der warmen Morgenluft vor der Columbia University auf.
Als hätte er alle Zeit der Welt, verfolgte Ernest Jefferson die sanften Bewegungen der Rauchschwaden. Sehnsüchtig dachte der nicht ganz schlanke Mann an die guten alten Zeiten, in denen er seine Marlboros noch im Büro, oder wenigstens draußen, vor dem Eingang des geisteswissenschaftlichen Institutes hatte rauchen konnte. Seit das Rektorat das Rauchen auf dem gesamten Campus verboten hatte, war selbst er gezwungen, seine Zigarettenpausen auf der Toilette zu verbringen.
Eine Spüle ertönte, und die Tür einer WC-Kabine wurde aufgestoßen. Ernest drehte sich um: Ein junger Mann grinste ihm entgegen. Sie zwinkerten sich zu, und der Student verließ die Toilette. Die Raucher an der Uni bildeten inzwischen eine verschworene Solidaritätsgemeinschaft.
Ernest sah auf die Uhr. In vier Minuten begann seine nächste Vorlesung – amerikanische Literatur. Heute war Charles Bukowski angesagt. Ein Dichter, den Ernest besonders schätzte. Nicht nur aus literarischen Gründen.
Einer seiner Studenten hatte versprochen, Kopien mit Texten zu verteilen und den Overheadprojektor aufzubauen. Also konnte Ernest sich Zeit lassen.
Er nahm einen tiefen Zug von der Zigarette und angelte umständlich eine kleine, flache Flasche aus seinem hellgrauen Sakko. Der Whisky rann brennend seine Kehle hinunter. Ernest stöhnte genüsslich. Zweimal im Lauf eines Vormittags gönnte er sich einen Schluck. Die Zigarette schmeckte dann noch einmal so gut.
Ein letzter Zug – dann versenkte er die Kippe in der Kloschüssel und wusch sich gründlich die Hände. Er musterte sein blasses, etwas aufgedunsenes Gesicht im Spiegel und strich sich durch die weiße Mähne. Seine kleinen, grünen Augen funkelten hellwach. Ein Pfefferminzbonbon noch und ein Spritzer Kölnisch Wasser an Kragen und Fingerspitzen, und der Tag konnte weitergehen.
Ernest schnappte sich seine alte Aktentasche, die er wie immer auf der Heizung abgestellt hatte, und machte sich auf den Weg in den Hörsaal.
Stimmengewirr von fast achtzig Studenten empfing ihn. Während er winkend zum Pult schaukelte, verstummten die vielen Unterhaltungen. Sein Blick fiel missmutig auf den Stapel Kopien auf seinem Pult – Gedichte von Bukowski. Die sollten längst verteilt sein.
Auch vom Overheadprojektor keine Spur, und die Leinwand hing noch säuberlich eingerollt unter der Decke. Mit gerunzelter Stirn suchten die Augen des Professors die vorderste Reihe des Auditoriums ab. Der Student, der ihm versprochen hatte, die Texte zu verteilen und den Projektor betriebsbereit zu machen, war nirgends zu sehen.
„Henry Portman nicht da?‟ Er erntete nur Schulterzucken. Ernest schüttelte unwillig den Kopf und deutete auf den Stapel Papiere. Zwei Studenten verteilten sie, ein Dritter kümmerte sich um den Projektor.
Normalerweise konnte Ernest sich auf Henry verlassen. Er war sein eifrigster Schüler und ließ keine Gelegenheit aus, seinem alten Professor seine Bewunderung zu beweisen.
Portman hatte noch nie bei einer seiner Vorlesungen gefehlt. Aber jetzt war keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Die Studenten beschlagnahmten ihn, und Charles Bukowski wollte unter die Leute gebracht werden.
Ernest kramte einen zerlesenen Gedichtband aus seiner Tasche. „Zunächst ein paar Textproben.‟ Er blätterte ein Weilchen in seinem Buch herum, bis er die Stelle fand. „Eine Nacht mit Mozart‟. Er räusperte sich und las das Gedicht mit erhobener Stimme vor:
„Sie erschossen ihn in seinem Wagen und schlitzten ihm die Taschen auf; die 1800 Dollar teilten sie sich zu viert. Ich hatte ihn regelmäßig auf dem Pferderennplatz gesehen ...‟
Ernest Jefferson gehörte zu den Hochschullehrern an der Columbia University, die sich nicht zu wichtig fanden, um mit den Studenten auch mal ein persönliches Wort zu reden. Es war nicht seine Art, am Katheder zu stehen und seine Konzepte abzuspulen, als hätte er einen Hörsaal voller Luft vor sich. Und er liebte sein Fach – die Literatur. Wenn Ernest Gedichte las, passierte es regelmäßig, dass ein paar Studenten in schallendes Gelächter ausbrachen – oder sich verstohlen die Tränen aus den Augen wischten.
Nach der Vorlesung sprach er einen farbigen Studenten an, von dem er wusste, dass er wie Henry Portman in Harlem wohnte. „Ist Henry krank, oder was?‟
Der schwarze Junge zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, ehrlich nicht. Hab′ ihn die letzten zwei Tage nicht gesehen. Weder hier noch in der Metro.‟
Henry Portman hatte eine außergewöhnlich gute Semesterarbeit bei Ernest abgeliefert. Sie hatten für morgen, Mittwoch, einen Termin vereinbart, um die Arbeit zu besprechen. Der Professor beschloss, bis morgen abzuwarten.
Doch auch am nächsten Tag ließ Portman sich nicht blicken. Als er zum verabredeten Termin nicht in seinem Büro erschien und sich nicht einmal telefonisch entschuldigte, griff Ernest Jefferson zum Telefon und wählte die Nummer, die ihm sein Student gegeben hatte. Eine fremde Stimme meldete sich. „Bailey?‟
„Entschuldigung!‟ Ernest runzelte überrascht die Stirn. „Hab′ ich mich wohl verwählt.‟
„Wen wollten Sie denn sprechen?‟
„Henry Portman.‟
„Der ist vor ein paar Tagen umgezogen.‟ Die Männerstimme nahm einen Unterton an, der Ernest an Schmirgelpapier erinnerte. „Ich hol′ mal was zum Schreiben. Wenn er sich meldet, kann ich ihm ja was ausrichten.‟
„Lassen Sie mal‟, sagte Ernest rasch, „ist nicht so wichtig.‟ Der Mann wollte seinen Namen und den Grund seines Anrufes wissen. Aber der Professor wimmelte ihn ab und legte auf.
„Umgezogen‟, murmelte er. Das Studenten im Laufe ihres Studiums umzogen, war nichts Ungewöhnliches. Aber dass sie deswegen nicht zur Vorlesung kamen, schon. „Es sei denn, sie ziehen in eine andere Stadt‟, überlegte Ernest. „Aber dann müssten sie sich exmatrikulieren.‟
Er griff erneut zum Telefonhörer und wählte die Nummer der Verwaltung. „Hat sich ein Student namens Henry Portman in den letzten drei Tagen abgemeldet?‟
Die Sekretärin stöberte auf ihrer Festplatte herum, bis Portmans Name auf dem Monitor erschien. „Nein, der ist bei uns eingeschrieben. Für Literatur und Politologie.‟
„Danke.‟ Ernest legte auf. Nachdenklich betrachtete er seine fleischigen Hände. Er kramte die vier, fünf längeren Gespräche mit Portman aus seinem Gedächtnis und versuchte sich zu erinnern, ob er irgendwelche Hinweise auf einen bevorstehenden Umzug von dem jungen Mann gehört hatte.
Die Kirche fiel ihm ein, an die sich Portman in den letzten zwei Jahren gehalten hatte. Bis vor wenigen Monaten. Und die ausweichende Art, mit der er seinen Austritt begründete. Ernest erinnerte sich noch genau, wie plötzlich ein verschlossener Zug auf das Gesicht des Studenten getreten war, als er ihn danach gefragt hatte. Als gäbe es da Geheimnisse, über die er nicht reden durfte.
Er zog die unterste Schublade seines Schreibtisches auf und angelte eine Whiskyflasche und ein Glas heraus. Während er sich einen Drink einschenkte, fiel ihm der Bekannte ein, von dem Henry mal erzählte hatte. Ein FBI-Mann, mit dem er ab und zu Billard spielte. Und über Gott und die Welt diskutierte. Wie hieß er gleich? Ted oder Ed. Gehörte der nicht auch zu Henrys Kirche?
„Aber soviel schwarze FBI-Agenten, die in Harlem wohnen, wird es ja in New York City nicht geben‟, murmelte er und griff zum dritten Mal nach dem Telefon ...
9
Drei Tage brauchte Rose, bis sie sich wieder leidlich im Griff hatte. Drei üble Tage. Die vier Toten verfolgten sie nachts im Schlaf. Und tagsüber stand ihr Chef auf ihrer inneren Bühne. Sein dämliches Gesicht schnürte ihr den Magen zusammen.
Sie verfluchte ihre Kollegen, von denen keiner den Mut gehabt hatte, sich für sie einzusetzen, sie verfluchte Stanford, ihren SAC, sie verfluchte das FBI.
Scheißladen, verdammter!
Es ging ihr schlecht, wirklich schlecht.
Drei Stunden nach ihrer Suspendierung setzte sie sich auf ihr Motorrad – eine nagelneue Yamaha – und verließ die Stadt. Weit nach Arizona fuhr sie hinein. Irgendwo in der Einsamkeit der kargen Steppenlandschaft schlug sie ihr Einmann-Zelt auf.
Den zweiten Tag nach ihrer Suspendierung kletterte sie auf einen Tafelberg. Auf dem Gipfel schrie und weinte sie ihren Frust heraus. Danach fühlte sie sich besser.
Am dritten Tag fuhr sie zurück nach San Francisco. Die Nacht verbrachte sie in einer Disco in Downtown; in einer Schwulendisco – sie hatte nicht die geringste Lust von einem Kerl angemacht zu werden. Bis zum Morgengrauen tanzte sie durch. Danach schlief sie ein paar Stunden. Ohne von den toten Zuhältern gestört zu werden. Als sie aufwachte, war auch ihre innere Bühne wieder frei.
Und die üblichen Sorgen meldeten sich zu Wort. Das waren bei Rose meistens Geldsorgen. Sie pflegte grundsätzlich Geld auszugeben, das sie erst noch verdienen musste. Sie war mit der Miete um einen Monat in Rückstand. Das Motorrad, das sie vor drei Wochen gekauft hatte, hatte ein gewaltiges Loch in ihren Haushalt gerissen.
Sie musste davon ausgehen, dass in nächster Zeit nur ein Teil ihres Gehaltes ausbezahlt würde. Vorsichtshalber musste sie sich also nach irgendwelchen Geldquellen umsehen. Und wenn man auf der anerkannten Seite des Gesetzes stand, hieß das: Ein Job musste her.
Rose schwang sich auf ihre Maschine und fuhr nach Downtown hinein. In der Pine Street, nicht weit vom Financial District, parkte sie in der Tiefgarage eines zehnstöckigen Hauses.
Über das Treppenhaus gelangte sie ins Erdgeschoss. Dort hatte der Mann, den sie besuchen wollte sein Büro – Bill Jensen. Bill war ehemaliger FBI-Agent. Vier Wochen, nachdem Rose im District Office San Francisco angefangen hatte, war er vom Dienst suspendiert worden. Er hatte sich bei verdeckten Vermittlungen im Drogenmilieu zu weit aus dem Fenster gelehnt. Der Staatsanwalt hatte ihm eine Reihe von Ermittlungsmethoden nachgewiesen, die im Gesetz nicht vorgesehen waren.
Jetzt schlug er sich als Privatdetektiv durch.
Sie hatten es für ein paar Wochen miteinander versucht. Anderthalb Jahre war es her. Aber über einen gemeinsamen Urlaub in Hawaii waren sie nicht hinausgekommen.
„Hi, Bill‟, begrüßte sie ihn.
„Hi, Rose‟, er machte ein verblüfftes Gesicht und stand auf, um sie zu umarmen. „Was verschafft mir die seltene Ehre?‟
Rose warf ihre Lederjacke auf einen freien Stuhl und legte ihren Helm dazu. „Ich brauch′ Geld. Hast du einen Job für mich?‟ Sie ließ sich in den Sessel an seinem Schreibtisch fallen.
Er starrte sie entgeistert an. „Soll das heißen, dass du ...?‟ Er setzte auf seinen Schreibtisch.
„Ja, das soll es heißen – Stanford hat mich in die Wüste geschickt. Und demnächst muss ich in Washington zu Kreuze kriechen.‟
„Was ist passiert?‟
Rose hob abwehrend beide Hände. „Keine Fragen bitte! Hast du einen Job für mich – ja oder nein?!‟
Schweigend musterte er sie eine Zeitlang. „Du siehst gut aus, Rose.‟ Er stand auf, ging um den Schreibtisch herum, und setzte sich in seinen Arbeitssessel.
„Das weiß ich, aber danach habe ich nicht gefragt.‟ Rose merkte, dass sie herber reagierte, als sie wollte. „Sorry, Bill – meine Nerven liegen blank. Ich brauch′ Arbeit. Kannst du mir helfen?‟
„Geduld, Mädchen. Meine Bemerkung, dass du gut aussiehst, war gewissermaßen schon der erste Teil einer Antwort – ich suche nämlich eine Detektivin, die gut aussieht.‟ Er holte einen Heftordner aus der obersten Schublade seines Schreibtisches.
„Doch nicht etwa im Rotlichtmilieu?!‟
„Glaubst du, ich würde dich verderben wollen?‟ Er grinste. „Nein, nein – etwas anderes.‟ Er hob die Akte hoch. „Gestern war die Frau eines Ölmagnaten bei mir. Ein Multimillionär aus Houston, Texas. Sie will ums Verrecken wissen, ob ihr Mann fremd geht.‟ Er sah sie prüfend an. „Und du wärst die Richtige um ihn – sagen wir: Im Feuer der Versuchung zu testen.‟ Er warf die Akte vor sie auf den Schreibtisch.
Rose hob entsetzt beide Arme. „Ach du Scheiße!‟ Dann spähte sie nach der Akte. „Wie viel?‟
Bill wiegte unschlüssig den Kopf. „Sechshundert Dollar pro Ermittlungstag?‟
Rose griff nach der Akte. „Warum nicht ...‟
10
Auf dem Bildschirm des PCs flimmerte eine Namensliste. Neben der Tastatur das teure Handbuch von Henry Portman. Ed arbeitete mit der neuen Datenbank. Die Idee, seine Jagd auf Bankräuber mit dieser Software zu erleichtern, ließ ihn nicht mehr los. Stunden verbrachte er zu Hause vor dem Computer. In zwei Wochen, schätzte er, würde er soweit sein, die Idee seinem Chef vorzustellen.
„Wir sind dann unterwegs, Darling.‟ Tina beugte sich über Eds Schulter und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Ed speicherte seine neue Datei und drehte sich um. „Unterwegs? Wohin?‟
„Ach, Ed! Du weißt doch schon seit Anfang der Woche, dass am Freitagabend ein Gemeindefest stattfindet!‟ Tina setzte eine vorwurfsvolle Miene auf. „Und heute ist Freitag!‟
„Ach so, richtig.‟ Er stand auf und nahm sie in den Arm. „Viel Spaß dann.‟ Die beiden Kids sprangen an ihm hoch, um sich zu verabschieden. Ed brachte seine Familie zur Wohnungstür.
Kurz darauf hängte er sich ans offene Fenster und sah ihnen hinterher. Die Kinder entdeckten ihn und winkten ihm zu. Er winkte zurück.
Die Straße war voller Menschen. Wie immer um diese Zeit. Noch in drei, vier Stunden, lange nach Einbruch der Dunkelheit, würden Kids da unten spielen, während ihre Eltern das eine oder andere Bier leerten, oder sogar einen Grill in den Vorgarten stellten. Ed nahm sich vor, sich später ein wenig unter das Volk auf der Straße zu mischen.
Der Mann, der auf der anderen Straßenseite auf der Treppe eines Hauseingangs saß und ihn beobachtete, fiel ihm nicht weiter auf.
Ed wartete, bis seine Familie um die nächste Straßenecke gebogen war. Dann setzte er sich wieder an seinen PC.
Er arbeitete, bis es dunkel wurde. Durch das offene Fenster drangen Musik und Gelächter in sein Arbeitszimmer. Ein Blick auf die Straße – die Nachbarn saßen in drei kleinen Gruppen beieinander. Direkt gegenüber glühte ein Holzkohlenfeuer in einem Grill. Jemand erkannte ihn am Fenster. „Komm runter, Ed, du alter Stubenhocker!‟
Er schaltete den PC aus. Das Handbuch für die Software ließ er aufgeschlagen liegen. Henry, der Besitzer des Buches, fiel ihm ein. Und dass er immer noch nicht dazu gekommen war, seinen Nachbarn anzurufen.
Also zum Telefon und Jimmy Chicoreas Nummer gewählt. Fehlanzeige – es meldete sich niemand.
Ed stieg die Treppe hinab und gesellte sich zu den Männern und Frauen vor dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine Bierdose wurde ihm in die Hand gedrückt. Irgend jemand tastete ihn scherzhaft nach seiner Dienstwaffe ab. Natürlich hatte er sie nicht dabei. Sie lag oben. Neben seinem Bett auf dem Boden.
Er hob beide Arme und stimmte in das allgemeine Gelächter ein. Aber das war auch die einzige Anspielung auf seinen Job. Jedermann hier wusste, dass Ed Yorkham nicht gerne über seinen Beruf sprach. Er tat sich schwer genug, umzuschalten, wenn mal zur Abwechslung Freizeit angesagt war.
Ein Schatten huschte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in das Dreifamilienhaus, in dem die Yorkhams wohnten. Niemand nahm ihn wahr.
Gegen halb elf sah Ed auf die Uhr und begann, unruhig die Straße hinunter zu schauen. Nach seinem Geschmack wurde es langsam Zeit, dass Tina und die Kinder nach Hause kamen. Er trank sein Bier aus und verabschiedete sich.
„Hey, Ed, Mann – komm öfter herunter zu uns, dann fühl′n wir uns sicherer!‟, rief einer. Die anderen lachten.
„Versprochen.‟ Ed winkte und schlenderte über die Straße.
Das Bier hatte ihn müde gemacht. Gähnend betrat er die Wohnung. Im Dunkeln legte er sich auf das französische Bett im Schlafzimmer. Die Tür ließ er angelehnt. Ein Lichtschimmer aus dem erleuchteten Flur fiel in den Raum.
Das Bier arbeitete sich durch sein Hirn, der Tag war anstrengend, und irgendwann sackte Ed weg.
Ein Geräusch im Flur ließ ihn plötzlich hochschrecken. Schritte vor der Schlafzimmertür. Er schüttelte sich und versuchte die Digitalanzeige des Weckers auf Tinas Nachttisch zu entziffern – halb zwölf.
„Tina?‟ Keine Antwort. „Hey, Tina – seid ihr endlich zurück?‟ Das Licht im Flur ging aus. Ed fuhr hoch und lauschte. Sein Herzschlag dröhnte ihm plötzlich in den Schläfen. Ein Eisschauer fuhr seinen Brustkorb herauf und hinunter.
Die Schlafzimmertür bewegte sich. Langsam und geräuschlos ging sie auf. Im Dunkeln die Umrisse eines Mannes. Instinktiv rollte sich Ed quer über das Bett in ließ sich auf der anderen Seite auf den Boden fallen.
Ein metallenes Floppen, die Kugel surrte pfeifend von der Wand zu Wand und schlug in klirrend in Glas ein. Tinas Schminktisch. Oder das große, gerahmte Foto der Kinder.
Ed presste seine Stirn gegen den Teppichboden und kämpfte gegen das Chaos aus Bildern und Panik unter seiner Schädeldecke. Und er unterdrückte das Brennen in seiner Brust, das ihn zwingen wollte, laut und keuchend zu atmen.
Leise, Ed, ganz leise ... er benutzt einen Schalldämpfer ...
Er lauschte. Der Boden knarrte drüben auf der anderen Seite des Bettes.
Irgend jemand will dich umlegen ... ein Junkie ... ein Typ, den du in den Knast gebracht hast ... Scheißegal – irgend jemand will dich umlegen ...
Er verfluchte den Umstand, dass seine Dienstwaffe auf der anderen Seite auf dem Boden unter dem Nachttisch lag, auf seiner Seite. Er musste irgendwie über das Bett kommen. Möglichst, bevor Tina und die Kinder zurückkamen.
Wahrscheinlich ein ehemaliger Knacki ... ein Einbrecher oder ein Junkie benutzen keinen Schalldämpfer ... das muss ein Profi sein, Ed ...
Der Gedanke, dass der bewaffnete Eindringling auf seine Familie treffen konnte, überflutete sein Hirn erneut mit Panik.
Bleib cool, Mann, bleib cool ...
Er lauschte. Kaum hörbares Seufzen von Luftpolstern in Turnschuhen am Fußende des Bettes. Sein unsichtbarer Gegner bewegte sich langsam auf seine Deckung zu.
Du wirst dich hier nicht abknallen lassen, Ed. Hey, Mann – was werden deine Kollegen sagen, wenn du dich hier abknallen lässt, wie ein Karnickel ...
Er atmete tief ein. Behutsam schob er seine Hände unter Tinas Nachttisch.
Du musst auf die andere Seite des Bettes ... ohne deinen Revolver hast du null Chance ... du musst ...
Er ließ sich vorsichtig auf den Rücken kippen. Seine Handflächen berührten jetzt den Boden des Nachttischs. Er wollte ihn an der Fensterwand vorbei gegen den Garderobenschrank an die gegenüberliegende Seite des Raumes schleudern. Weniger, um seinen Gegner zu treffen, sondern um ihn für eine entscheidende Sekunde abzulenken.
Ruhig, Ed, ruhig ... nimm dir Zeit ... es geht um deine gottverdammte Haut ... konzentrier dich ... zieh die Beine an ... es geht um deine schöne, schwarze Haut ...
Er stemmte den Nachttisch hoch und schleuderte ihn in die Dunkelheit. Gleichzeitig sprang er auf und hechtete über das Bett.
Wieder das Floppen. Heiß bohrte sich die Kugel in seinen Oberarm. Er unterdrücke einen Schrei.
Ed rutschte vom Bett. Er fiel auf den angeschossenen Oberarm, eine Schmerzwelle schoss durch seinen Körper. Seine Rechte fuhr unter den Nachttisch, tastete den Teppichboden ab – nichts!
Mein Revolver ... verdammt, wo ist mein Schießeisen ...
Und dann direkt vor ihm die Gestalt seines Gegners. In panischem Schreck versuchte Ed, ihm den Nachttisch entgegen zu schleudern. „Du Misthund! Nimm dir was du willst, und hau ab!‟
Das trockene Knallen der Waffe. Der Nachttisch fiel auf Eds Beine. In seiner Brust surrte etwas zusammen. Die Luft blieb ihm weg. Er bekam die heruntergefallene Nachttischlampe zu fassen, drückte auf den Schalter, sah den Kerl über sich stehen, sah in den langen Lauf der Pistole – die nächste Kugel durchschlug seine Wange.
Ein roter Nebel kroch über seine Augäpfel. Er hörte den Kerl davonrennen. Er hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel. Dann nur noch das Keuchen seiner eigenen, bedrohlich kurzen Atemzüge.
Wie ein schwankendes Schiff kippte das Schlafzimmer nach links weg, fing sich, und wippte quälend langsam nach rechts.
In Zeitlupe hob Ed seine rechte Hand und tastete nach seinem Gesicht – warme, klebrige Nässe.
Der rote Nebel vor seinen Augen begann, sich schwarz zu verfärben. Sein Lebenswille bäumte sich auf. Er schob sich aus dem Schlafzimmer, er schob sich über den Flur – Zentimeter für Zentimeter näherte er sich dem Telefontisch neben dem Garderobenspiegel.
Er schaffte es noch, den Apparat herunter zu ziehen. Sogar die Null zu drücken, schaffte er noch. Doch als eine Frauenstimme sich meldete, versagten seine Kräfte.





























