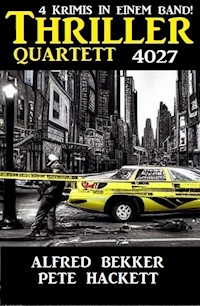
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dieser Band enthält folgende Krimis: (499XE) Trevellian und der Schlitzer von Harlem (Pete Hackett) Trevellian und die tödlichen Millionen (Pete Hackett) Der Fall mit dem Stadtpark-Killer (Alfred Bekker) Wettlauf mit dem Killer (Alfred Bekker) Der Blick des Bikers fixierte zwei Männer. Der eine war groß, schlaksig und war mit einem dunklen Anzug bekleidet. Schon deswegen fiel er unter den Joggern und Skateboardern ziemlich auf. Der andere war klein und breitschultrig. Er trug eine braune Lederjacke. Die beiden waren in ein ziemlich gestenreiches Gespräch verwickelt. Der Mann im Anzug setzte eine Sonnenbrille auf. Sein Gesicht war rot. Der Breitschultrige in der Lederjacke redete auf ihn ein. Ein Skateboarder kurvte riskant um die beiden herum und balancierte dabei auch noch einen Ghettoblaster auf den Schultern. Der Mann im Anzug wich ein Stück zur Seite. Der Biker fasste unterdessen den Griff der Pistole fester, entsicherte sie. Ein guter Jäger muss den richtigen Moment abwarten!, dachte er kalt. Ein guter Jäger - oder ein Killer! So war das eben. Darauf lief es hinaus. Er beobachtete, wie der Mann im Anzug in die Jackettinnentasche griff und ein gepolstertes, braunes Kuvert herausholte. Der Kerl in der Lederjacke riss es förmlich an sich, verbarg es dann sofort unter der Jacke. Er drehte sich kurz um, ließ den Blick kreisen. Um ein Haar rempelte er einen Jogger an, als er einen Schritt zur Seite machte. Der Killer erkannte jetzt, dass er nicht länger zögern durfte. Sonst würde es unmöglich werden, beide Männer auf einmal zu töten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Alfred Bekker
Thriller Quartett 4027 - 4 Krimis in einem Band!
Inhaltsverzeichnis
Thriller Quartett 4027 - 4 Krimis in einem Band!
Copyright
Trevellian und der Schlitzer von Harlem
Trevellian und die tödlichen Millionen
Der Fall mit dem Stadtpark-Killer
Wettlauf mit dem Killer
Thriller Quartett 4027 - 4 Krimis in einem Band!
Pete Hackett, Alfred Bekker
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und der Schlitzer von Harlem (Pete Hackett)
Trevellian und die tödlichen Millionen (Pete Hackett)
Der Fall mit dem Stadtpark-Killer (Alfred Bekker)
Wettlauf mit dem Killer (Alfred Bekker)
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und der Schlitzer von Harlem
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 111 Taschenbuchseiten.
Prostituierte vom Straßenstrich werden in mehreren Städten ermordet, das Herz wird ihnen herausgeschnitten. Die FBI-Agenten Trevellian und Tucker ermitteln gegen Anhänger von Satanskulten. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wie die Agenten wissen. Und die Täter gehen wortwörtlich über Leichen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Belinda Brown stand am Straßenrand und wartete auf Kundschaft. Sie ging auf den Strich. Das Geld benötigte sie, um für sich und Ken Douglas die notwendigen Drogen beschaffen zu können. Beide waren heroinabhängig.
Belinda schlenderte etwas gelangweilt hin und her. Noch ein paar andere Ladys vom horizontalen Gewerbe belagerten die Gehsteige. Keine von denen, die hier anschafften, war registriert. Autos rollten die Straße hinauf und hinunter. Es war kühl und Belinda fröstelte es in ihrem Outfit, das mehr zeigte als es verbarg; kurzer Rock, freizügige Bluse, kniehohe Stiefel. Das war alles.
Ein weißer Ford Lincoln rollte heran. Bei Belinda bremste der Fahrer. Schnell waren sich das Mädchen und der Kunde einig. Belinda stieg in den Wagen ein. Es wurde eine Fahrt in den Tod …
Der Freier lenkte den Ford an den Rand des Marcus Garvey Parks und hielt an einer dunklen Stelle an. Er beugte sich etwas hinüber zu Belinda. Ein fast betreten wirkendes Lächeln bog seine Mundwinkel in die Höhe. Er sagte: „Ich denke, auf dem Vordersitz ist es ziemlich unbequem. Gehen wir nach hinten in den Fond. Dort haben wir Platz.“
„Von mir aus“, sagte Belinda und öffnete die Beifahrertür.
Auch der Kunde stieg aus. Es war ein Mann von etwa vierzig Jahren, schlank, etwa eins-achtzig groß. Seine Haare begannen sich schon grau zu färben. Er war mit einem Anzug und einem hellblauen Hemd bekleidet. Belinda tippte, dass es sich um einen Beamten oder höheren Angestellten handelte.
Belinda ließ sich auf den Rücksitz fallen. Der Mann setzte sich neben sie, legte ihr den rechten Arm um die Schulter und griff mit der linken Hand nach einer ihrer prallen Brüste.
„Das ist im Preis nicht enthalten“, stieß sie hervor. „Du hast lediglich für …“
Brutal drückte er sie mit seinem rechten Arm an sich heran. Ihre Stimme erstarb. Nur noch ein japsender Laut kam über ihre Lippen. Die linke Hand des Mannes packte sie an der Kehle und drückte sie unerbittlich zusammen. Belinda wand sich unter dem erbarmungslosen Griff, bäumte sich auf, ihre Lippen klafften auseinander. Ihre Lungen schrien nach Sauerstoff. Die Augen quollen ihr aus den Höhlen. Benommenheit brandete gegen ihr Bewusstsein an, weil durch die würgende Hand die Blutzufuhr zum Gehirn nicht mehr gewährleistet war. Und dann verlor Belinda die Besinnung. Ihre Gestalt erschlaffte.
Der Mann nahm seine Hand von ihrem Hals. Er stieg aus dem Wagen, ging zur Beifahrertür, öffnete sie, beugte sich ins Innere des Wagens und klappte das Handschuhfach auf. Er entnahm ihm eine dünne Schnur und ein Stück Tuch. Mit der Schnur fesselte er Belindas Hände auf den Rücken. Mit dem Tuch knebelte er das Mädchen. Er ließ es auf dem Rücksitz liegen. Der Bursche klemmte sich hinter das Steuer und fuhr weg.
Die Uhr im Armaturenbrett zeigte 23 Uhr 16.
Der Mann fuhr mit seinem Opfer in die 121. Straße. Hier gab es fast nur Ruinen und unbewohnte Häuser. Ratten und ein paar Obdachlose lebten hier. Viele Türen waren mit Brettern vernagelt. Die Fenster waren eingeschlagen. Vor einem vierstöckigen Gebäude wurde der Lincoln angehalten. Der Motor starb ab, die Scheinwerfer verloschen.
Die Straße war wie ausgestorben. Es war in dieser Gegend gefährlich, sich zu fortgeschrittener Stunde auf die Straße zu wagen. Brutale Streetgangs machten Harlem unsicher. Selbst die Polizei hütete sich, in diesen dunklen Straßen Patrouille zu fahren. Gegen eine Kugel aus einer finsteren Ecke waren nämlich auch die Cops nicht gefeit.
Der Mann stieg aus dem Ford. Er schaute sich um. Dann öffnete er die Hintertür und zog Belinda aus dem Auto. Das Mädchen war noch immer nicht bei Besinnung. Der Mann schleppte es zu einer Treppe, die zur Tür einer Kellerwohnung führte. Hinter dem Fenster war es finster. Der Mann schloss die Tür auf und schleifte Belinda hinein. Dann kehrte er zu seinem Wagen zurück und verschloss ihn.
Anschließend ging er in die Wohnung und sperrte die Tür ab. Ehe er Licht machte, zog er sorgfältig die dicken Vorhänge vor dem Fenster zu. Von außen einen Blick in die Wohnung zu werfen war unmöglich.
Der Mann hob Belinda auf und legte sie auf die Couch, die in dem Raum stand. Er trat durch eine Tür ins Badezimmer und wusch sich die Hände. Dann kam er in den Livingroom zurück. Er zog sich einen Stuhl an die Couch heran und setzte sich. Geduldig wartete er, bis Belinda erwachte.
Die Lider des Mädchens zuckten. Dann öffnete es die Augen. Sekundenlang starrte Belinda mit dem Ausdruck des absoluten Nichtbegreifens zur Zimmerdecke hinauf. Dann schien die Erinnerung einzusetzen, und in ihre Miene schlichen sich die Angst und das Entsetzen. Der Mann zog ihr den Knebel aus dem Mund. Belinda zerrte an ihrer Handfessel. Sie drehte den Kopf ein wenig und sah den Burschen neben der Couch sitzen.
Das Begreifen kam mit einer fast schmerzhaften Intensität. Sie befand sich in der Gewalt eines Perverslings, eines Sittenstrolchs, vielleicht sogar eines gefährlichen Verrückten. Eine unsichtbare Hand schien Belinda zu würgen. Ihr Blick begegnete dem des Mannes. Sie registrierte, dass er braune Augen hatte. Kalt starrten sie diese Augen an.
„Was soll das?“, entrang es sich Belinda. „Warum haben Sie mich gefesselt und …“
Er unterbrach sie. „Du bist es nicht wert zu leben, du kleine, miese Hure. Darum werde ich dich töten. Erst aber wirst du durch die Hölle gehen. Und mach dir keine Hoffnungen. Du entkommst mir nicht. Was ich einmal habe, lasse ich nicht mehr los.“
„Wer sind Sie? Warum tun Sie das?“ Belinda versuchte, ihren Oberkörper aufzurichten.
Der Mann drückte sie auf das Sofa zurück. „Liegenbleiben“, knurrte er. Dann fügte er hinzu: „Du hast sicher schon in der Zeitung von mir gelesen oder in den Nachrichten von mir gehört. Man nennt mich den Schlitzer. Ich fühle mich berufen, die Welt von Parasiten wie dir zu säubern. Drei deiner Kolleginnen habe ich schon bestraft. Auch du wirst büßen. Und dir werden noch viele Huren folgen.“
Ein Verrückter! Das stand für Belinda schlagartig fest. Vielleicht ein religiöser Eiferer!
Das Grauen kam bei Belinda wie ein Schwall eiskaltes Wassers. Natürlich hatte sie schon vom „Schlitzer“ gehört. Die Medien begannen ihn schon mit Jack the Ripper zu vergleichen. Drei Frauen hatte er bisher brutal ermordet. Alle drei waren auf den Strich gegangen.
Die Polizei tappte im Dunkeln.
„Aus welchem Grund?“, keuchte Belinda. Sie wand ihre Hände in den Fesseln. Tief schnitten die Schnüre in ihre Haut ein. Die Blutzufuhr zu den Fingern war eingeschränkt, die Hände wurden taub.
„Ich muss es tun“, sagte der Mann. „Du und deinesgleichen verbreiten Krankheiten, Seuchen, die unter der Menschheit wüten werden wie die Pest im Mittelalter, wenn man das Übel nicht an der Wurzel packt. Darum musst du sterben. Deshalb mussten auch die drei Huren vor dir sterben. Und weitere werden euch in die Hölle folgen.“
2
Ken Douglas kam um zwei Uhr in die Morningside Avenue. Viele der Bordsteinschwalben hatten ihre Arbeit bereits beendet und waren nach Hause gefahren. Douglas fuhr einen Pontiac. Er hielt bei der Ecke, an der Belinda immer zustieg. Heute war sie nicht da.
Douglas stellte den Motor ab und stieg aus. Ein kühler Nachtwind streifte sein Gesicht. Nur noch wenige Autos befuhren die Morningside Avenue. Bei einer Straßenlaterne sah Douglas eines der Mädchen stehen und ging hin. „Hallo, Mary. Wo ist Belinda? Ist sie noch mit ‘nem Freier unterwegs?“
„Ich hab sie seit etwa drei Stunden nicht mehr gesehen, Ken. Himmel, mir fällt das jetzt erst auf. Ich sah sie gegen elf Uhr in einen Wagen steigen. Sie ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.“ Das Mädchen schaute betroffen.
Ken Douglas nagte an seiner Unterlippe. „Das gefällt mir nicht“, knurrte er. „Was war es für ein Wagen, in den sie gestiegen ist?“
„Ich hab nicht aufgepasst. Vielleicht weiß es Cindy. Cindy hat den ganzen Abend in der Nähe gestanden. Gegen Mitternacht hat James sie abgeholt.“
„Hast du Cindys Telefonnummer?“
„Nein. Ich kenne nicht mal ihren richtigen Namen. Machst du dir Sorgen wegen Belinda? Vielleicht hat sie einen besonders zahlungskräftigen Freier aufgerissen. Sie aalt sich vielleicht in einem weichen Hotelbett …“
„Sie hätte mir Bescheid gesagt“, versetzte Ken Douglas.
„Du denkst an den Schlitzer?“
„Mal bloß nicht den Teufel an die Wand.“
„Das liegt mir fern. Aber Tatsache ist, dass der Schlitzer in New York drei Mädchen brutal umgebracht hat.“
„Ich warte hier auf sie.“
„Warum rufst du sie nicht an?“
„Wenn Belinda ihrer Arbeit nachgeht, hat sie ihr Handy ausgeschaltet.“
Ein Wagen kam im Schritttempo die Straße herunter. Es war ein Porsche. Bei Mary hielt der Flitzer an. „Das ist Larry“, sagte Mary. „Er holt mich ab. Lass dir die Zeit nicht zu lang werden, Ken.“
Mit dem letzten Wort öffnete Mary die Beifahrertür des Porsche und stieg an. Der Sportwagen fuhr davon.
Ken Douglas setzte sich in den Pontiac. Diesen Wagen hatte er Belinda zu verdanken. Auch für den Unterhalt der schönen Wohnung in Clinton sorgte Belinda. Sie verdiente in drei Tagen mehr Geld als er früher im ganzen Monat. Da arbeitete er noch als Automechaniker. Jetzt ließ er Belinda für sich arbeiten. Sie finanzierte das Heroin, das sie beide benötigten. Ken Douglas fühlte sich wie ein Mann, der ausgesorgt hatte.
Jetzt machte er sich Sorgen.
Es wurde drei Uhr. Belinda kam nicht. Er wählte ihre Handynummer. Sie hatte ihr Mobiltelefon nicht eingeschaltet.
Um halb vier Uhr fuhr Ken Douglas nach Hause.
Er fand aber keinen Schlaf. Am Morgen fuhr er noch einmal in die Morningside Avenue. Von Belinda keine Spur. Und als ihm Belinda bis gegen 10 Uhr vormittags noch immer kein Lebenszeichen zukommen hatte lassen, verständigte er die Polizei.
3
Drei Tage später, es war Montag, der 28. Juni, wurde im Zentralpark die Leiche der Prostituierten aufgefunden. Wie die drei Mädchen vor Belinda war ihr Leib aufgeschlitzt worden, ihr Herz fehlte. Der Fund sorgte in den Medien für Schlagzeilen. In der New York Times, die vor mir auf dem Schreibtisch lag, hieß es: „Der Schlitzer von New York hat wieder zugeschlagen.“
Ich las den Bericht durch.
Da war von einem Serienmörder die Rede. Ähnliche Morde, hieß es in dem Bericht, waren in den vergangenen Wochen in Baltimore, Cincinnati und Indianapolis geschehen. Der Verfasser des Artikels wandte jedoch ein, dass nicht ein und derselbe Täter am Werk gewesen sein konnte, da zwei Morde zur selben Zeit in Indianapolis und New York geschehen waren, und zwar am 6. Juni.
Es war auch von möglichen Ritualmorden die Rede. Das schloss der Journalist der New York Times aus der Tatsache, dass den Mädchen jeweils die Herzen herausgeschnitten worden waren.
War hier eine Sekte am Werk?
Teufelsanbeter vielleicht?
Waren die Mädchen Opfer Schwarzer Messen geworden?
Ich sprach mit Milo darüber. Mein Kollege sagte: „Eines ist Fakt: Es wurden nur Mädchen vom Straßenstrich ermordet. In New York hier sind alle vier Girls in Harlem verschwunden. Dass es sich hier um ein und denselben Täter handelt, dürfte keine Frage sein. Entweder es ist einer, der die Morde in Baltimore, Cincinnati und Indianapolis nachahmt, oder es handelt sich um eine Gruppe von Leuten, die in mehreren Städten gleichzeitig operiert.“
„Eine Sekte“, stieß ich hervor.
„Möglich. Wir sollten vielleicht mal mit der Mordkommission Verbindung aufnehmen.“
Ich rief beim Police Department an. Der Beamte, der mit der Sache betraut war, erklärte mir, dass es keinen Hinweis auf den oder die Mörder gebe. Dass immer derselbe Täter am Werk gewesen war, stand zur Überzeugung des Kollegen fest. „Warum interessiert Sie der Fall?“, fragte er abschließend.
„Weil es in einigen anderen Staaten ähnliche Morde gab“, versetzte ich. „Es könnte also ein Fall für das FBI werden.“
„Darüber habe ich auch schon nachgedacht, Kollege“, sagte mein Gesprächspartner lachend. „Zumindest hätte ich ihn dann vom Tisch.“
Ich bedankte mich bei dem Kollegen und beendete das Gespräch.
„Vielleicht sollten wir mal mit dem Chef drüber sprechen“, schlug Milo vor.
„Keine schlechte Idee. Ich schätze aber, dass es unser Fall ist, sobald wir Mr. McKee wieder verlassen.“ Ich grinste. „Das bedeutet, dass wir vor dem Rätsel stehen werden, vor dem im Moment noch die Mordkommission steht.“
„Rätsel sind da um gelöst zu werden“, versetzte Milo.
Ich rief Mandy an und ließ uns beim Special Agent in Charge anmelden.
Wenig später saßen wir am Besuchertisch im Büro Mr. McKees. Der Chef war damit einverstanden, dass wir den Fall übernahmen. Nachdem es sich wahrscheinlich um einen Täterkreis handelte, der in verschiedenen Staaten sein Unwesen trieb, war es Bundessache und damit Sache des FBI.
Tags darauf hatten wir auch die Ermittlungsakten von den vier New Yorker Mordfällen auf dem Tisch. Der Eintritt des Todes bei Belinda Brown war den Feststellungen der Gerichtsmedizin zufolge Sonntag, der 27. Juni. Am 24. Juni war das Mädchen spurlos verschwunden.
Wir studierten die Akten ausgiebig. Milo sagte dazwischen einmal: „Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass die Mädchen jeweils an einem Donnerstag entführt werden? Der Mörder schlägt seit dem dritten Juni im Wochentakt zu.“
„Und der Tod ist laut Gerichtsmedizin jeweils an einem Sonntag eingetreten.“
„Das bedeutet, dass am ersten Juli wieder ein Mädchen entführt werden wird.“
„Die Mädchen wurden auch nie dort ermordet, wo sie aufgefunden worden sind. Man hat sie nach Eintritt des Todes zu den jeweiligen Fundorten gebracht. Leider konnte niemand Angaben darüber machen, was es für Fahrzeuge waren, in die die Mädchen gestiegen sind.“
„Wann geschahen die Morde in Baltimore, Cincinnati und Indianapolis?“, fragte Milo.
Eine halbe Stunde und drei Telefongespräche später wussten wir es. Die Mordserie begann am 5. Mai. Die Mädchen wurden an unterschiedlichen Tagen entführt. Morde aber wurden jeweils an einem Sonntag verübt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Ritualmorde handelte, nahm Formen an. Wir waren uns einig, dass irgendwelche Teufelsanbeter für die Morde verantwortlich waren, die jeweils an den Sonntagen Schwarze Messen abhielten, sowohl in Baltimore, Cincinnati und Indianapolis wie auch in New York.
Blutiger Satanskult! Anders war es nicht erklärbar, dass den Mädchen die Herzen herausgeschnitten worden waren. Satansjünger, die in verschiedenen Städten ihrem furchtbaren Glauben frönten und miteinander in Verbindung standen.
Milo und ich waren uns einig. Es handelte sich um Ritualmorde. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass wir mit Satanskult konfrontiert worden wären.
Die Frage war, wo wir ansetzen sollten. Wir gingen unsere Möglichkeiten durch. Das Ergebnis war nicht besonders zufriedenstellend. Es lief im Endeffekt darauf hinaus, dass wir einschlägig Vorbestrafte überprüfen würden müssen.
Ich klickte mich in den Zentralcomputer des FBI ein. Milo versuchte sein Glück im Zentralcomputer des Police Department, zu dem wir Zugang hatten.
Nach einiger Zeit hatten wir einige Namen und Adressen von Leuten, die sich in der Szene des Okkultismus einen Namen gemacht hatten. Wir sortierten jene Leute aus, die nicht in New York wohnten oder die sich derzeit in Haft befanden.
Übrig blieben:
Sebastiano Valdez, mexikanische Abstammung, lebte seit 12 Jahren in New York. Seine derzeitige Adresse war Greene Street, SoHo.
Hugh McLeod, wohnhaft in der 38. Straße Ost, Murray Hill. McLeod hatte wegen Körperverletzung mit Todesfolge sieben Jahren auf Rikers Island verbracht.
Fred Harper, er wohnte in der 77. Straße, Upper West Side. Er hatte wegen Totschlags 12 Jahre hinter Gittern gesessen und war auf Bewährung frei.
Richard Jackson, 42 Jahre alt. Er war wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung vorbestraft. Jackson wohnte in Staten Island, Rockland Avenue No. 1465.
Diese vier Männer pickten wir uns heraus. Jeder von ihnen hatte irgendwann einmal einem Satanszirkel angehört.
Milo sprach aus, was ich dachte: „Damit haben wir vier potentielle Täter, Jesse, die aber nur für die Morde in New York in Frage kommen. Es wurden aber – zum Teil zeitgleich – in Cincinnati, Baltimore und Indianapolis Morde nach demselben Muster verübt. Das Täterprofil ist dasselbe. Die Leichen der Frauen waren immer auf dieselbe Art verstümmelt.“
„Kümmern wir uns erst einmal um unsere vier Kandidaten“, versetzte ich. „Sollte einer dabei sein, der sich verdächtig macht, bleiben wir solange an ihm dran, bis wir ihn haben. Und dann löst sich vielleicht der Rest des Rätsels von selbst.“
„Was ist, wenn wir ihm einen Köder hinwerfen würden“, kam es von Milo.
„Du denkst an eine Frau?“
„An eine Agentin.“
Ich grinste. „Sind Agentinnen keine Frauen?“
„Es sind besondere Frauen“, knurrte Milo. „Ich erinnere mich eines Zitats, das deine Kollegin Sarah Anderson mal gebrauchte. Du hast mir davon erzählt. Wie sagte sie gleich wieder?“ Milo legte theatralisch die Hand an die Stirn. „Ach ja. Jetzt weiß ich‘s. Sie sagte: Ich bin Special Agent, losgelöst von geschlechtlichen Attributen.“
„Sarah war in der Tat eine besondere Frau“, sagte ich und begann für einen Moment in Erinnerungen zu schwelgen. Doch im nächsten Augenblick riss ich mich gewaltsam los und konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart. Ich sagte: „Keine schlechte Idee, Milo. Aber zunächst sollten wir mal die vier Gentlemen checken. Mal sehen, ob sie Alibis für die Tage haben, an denen die Girls verschwanden.“
4
Zunächst fuhren wir in die Greene Street. Dort lebte Sebastiano Valdez. Der Stadtteil SoHo war nur einen Katzensprung vom Federal Building entfernt. Von einer Nachbarin erfuhren wir, dass sich Valdez in der Arbeit befand. Er fuhr eine Straßenkehrmaschine. Die Lady nannte uns auch den Betrieb. Wir ließen Valdez eine Vorladung zurück. Danach sollte er am folgenden Tag um 8 Uhr im Federal Building vorsprechen. Ich vermerkte unsere Zimmernummer auf der Vorladung.
Als nächstes statteten wir Hugh McLeod in der 38. Straße einen Besuch ab. Er war zu Hause und bat uns – nachdem wir uns ausgewiesen hatten – in seine Wohnung. McLeod war nur mit Unterhemd und Hose bekleidet. Er hatte sich seit mindestens drei Tagen nicht mehr rasiert. Übler Geruch drang uns aus der Wohnung entgegen. Es sah hier aus wie in einem Schweinestall. Auf der Couch im Livingroom lag eine Decke. Auf dem Tisch stand eine halbleere Flasche billigen Weines. Der Aschenbecher quoll über. Ein Blick in McLeods gerötete Augen sagte mir, dass der Bursche schon am hellen Vormittag angesäuselt war.
Für mich schied er als Mörder aus.
„Ich bin arbeitslos“, erklärte der Bursche. „Wenn ich mich bei einem Arbeitgeber vorstelle und in den Bewerbungsbogen schreibe, dass ich sieben Jahre eingesperrt war, habe ich schon verloren. Gelegenheitsjobs – ja. Aber eine richtige Anstellung finde ich nicht.“
Ich hätte ihm schon sagen können, woran das – unter anderem – lag. Aber ich hielt mich zurück.
Milo sagte: „Anlässlich der Verhandlung gegen Sie damals kam zur Sprache, dass Sie einem Satanszirkel angehörten, McLeod. Sind Sie nach Ihrer Haftentlassung diesem Zirkel wieder beigetreten? Haben Sie wieder begonnen, an Schwarzen Messen teilzunehmen und …“
McLeod lachte fast belustigt auf, so dass Milo abbrach. Dann stieß der angetrunkene Bursche hervor: „Ich habe mich damals den Satansjüngern zugewandt, weil sie Rauschgift- und Sexorgien feierten. Allerdings war ich kein überzeugter Anhänger Satans.“ Wieder lachte McLeod auf. Er leckte sich über die Lippen, ging zum Tisch, nahm die Schachtel Marlboro, und schüttelte sich einen Glimmstängel heraus. Als er brannte und McLeod den ersten Zug inhaliert hatte, fuhr er fort: „Ich glaube weder an Gott noch an den Satan. Meine Teilnahme an den Schwarzen Messen diente ausschließlich der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse. Im Suff erwürgte ich beim Sex eine dieser Schlampen, die Satan anbeteten. Das brachte mir zehn Jahre ein, von denen ich sieben absaß.“
„Wo waren Sie am dritten, zehnten, siebzehnten und vierundzwanzigsten Juni?“, fragte ich.
Er blinzelte mich an. „Wahrscheinlich habe ich hier auf der Couch gelegen und Fernsehen geglotzt. Es kann aber auch sein, dass ich auf der Couch lag und geschlafen habe. Warum fragen Sie das?“
„Weil an diesen Tagen – es war jeweils donnerstags – junge Prostituierte in der Morningside Avenue, Harlem, entführt worden sind. Man hat sie einige Tage später in irgendwelchen Parks gefunden. Ihre Herzen fehlten.“
McLeod kratzte sich hinter dem Ohr. „Sie sprechen von den Opfern des Schlitzers, nicht wahr?“
„So ist es.“
McLeod ging zur Couch und ließ sich drauf fallen. Sie ächzte verdächtig in der Federung. Das Ding sah aus, als hätte er es sich vom Sperrmüll besorgt. Der Bursche saugte an seiner Zigarette, als wäre es der letzte Zug eines Lebens, dann schnappte er: „Schieben Sie mir nur nichts in die Schuhe, Trevellian. Ich hab mit dem Satanskult nichts mehr am Hut. Wie ich schon sagte: Meine Tage verbringe ich mit Schlafen und Fernsehschauen. Da ich alleine lebe, habe ich für die Tage, die Sie genannt haben, natürlich kein Alibi. Aber ich muss meine Unschuld nicht beweisen.“
„Besitzen Sie ein Auto?“
McLeod tippte sich mit dem Daumen gegen die Brust. „Ich – ein Auto?“ Er lachte rasselnd auf. „Nein. Wie sollte ich mir ein Auto leisten können? Wenn ich ein geregeltes Einkommen hätte, dann wäre das was anderes. Aber so …“ Er brach vielsagend ab.
Wir verabschiedeten uns von McLeod. Als wir wieder im Wagen saßen, sagte Milo: „McLeod scheidet aus. Wie hätte er die Leichen der Frauen transportieren sollen? Außerdem vermittelte er ganz den Eindruck, vom Alkohol abhängig zu sein. Als Schluckspecht dürfte er andere Interessen haben, als Frauen die Herzen aus der Brust zu schneiden.“
Ich war Milos Meinung. Alles sprach gegen eine Täterschaft McLeods.
Wir fuhren zu Fred Harper. Er war zu Hause. Im Gegensatz zu McLeod wohnte er in einem ordentlich eingerichteten Apartment, er sah gepflegt aus und erklärte uns, dass er seit einem halben Jahr verheiratet sei. Seine Frau sei berufstätig. Sie sorge für das Geld, während er den Hausmann spiele.
„Haben Sie nach Ihrer Haftentlassung wieder Kontakt mit einem Satanszirkel aufgenommen?“, fragte ich. „Frönen Sie wieder dem Teufelskult?“
„Woran ich glaube, müssen Sie schon mir überlassen, Trevellian“, stieß Harper hervor. „Ja, ich glaube an den Satan. Aber ich bin nicht mehr aktiv tätig. Meine Frau würde dafür kein Verständnis aufbringen.“
Auf meine Frage nach einem Alibi für die Tage, an denen die Mädchen entführt wurden, antwortete Harper: „Meine Frau wird Ihnen bestätigen können, dass ich an den jeweiligen Tagen zu Hause war.“ Er räusperte sich, dann fuhr er fort: „Wie Sie wahrscheinlich wissen, bin ich auf Bewährung draußen. Zwölf Jahre habe ich abgebrummt. Ich habe nicht vor, mir die Bewährung zu verscherzen. Ich habe damals jenem Kerl, der mich angriff, eine verpasst. Er fiel derart unglücklich, dass er einen Schädelbasisbruch davontrug, woran er starb. Ich bin kein Straftäter im herkömmlichen Sinn, einer, der kriminelle Energie an den Tag legt und immer wieder rückfällig wird. Meine Straftat ordne ich mehr dem Bereich Unfall zu.“
„Sie sind also der Meinung, zu Unrecht verurteilt worden zu sein?“, fragte ich.
„Man hat mir fünfzehn Jahre aufgebrummt. Ich denke, Jury und Richter waren auf Grund der Tatsache, dass ich einem satanischen Zirkel angehörte, nicht objektiv.“
„Das Urteil wurde in der zweiten Instanz bestätigt“, wandte ich ein.
Harper winkte ab. „Ich habe mit den Morden an den Prostituierten nichts zu tun. Meine Frau kann Ihnen bestätigen, dass ich meine Abende zu Hause verbringe.“
Ich glaubte es ihm.
Zuletzt begaben wir uns nach Staten Island, in die Rockland Avenue, wo Richard Jackson lebte. Jackson war nicht zu Hause. Wir fragten bei einer Nachbarin nach.
Die Frau sagte: „Jackson arbeitet bei Jefferson-Industries Ltd., drüben, in New Jersey. Die Firma stellt Autobatterien her.“ Die Stimme der Frau sank herab, nahm einen verschwörerischen Ton an. „Vor zwei Monaten ist Jackson die Frau weggelaufen. Man sagt, Jackson sei mit HIV infiziert. Er soll sich bei einer Hure angesteckt haben. Was Genaues weiß man nicht. Jackson sieht jedenfalls schlecht aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass er in der Batteriefabrik mit Giftstoffen umgeht.“
„Wo lebt seine Frau?“
„Das müssen Sie Jackson schon selber fragen“, erwiderte die Lady. „Soviel ich weiß, muss er Unterhalt an sie bezahlen. Wahrscheinlich hat er sie sogar angesteckt. Aber das ist nur eine Vermutung. Man muss vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Denn man kann leicht in Teufels Küche kommen, wenn man Unwahrheiten in die Welt setzt.“
„Ja“, sagte Milo lächelnd, „das kann man. Darum sollte man sich hüten, unbestätigte Gerüchte in die Welt zu setzen.“
Die Frau nickte ernsthaft. „Das ist der Grund, weshalb ich immer ausgesprochen zurückhaltend bin.“
„Eine gute Einstellung, Ma‘am“, sagte ich.
Wir ließen auch Jackson eine Vorladung für den kommenden Tag 9 Uhr zurück.
5
Es war Donnerstag, 1. Juli. Laura Bennett, die 22-Jährige, schaute auf ihre Armbanduhr. Es war 22 Uhr 24. Laura trug nur ein sogenanntes heißes Höschen, ein freizügiges T-Shirt und Stöckelschuhe. In der linken Hand schwang sie eine kleine Tasche, in dem sie Lippenstift und ein paar andere Schönheits-Utensilien aufbewahrte.
Laura hatte Angst. Sie hielt sich in der Nähe der anderen Mädchen auf, die in der Morningside Avenue auf den Strich gingen. Der „Schlitzer“ hatte wieder zugeschlagen. Vor genau einer Woche war Belinda Brown spurlos verschwunden. Drei Tage später hatte man ihre Leiche gefunden.
Die Girls vom Straßenstrich hatten sich abgesprochen. Sobald eine von ihnen ein Auto bestieg, wurde von den anderen die Zulassungsnummer des Wagens notiert. Das gab zwar dem Mädchen, das mit dem Wagen gefahren war, keine Sicherheit, aber diese Vorsichtsmaßnahme entlarvte vielleicht den Mörder, falls er wieder zuschlug.
Die Angst hielt sie alle im Klammergriff. Aber die Gier der Zuhälter war stärker als die Angst der Mädchen. Und so standen sie auch nach dem vierten Mord auf der Straße und warteten auf Kundschaft.
Laura ging hin und her. Die Stöckel ihrer Schuhe klapperten leise. Heute lief das Geschäft nicht besonders. Sie hatte erst fünfzig Dollar eingenommen. Mark würde sauer sein. Mark war ihr Zuhälter. Er hatte Laura versprochen, dass sie mit fünfundzwanzig aufhören konnte. Bis dahin – so Mark – habe sie genug Geld verdient, um sich ein kleines Haus in Queens zu gönnen, sich in eine Firma einzukaufen und ein sorgenfreies Leben zu führen. Laura glaubte ihm. Sie war dem Burschen hörig. Darauf, dass er sie nur schamlos ausnutzte, kam Laura nicht. Daran, dass er gar nicht daran dachte, sein Versprechen einzulösen, dachte sie nicht. Sie liebte Mark – sie würde für ihn durchs Feuer gehen.
Autos fuhren langsam vorbei. Hin und wieder wurde eine zotige Bemerkung aus einem der heruntergekurbelten Fenster gerufen. Einige der Huren antworteten mit ordinären Sprüchen.
Ein Streifenwagen fuhr vorbei. Die Polizisten schauten weg. Sie hatten auch gar keine Handhabe gegen die Mädchen, solange sie sie nicht auf frischer Tat ertappten. Einige der Girls winkten den Cops sogar zu. Es war so etwas wie ein kameradschaftliches Verhältnis zischen den Streifenwagenbesatzungen und den Bordsteinschwalben.
Ein weißer Ford Lincoln fuhr vor. Langsam rollte er am Randstein entlang. Laura trat ins Licht einer Straßenlaterne, um ihre körperlichen Vorzüge besser in Szene zu setzen. Der Wagen hielt an. Ein etwa 40-Jähriger Mann saß drin. Er ließ das Fenster herunter.
„Wie viel verlangst du?“
„Eine Nummer auf dem Autositz kostet fünfundzwanzig Dollar“, sagte Laura.
„Der Preis ist in Ordnung. Komm rein.“
Laura warf einen schnellen Blick in die Runde. Ganz in der Nähe standen Mary und Ann. Die beiden schauten her. Laura gab ihnen mit der rechten Hand ein Zeichen. Dann öffnete sie die Beifahrertür und ließ sich auf den Sitz fallen. „Fahr zum Marcus Garvey Park“, wies sie den Fahrer an.
Der Bursche nickte. „Ich war schön öfter hier. Ich kenne mich aus.“
Laura warf ihm einen Seitenblick zu. Die Morningside Avenue war hell genug, so dass auch im Wageninnern keine absolute Dunkelheit herrschte. Laura sah vom Profil ein hohlwangiges Gesicht mit einer geraden Nase und einem dünnlippigen Mund. Der Mann schien sich voll und ganz auf den Verkehr zu konzentrieren.
„Ich habe dich noch nicht gesehen“, sagte Laura.
„Schon möglich“, kam es wortkarg zurück.
Sie erreichten den Park. An einer dunklen Stelle hielt der Mann den Ford an. Er stellte den Motor ab und sagte: „Wir sollten auf den Rücksitz gehen. Hier vorne ist es unbequem.“
„Hast du denn keinen Liegesitz?“
„Schon, aber …“
„Für fünfundzwanzig Dollar kannst du nichts Besonderes erwarten“, fiel ihm Laura ins Wort. Sie fühlte sich plötzlich unbehaglich. Durch die Dunkelheit, die hier herrschte, sah sie den Blick des Mannes auf sich gerichtet. Seine Augen glitzerten leicht. Sie erinnerten Laura plötzlich an die Lichter eines Raubtieres.
Der Bursche beugte sich ein wenig zu ihr herüber. „Ich kann zumindest erwarten“, gab er zu verstehen, „dass ich mir keinen Bandscheibenschaden hole. Aber wenn du meinst …“
Er beugte sich über Laura und griff nach dem Hebel, mit dem man die Rückenlehne des Beifahrersitzes umlegen konnte. Plötzlich hielt er inne. „Was war das für ein Zeichen, das du den anderen Mädchen gegeben hast, als du bei mir eingestiegen bist?“
Laura roch den Duft seines Rasierwassers. Ihm haftete auch der Geruch von Seife an. Wahrscheinlich hatte er sich geduscht, ehe er in die Morningside Avenue fuhr.
„Das ist wegen dem Schlitzer“, versetzte Laura. „Wir notieren gegenseitig die Zulassungsnummern der Autos, in die wir steigen. Sollte noch einmal was passieren, können wir der Polizei vielleicht einen Anhaltspunkt liefern.“
Sekundenlang presste der Mann die Lippen zusammen. Dann legte er mit einem entschlossenen Hebeldruck die Rückenlehne um. Laura fiel zurück.
„Zieh deine Hose aus“, forderte der Bursche. Er selbst begann, am Verschluss seiner Hose herumzunesteln.
Eine halbe Stunde später stand Laura wieder auf der Morningside Avenue. Sie hatte keine Ahnung, dass sie im Wagen des „Schlitzers“ gesessen hatte.
6
Kurz vor acht Uhr erschien Sebastiano Valdez im Federal Building. Er saß auf der Bank im Flur, als Milo und ich den Dienst antraten. Da war es Punkt acht. Wir baten den Mexikaner in unser gemeinsames Büro und boten ihm einen Sitzplatz an.
„Weswegen haben Sie mich vorgeladen?“, fragte er. „Ich hatte seit einigen Jahren Ruhe vor der Polizei.“
„Einige Morde sind geschehen, Mr. Valdez“, sagte ich. „Wir nehmen an, dass es sich um Ritualmorde handelt. In New York waren es bisher vier Mädchen, die ermordet wurden. Allen wurden die Herzen herausgeschnitten.“
Valdez schluckte krampfhaft. „Was habe ich damit zu tun?“
„Sie waren mal als Priester in einer Satanssekte tätig. Damals wurde gegen Sie wegen Drogenhandels ermittelt. Das Verfahren wurde eingestellt. Allerdings nicht, weil Ihre Unschuld bewiesen wurde, sondern aus Mangel an Beweisen.“
„Das ist sieben Jahre her. Wir haben den satanischen Zirkel damals aufgelöst. Ich habe auch nie wieder versucht, einen zu gründen. Ich habe mich vom Satanskult losgesagt und begonnen, mich mit der Bhagavadgita zu beschäftigen.“
„Das bedeutete ein Gesinnungswandel um dreihundertsechzig Grad“, sagte Milo.
„So ist es. Ich war immer bemüht, die Wahrheit zu ergründen. Der Satan ist Wahrheit. Er verkörpert das Böse. Also muss es auch einen Gott geben, der das Gute personifiziert. Ich …“
„Schon gut“, unterbrach ich ihn. „Wir haben Sie nicht vorgeladen, um von Ihnen bekehrt zu werden. Wo waren Sie am vierundzwanzigsten Juni? In der Nacht, zwischen elf und ein Uhr?“
„Zu Hause, in meinem Bett. Ich gehe jeden Abend gegen zehn Uhr schlafen. Ich muss morgens immer früh raus, und ich brauche mindestens sieben Stunden Schlaf.“
„Besitzen Sie ein Auto?“
„Ja, einen alten Chevy.“
„Sind Sie mit dem Wagen da?“
„Natürlich. Warum sollte ich mit der Subway fahren, wenn ich ein Auto besitze?“
„Haben Sie ein Alibi für die Nacht vom vierundzwanzigsten Juni auf den fünfundzwanzigsten?“
„Ich lebe allein.“
„Leider müssen wir Ihren Wagen vorübergehend beschlagnahmen“, erklärte ich. „Er muss von der SRD auf Spuren untersucht werden. Sie werden also einige Tage die Subway benutzen müssen.“
Mit einem Ruck stand der Mexikaner auf. „Stehe ich etwa im Verdacht, der Schlitzer von Harlem zu sein?“
„Wir müssen jeder möglichen Spur nachgehen, Mr. Valdez“, versetzte Milo. „Wir nehmen an, dass die Mädchen im Rahmen Schwarzer Messen ermordet wurden. Sie waren mal Satanspriester. Die Katze lässt das Mausen nicht. Sie verstehen?“
„Nein. Was hat das mit meinem Wagen zu tun?“
„Die Mädchen wurden nicht dort ermordet, wo sie aufgefunden worden sind. Also müssen die Leichen mit einem Fahrzeug befördert worden sein. Auf entsprechende Spuren wird Ihr Fahrzeug untersucht. Sie bekommen Ihren Chevy innerhalb von drei Tagen wieder zurück, sollten sich keine Verdachtsmomente gegen Sie ergeben.“
„Ich werde einen Rechtsanwalt einschalten!“, erregte sich Valdez. „Sie haben schon einmal bei mir auf Granit gebissen. Dieses Mal wird es nicht sein Bewenden damit haben, dass man das Verfahren gegen mich einstellen muss. Ich werde mich beschweren. Bei Ihrer vorgesetzten Dienststelle. Es ist eine Ungeheuerlichkeit …“
Ich unterbrach seinen Redefluss. „Gegen Sie ist kein Verfahren eröffnet, Mr. Valdez. Und wenn Ihr Wagen sauber ist, wird auch keines gegen Sie eröffnet, und an Ihnen wird nicht der geringste Makel haften bleiben. Sie als steuerzahlender Staatsbürger müssen doch Interesse daran haben, dass die Polizei ihren Job ordentlich macht. Wenn sich Ihre Unschuld herausstellt, ist das auch zu Ihrem Besten. Also beginnen Sie nicht, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.“
Valdez beruhigte sich. „Gut. Untersuchen Sie meinen Chevy auf Spuren. Sie werden nichts finden. Ich habe mit den Morden nichts zu tun.“ Er warf mir den Autoschlüssel auf den Tisch und erklärte mir, wo er den Wagen abgestellt hatte. Außerdem gab er die Zulassungsnummer bekannt, die ich auf einem Zettel notierte.
Valdez verabschiedete sich von uns.
„Was meinst du?“, fragte Milo, als wir alleine waren. „Ist er ein Mörder?“
„Das sieht man ihm leider nicht an der Nasenspitze an“, versetzte ich. „Aber wenn ich meiner Menschenkenntnis vertrauen kann, dann ist er nicht unser Mann.“
„Heute ist der erste Juli“, meinte Milo. „Donnerstag. Dem Gesetz der Serie entsprechend, nach dem der Schlitzer zuschlägt, ist wieder eine Entführung fällig.“
„Und wir stehen dem machtlos gegenüber.“
„Es ist zum Heulen.“
Wir widmeten uns wieder unserer Schreibtischarbeit.
Um 9 Uhr klopfte es gegen die die Tür.
„Herein!“, rief ich. Ich vermutete, dass es sich um Richard Jackson handelte, der geklopft hatte.
Die Tür öffnete sich, ein hohlwangiger Mann mit bleicher Gesichtshaut streckte den Kopf ins Büro. „Mein Name ist Jackson. Ich habe für heute um neun Uhr eine Vorladung von Ihnen erhalten.“
„Treten Sie ein“, forderte ich den Mann noch einmal auf. Als er im Büro war und die Tür hinter sich zugedrückt hatte, bot ich ihm einen Sitzplatz auf dem Stuhl an, auf dem vorhin Sebastiano Valdez gesessen hatte.
„Es geht um die Morde an vier Prostituierten“, begann ich.
Sofort stand Jackson senkrecht. „Was habe ich damit zu tun?“
Ich wies auf den Stuhl. „Setzen Sie sich wieder, Mr. Jackson. Es handelt sich um eine reine Routineüberprüfung. Sie sind vor einigen Jahren als Satansjünger in Erscheinung getreten. Da wir annehmen müssen, dass die Prostituierten Ritualmorden zum Opfer fielen, überprüfen wir die Leute, die irgendwann mal mit Satanskult in Verbindung standen.“
Jackson setzte sich wieder. In seinem Gesicht arbeitete es. „Ich habe von den Morden in den Nachrichten gehört“, sagte er schließlich mit sachlichem Tonfall. „Man spricht vom Schlitzer von Harlem.“
„Sehr richtig“, erwiderte ich. Dann fragte ich ihn nach seinem Alibi für die Tage, an denen die Mädchen verschwunden waren. Jackson hatte keines. „Ich gebe mich kaum mit jemand ab. Meine Frau hat mich verlassen …“
„Warum hat Sie Ihre Frau verlassen?“
Jackson zögerte etwas. Es mutete an, als musste er die Antwort erst im Kopf formulieren. Dann sagte er: „Wir haben uns auseinandergelebt und hatten uns nichts mehr zu sagen.“
„Wo wohnt Ihre Frau jetzt?“
„Ich weiß es nicht.“
„Müssen Sie nicht an sie Unterhalt bezahlen?“
„Doch. Das Geld geht auf ein Konto bei der City Bank.“
Ich fragte ihn, ob er ein Auto besaß. Er bejahte, worauf ich ihm erklärte, dass wir seinen Wagen für einige Tage konfiszieren mussten, damit er von der SRD unter die Lupe genommen werden konnte.
„Ich brauche den Wagen für den Weg zur Arbeit“, stieß Jackson hervor.
„Es verkehrt sicher ein öffentliches Verkehrsmittel zwischen Staten Island und New Jersey“, entgegnete ich. „Außerdem nehmen wir Ihnen den Wagen nicht weg. Sie bekommen ihn auf der Stelle zurück, wenn sich keine Spuren von den Mädchen finden.“
„Welche Spuren?“
„Haare, Hautschuppen, vielleicht auch Speichel …“
„Aaah, für eine DNS-Analyse. Ich verstehe. Na schön, G-men. Sehen Sie zu, dass ich mein Auto bald zurückbekomme. Ich brauche es.“
„Was für einen Wagen fahren Sie denn?“
„Einen Chevrolet. Ein älteres Fabrikat.“
„Welche Farbe hat der Wagen?“
„Metallic-Silber.“
„Sie arbeiten in einer Batteriefabrik. Werden Sie regelmäßig auf Ihren Gesundheitszustand durchgecheckt?“
„Ja.“ Jackson zögerte ein wenig. Dann erklärte er: „Mir fehlt nichts. Noch nicht. Welche Langzeitschäden sich infolge des Umgangs mit Blei und Säure ergeben, ist allerdings nicht abzusehen.“ Jackson grinste säuerlich, fast betreten.
Schließlich hatten wir keine Fragen mehr. Wir zogen die Autoschlüssel ein, fragten ihn, wo er den Wagen geparkt hatte und wie das Kennzeichen lautete, dann er durfte gehen.
Es war nicht viel, was wir herausgefunden hatten.
„Möglicherweise handelt es sich gar nicht um Ritualmorde“, meinte Milo. „Wenn es auf den ersten Blick vielleicht auch so aussieht. Kann es nicht sein, dass der Mörder vom Hass auf Prostituierte geleitet wird?“
An diesen Aspekt hatte ich auch schon gedacht, ihn aber noch keiner intensiveren Beurteilung unterzogen, denn es sprach einiges dagegen. „In Baltimore, Cincinnati und Indianapolis geschehen Morde nach dem selben Strickmuster. Am dritten Juni müsste sich der Täter gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten aufgehalten haben. Das spricht gegen diese Theorie.“
„Ein Nachahmer“, sagte Milo. „Der Personenkreis der Opfer lässt diesen Schluss zu. Dadurch, dass der Killer den Mädchen die Herzen aus dem Leib schneidet, will er vielleicht eine falsche Spur legen.“
Ich konnte mich Milos Theorie nicht völlig verschließen.
Mein Freund und Kollege fuhr fort: „Es handelt sich jedes Mal um Prostituierte. Und zwar nur um Mädchen, die auf den Straßenstrich gehen. Würde es sich um Ritualmorde handeln, wäre es den Tätern egal, woher ihre Opfer kommen. So aber steckt System dahinter. Bei dem Täter handelt es sich möglicherweise um einen Psychopathen, der vom Hass auf die Huren vom Straßenstrich geleitet wird. Vielleicht ein Kindheitserlebnis, ein Trauma, eine Neurose.“
„Das erweitert unseren Täterkreis immens“, knurrte ich. „Es gibt auch keinen Hebel, wo wir ansetzen könnten. – Was hältst du von Jackson?“
„Sieht krank aus, der Mann. Im Übrigen ist er schlecht einzustufen. Wir sollten vielleicht mal mit seiner Gattin ein paar Worte wechseln.“
„Dazu müssen wir ihre Anschrift herausfinden. Ich bin fast überzeugt davon, dass Jackson sie kannte, sie uns aber verschwieg.“
„Warum sollte er?“
„Ist nur ‘ne Vermutung“, sagte ich und beendet das Thema. „Vielleicht verrät man uns bei der City Bank ihre Anschrift.“
Milo wiegte skeptisch den Kopf. „Wir werden eine richterliche Anordnung erwirken müssen.“
„Dann erwirken wir sie eben“, stieß ich hervor.
7
Es war 22 Uhr 35. Der Ford rollte langsam die Morningside Avenue hinunter. Laura Bennett wartete auch an diesem Abend wieder auf Kundschaft. Sie trat ins Licht der Straßenlaterne, damit der Fahrer auf sie aufmerksam wurde. Sie erinnerte sich des Fahrzeugs. Der Mann war gestern schon einmal hier und mit ihr zum Marcus Garvey Park gefahren. Der Ford wurde abgebremst. Der Mann kurbelte die Seitenscheibe nach unten. Er lächelte. Seine stechenden Augen waren auf das Mädchen gerichtet.
Laura bückte sich, um besser in den Wagen blicken zu können. Sie hatte sich nicht geirrt. Es war ihr Kunde vom Vortag. „Willst du noch einmal fünfundzwanzig Dollar investieren?“, fragte sie.
„Was kosten Extras?“
„Das kommt ganz auf die Art der Extras an.“
„Steig ein. Wir werden uns sicherlich einig.“
„Das denke ich auch.“ Laura öffnete die Beifahrertür und ließ sich auf den Sitz sinken. Sie war ähnlich gekleidet wie am Vortag. Heißes Höschen, freizügiges T-Shirt, Stöckelschuhe. Wenn Laura am Tag vorher den grünen Farbton bevorzugt hatte, so überwog heute rot.
Der Fahrer gab Gas. Der Ford rollte vom Gehsteig weg und nahm die Richtung zum Park. Laura hatte ihr Misstrauen abgelegt. Wenn der Bursche Übles von ihr gewollt hätte, dann hatte er schon am Tag zuvor die Gelegenheit dazu. So dachte das Mädchen. Der Mann parkte den Ford wieder an einer verlassenen Stelle am Rand des Parks. „Liegesitz oder Rücksitz?“, fragte er lachend.
„Reden wir erst über die Extras.“
Er beugte sich zu Laura hinüber, legte ihr den Arm um die Schultern, zog sie näher zu sich heran. Laura wollte sich wehren. Der Griff wurde härter. Der Bursche hielt sie plötzlich wie im Schwitzkasten. Laura wollte schreien, der Schrei kämpfte sich auch in ihrer Brust hoch, erstickte aber in der Kehle.
Der Mann drückte mit dem Arm ihren Hals zu. Mit der anderen Hand hielt er ihre Hände an den Gelenken fest. Laura hatte seiner Kraft nichts entgegenzusetzen. Sie drehte den Kopf, wand sich, versuchte ihre Hände zu befreien. Benommenheit brandete gegen ihr Gehirn an, ihr wurde es schwindlig. Verzweifelt versuchte sie Luft zu holen. Und dann riss ihr Denken. Sie versank in einer schwarzen Wolke.
Der Mann ließ sie los und schob ihren Oberkörper hinüber auf den Beifahrersitz. „Dreckige Hure“, knirschte er. Dann startete er den Motor und fuhr los. Erst als er in die 121. Straße einbog, machte er die Scheinwerfer an. Er brachte das Mädchen in die Kellerwohnung, fesselte und knebelte es und wartete dann, dass es das Bewusstsein wieder erlangte. Das Licht hatte er ausgemacht. Die Wohnung lag in Dunkelheit.
Als Laura die Augen aufschlug, umgab sie nur Nacht. Dann aber konnte sie die schemenhafte Gestalt auf dem Stuhl neben der Couch, auf der sie lag, ausmachen. Der Schreck kam bei dem Mädchen in langen, heißen Wogen. Laura wollte etwas sagen, aber wegen des Knebels brachte sie nur unartikulierte Laute zustande.
Der Mann zog ihr den Knebel heraus. „Wo – bin – ich? Warum – warum tun Sie das?“
„Was?“
„Sie – Sie sind doch der Schlitzer“, kam es mit zittriger Stimme von Laura. „Mein Gott. Sie wissen doch hoffentlich, dass meine Kolleginnen Ihre Zulassungsnummer notiert haben.“
„Sicher“, sagte der Mann heiser. „Darum habe ich zwei gestohlene Kennzeichen an den Wagen geschraubt, ehe ich zu dir gefahren bin.“
„Was haben Sie vor?“ Panik stieg wie ein alles verzehrendes Feuer in Laura auf, verbreitete sich und erfasste ihren ganzen Körper.
„Ich werde dich umbringen und in irgendeinem Park ablegen“, sagte der Schlitzer. „Und die dämlichen Bullen werden von einem weiteren Ritualmord ausgehen. Ich sehe schon die Schlagzeilen: Satansjünger haben in New York die fünfte Frau geopfert!“
Der Bursche gluckste vor Lachen. „Oder: Der Schlitzer hat wieder zugeschlagen!“
Wieder lachte der Mann auf. „Ich werde künftig an die New York Times Briefe schicken. Ja, das verleiht dem Ganzen viel mehr Würze. Ich werde ab sofort unsere Vergeltungsschläge ankündigen.“
Der Mann erhob sich und beugte sich über Laura. Seine Stimme senkte sich, sie war nur noch ein fanatisches Geflüster, als er fortfuhr. „Ihr elenden Huren! Wie viele Menschen habt ihr dreckigen Nutten schon ins Unglück gestürzt. Ihr verbreitet Geschlechtskrankheiten. Ehen gehen euretwegen kaputt. Weltreiche gingen schon der Hurerei wegen zu Grunde. Ihr seid eine Geißel der Menschheit.“
Er holte Luft. Groß und unheilvoll stand er vor Laura. Jetzt hub er wieder an: „Du wirst büßen, ebenso wie die Huren, die wir uns vor dir geholt haben, und diejenigen, die wir uns nach dir noch holen werden. In drei Tagen bist du tot. Und dann holen wir uns die nächste Schlampe vom Straßenstrich.“
Die Stimme sank herab. „Sicher, wir können euch nicht alle umbringen. Aber wir verbreiten Angst und Schrecken. Und bald wird sich keine von euch Schlampen mehr auf die Straße wagen. Wenn es soweit ist, dann ist unsere Mission erfüllt. Dann werden wir voll Stolz auf unser Werk blicken.“
Das Grauen nahm Laura jede andere Empfindung. Ihr Herz raste. Laura zitterte an Leib und Seele.
Das einzige, was sie begriff und was mit aller Wucht auf sie einstürmte, war die Androhung, dass sie sterben würde.
8
Es hatte tatsächlich eines richterlichen Beschlusses bedurft, damit wir von der City Bank die erforderlichen Auskünfte bezüglich der Frau Richard Jacksons erhielten. Obwohl wir Mr. McKee eingeschaltet hatten, dauerte es einen vollen Tag, bis wir den Beschluss hatten. Wir fuhren damit zur City Bank. Der zuständige Sachbearbeiter nannte uns nach Vorlage des Beschlusses die Adresse. Mrs. Jackson wohnte in Brooklyn, Strauß Street Nummer 427. Wir bekamen auch die Telefonnummer der Frau. Ehe wir nach Brooklyn fuhren, riefen wir sie an, um festzustellen, ob sie überhaupt zu Hause war.
Sie nahm ab und nannte ihren Namen.
„Trevellian, Special Agent, FBI New York“, sagte ich. „Wir hätten Sie gerne mal gesprochen, Mrs. Jackson.“
„Das FBI will mich sprechen?“
„Ja. Es ist wegen Ihres Mannes. Nur ein paar Fragen.“
„Dieses verdammte Schwein! Ist er straffällig geworden?“
Das war eine Reaktion, die ich nicht erwartet hatte. „Nein“, erwiderte ich. „Es handelt sich um einige Routinefragen, seine Vergangenheit betreffend. Wann können wir Sie sprechen?“
„Ich bin zu Hause. Arbeitsunfähig. Das habe ich diesem elenden Hurenbock zu verdanken.“
„Wir sind in einer Stunde bei Ihnen“, sagte ich und unterbrach die Verbindung. Da ich den Lautsprecher eingeschaltet hatte, konnte Milo alles hören, was Mrs. Jackson von sich gegeben hatte. Er sagte: „Besonders gut ist sie ja nicht auf ihren Mann zu sprechen. Schwein, Hurenbock, das sind nicht gerade Kosenamen, mit denen sie ihn tituliert.“
„Fahren wir zu ihr“, knurrte ich, „und hören wir uns an, was sie zu sagen hat.“
Wir nahmen die Brooklyn Bridge. Eine knappe Stunde später standen wir vor dem Gebäude mit der Nummer 427 in der Strauß Street. Es war ein Wohnblock. Wir fanden das Apartment Mrs. Jacksons in der 3. Etage. Milo läutete. Die Frau öffnete uns. Ich schaute in ein eingefallenes Gesicht, in dem fiebrige Augen glänzten und das von einer fahlen Blässe war. Die dunklen Haare, die das Gesicht einrahmten, verstärkten diesen krankhaften Eindruck noch.
Sie ließ uns in die Wohnung. Im Livingroom bot sie uns Sitzplätze an. Ich schaute mich um. Mrs. Jackson war ziemlich ärmlich eingerichtet. Kein Möbelstück passte zum anderen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Wohnung nur für einen vorübergehenden Aufenthalt eingeräumt worden war.
Hatte es etwas mit der Erkrankung der Frau zu tun?
Ich erinnerte mich der Aussage der Nachbarin Jacksons. Sie sprach davon, dass Richard Jackson an Aids erkrankt sein sollte.
„Stellen Sie Ihre Fragen“, sagte Carol Jackson.
„Ihr Mann gehörte mal einer Teufelssekte an.“
„Das stimmt.“ Mrs. Jackson hob die Schultern. „In den ersten Jahren unserer Ehe hatte er noch Kontakt mit den Teufelsanbetern. Dann ist der Zirkel aufgelöst worden. Ich habe hinterher nie mehr feststellen müssen, dass das Schwein dem Satanskult frönte.“
„Wie lange waren sie mit Richard Jackson verheiratet?“
„Neun Jahre.“
„Sie sind nicht gut auf Ihren Mann zu sprechen“, sagte Milo.
„Seinetwegen bin ich dem Tod geweiht“, erklärte die Frau. „Er hat mich mit Aids angesteckt. Bei mir kam die Krankheit nach sieben Jahren zum Ausbruch. Er hat sich bei einer Hure vom Straßenstrich infiziert. – Ich habe nur noch kurze Zeit zu leben. Sehen Sie sich nur um hier. In meiner Wohnung finden Sie nur altes Gerümpel, das mir Bekannte und Freunde geschenkt haben. Es rentiert sich für mich nicht mehr, mich neu einzurichten. Außerdem hätte ich gar nicht das Geld dazu. Mit dem Unterhalt, den mir der Schuft zahlt, komme ich gerade so über die Runden. Manchmal gibt mir mein Bruder etwas Geld. Er ist auch der einzige, zu dem ich noch Kontakt habe. Nach und nach haben sich alle Freunde und Bekannten zurückgezogen. Sie fürchten, ich könnte sie anstecken.“ Mrs. Jackson lachte bitter auf.
Das war eine Eröffnung, die ich zuerst einmal verdauen musste. In meinem Kopf klickerte es. Ein Wort zog mir durch den Sinn. Es lautete „Rache“. Plötzlich betrachtete ich Milos Theorie, wonach der Täter ganz profane Beweggründe hatte, mit völlig anderen Augen.
Ein Mann, der allen Grund hatte, sich zu rächen, war Richard Jackson. Er hatte sich bei einer Hure mit Aids infiziert. Seine Ehe war kaputtgegangen. Er war ein zum Tode Verurteilter. Und er hatte seine Frau, die er sicher mal geliebt hatte, mit ins Verderben gerissen. Außerdem hatte er früher einmal zu einer Satanssekte gehört.
Alles passte wunderbar zusammen.
War Jackson unser Mann?
Vieles sprach gegen ihn.
„Ich habe mich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen“, hörte ich Mrs. Jackson sagen. „Ich war der Meinung, im Verein mit anderen Betroffenen könnte ich darüber hinwegkommen, dass mein Leben so gut wie beendet ist. Aber es ist nicht so einfach, zu akzeptieren, dass man in wenigen Wochen oder Monaten tot sein soll. Solange es einem gut geht, so lange man gesund ist, verschwendet man kaum einen Gedanken an den Tod. Das ändert sich aber schlagartig, wenn man direkt damit konfrontiert wird. Ein positiver HIV-Test ist ein Todesurteil. Und plötzlich fragst du dich, ob das wirklich alles gewesen sein soll im Leben. Ich bin achtunddreißig Jahre alt. An der statistischen Lebenserwartung gemessen habe ich noch nicht mal die Hälfte des Lebens hinter mir. Real ist, dass ich meinen neununddreißigsten Geburtstag wohl nicht mehr erleben werde. Ich habe nur noch Hass für Richard übrig. Er hat mir ein halbes Leben gestohlen.“
Carol Jacksons Augen schimmerten feucht.
Es waren bittere Worte gewesen, die sie gesprochen hatte. Was sollten wir darauf antworten? Milo und ich wechselten einen betretenen Blick.
Dann fragte ich: „Wann trifft sich die Selbsthilfegruppe jeweils?“
„Jeden Donnerstag. Immer in der Wohnung eines anderen Betroffenen.“
„Wer leitet diese Sit-ins?“
„Dr. Steven Martin. Er ist Diplompsychologe.“
„Wo wohnt Dr. Martin?“
Carol Jackson stand auf, ging zu einem Sideboard, zog einen Schub auf und griff hinein. Als ihre Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine Visitenkarte. Sie kam zum Tisch zurück und reichte sie mir wortlos.
Es war eine Visitenkarte Dr. Martins. Danach wohnte der Psychologe in der 22. Straße Ost. Auch seine Telefonnummer war angegeben.
„Dr. Martin ist Professor an der Columbia Universität“, erklärte Mrs. Jackson. „Er besitzt aber auch eine eigene Praxis.“
„Besitzen Sie einen Pkw?“, fragte ich und schob die Visitenkarte ein.
„Nein. Ich lebe sozusagen von der Hand in den Mund. Ein Auto kann ich mir nicht leisten. Warum fragen Sie?“
„Im Juni wurden vier Mädchen vom Straßenstrich in New York ermordet. Es hat den Anschein, als stecke ein Zirkel von Satansanbetern dahinter. Nach dem, was wir jetzt von Ihnen hörten, ist aber nicht auszuschließen, dass Rache das Motiv für die Morde ist. Die Mädchen wurden nicht dort ermordet, wo sie gefunden wurden. Darum muss der Mörder ein Auto besitzen, mit dem er sie transportierte.“
„Sie denken doch nicht, dass ich …“ Mrs. Jackson verschluckte sich fast. Sie musterte uns mit allen Anzeichen des tiefen Entsetzens.
„Nein“, erklärte ich. „Sie verdächtigen wir nicht, Mrs. Jackson.“
„Verdächtigen Sie Richard?“
Ich zuckte nur mit den Achseln. „Wir werden ihm sicher einige Fragen stellen.“
Da wir keine weiteren Fragen mehr hatten, verließen wir Mrs. Jackson.
Im Wagen brachte ich zum Ausdruck, was mich beschäftigte. Milo hörte mir schweigend zu.
Als ich geendet hatte, sagte er: „Sicher, Jackson könnte unser Mann sein. Irgendwie aber kommt mir das alles zu einfach vor. Warten wir ab, was die Kollegen im SRD feststellen, wenn sie seinen Wagen checken. Wenn sie keinen Hinweis darauf finden, dass eines der Mädchen in dem Auto transportiert wurde, bleiben wir auf unserer Vermutung sitzen. Dann können wir ihn allenfalls beschatten und darauf warten, dass wir ihn auf frischer Tat ertappen.“
Mein Handy dudelte. Ich nahm es aus der Freisprechanlage und nannte meinen Namen. Es war Mr. McKee. Er sagte: „In der vergangenen Nacht wurde wieder ein Mädchen in der Morningside Avenue entführt. Ihr Name ist Laura Bennett. Andere Mädchen haben beobachtet, dass sie in einen weißen Ford Lincoln eingestiegen ist. Eines der Girls hat das Kennzeichen notiert. Danach ist ein gewisser Jack Baccon der Wagenbesitzer. Allerdings fährt Baccon einen Dodge. Die Kennzeichen waren von seinem Wagen gestohlen worden.“
Die Nachricht schockierte mich. Sekundenlang spürte ich tief in meiner Seele die Qual des Hilflosen. „Heute ist der zweite Juli, Sir“, presste ich schließlich hervor. „Übermorgen ist Sonntag. Großer Gott! Der Killer wird das Mädchen töten, wenn es uns nicht gelingt, ihn bis übermorgen zu entlarven und festzunehmen.“
„Das ist zu befürchten“, meinte Mr. McKee. „Bis jetzt haben wir noch nicht mal einen Anhaltspunkt, außer der Theorie, dass es sich um Ritualmorde handelt.“
Ich erzählte dem Chef, was wir bei Mrs. Jackson in Erfahrung gebracht hatten. „Jackson hätte also ein Motiv“, endete ich. „Wir werden ihm in der nächsten Zeit etwas genauer auf die Finger sehen.“
„Hätte nicht auch Mrs. Jackson ein Motiv?“, wandte der Chef ein.
Ich war einen Moment ziemlich verdutzt. Dann sagte ich: „Bei der gegebenen Sachlage – ja, Sir. Das Motiv ist sicherlich auch bei ihr vorhanden. Aber bei ihr ist die Krankheit bereits ausgebrochen. Sie sieht schwach aus. Außerdem besitzt sie kein Auto. Mrs. Jackson schließe ich aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Wenn diese Frau im Stande wäre, einen Mord zu begehen, dann den Mord an ihrem Ehemann, der sie mit der Krankheit infizierte.“
„Sie haben Recht, Jesse“, sagte Mr. McKee. „Nach allem, was wir wissen, kommt Richard Jackson als Hauptverdächtiger in Frage. Tun Sie und Milo alles, um das Mädchen, das sich wahrscheinlich in der Gewalt des Schlitzers befindet, zu retten. Wir haben nur noch zwei Tage Zeit.“
Mr. McKee beendete das Gespräch. Ich drückte die Aus-Taste und stellte das Gerät in die Halterung der Freisprechanlage zurück.
„In die Rockland Avenue“, knurrte Milo. „Wir stellen das Haus Jacksons auf den Kopf.“
9
Jackson war Zuhause. Er ließ uns in die Wohnung. Misstrauisch musterte er uns abwechselnd.
Ich sagte: „Wir haben mit Ihrer Frau gesprochen, Mr. Jackson. Sie ist ziemlich sauer auf Sie.“
„Wundert Sie das?“, fragte Richard Jackson. „Sicher wissen Sie nach dem Besuch bei Carol Bescheid. Ich habe sie mit Aids angesteckt. Ein einmaliger Ausrutscher von mir, als ich zu einer Hure ging. Ich suchte schlicht und einfach nur mal etwas Abwechslung.“
Er wirkte ziemlich zerknirscht. Sein Blick schien sich nach innen verkehrt zu haben.
„Dürfen wir uns etwas in Ihrer Wohnung umsehen?“
„Was gedenken Sie zu finden?“
„Gestern in der Nacht wurde wieder ein Mädchen in der Morningside Avenue entführt. Sie hätten ein Motiv, die Girls vom Straßenstrich zu hassen.“
Jackson prallte zurück. Dann aber sagte er kehlig: „Sie verdächtigen den falschen Mann. Ich habe seit gestern Nachtschicht. Ich war nachweislich ab zweiundzwanzig Uhr in der Fabrik. Da ich nicht hingeflogen sein kann und Sie mein Auto konfisziert haben, musste ich mich gegen einundzwanzig Uhr auf den Weg machen, um mit dem Omnibus rechtzeitig die Firma zu erreichen. Zu spät zu kommen kann ich mir nicht leisten. Man hat dafür im Betrieb wenig Verständnis. Wenn es sich wiederholt, fliegt man.“
Ich war wie vor den Kopf gestoßen.
Jackson hatte ein Alibi. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass das, was er von sich gegeben hatte, der Wahrheit entsprach. Eine Lüge hätte ihm nichts genützt. Denn er musste davon ausgehen, dass wir seine Angaben überprüfen würden.
Auch Milo schaute nicht besonders geistreich drein. „Wir würden uns trotzdem gerne mal in Ihrer Wohnung umsehen, Mr. Jackson“, sagte er.
„Gerne“, erwiderte Jackson.
Dann führte er uns durch sämtliche Räume, die die Wohnung aufwies. Es waren drei Zimmer und Küche. Sogar den Keller und den Dachboden ließen wir uns zeigen. Es gab nicht den geringsten Hinweis, dass in Jacksons Wohnung jemals jemand gegen seinen Willen festgehalten worden wäre.
„Haben Sie sich auch einer Selbsthilfegruppe angeschlossen?“, fragte ich.
„Nein. Das bringt nichts, außer dass man ständig daran erinnert wird, dass man lebensbedrohlich erkrankt ist.“
Wir fuhren zu der Batteriefabrik in New Jersey. Dort bestätigte man uns, dass Jackson am vergangenen Abend um 22 Uhr seinen Dienst angetreten und bis morgens um 6 Uhr 30 gearbeitet hatte.
Das Kartenhaus, das wir uns für kurze Zeit aufgebaut hatten, stürzte in sich zusammen.
„Vielleicht gibt es einen Helfershelfer“, sagte Milo, als wir nach Manhattan zurückfuhren. „Nachdem es in anderen Städten identische Morde gab, ist davon auszugehen, dass es sich eine ganze Gruppe zur Aufgabe gemacht hat, Straßenmädchen auf die brutale Art aus dem Verkehr zu ziehen. Ob das nun Satansjünger sind oder einfach nur Leute, die sich rächen wollen, lasse ich mal dahingestellt.“
Das war ein völliger neuer Aspekt.
Milo fügte hinzu: „Von Carol Jackson wissen wir, dass sich die Selbsthilfegruppe jeweils donnerstags trifft. Die Entführungen der Mädchen fanden auch jeweils an einem Donnerstag statt. Diese Übereinstimmung kann Zufall sein, muss aber nicht …“
„Eine Gruppe“, sinnierte ich laut. „Gleichgesinnte, die sich irgendwo gefunden haben.“ Ich schaute Milo an. „In einer Selbsthilfegruppe. So etwas gibt es sicherlich in jeder größeren Stadt. Warum sollten sie nicht miteinander kommunizieren, Erfahrungen austauschen, Treffs vereinbaren? Himmel, Milo, das ist ein hervorragender Gedanke.“
„Ab und zu findet auch ein blindes Huhn ein Korn“, knurrte Milo und grinste mich an. Doch sogleich dämpfte er meinen Enthusiasmus, indem er hinzufügte: „Leider auch nur Theorie. Bis wir die Wahrheit herausfinden, dürfte es für das Girl, das sich in der Gewalt des Schlitzers befindet, zu spät sein.“
„Wir sollten mal in den anderen Städten anrufen, ob dort auch Mädchen entführt wurden“, sagte ich.
„Also fahren wir zurück ins Büro“, knurrte Milo. „Mir schwant Fürchterliches.“
Ich rief in Baltimore an. Der Kollege, mit dem ich sprach, konnte keine Entführung feststellen. Währenddessen sprach Milo mit einem Beamten des Police Department in Cincinnati.
Nachdem ich das Gespräch mit Baltimore beendet hatte, wählte ich die Nummer des Field Office Indianapolis. Der Kollege sagte: „Ein neuer Entführungsfall ist nicht bekannt. Wir benutzen eine Agentin als Köder. Es ist zwar ein Spiel mit dem Feuer, aber anders kommen wir dem Mörder kaum auf die Spur. Sollten wir zu irgendwelchen Erkenntnissen gelangen, werden wir Sie informieren.“
Ich legte auf.
Auch Milo hatte das Gespräch beendet.
„Und?“, fragte ich.
„Nichts.“
„In Indianapolis arbeiten sie mit einem Köder. Eine Agentin hat sich dafür hergegeben.“
„Diesen Vorschlag habe ich auch schon mal gemacht“, erklärte Milo.
„Wir müssten es mit dem Chef abklären“, antwortete ich. „Es kann auch schief gehen. Und dann möchte ich nicht in der Haut des SAC stecken, der die Verantwortung für den verdeckten Einsatz übernehmen muss.“
„Wir sollten auch mal mit den anderen Mädchen in der Morningside Avenue reden“, schlug Milo vor. „Laura Bennett ist in einen Ford mit gestohlenen Kennzeichen gestiegen. Vielleicht hat das eine oder andere Mädchen irgendwelche Beobachtungen gemacht, die uns weiterhelfen.“
„Das heißt, wir müssen eine Abendschicht einlegen“, gab ich zu verstehen. „Tagsüber triffst du kaum eines der Girls an. Für die meisten von denen beginnt der Tag erst am Abend.“
Wir begaben uns zu Mr. McKee. Zunächst erklärten wir ihm, dass Richard Jackson ein Alibi für den vorhergehenden Abend hatte, dass er also nicht als Entführer Laura Bennetts in Frage kam. Milo wies auch darauf hin, dass möglicherweise eine ganze Gruppe am Werk war, die hinter den Morden an den Strichmädchen steckte. Er brachte die Sprache auch darauf, dass Mrs. Jackson einer Selbsthilfegruppe angehörte, die sich jeweils donnerstags traf, und dass die Mädchen bisher allesamt an einem Donnerstag entführt worden waren. Schließlich kam ich auf den Einsatz einer Agentin als Köder zu sprechen.
Mr. McKees Brauen hatten sich zusammengeschoben. Zwei steile Falten hatten sich über seiner Nasenwurzel gebildet. „An wen haben Sie gedacht?“, fragte er schließlich.
„Annie Francesco oder Jennifer Johnson“, versetzte ich.
Der Chef nickte. „Es muss auf freiwilliger Basis geschehen. Ich will weder Annie noch Jennifer zwingen, sich auf dieses Vabanquespiel einzulassen.“
„In Indianapolis arbeitet bereits eine Kollegin undercover auf dem Straßenstrich“, rückte ich mit der Sprache heraus.
„Die Idee ist nicht schlecht“, sagte der SAC. „Aber es kann ins Auge gehen. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen nur, dass er konsequent und brutal mordet. Außerdem muss es strikt geheim bleiben, dass eine unserer Agentinnen auf den Schlitzer angesetzt ist. Die anderen Mädchen werden in ihr eine Konkurrenz sehen und ihre Zuhälter auf sie hetzen.“
„Ich werde unsere Agentin beschützen“, erklärte ich mich bereit. „Es wird mir nicht schwer fallen, in die Rolle ihres Zuhälters zu schlüpfen. Unabhängig davon sollten wir unseren Köder mit einem Funkpeilsender ausstatten und in der Nähe der Morningside Avenue einen Funkpeilwagen platzieren.“
Der Chef griff zum Telefon und wählte eine Nummer. Dann sagte er: „Jennifer, kommen Sie doch bitte mal zu mir. Und bringen Sie Annie mit. Es geht um einen Einsatz. – Danke.“
Mr. McKee legte auf.
Zwei Minuten später kamen Jennifer und Annie. Nachdem wir uns gegenseitig begrüßt hatten, bot ihnen Mr. McKee Sitzplätze an, dann begann er: „Jesse und Milo ermitteln in Sachen des Schlitzers von Harlem, der bis jetzt vier Mädchen ermordet und ein fünftes entführt hat. Sicher sagt Ihnen das etwas.“
Jennifer erwiderte: „Natürlich. Die lokalen Nachrichten sind voll davon. In einigen anderen Städten sollen aber ähnliche Morde geschehen sein.“
„Ja. In Baltimore, Cincinnati und Indianapolis. Jesse und Milo kommen nun mit der Idee zu mir, dem Killer einen Köder anzubieten. Ich finde die Idee nicht schlecht, will aber niemand dazu zwingen, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Denn es ist ausgesprochen gefährlich. Wir wissen bisher nur, dass wir es mit einem gnadenlosen, brutalen Mörder zu tun haben. Die Kollegen in Indianapolis arbeiten bereits mit einem Köder.“
„Ich stelle mich zur Verfügung“, erklärte Jennifer Johnson spontan.
„Ich auch“, kam es von Annie Francesco, unserer rassigen Latina.
Ich hatte eine Idee. „Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, mit zwei Ködern zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Killer ins Netz geht, würde sich verdoppeln.“





























