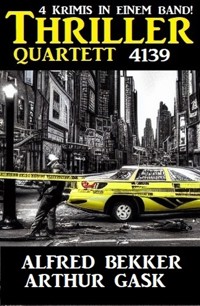Commissaire Marquanteur
und der ermordete Zeuge: Frankreich Krimi
von Alfred Bekker
Ein neuer Fall für Commissaire Marquanteur und seine Kollegen
aus Marseille.
Ein Kronzeuge wird im Polizeischutz ermordet, auch eine
Polizisten wird zum Opfer. Die Ermittler Marquanteur und Leroc
suchen einen Killer, der scheinbar kein Motiv hat. Ein weiterer
Mord im Polizeigewahrsam bringt die Kommissare der FoPoCri an ihre
Grenzen, denn der Täter hat Zugriff auf ihre Handys.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Jack Raymond,
Robert Gruber, Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet
Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Ich kam am Yachthafen an und stellte meinen Wagen ab. Wenig
später erreichte ich den Anlegeplatz des Jollenkreuzers von einem
Bekannten, der allgemein in Marseille als der Libanese bekannt war.
Er betrieb ein paar Clubs auf Pointe-Rouge und war gleichzeitig ein
Informant. Ich erfuhr über ihn, was sich so in der Szene tat. Auch
Dinge, die noch gar nicht offiziell waren oder Gerüchte. Aber das
konnte manchmal durchaus hilfreich sein.
Ab und zu gingen der Libanese und ich auf dem Meer zusammen
segeln. Da war es zumindest sicher, dass man uns nicht
abhörte.
Und abgesehen davon hatte er ein schönes Boot.
»Bonjour!«, sagte ich.
»Wallah, du bist spät dran!«, sagte der Libanese.
Ich ließ einen Blick über das Boot schweifen.
»Und du hast noch nichts fertig gemacht!«
»Wallah!«
»Ich dachte, wir legen gleich ab!«
Mein Name ist übrigens Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire
und gehöre zu einer Sonderabteilung, die sich Force spéciale de la
police criminelle, kurz FoPoCri nennt und in Marseille angesiedelt
ist. Zusammen mit meinem Kollegen François Leroc, unserem Chef
Monsieur Jean-Claude Marteau, Commissaire général de police und all
den anderen Kollegen und Spezialisten unserer Abteilung kümmere ich
mich um die schwierigen Fälle. Um alles, was mit organisierter
Kriminalität, Terrorismus, Serientätern oder anderen Verbrechen zu
tun hat, bei denen die Ermittlungen besondere Fähigkeiten und
Ressourcen erfordern.
Jetzt allerdings hatte ich mich eigentlich auf eine Segeltour
gefreut – aus der vermutlich nichts werden würde, denn das Boot war
nicht klargemacht. Das musste seinen Grund haben.
»Wallah, heute wird das leider nichts, Pierre«, sagte der
Libanese.
»Schade.«
»Kann nix dafür.«
»Was ist los?«
»Schaden am Heck. Ich denke, da ist irgendein Idiot mit seinem
Boot dagegen gefahren. Hat natürlich nicht Bescheid gesagt. Ist
etwas Wasser eingedrungen. Deswegen liegt das Boot so tief. Habe
Werft schon angerufen.«
»Wirklich schade.«
»Wallah, kann nix dafür.«
»Hättest mich aber anrufen können, dass das heute nichts
wird!«
»Wallah, ich wollte ja, dass du trotzdem kommst.«
»Wieso?«
Er stieg jetzt von Bord auf den Steg.
»Kennst du Bruno Montagnola?«
»Wer kennt den nicht?«
»Wallah, ich habe Namen gegoogelt. Ist kalabrischer Name.
Wahrscheinlich ‘Ndrangheta, richtig?«
»Was ist mit Montagnola?«
»Es gibt anscheinend ein paar Leute, die ihn nicht
mögen.«
»Wie das so ist …«
»Und er sitzt zur Zeit im Gefängnis, weil er wohl einiges auf
dem Kerbholz hat.«
»Wallah, ich wollte euch nur warnen: Er ist nicht sicher. Es
gibt Pläne, ihn umzubringen. Und zwar von mehr als einer
Seite.«
Überraschend kam das nicht.
Etwas in der Art hatte ich schon befürchtet.
Bruno Montagnola war schließlich ein wichtiger Kronzeuge gegen
die Mafia.
Und solche Leute sind bei ihresgleichen eben selten
beliebt.
»Wallah, ihr werdet auf ihn sehr gut aufpassen müssen«, sagte
der Libanese.
Und er sollte Recht behalten.
*
Wir waren mit einem SUV aus den Beständen unserer
Fahrbereitschaft auf halbem Weg zwischen Marseille und Aubagne. Der
Auftrag, den François und ich bekommen hatten, war klar: Wir
sollten den Mafia-Kronzeugen Bruno Montagnola an einen Ort bringen,
wo er vor seinen ehemaligen Gangsterfreunden sicher war. Für die
ging es um alles oder nichts – und deswegen mussten wir damit
rechnen, dass uns eine Meute von Auftragskillern auf den Fersen
war.
Bruno Montagnola saß auf dem Rücksitz und wirkte nervös.
Er hatte allen Grund dazu. Wahrscheinlich gab es derzeit
niemanden im ganzen Norden, auf den ein höheres Kopfgeld ausgesetzt
war.
Und unser Job war es, um jeden Preis zu verhindern, dass es
sich jemand verdiente.
2
Neben Montagnola hatte Monique Alperte auf der Rückbank Platz
genommen. Alperte war eine Kollegin, die erst vor Kurzem von Paris
zu uns nach Marseille versetzt worden war.
Über die Freisprechanlage meldete sich unser Kollege Fred
Lacroix, der uns mit einem zweiten Fahrzeug folgte.
»Kein verdächtiges Fahrzeug in Sicht. Es folgt euch
niemand.«
»Dann ist ja alles in Ordnung«, meinte François, der auf dem
Beifahrersitz Platz genommen hatte.
Lange sollte diese Einschätzung keinen Bestand haben.
Wir alle trugen Kevlar-Westen unter der Kleidung. Bruno
Montagnola hatte zwar geflucht, aber sich schließlich doch
überzeugen lassen, so eine unbequeme Weste anzuziehen. Sein Jackett
spannte jetzt natürlich. Er war ohnehin nicht besonders schlank,
aber jetzt sah er aus, als hätte er fünfzehn Kilo zugenommen.
Bei Alperte hingegen fiel die Kevlar-Weste kaum auf, was
einfach daran lag, dass sie sehr zierlich war.
»Ich kenne die Strecke. Ein paar Kilometer noch, dann müsste
eine Tankstelle kommen«, meinte Montagnola.
»Der Tank ist noch voll genug«, sagte ich.
»Aber ich müsste mal.«
So etwas hatte uns noch gefehlt!
»Können Sie sich das nicht bis Aubagne verkneifen, Monsieur
Montagnola?«, fragte François.
»Hey, Mann, wo sind wir hier denn? Glauben Sie vielleicht, da
wartet jemand darauf, dass wir zufällig vorbeikommen, um mich dann
umzunieten?«, brach es aus Montagnola hervor.
Er war ziemlich gereizt, und dafür hatte ich durchaus
Verständnis. Er war schließlich in einer schwierigen Lage. Und auch
wenn er selbst jemand war, der mit den schwersten Verbrechen in
Verbindung gebracht wurde, würden seine Aussagen und sein Wissen
dazu führen, dass einige der größten Haie der Marseiller Unterwelt
für lange Jahre ins Gefängnis gehen würden. Große Bosse des
organisierten Verbrechens, an die wir sonst wohl niemals
herangekommen wären.
»Wir versuchen jedes Sicherheitsrisiko zu vermeiden«, sagte
ich. »Und dazu gehört natürlich auch jeder nicht unbedingt
notwendige Stopp unterwegs.«
»Dieser Stopp ist aber nicht überflüssig«, sagte Montagnola.
»Verdammt, wenn man meine Leiche findet, dann lieber mit einer
Kugel im Kopf als mit bepisster Hose!«
»Monsieur Montagnola …«
»Das ist sowieso alles eine verdammte Scheiße … Ich hätte mich
nie darauf einlassen sollen!«
»Wenn ich Psychologin wäre, würde ich vielleicht auf die Idee
kommen, es könnte irgendetwas zu bedeuten haben, dass bei Ihnen
jeder zweite Satz etwas mit menschlichen Ausscheidungen zu tun
hat«, meinte Alperte.
Montagnola verdrehte die Augen. Er war schon die ganze Zeit
über so. Und dabei war seine Familie bereits in Sicherheit. Die war
nämlich getrennt von Bruno Montagnola weggebracht worden. Eine
Sicherheitsmaßnahme. Wir hatten inzwischen die Bestätigung, dass
seine Angehörigen ihren geheimen Bestimmungsort sicher erreicht
hatten und es ihnen gut ging. Und eigentlich hatten wir alle
gehofft, dass Bruno Montagnolas Stimmung sich von da an etwas
aufhellen würde. Aber das war offensichtlich nicht der Fall.
Ich wechselte einen kurzen Blick mit François. Mein Kollege
nickte. Ein Zwischenstopp war unter Sicherheitsgesichtspunkten
durchaus vertretbar. François stellte eine Verbindung zu den
Kollegen im nachfolgenden Wagen her.
»Was gibt’s?«, fragte unser Kollege Fred Lacroix.
»Wir machen einen unplanmäßigen Zwischenstopp an der nächsten
Tankstelle in ein paar Kilometern. Unsere Schutzperson muss auf die
Toilette.«
»Ich kenne die Tankstelle«, sagte Fred. »Da gibt’s auch eine
gutes Restaurant und handgemachte Hamburger. Nur der Kaffee ist so
dünn, dass man durchgucken kann.«
»Diesmal gibt’s weder Kaffee noch Hamburger, Fred«, sagte
François. »Wir fahren gleich weiter, wenn Monsieur Montagnola sein
dringendes Geschäft erledigt hat.«
Wir erreichten die Tankstelle. Die Abfahrt von der Autobahn
beschrieb eine starke Kurve und machte es notwendig, die
Geschwindigkeit stark zu drosseln.
Das zweite Einsatzfahrzeug mit Fred Lacroix und unserer
Kollegin Pia Handau folgte uns in einigem Abstand.
Ich stellte den SUV auf einen der unmittelbar an das
Hauptgebäude anschließenden Parkplätze. Fred steuerte das zweite
Fahrzeug – einen Mercedes aus den Beständen der Fahrbereitschaft
des Polizeipräsidiums Marseille – in einigem Abstand so, dass die
Kollegen jederzeit unseren SUV und dessen komplettes Umfeld im Auge
hatten.
François und ich stiegen aus – nicht ohne vorher Headsets
anzulegen, über die wir mit den Kollegen in ständiger Verbindung
bleiben würden. Falls sich irgendwo etwas Verdächtiges tun würde,
konnten uns die Kollegen sofort warnen.
Alperte stieg ebenfalls aus. Sie öffnete Montagnola die Tür.
Der Kronzeuge stieg aus, und François und ich nahmen ihn in die
Mitte.
»Sie bleiben beim Wagen«, sagte ich zu Alperte.
Wir gingen mit unserem Schützling zum Hauptgebäude, wo sich
ein Schnellrestaurant befand.
Aus den Augenwinkeln heraus bekam ich noch mit, dass ein
offenbar betrunkener Kerl auf den SUV zutorkelte. Er trug einen
Parka. Die Kapuze war über den Kopf gezogen. Vom Gesicht war so gut
wie nichts zu erkennen.
Alperte hatte das Problem aber offensichtlich erkannt und ging
auf den Mann zu. Er schien zu einer Gruppe von Personen zu gehören,
die aus einem Bus gestiegen waren.
Eine Gruppe von Rentnern kam uns entgegen und mir wurde die
Sicht verdeckt.
Kurz nachdem wir in das Innere des Gebäudes getreten waren,
fiel mir ein Mittdreißiger mit schütteren roten Haaren und ziemlich
großen, etwas blutunterlaufenen Augen auf. Er starrte Montagnola
sehr intensiv an.
In solchen Situationen neigt man dazu, einzelnen Beobachtungen
entweder eine zu große oder eine zu geringe Bedeutung beizumessen.
Letztlich muss man sich immer auf den Instinkt verlassen, den man
dafür nach ein paar Dienstjahren entwickelt, und darauf hoffen,
dass dieser Instinkt einen nicht trügt. Letzteres kommt bei einem
guten Polizisten nicht oft vor.
Wenn doch, kann es Menschenleben kosten.
In diesem Fall sagte mir mein Instinkt, dass ich eingreifen
musste. Und zwar gerade noch rechtzeitig.
Der Rothaarige drängte plötzlich auf Montagnola zu und wäre
ihm wenige Augenblicke später gefährlich nahe gekommen. Ich stellte
mich dazwischen und drängte ihn ab. Der Rothaarige sah mich an, als
wollte er mich mit seinem Blick töten.
»Hey, was soll das?«, rief er. »Blöder Wi…«
Er verstummte, als er den Lauf meiner Dienstwaffe und den
Ausweis der FoPoCri sah.
»Treten Sie einen Schritt zurück!«, sagte ich.
»Kommst du allein klar, Pierre?«, fragte François.
»Kein Problem.«
Ich durchsuchte den Mann nach Waffen. Er hatte keine bei sich.
Nur Smartphone und Brieftasche. Und einen Führerschein, ausgestellt
auf den Namen Martin Duval.
»Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt Leute, die heißen
wirklich so«, sagte er.
Er roch nach Marihuana. Und die schleppende Art und Weise, in
der er redete, war wohl auch ein Zeichen dafür, dass er häufiger
mal Substanzen nahm, mit denen man sich besser nicht im
Straßenverkehr erwischen ließ. Substanzen, die vielleicht aber auch
dazu führten, dass man sich unkontrolliert bewegte und Leute
anrempelte.
Es schien so, als hätte ich überreagiert.
»Das ist doch ein freies Land, oder?«, krakelte er jetzt. »Was
Sie machen, ist Polizeigewalt!«
Ich gab ihm seine Sachen zurück.
»Wo fahren Sie jetzt hin, Monsieur Duval?«
»Nach Aubagne. Wohin denn auch sonst?«
»Was machen Sie in Aubagne?«
»Freunde besuchen.«
»Gute Fahrt, Monsieur Duval.«
»Hey, Mann, das ist alles? Erst einen mit der Waffe bedrohen
und dann einfach nur gute Fahrt sagen?«
»Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten! Ich habe Sie
offenbar verwechselt.«
»Na, wenigstens versuchen Sie mir jetzt nichts anzuhängen.
Aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil hier so viele Zeugen
sind.«
Mein Vorgehen gegen den rothaarigen Martin Duval hatte
tatsächlich einiges an Aufmerksamkeit erregt.
Duval packte seine Sachen wieder in die Taschen seiner Jacke
und suchte das Weite. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Den
Blick, der mich jetzt traf, sollte ich lange nicht vergessen.
»Fred? Pia?«, murmelte ich in das Mikro meines Headsets
hinein. »Da ist gerade ein rothaariger Mann, Mitte dreißig in Jeans
und Lederjacke ins Freie gegangen. Haltet den mal etwas im Auge und
seht, wo der hingeht!«
»Machen wir«, bestätigte Fred Lacroix.
3
Wenig später verließen François und ich das Gebäude wieder.
Mir fiel der Rothaarige auf. Er tauchte hinter einem Ford auf
und hielt eine Kamera in der Hand, die mit einem Teleobjektiv
ausgestattet war. Er hatte uns im Visier.
Ein Reporter vielleicht, der ein paar Schnappschüsse von dem
untergetauchten Boss machen wollte. Oder er arbeitete für jemanden,
der ganz andere Absichten hatte als ein paar Fotos an den
Meistbietenden zu verkaufen.
Mein Instinkt hatte mich also nicht getrogen. Mit dem Kerl
stimmte was nicht.
Die Kamera musste er aus dem Wagen geholt haben. Bei der
Durchsuchung hatte er nichts dergleichen bei sich gehabt.
»Ihr solltet den Rothaarigen doch im Auge behalten!«, sagte
ich über Headset an die Kollegen gerichtet.
»Der ist gerade erst wieder aufgetaucht«, meldete sich Fred
Lacroix. »Ich dachte, der wäre längst weg!«
»Ist er aber nicht. François und ich nehmen ihn uns noch mal
vor. Alperte …«
»Ja?«, meldete sich ihre helle Stimme in meinem
Ohrhörer.
»Kommen Sie uns entgegen und nehmen Sie Montagnola in
Empfang!«
»Okay!«
Alperte kam uns entgegen.
»Scheiße, ich dachte, es wüsste niemand, wo unsere Reise
hingeht«, maulte Montagnola. Und ich konnte seinen Ärger sogar
verstehen. Schließlich ging es ja um seinen Kopf. Und jeder, der
wusste, wo er sich befand, stellte ein potenzielles Risiko dar. Wie
es dazu kommen konnte, dass der rothaarige Mann mit dem überaus
seltenen Namen Martin Duval es offenbar geschafft hatte, Montagnola
an den Fersen zu kleben, war mir schleierhaft. Eigentlich hatten
wir sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die man bei so so einer
Operation beachten muss.
Der kritische Punkt war dabei meistens die zu schützende
Person selbst – oder die Angehörigen. Vielleicht hatte Montagnola
irgendjemandem gegenüber, dem er glaubte vertrauen zu können, zu
viel offenbart. Aber das würden wir noch herausbekommen.
Alperte ging mit dem Kronzeugen zum Wagen. Sie stiegen ein.
François und ich näherten uns unterdessen Duval.
Der hielt seine Kamera völlig ungeniert in Montagnolas
Richtung.
Und dann brach plötzlich die Hölle los.
Ein ohrenbetäubendes Explosionsgeräusch ließ mich für einen
Augenblick denken, ich wäre taub. Ich drehte mich halb herum. Aus
den Augenwinkeln heraus sah ich, wie sich der SUV in eine
Feuerhölle verwandelte. Ich wurde zu Boden gerissen. Ob das die
Druckwelle war oder François eingegriffen hatte, weiß ich bis heute
nicht genau. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Ich spürte unter
mir den harten, kalten Asphalt, während eine Hitzewelle über mich
hinweg sengte. Trümmerteile flogen durch die Luft. Ich schützte das
Gesicht mit den Armen. In diesem Moment konnte ich nichts tun,
außer darum beten, dass keines der empor geschleuderten
Trümmerteile sich ausgerechnet die zwei Quadratmeter Asphalt zur
Landung aussuchte, auf denen ich lag.
Dann hörte ich Stimmen. Schreie. Manche vor Schmerz, andere
vor purem Entsetzen. Ein Wagen fuhr mit quietschenden Reifen davon.
Ich rappelte mich auf und sah nach François. Aber der war okay. Ich
hatte offenbar ebenfalls nichts abbekommen.
Von dem SUV allerdings war nur ein rauchendes, von lodernden
Flammen verzehrtes Wrack geblieben.
Zwei Männer, die ihren Overalls nach zum Personal der
Tankstelle gehörten, versuchten mit Feuerlöschern die Flammen zu
löschen. Das war natürlich vollkommen aussichtslos.
»Montagnola«, murmelte ich.
Von dem Kronzeugen, der sich in unserer Obhut befunden hatte,
würde man nichts weiter finden als ein paar verkohlte Knochen. Und
dasselbe galt für unsere Kollegin Monique Alperte.
Ich schluckte.
Für einige Augenblicke war ich wie gelähmt. Ich konnte noch
immer nicht wirklich fassen, was da gerade passiert war. Fred
Lacroix und Pia Handau waren kurze Zeit später bei uns. Pia
telefonierte bereits mit unserem Präsidium.
Ich drehte mich um. Von dem rothaarigen Mann namens Martin
Duval war nichts mehr zu sehen.
4
Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Autobahnpolizei trafen
ein. Und außerdem natürlich Fahrzeuge der Feuerwehr. Aus Marseille
würden unsere eigenen Erkennungsdienstler und
Sprengstoffspezialisten anrücken, aber das konnte noch eine ganze
Weile dauern, bis die hier eintrafen.
Ich fühlte mich so leer und elend, dass ich kaum Worte dafür
hätte finden können. Nicht, dass mir Bruno Montagnola in
irgendeiner Weise sympathisch gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Er
war ein Schweinehund – wenn auch einer, der uns half, andere
Schweinehunde hinter Gitter zu bringen. Aber auch wenn Montagnola
kein besonders sympathischer Mensch gewesen war und es mir
irgendwie auch nicht gefiel, dass die Verbrechen, in die er selbst
verwickelt gewesen war, nun niemals gesühnt werden konnten, war es
nun mal so, dass seine Sicherheit uns anvertraut worden war. Was
das betraf, hatten wir schrecklich versagt.
Ich zermarterte mir noch immer das Hirn darüber, wie es dazu
hatte kommen können. Schließlich war die ganze Operation, die mit
Montagnolas sicherer Unterbringung in Zusammenhang stand, unter
allerhöchster Geheimhaltung vonstatten gegangen. Wie hatte es
trotzdem jemand schaffen können, dafür zu sorgen, dass unser
Kronzeuge von einer Explosionshölle zerrissen wurde?
»Wir müssen diesen Rothaarigen kriegen«, sagte ich.
»Pierre, du redest Unsinn!«
»Nein. Denn dieser Martin Duval hatte mit Sicherheit mit all
dem hier zu tun.« Und während ich das sagte, machte ich eine
ausholende Geste. »Der war nicht zufällig hier! Der hatte es auf
Montagnola abgesehen!«
»Aber nur mit der Kamera, Pierre!«
»Und wie kommt es, dass er uns hier quasi erwartet hat? Wenn
er uns gefolgt wäre, hätten Fred und Pia das bemerkt.«
»Vielleicht war er einfach nur geschickt und unauffällig. Oder
er hat Montagnola wiedererkannt, hatte vorher davon gehört, dass
der große Boss abgetaucht ist und sich gedacht, dass die Fotos ein
paar Euros wert sein könnten.«
»François!«
»Du hast ihn selbst durchsucht, seinen Führerschein gesehen
und festgestellt, dass er unbewaffnet war. Er hatte noch nicht
einmal eine Kamera dabei. Also, wenn er auf uns gewartet hätte,
dann hätte er die doch wohl auch bei sich gehabt.«
»Auf die kurze Distanz hätte sein Handy vollkommen
ausgereicht, um gute Bilder zu machen. Ich hätte überprüfen sollen,
ob etwas drauf ist.«
»Er hatte es doch in seiner Tasche! Außer uns unverschämt
anzuglotzen, hat der Kerl nichts verbrochen!«
Genau das war das Problem gewesen. Mein Verhalten Martin Duval
gegenüber war ohnehin schon an der Grenze dessen gewesen, was
rechtlich zulässig war. Insofern gab es eigentlich auch nichts, was
ich mir da vorwerfen konnte.
»Überprüfen werde ich ihn auf jeden Fall«, meinte ich.
Ich nahm mein Smartphone ans Ohr und telefonierte mit dem
Kollegen Maxime Valois aus der Fahndungsabteilung des
Polizeipräsidiums Marseille.
»Weißt du, wie viele Personen mit dem Namen Martin Duval es
allein in Marseille gibt?«, fragte Maxime.
»Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Er hatte einen
Führerschein, ausgestellt in Marseille. Und das Kennzeichen seines
Wagens habe ich mir gemerkt.«
»Dann müssten wir ihn ja kriegen.«
»Und rote Haare sind ja auch nicht so häufig.«
Als ich das Gespräch beendete, fiel mir auf, dass ich eine SMS
bekommen hatte. Der Absender nannte sich einfach nur Unknown –
unbekannt.
Ich öffnete die Kurznachricht.
Ihr könnt niemanden schützen, stand dort.
5
»Woher hast du das?«, fragte Henri Lambert. Sein Bauch wölbte
sich unter dem Gefängnisoverall hervor. Seine Gesichtsfarbe wurde
dunkelrot, und die Ader an seinem Hals schwoll auf eine ungesund
wirkende Art und Weise an.
»Aus sicherer Quelle«, sagte sein Gegenüber leise, ein Mann im
dunklen Dreiteiler. »Es kam im Radio. An einer Tankstelle an der
Autobahn zwischen Marseille und Aubagne hat es eine Explosion
gegeben. Und in dem Wagen, der da in die Luft geflogen ist, saß
unser Freund Bruno Montagnola. Angeblich soll auch eine Commissaire
ums Leben gekommen sein, aber das ist noch nicht bestätigt.«
»Dieser verfluchte Verräter«, knurrte Lambert. »Wäre dieser
Hund nicht gewesen, wäre ich nie in Schwierigkeiten gekommen. Es
wäre geheuchelt, wenn ich jetzt sagen würde, dass mir Brunos Tod
besonders leidtut.«
»Kann ich gut verstehen.«
»Nicht, dass ich jetzt gefühllos erscheine …«
»Henri …«
»Sorgst du dafür, dass Brunos Familie mein Beileid in
angemessener Form übermittelt wird?«
»Brunos Familie ist im Moment schwer erreichbar, um es mal
vorsichtig auszudrücken.«
Henri Lambert nickte langsam.
»Ja, ich verstehe. Bruno ist immer schon ein cleveres Kerlchen
gewesen. Hat wohl seine Lieben frühzeitig in Sicherheit bringen
lassen.«
»Das dürfte Teil des Deals gewesen sein, den er eingegangen
ist.«
»Ein Deal, mit dem er uns alle hineingeritten hat! Dieser
verfluchte Hund! Ich hätte ihm selbst gerne den Hals umgedreht,
wenn eine Gelegenheit dazu gewesen wäre.«
Der Anwalt beugte sich jetzt über den Tisch des spartanisch
eingerichteten Besprechungszimmers. Sein Blick wirkte ernst, die
Augenbrauen waren hochgezogen.
»Henri, du musst jetzt in die Offensive gehen.«
»Und was soll das heißen?«
»Nutze die Situation, bevor es ein anderer tut – und biete
dich selbst als Kronzeuge an! Aber das muss schnell geschehen,
sonst ist niemand mehr scharf auf deine Aussage. Dann ist es denen
wichtiger, dich für immer wegzuschließen, statt auch noch den
allerletzten Geldwäschedeal und den Fall irgendeines Drogendealers,
der von einem deiner Leute eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, bis
ins letzte Detail aufzuklären.«
»Du meinst, ich soll an Brunos Stelle treten?«
»Es bleibt dir keine andere Wahl, Henri.«
»Wenn du das sagst …«
»Und diese Entscheidung musst du darüber hinaus aus den
bekannten Gründen schnell treffen. Sehr schnell!«
Henri Lambert schluckte. Er lehnte sich zurück.
»Die werden mich genauso ausradieren wie Bruno Montagnola«,
war er überzeugt.
»Nicht, wenn du schnell und entschlossen genug bist.«
»Aber …«
»Was wäre die Alternative, Henri? Die lassen dich hier nie
wieder raus. Da reicht schon das, was sie bisher gegen dich in der
Hand haben.«
»Ich dachte, ich habe gute Anwälte!«
»Unsere Kanzlei kann auch keine Wunder vollbringen, Henri. Und
außerdem sind ja noch ein paar andere Geschäftsfreunde von dir in
Bedrängnis. Und von denen wird sicher einer skrupellos genug sein,
die Chance zu nutzen, den eigenen Hals aus der Schlinge zu
ziehen.«
»Lass mir noch etwas Zeit!«
»Du hast keine Zeit mehr, Henri! Entweder jetzt oder nie! Wenn
du willst, leite ich alles Nötige sofort ein. Glaub mir, der Moment
ist günstig! Die andere Seite braucht dich nach Brunos Tod so
dringend, wie es nie wieder sein wird.«
Henri Lambert zögerte noch. Nur langsam wollte er die Wahrheit
über seine Situation akzeptieren. Und die Wahrheit war nun mal,
dass er gar keine andere Wahl hatte, als auf den Vorschlag seines
Anwalts einzugehen.
»Also gut, leite alles in die Wege!«, sagte Henri Lambert
schließlich. Und noch während er diese Worte über die Lippen
brachte, sank der große, übergewichtige und eigentlich sehr kräftig
wirkende Mann förmlich in sich zusammen.
»Gut, dann mach ich das für dich«, sagte der Anwalt.
»Charles!«
Einige Augenblick sah Henri Lambert sein Gegenüber sehr
eindringlich an.
»Henri, ich weiß, wie ich das machen muss. Und um deine
Familie werde ich mich auch kümmern.«
»Das wollte ich hören.«
Henri Lambert schien ein zentnerschwerer Stein vom Herzen zu
fallen. Er atmete tief durch und rang dabei förmlich nach
Luft.
»Allerdings gibt es da noch eine Sache, über die wir
vielleicht auch schon jetzt sprechen sollten«, sagte der
Anwalt.
Henri Lamberts Augen wurden schmal, als er sein Gegenüber
musterte.
»Wovon redest du?«
»Wenn es zum Prozess kommt, werde ich dich nicht vertreten
können.«
»Wieso das nicht?«
»Eigentlich ist es sogar besser, wenn ich bereits vor der
Anhörung vor dem Gericht aussteige.«
»Charles, was redest du da?«
»Du musst mich verstehen. Deine Geschäfte und meine
Nebeneinkünfte haben ja durchaus ein paar Berührungspunkte, um es
mal vorsichtig auszudrücken. Und es könnte daraus sehr schnell
jemand einen Interessenkonflikt konstruieren. Ich habe deshalb
schon mit den Partnern unserer Kanzlei gesprochen. Unser Haus wird
dich natürlich weiter vertreten, und ich werde auch ganz sicher ein
Auge auf alles haben, was da für dich und in deinem Namen
unternommen wird. Aber ich persönlich kann dabei nicht mehr in der
ersten Reihe mitspielen. Das verstehst du doch, oder?«
»Ja, das verstehe ich vielleicht sogar besser, als du glaubst,
Charles.«
»Henri, es gibt Gesetze und Verfahrensregeln, an die auch ich
mich halten muss. Und wenn die Anwaltskammer …«
»Schenk dir deine Scheiß-Erklärungen!«
»Henri!«
»Wie schon gesagt, ich habe dich gut verstanden. Du willst
dich gerade noch rechtzeitig abseilen, bevor es auch für dich zu
heiß werden könnte.«
»Nein, so ist das nicht«, widersprach der Anwalt auf seine
gewohnt nüchterne und kühle Art und Weise. Sein Gesicht blieb dabei
vollkommen unbewegt. Es war unmöglich, ihm anzusehen, was hinter
seiner glatten Stirn vor sich ging. Gefühle gab er nicht preis.
Auch in diesem Fall nicht.
»Ach, nein?«, ätzte Lambert.
»Diese Maßnahme ist durchaus auch in deinem wohlverstandenen
Interesse. Schließlich wollen wir dich doch möglichst schnell hier
herausholen. Da sind wir uns ja wohl einig.«
»Ja, das schon.«
»Vergiss eines nicht: Hier drinnen bist du denen ausgeliefert!
Jederzeit! Deren Arme sind lang genug, um dich auch hier im
Gefängnis ins Jenseits zu befördern oder dir alles anzutun, was
denen so einfällt … Und die sind sehr einfallsreich, das weißt du
ja.«
Henri Lambert schluckte. Er nickte leicht.
»Solltest du mich bescheißen, Charles, dann wirst du meinen
Einfallsreichtum kennenlernen. Hast du mich verstanden? Und wenn
ich hier dreißig Jahre absitzen muss, werde ich in dieser Zeit ganz
sicher nur an eines denken. Wie ich diejenigen kalt machen kann,
die mir das angetan haben. Also – sei gewarnt!«
Das Gesicht des Anwalts blieb noch immer vollkommen
regungslos.
»Du kannst bedrohen, wen immer du willst, Henri. Aber du
solltest dir mal überlegen, ob es besonders klug ist, das
ausgerechnet bei denen zu versuchen, die noch auf deiner Seite
stehen und dir zu helfen versuchen.«
Noch, dachte Henri Lambert. Dieses eine Wort brannte sich in
seinen Gedanken besonders ein. Er hat noch gesagt!, ging es ihm
durch den Kopf.
Henri Lambert hatte auf einmal das Gefühl, als würde sich eine
Schlinge um seinen Hals legen und langsam zuziehen.
Der Anwalt sah auf die Rolex an seinem Handgelenk.
»Ich muss jetzt gehen, Henri.«
6
Nach und nach trafen etwa zwei Dutzend Kollegen des
Polizeipräsidiums Marseille am Tatort ein. Darunter auch unsere
eigenen Erkennungsdienstler Pascal Montpierre und Jean-Luc Duprée
sowie ein Sprengstoffexperte. Unterstützt wurden wir außerdem von
zahlreichen Beamten der Polizei und der Autobahnpolizei. Es ging
unter anderem darum, dass möglichst schnell festgehalten wurde,
welche Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Anschlags auf den zum Gelände
gehörenden Parkplätzen gewesen waren. Die Überwachungskameras an
der Tankanlage gaben darüber nicht unbedingt ein vollständiges
Bild. Es war nämlich nicht anzunehmen, dass der oder die Attentäter
vor dem Anschlag auf Montagnola erst noch getankt hatten. Aber da
das andererseits auch nicht völlig auszuschließen war, machten sich
unsere Innendienstkollegen bereits daran, alle
Kreditkartenzahlungen zu überprüfen, die an diesem Tag in der
Tankstelle oder im Schnellrestaurant getätigt worden waren. Und die
Angestellten wurden nach Barzahlern gefragt. Ob da irgendetwas
dabei herauskommen würde, war höchst fraglich. Aber irgendwo
mussten wir unsere Ermittlungen ja beginnen. Und im Moment tappten
wir da noch vollkommen im Dunkeln.
Die Aufzeichnungen sämtlicher Überwachungskameras waren
natürlich Beweisstücke und wurden beschlagnahmt. Auch da würden
sich Kollegen aus dem Innendienst in mühevoller Kleinarbeit darum
kümmern und die Bilder mit Hilfe von Bilderkennungssoftware nach
bekannten Gesichtern durchsuchen. Der Abgleich mit unseren
Datenbeständen war dabei eine Sache von Augenblicken, aber vorher
war zumeist eine Menge mühevoller Handarbeit nötig, um das
Bildmaterial erst mal zu durchsuchen und gegebenenfalls so
aufzubereiten, dass die Qualität überhaupt ausreichte, unser System
nicht vor unlösbare Aufgaben zu stellen.
Stéphane Caron, nach unserem Chef der zweite Mann im
Polizeipräsidium Marseille, kam zusammen mit seinem Dienstpartner
Boubou Ndonga als einer der letzten zum Tatort.
»Hallo Pierre, hallo François«, begrüßte Stéphane uns. »Ihr
habt nichts weiter abgekriegt, soweit ich gehört habe?«
»Wir hatten Glück«, gab ich zu.
»Unsere Kollegin Monique Alperte hatte das leider nicht«,
fügte François niedergeschlagen hinzu.
Der Tod wird nie zur Routine. Und schon gar nicht, wenn es
Kollegen trifft. Jeder von uns weiß natürlich, dass dies kein Job
wie jeder andere ist. Der Kampf gegen das Verbrechen ist nun mal
auch mit Gefahren für das eigene Leben und der eigenen Gesundheit
verbunden. Das war schon immer so, und es wird sich wohl auch in
absehbarer Zeit nicht ändern lassen. Wir tun alles, um so etwas zu
vermeiden. Dass die Eigensicherung immer Vorrang hat, lernt man auf
jedem Lehrgang. Aber wenn dann doch ein Kollege zu Tode kommt, dann
erinnert einen das immer daran, dass es jederzeit jemanden von uns
treffen könnte.
»Alle Fahrzeuge, die sich zur Zeit auf der Autobahn befinden,
werden an mehreren Kontrollpunkten überprüft«, berichtete Stéphane.
»Der Täter müsste sich also eigentlich in unserem weit gespannten
Netz verfangen. Früher oder später jedenfalls.«
»Dann hoffe ich, dass Ihnen auch ein rothaariger Ford-Fahrer
namens Martin Duval ins Netz geht«, lautete mein Kommentar.
Irgendwie klangen meine Worte etwas schroff und sarkastisch.
Aber im Moment war meine Stimmung einfach auf dem Tiefpunkt.
Stéphane wusste das richtig einzuschätzen und ignorierte es
schlicht. Das war wohl auch das Beste.
»Wenn dieser Duval tatsächlich etwas damit zu tun hat, wird er
die Autobahn frühzeitig verlassen haben«, glaubte François.
»Jedenfalls würde ich das so machen, wenn ich an seiner Stelle
wäre.«
Mein Handy klingelte. Ich nahm den Apparat ans Ohr. Es war
Maxime.
Vielleicht gab es ja mal irgendwelche ermutigenden
Nachrichten, so hoffte ich. Aber dem war leider nicht so.
»Pierre, wir haben herausgekriegt, von was für einem Handy dir
die SMS geschickt wurde.«
»Und?«
»Ein Prepaid-Gerät. Wir können nicht herausfinden, wem es
gehört. Der Versuch, es zu orten, ist fehlgeschlagen. Wir nehmen
an, dass es ausgeschaltet ist.«
Ich atmete tief durch.
»So was Ähnliches hatte ich mir schon gedacht.«
»Was diesen Martin Duval angeht: Du kannst dir denken, dass es
davon allein in Marseille ganze Hundertschaften gibt – selbst wenn
man ein zusätzliches Merkmal hinzunimmt, etwa die Haltung eines
Ford oder rote Haare.«
»Und?«
»Also, das Fahrzeug, dessen Kennzeichen du mir durchgegeben
hast, passt zu einem Ford, der einem gewissen Martin Duval auf
Pointe-Rouge gehört. Es sind schon ein paar Kollegen dahin
unterwegs.«
»Gut. Vielleicht erfahren wir dann ja mehr.«
»Ach ja, und dann habe ich gerade etwas sehr Interessantes von
Monsieur Marteau erfahren.«
»Was denn?«
»Charles Gregoire, der Anwalt von Henri Lambert, hat sich
gemeldet. Er will jetzt quasi an Montagnolas Stelle als Kronzeuge
treten.«
»Das ist in der Tat interessant«, sagte ich. »Und eine
ziemlich drastische Änderung seiner bisherigen
Verteidigungsstrategie.«
»Kann man wohl sagen, Pierre. Unser Chef war auch ziemlich
überrascht, aber er hat’s vom Staatsanwalt, und dann muss es ja
wohl stimmen. Wenn du mich fragst, haben wir mit Lambert dann
allerdings jemanden, der ein ganz starkes Motiv hätte, um
Montagnola aus dem Weg zu räumen.«
In diesem Punkt musste ich Maxime recht geben. Durch
Montagnolas Tod hatte sich Lambert erst die Möglichkeit eröffnet,
als Kronzeuge aufzutreten. Ob sich die Justiz darauf einließ, war
natürlich noch nicht gesagt. Aber mit Montagnolas Aussage in der
Hinterhand wäre die Staatsanwaltschaft auf jemanden wie Lambert gar
nicht angewiesen gewesen. Das hatte sich mit dem heutigen Tag
geändert.
Und ich zweifelte auch nicht daran, dass jemand wie Henri
Lambert in der Lage war, auch aus dem Gefängnis heraus dafür zu
sorgen, dass sich ein Profi-Killer auf den Weg machte, um das zu
erledigen, was nach Lamberts Meinung erledigt werden musste.
Aber da war etwas anderes, was mich stutzig machte – und den
Verdacht in Richtung Henri Lambert durchaus unterstützte.
»Wie konnte Henri Lambert so schnell davon wissen, dass Bruno
Montagnola tot ist«, fragte ich an Stéphane und Boubou gewandt.
»Es kam in den Nachrichten«, antwortete Stéphane mir
nüchtern.
»Hat die FoPoCri diese Meldung herausgegeben?«
»Nicht, dass es mir bekannt wäre.«
»Wir haben es im Radio auf dem Weg hierher gehört«, ergänzte
Boubou.
»Und dabei wurde explizit Montagnola erwähnt?«, hakte ich
nach.
Stéphane und Boubou nickten.
»Ja, er wurde genannt. Ich bin mir ganz sicher«, stellte
Boubou im Brustton der Überzeugung fest.
Stéphane kratzte sich am Kopf.
»Tja, eigentlich sollte ich ja als stellvertretender Chef des
Polizeipräsidiums Marseille wissen, was da an offiziellen
Verlautbarungen rausgeht.«
»Pierre war zu höflich, darauf auch noch herumzuhacken«,
meinte Boubou. »Aber wo die Sache jetzt auf dem Tisch liegt, frage
ich mich natürlich auch, wie es sein kann, dass hier der hoch
geheime Transfer eines Kronzeugen schiefgeht und schon unmittelbar
danach in den Medien darüber berichtet wird, wer dabei ums Leben
gekommen ist.«
»Auf jeden Fall ist das ein Punkt, der überprüft werden muss«,
meinte ich.
Niemand von uns wagte den Verdacht auszusprechen, aber er lag
natürlich in der Luft. Die eine Möglichkeit war, dass der Täter
oder sein Auftraggeber sich an die Medien gewandt hatte. Dann
konnte man dort vielleicht auch eine Spur aufnehmen. Die andere
Möglichkeit war sehr viel beunruhigender.
Was, wenn es in unseren Reihen eine undichte Stelle gab?
Jemanden, der vielleicht brisante News an die Öffentlichkeit gab,
noch bevor wir das von uns aus taten. Das wäre natürlich eine
permanente Bedrohung unserer Arbeit gewesen, denn schließlich war
das Ausnutzen des Informationsvorsprungs, den wir in der Regel
hatten, eine der wirkungsvollsten Methoden zur Überführung von
Straftätern.
Es war durchaus möglich, dass sich die Nachricht von einer
Explosion an einer Autobahn-Tankstelle so schnell verbreitete. Aber
dass auch die Information über die Identität des Opfers bekannt
wurde, war eigentlich nicht möglich.
Ich sah den Spurensicherern zu, wie sie an dem ausgebrannten
Wrack arbeiteten. Ein beißender Geruch hing in der Luft.
»Die wichtigste Frage scheint mir zu sein, wie der Sprengstoff
eigentlich zum Wagen gelangen konnte«, sagte François. »Darüber
denke ich schon die ganze Zeit nach.«
»Es muss hier geschehen sein«, glaubte ich.
Ich rekapitulierte, was mit dem SUV heute geschehen war. Ich
hatte ihn aus der Fahrbereitschaft abgeholt, dann waren François
und Montagnola zugestiegen. Es war kinderleicht, einen Sprengsatz
an einem Fahrzeug zu befestigen und ihn mit einem Sender zu zünden.
Allerdings musste das Fahrzeug dazu eigentlich wenigstens einen
Augenblick lang so unbeobachtet sein, dass dies überhaupt möglich
war.
Aber in unserem Fall hatten François und ich uns nie weiter
vom Wagen entfernt als ein paar Meter. Außerdem war das Fahrzeug
die ganze Zeit über auch noch von den Kollegen im zweiten Fahrzeug
überwacht worden. Wie ein Täter dazu Gelegenheit gehabt hatte,
einen derartigen Sprengsatz an den SUV zu heften, war mir einfach
schleierhaft. Aber irgendwann musste es dem Täter gelungen sein,
dem Wagen nahe genug zu kommen, um den Sprengstoff anzubringen.
Ich dachte an den betrunkenen Mann im Parka, der auf den Wagen
zugekommen war, während François und ich bereits mit Montagnola auf
dem Weg zum Hauptgebäude gewesen waren. Die Aufzeichnungen der
Überwachungskameras gaben da vielleicht noch Aufschluss.
François griff in diesem Augenblick zum Handy. Und dann zeigte
er mir, dass auch er eine Nachricht mit dem Text »Ihr könnt
niemanden schützen« bekommen hatte.
Ich stellte fest, dass das Absendedatum dasselbe war wie bei
der Nachricht, die ich erhalten hatte.
»Der Empfang war bei mir offenbar verzögert«, stellte François
fest. »So was kommt vor.«
»Diese Nachricht klingt für mich wie eine Drohung«, stellte
ich fest.
7
Während wir noch weiter am Tatort blieben, um uns an den
Ermittlungen zu beteiligen, suchten unsere Kollegen Josephe
Kronbourg und Léo Morell die Adresse jenes Martin Duval auf, auf
den ein Ford mit dem Marseiller Kennzeichen zugelassen war, das ich
mir gemerkt hatte. Auch die anderen Merkmale des Fahrzeugtyps
stimmten überein.
Monsieur Marteau hatte einen Durchsuchungsbeschluss für die
Wohnung erwirken können. Dass der Verdächtige jetzt dort
anzutreffen war, nahmen unsere Kollegen nicht an. Es wäre selbst
unter günstigsten Verkehrsbedingungen rund um Marseille kaum
möglich gewesen, in so kurzer Zeit die Strecke zwischen der
Autobahn-Tankstelle und der auf Pointe-Rouge gelegenen Adresse
zurückzulegen. Schon gar nicht, wenn man die allgegenwärtigen
Verkehrsbehinderungen und Staus mit einrechnete.
Josephe und Léo parkten ihren Dienstwagen aus den Beständen
unserer Fahrbereitschaft vor einem achtstöckigen Haus.
Josephe überprüfte den Sitz seiner Waffe, und ließ den Blick
die Fassade entlangstreifen.
Die Adresse gehörte zur Wohnung im 7. Stock – und wenn man die
Ausmaße des Hauses berücksichtigte, gab es vermutlich nur eine
Wohnung pro Etage. Aber in der Wohnung, die Martin Duval gehörte,
waren mehrere Fenster offen. Gardinen wehte wie Fahnen ins
Freie.
»Also, wenn du mich fragst, ist da entweder jemand zu Hause
…«, begann Josephe.
»… oder Monsieur Duval lässt die Fenster offen, wenn er
wegfährt!«
»Oder wir wurden falsch informiert.«
»Warten wir es einfach ab, Josephe!«
Unsere Kollegen betraten das Haus. Die Postkästen befanden
sich im Eingangsbereich, zusammen mit dem Treppenhaus und einem
Aufzug. Der Name Martin Duval war an einem der Kästen zu lesen.
Allerdings hatte Duval seine Post offenbar als einziger im Haus
noch nicht abgeholt. Sie quoll aus dem Schlitz heraus.
»Das ist nicht nur die Post von einem Tag«, glaubte Léo.
Josephe hob die Augenbrauen.
»Monsieur Duval scheint nicht besonders interessiert daran zu
sein.«
»Vielleicht liegt das an der Art von Post, die Monsieur Duval
kriegt«, vermutete Léo. »Manche Leute ignorieren gerne
Zahlungsaufforderungen, Mahnungen, gerichtliche Anordnungen, und
was es da sonst noch an unerfreulichen Dingen so gibt.«
Der Aufzug war außer Betrieb. Allerdings merkte Josephe das
erst, als er versuchte, die Kabinentür zu öffnen. Sie war
verschlossen. Ein Hinweisschild, das darauf aufmerksam machen
sollte, dass der Aufzug nicht benutzt werden konnte, lag umgedreht
auf dem Boden. Der Klebestreifen, mit dem es befestigt gewesen war,
hatte sich wohl gelöst.
»Dann haben wir heute ein Extra-Fitness-Programm«, meinte Léo
dazu.
Die beiden Polizeibeamten nahmen immer mehrere Stufen auf
einmal. Es dauerte nicht lange, und sie standen vor Martin Duvals
Wohnungstür. Es war offen. In der Wohnung herrschte Zugluft.
Josephe zog den 357er Magnum-Revolver. Sicher war sicher. Er
ging voran. Léo Morell folgte ihm und hielt dabei die herkömmliche
P 226 in der Faust, die seit Jahren die Standardwaffe bei allen
Polizeieinheiten war.
Die beiden Kollegen drangen ins Wohnzimmer vor. Der Geruch von
verschimmelten Nahrungsmitteln hing in der Luft. Auf dem niedrigen
Wohnzimmertisch lag das Spritzbesteck eines Junkies. Die
Ledersessel wirkten durchgesessen. Flaschen standen zu Dutzenden
auf dem Boden. Überall lag Müll.
Léo Morell nahm sich das anschließende Schlafzimmer und die
Küche vor. Auch dort war niemand.
Aus dem Bad kamen Geräusche.
Josephe war als Erster dort. Ein Mann beugte sich über die
Toilette und würgte. Er übergab sich offenbar. Als er sich
einigermaßen erholt hatte, blickt er auf und stierte Josephe
ungläubig an.
»Josephe Kronbourg, FoPoCri«, sagte der ehemalige Polizist.
»Wer sind Sie, und was machen Sie hier?«
»Martin Duval«, ächzte der Mann. »Und wenn Sie nichts dagegen
haben: Ich wohne hier! Was wollen Sie von mir? Ich habe keinen
Stoff hier! Sie können mir nichts! Scheiße, ich kenne meine
Rechte!«
»Ist ja gut«, sagte Josephe.
»Oder wollt Ihr mir irgendwas in die Wohnung legen, damit ihr
mich einlochen könnt? So macht ihr das doch, oder?«
»Nein, so machen wir das nicht.«
»Scheiße …«
Er fing wieder an zu würgen. Josephe Kronbourg musste sich
dazu zwingen, nicht wegzuschauen. Aber das hätte unter Umständen
gefährlich werden können. Schließlich musste man auch damit
rechnen, dass so ein Würgeanfall möglicherweise eine Finte war, um
dann plötzlich anzugreifen. So was hatte Josephe in seiner Zeit bei
der Polizei mehr als einmal erlebt.
Aber dieser Mann wäre dazu wohl gar nicht in der Lage gewesen,
so schlecht war sein körperlicher Zustand. Josephe fragte sich, wie
alt er war. Er schätzte sein Gegenüber auf Mitte vierzig. Aber es
war durchaus möglich, dass er in Wahrheit fünfzehn Jahre jünger und
einfach nur in einem sehr schlechten Zustand war. Bei einem Junkie
wäre das nicht ungewöhnlich gewesen. Auf jeden Fall hatte er keine
roten Haare.
Und was er mit dem Anschlag auf Bruno Montagnola zu tun hatte,
musste sich erst noch herausstellen.
»Wir haben ein paar dringende Fragen an Sie«, sagte Josephe.
»Sind Sie in der Lage, die zu beantworten?«
»Kommt darauf an.«
»Ich schlage vor, wir gehen ins Wohnzimmer. Da riecht es nicht
ganz so schlimm wie hier.«
»Ich habe mit Drogen nichts mehr zu tun! Ehrlich! Und Sie
können in der Wohnung jeden Teppich umdrehen, wenn Sie wollen. Mehr
als die Mengen für den Eigenbedarf werden Sie nicht zusammenkratzen
… Im Moment bin ich sowieso völlig blank …«
»Wir sind nicht wegen irgendwelcher Drogen hier«, sagte
Josephe und steckte den Magnum-Revolver weg.
»Nicht wegen Drogen?«
Der Mann blinzelte. Er schien die Welt nicht zu
verstehen.
»Es geht um einen Sprengstoffanschlag, mit dem Sie in
Verbindung gebracht werden.«
»Hey, nun mal langsam …«
»Und ich hoffe, das können wir hier gleich klären, sonst
müssen wir Sie mit zur Dienststelle nehmen und dort
befragen.«
Der Mann schluckte.
»Ich bin gleich soweit«, versprach er.
Léo war inzwischen hinzugekommen.
»Glaubst du, dass wir aus dem irgendeine sinnvolle Äußerung
herausbekommen?«, fragte er.
»Abwarten«, murmelte Josephe.
»Also eins steht schon mal fest: Das ist nicht der Martin
Duval, von dem sich Pierre die Nummer gemerkt hat.«
8
Wenig später saßen Josephe und Léo zusammen mit Martin Duval
im Wohnzimmer. Léo hatte erst die Sessel freiräumen müssen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Martin Duval schließlich
einigermaßen vernehmungsfähig war. Josephe fand inzwischen einen
Reisepass. Er ragte aus der Brusttasche eines Field-Jacketts, das
neben der Wohnungstür an einem Haken hing. Léo blätterte darin
herum.
»Sie reisen zwei bis dreimal im Monat nach Mexiko«, stellte er
fest.
»Ist das verboten?«
»Sie fliegen?«
»Sollte ich vielleicht zu Fuß gehen?«
»Es soll Leute geben, die in ihrem Darm auf diese Weise Drogen
schmuggeln. Ihr Reiseverhalten passt jedenfalls dazu.«
»Meine Scheiße, wollen Sie jetzt vielleicht meine Gedärme
untersuchen? Eine Röntgenaufnahme? Stuhlprobe, mir vielleicht einen
Einlauf machen?«
»Sie könnten uns auch einfach sagen, wie Sie das Geld für
diese regelmäßigen Flüge verdienen«, meinte Léo.
Léo legte den Pass auf den Tisch und setzte sich wieder.
Dieser Martin Duval war mit ziemlich großer Sicherheit ein
Drogenkurier, auch wenn unsere Kollegen ihm das nicht so ohne
Weiteres beweisen konnten.
»Sie können mich mal! Ich bin Ihnen keine Rechenschaft
schuldig!«, schimpfte Duval.
»Sie besitzen einen Ford?«
»Ja, ist das auch noch verboten?«
»Wo befindet sich dieser Wagen?«
»Mann, was wollen Sie mir anhängen?«
»Dieser Wagen wird im Zusammenhang mit einem
Sprengstoffanschlag gesucht«, sagte Léo.
»Ich glaube, wir nehmen ihn einfach mit, und unsere Kollegen
von der Spurensicherung drehen hier mal das Unterste zuoberst«,
mischte sich Josephe Kronbourg ein. »Anders kommen wir hier wohl
nicht weiter …«
»Hey Leute, ich will einen Anwalt!«
»Vielleicht sagen Sie uns einfach, wo Ihr Wagen ist, dann sind
Sie uns vielleicht sogar los. Ihre Beschreibung passt nämlich nicht
auf den Fahrer. Und falls da jemand unter Ihrem Namen Morde begehen
sollte, sollten Sie ein Interesse daran haben, das
richtigzustellen, finden Sie nicht auch?«
Er schluckte.
»Ich habe mit den Sachen, von denen Sie reden, nichts zu tun«,
beteuerte er.
»Wo ist der Wagen?«, fragte Léo.
»Also mir gehört ein Ford. Ich bin im Moment aber ziemlich
blank. Eigentlich könnte ich mir nicht einmal den Sprit leisten,
verstehen Sie? Und mein Vermieter will mich rausschmeißen, weil ich
die Miete nicht bezahlt habe …«
»Wo ist der Ford?«, beharrte Léo.
»Die Wichser haben den einfach abgeschleppt!«
»Wen meinen Sie damit!«
»Und ich soll das jetzt sogar noch bezahlen! Vorher kriege den
Wagen nicht wieder. Aber ich bin blank, verdammt noch mal!«
»Jetzt mal der Reihe nach: Wer hat den Wagen
abgeschleppt?«
»Das Ganze fing damit an, dass mir das Nummernschild geklaut
wurde. Das ist ein paar Tage her.«
»Darf ich raten«, fragte Léo. »Sie waren gerade mal wieder in
Mexiko – und dafür hatten Sie Geld.«
»Spielt doch keine Rolle, oder?«
»Fahren Sie fort!«, forderte Josephe ihn auf.
»Die Scheißbullen haben den Wagen abgeschleppt, weil die
dachten, dass ich einen öffentlichen Parkplatz dafür missbrauchen
würde, einen Schrottwagen abzustellen. Jemand hat sich wohl
beschwert, und Parkplätze sind hier eben knapp.«
»Wo ist der Wagen jetzt?«, hakte Léo nach.
»Ich habe da irgend so einen Wisch gekriegt, da steht es
drauf. Wenn Sie mir suchen helfen …«
9
Eine Stunde später fanden Léo und Josephe den Ford bei einer
Werkstatt, die von der Polizei beauftragt worden war, das Fahrzeug
abzuschleppen. Das Fahrzeug war mit dem gesuchten Ford baugleich.
Die Nummernschilder fehlten.
»Eine einfache Masche«, sagte Josephe. »Man besorgt sich das
Nummernschild eines Fahrzeugs, das baugleich zum eigenen Wagen ist,
und fällt damit der Autobahnpolizei nicht auf.«
»Und wenn man dann noch einen falschen Führerschein hat oder
tatsächlich Martin Duval heißt …«
»Du sagst es, Léo!«
»Ein Problem kriegt man nur, wenn das Nummernschild als
gestohlen gemeldet wurde.«
»Was offensichtlich nicht geschehen ist, sonst hätten wir
gleich davon erfahren und uns die ganze Mühe sparen können!«
Josephe griff zum Handy und rief im zuständigen Polizeirevier
an, um sich in diesem Punkt noch mal zu vergewissern.
»Und?«, fragte Léo, nachdem Josephe das Gespräch beendet
hatte.
Der ehemalige Polizist lächelte.
»Die Kollegen haben bestätigt, dass Duval den Diebstahl nie
angezeigt hat.«
»So, wie der Typ auf mich wirkte, hat der das einfach nicht
zurecht gekriegt, weil ihm die Drogen im Laufe der Zeit das Gehirn
zerstört haben. Ehrlich Josephe, das wundert mich jetzt nicht
besonders.«
Josephe Kronbourg nickte. »Das ist eine Möglichkeit.«
»Und die andere?«
»Vielleicht wurde das Nummernschild gar nicht gestohlen –
sondern verkauft. Überleg doch mal! Jemand braucht einen Wagen, der
nicht gleich auffällt. Er besorgt sich ein falsches Nummernschild,
aber wenn er das stiehlt, muss er damit rechnen, dass der Besitzer
Anzeige erstattet. Besser, man gibt dem Besitzer einfach ein paar
Scheine, dann wird er den Diebstahl nicht melden und sich
vielleicht einfach so ein neues Schild besorgen.«
»Und jemand, der finanziell so am Ende ist wie Duval, ist
dafür ideal«, schloss Léo.
Die beiden Polizeibeamten kehrten zu Martin Duvals Wohnung
zurück. Duval wirkte jetzt etwas aufgeräumter. Josephe vermutete,
dass er inzwischen irgendwoher doch noch Stoff bekommen hatte.
Aber so genau wollte er das gar nicht wissen, denn jetzt ging
es um etwas anderes.
»Beschreiben Sie uns denjenigen, dem Sie das Nummernschild
verkauft haben«, sagte Josephe ihm schon an der Tür auf den Kopf
zu. Vielleicht lag er falsch. Aber einen Versuch war es jedenfalls
Wert, fand er
Duval wich zurück.
»Hey, Mann, fangen Sie nicht wieder an, mir etwas
anzuhängen!«
»Vielleicht begreifen Sie es langsam: Wir sind weder von der
Drogenfahndung, noch interessiert uns im Moment, was Sie sonst so
treiben«, sagte Josephe. »Aber das kann sich ändern. Im Augenblick
interessiert uns nur der Mann, der Ihr Nummernschild hat.«
»Okay, okay«, rief Duval. »Da war so ein Typ.«
»Wie sah der aus?«, fragte Josephe.
»Mitte dreißig, rotes, schütteres Haar. Und er hat gesagt, er
heißt wie ich: Martin Duval. Ist doch witzig, oder?«
»Hat er gesagt, wie er auf Sie gekommen ist?«
»Nein. Ich habe auch nicht gefragt. Ich meine, er hat mir ein
paar Hunderter geboten.«
»Wo ist Ihr Führerschein«, bohrte Léo weiter nach.
»Also …«, druckste Duval herum. »Wie soll ich das jetzt
sagen?«
»Wie wär’s einfach mit der Wahrheit, Monsieur Duval? Denn
alles andere führt nur dazu, dass wir noch mal auftauchen müssen –
und das bedeutet für Sie mehr Ärger, als Sie es sich vorstellen
können«, stellte Josephe Kronbourg klar.
»Tja, im Nachhinein ist das ziemlich seltsam, wenn ich so
darüber nachdenke. Aber er hat mir so viel Geld geboten, und ich
war völlig blank und brauchte …« Er schluchzte. »Sie wissen nicht,
wie das ist, wenn man keinen Stoff mehr hat, nicht wahr? Sie können
sich das nicht mal vorstellen.«
»Was ist mit dem Führerschein?«, beharrte Josephe.
»Er hat ihn auch gekauft. Ich weiß, dass das nicht legal ist.
Aber erstens wäre sowieso in einer Woche abgelaufen und zweitens
…«
»… hat er Ihnen ein paar Scheine gegeben, und Sie brauchten
Ihren Stoff«, vollendete Josephe seinen Satz.
»Ja«, murmelte er.
»Haben Sie ihn schon mal gesehen? Kam er aus der Gegend? Wohnt
er hier in der Nähe?«
»Ich habe keine Ahnung. Allerdings habe ich ihn vorher noch
nie gesehen.«
10
Es war schon früher Abend, als François und ich Aubagne
erreichten. Östlich der Stadt liegt ein kleiner Ort namens Gémenos.
Und dort waren Bruno Montagnolas Frau sowie sein 18-jähriger Sohn
Tony untergebracht.
Zwei Kollegen waren ständig bei ihnen, um ihre Sicherheit zu
gewährleisten. Im Moment waren das die Kollegen Sarah Andrés und
Louis Bouvet.
Die Montagnolas waren in einem freistehenden Haus
untergebracht. Es handelte sich um einen Mittelklasse-Bungalow an
einer breiten Allee. Die FoPoCri hat dieses Haus für genau solche
Fälle angemietet. Und wir hatten gehofft, dass auch Bruno
Montagnola hier die Zeit bis zu seiner Aussage unbehelligt
verbringen konnte. Aber diese Hoffnung hatte sich ja nun
zerschlagen.
Ich sah der Aufgabe entgegen, Madame Montagnola und ihrem Sohn
zu berichten, was mit Bruno geschehen war.
Unsere Kollegen wussten natürlich über den Anschlag Bescheid
und hatten Tony und seine Mutter vermutlich entsprechend
informiert. Das enthob uns zumindest schon mal von der unangenehmen
Pflicht, diese schlechte Nachricht als Erste zu überbringen. Viel
einfacher machte es unseren Besuch aber trotzdem nicht. Menschen
gegenüberzustehen, die einen nahen Angehörigen durch ein Verbrechen
verloren haben, wird niemals zur Routine und geht auch niemals
spurlos an einem vorbei. Selbst dann nicht, wenn der Ermordete
selbst ein Verbrecher gewesen ist, den nur eine Absprache mit der
Justiz davor schützte, die nächsten Jahrzehnte im Gefängnis zu
verbringen.
François und ich stiegen aus.
Als wir an der Tür klingelten, machte uns unser Kollege Louis
Bouvet auf.
»Hi, Pierre«, sagte er.
Wir wurden hereingelassen, und Louis führte uns ins
Wohnzimmer. Dort befand sich außer unserer Kollegin Sarah Andrés
auch Madame Montagnola.
Tony Montagnola, ein hoch aufgeschossener junger Mann mit
dunklen, leicht gelockten Haaren, die nahezu seine gesamte Stirn
verdeckten, trat jetzt aus dem Nachbarraum ein.
»Der Anschlag an der Autobahn kam überall in den Nachrichten«,
sagte er an François und mich gerichtet, ohne uns zu begrüßen.
»Konnten Sie das nicht verhindern?«
Sein Tonfall war schroff. Und ich hatte ein gewisses
Verständnis dafür.
»Glauben Sie mir, wir hätten alles dafür getan, wenn es
irgendwie möglich gewesen wäre!«
»Untersuchen Sie Ihre Fahrzeuge nicht auf Sprengstoff, bevor
Sie damit losfahren? Oder lassen Sie jeden an einen Wagen heran, in
dem ein Kronzeuge sitzt, damit man sich den ganzen Prozess sparen
kann?«
»Tony, jetzt reden Sie Unsinn!«, sagte ich.
»Mein Vater hat sein Leben riskiert, und Sie konnten ihn nicht
schützen! Und wahrscheinlich werden Sie jetzt zu uns sagen: Tut uns
leid, Sie werden damit leben müssen, dass ein paar Mafia-Killer
landesweit auch noch die kleinste Fachhochschule durchforsten, ob
da nicht der Sohn des großen Bruno Montagnola einfach nur ganz
normal unter falschem Namen studieren will.«
»Tony, lass es gut sein!«, mischte sich jetzt Madame
Montagnola ein. Ihre Stimme klang dunkel und ruhig. Und vor allem
sehr bestimmt.
»Ist doch wahr, Mutter!«, schimpfte Tony.
»Ich bin überzeugt davon, dass diese Herren getan haben, was
sie konnten«, sagte Madame Montagnola. »Auch, wenn es
offensichtlich zu wenig war.« Während ihrer letzten Worte bekam
ihre Stimme einen glasklaren, eisigen Tonfall, in dem durchaus
mitschwang, wie verbittert auch sie war. Äußerlich bewahrte sie
zwar die Haltung, aber hinter dieser ruhigen und beherrschten
Fassade brodelte es. Das war unübersehbar.
»Ich kann Ihnen sagen, dass es mir unendlich leid tut, was
geschehen ist«, sagte ich. »Es wird für Sie beide kein Trost sein,
aber ich verspreche Ihnen, dass niemand von uns ruhen wird, ehe wir
nicht die Schuldigen gefunden haben …«
»… mit denen Sie vielleicht auch einen Deal machen«, meinte
Tony ätzend. »So läuft das doch bei Ihnen, nicht wahr? Und wir
haben unser altes Leben verloren und werden für alle Zukunft davor
Angst haben müssen, dass irgendeiner, der sich von meinem Vater
verraten fühlte, einen Killer losschickt.«
»Unsere Erfahrungen mit dem Zeugenschutzprogramm sind bisher
sehr gut«, sagte ich sachlich. »Ich mache Ihnen nichts vor: Es wird
nicht einfach sein …«
»Was wohl eine Untertreibung sein dürfte!«, fuhr mir Tony
Montagnola in die Parade.
»… aber wenn Sie sich an die Vorgaben halten, dann wird
niemand Sie finden«, schloss ich. »Und diejenigen, von denen Sie
glauben, dass sie Jagd auf Sie und Ihre Mutter machen werden,
sitzen bis dahin vielleicht längst im Gefängnis und haben ganz
andere Probleme.«
»Sie wissen, dass man auch vom Gefängnis aus einen Mord in
Auftrag geben kann«, sagte Tony verächtlich. »Nein, Monsieur
…«
»Marquanteur.«
»Wir werden nie sicher sein können. Wir werden jeden Tag
aufstehen und befürchten müssen, dass es uns genauso ergeht wie
Papa.«
»Lass es jetzt wirklich gut sein, Tony«, fuhr nun Madame
Montagnola dazwischen. Sie erhob sich aus dem Sessel, in dem sie
bisher gesessen hatte. Sie sah mich an. Ihr Blick schien mich
regelrecht zu durchbohren. »Können Sie mir versprechen, dass meinem
Sohn nichts geschieht?«, fragte sie. »Können Sie mir das, nach dem,
was mit meinem Mann passiert ist, jetzt wirklich noch versprechen,
ohne rot zu werden?«
»Ich kann Ihnen nur sagen, dass jeder von uns sein Bestes
gibt«, sagte ich.
»Dann wollen wir hoffen, dass das gut genug ist«, sagte Madame
Montagnola. »Ich will ehrlich sein. Früher hatten wir unsere
eigenen Leibwächter. Jetzt sind wir auf Ihre Leute angewiesen. Und
ich war dagegen, dass wir Fremden trauen sollen …«
»Sie können unseren Leuten auf jeden Fall eher trauen als den
ehemaligen Leibwächtern, die Ihr Mann engagiert hatte. Jeder von
denen hätte vielleicht auf der Lohnliste von einem der Männer
stehen können, gegen die Ihr Mann aussagen sollte.«
»Ja, das hat Bruno auch gesagt.«
»Wir sind bei den Ermittlungen auch auf Sie angewiesen«,
stellte ich klar und wandte den Blick dann in Richtung von Tony
Montagnola, der die Arme vor der Brust verschränkt hatte. »Auf Sie
beide, Tony«, stellte ich ausdrücklich fest.
Tony sah mich dabei nicht an. Er wich meinem Blick förmlich
aus.
»Wie können wir Ihnen helfen?«, fragte Madame Montagnola
schließlich.
»Wir müssen eine Liste der Leute erstellen, die eventuell über
Einzelheiten über den Transfer Ihres Mannes informiert gewesen sein
könnten.«
Tony mischte sich jetzt ein.
»Glauben Sie wirklich, mein Dad war so dumm, das irgendwo
hinauszuposaunen?«
»Nein, aber vielleicht hat er jemandem vertraut, dem er nicht
hätte vertrauen dürfen, und dabei Informationen preisgegeben, die
ihn später das Leben kosteten«, gab ich zurück.
»Wir wissen noch nichts über die Einzelheiten dieses
Anschlags«, meldete sich nun François zu Wort. »Und insbesondere
ist es uns ein Rätsel, wie der Sprengstoff letztlich in oder an den
Wagen gelangte. Aber das kriegen wir früher oder später heraus.
Wichtig ist, dass der oder die Täter offenbar genauestens über das
ganze Unternehmen Bescheid wusste. Anders wäre die Durchführung
dieses Attentats nicht möglich gewesen.«
»Sie können sicher sein, dass wirklich niemand darüber
Bescheid wusste«, sagt Madame Montagnola. »Bruno wusste genau,
worum es ging. Ihm war der Ernst der Lage bewusst, und wir haben
alle Eventualitäten miteinander besprochen – und zwar lange, bevor
er sich schließlich tatsächlich dazu entschied, sich an die FoPoCri
und die Justiz zu wenden.«
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte ich Tony. »Haben Sie mit
jemandem telefoniert? Haben Sie SMS ausgetauscht, Nachrichten in
sozialen Netzwerken hinterlassen?«
»Nein. Mir wurde ja schließlich eingeschärft, dass ich das
nicht tun soll.«
»Es gibt da eine Sache, die wir vielleicht erwähnen sollten«,
meldete sich nun Madame Montagnola zu Wort.
»Jede noch so unbedeutend erscheinende Kleinigkeit kann uns
unter Umständen ein entscheidendes Stück weiterbringen«, sagte ich.
»Es ist nur so – Sie erwähnten doch gerade die Leibwächter,
die mein Mann engagiert hatte.«
»Richtig«, sagte ich, während Madame Montagnola mit ihrem Sohn
einen Blick wechselte. Einen Blick, der beinahe so wirkte, als
würde sie ihren Sohn um Zustimmung dafür bitten, mir von dieser
Sache zu erzählen. Mir fiel auf, dass Tony ihrem Blick
auswich.
»Es gab da einen Mann namens Roland Brique. Mein Mann hat ihm
vertraut wie sonst niemandem. Und als das erste konspirative
Treffen mit einem Ihrer Kollegen stattfand, um die Möglichkeiten
einer Aussage auszuloten, da war Brique in der Nähe.«
»Sie meinen, er hat auch etwas von dem mitbekommen, was da
besprochen wurde?«
Ich nahm mir vor, meinen Kollegen Stéphane Caron danach zu
genauer zu befragen. Stéphane war es nämlich gewesen, der sich
zuerst mit Montagnola getroffen hatte. Und eigentlich hatte es zu
den Absprachen gehört, dass beide allein zum Treffpunkt kamen.
Offenbar hatte Montagnola seinem Leibwächter Roland Brique mehr
vertraut als der Zusage der FoPoCri. Vielleicht ein Fehler.
»Was ist mit diesem Brique?«
»Er war plötzlich verschwunden. Wir wissen bis heute nicht, wo
er ist.«
François sah mich an und verdrehte die Augen. Ich musste mir
äußerste Mühe geben, die Fassung zu bewahren.
»Das hätte man uns sagen müssen«, sagte ich nur.
»Mein Mann wird gute Gründe gehabt haben, es nicht zu sagen«,
gab Madame Montagnola zurück. »Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
In die Art und Weise, wie mein Mann seine Geschäfte geführt hat,
habe ich mich im Übrigen auch nie eingemischt. Und davon abgesehen
bestand durchaus die Möglichkeit, dass Roland Briques Verschwinden
nichts damit zu tun hatte, dass mein Mann Kontakt mit der FoPoCri
aufnahm.«
Ich hob die Augenbrauen.
»Wie meinen Sie das?«, hakte ich nach.
»Nun, Roland Brique hatte ein paar eigene Probleme. Bruno hat
da mal so etwas angedeutet.«
»Genaueres wissen Sie nicht?«
»Du kannst es ihm ruhig sagen«, mischte sich jetzt Tony
Montagnola ein. »Roland wirst du damit nicht mehr schaden können,
denn der liegt wahrscheinlich längst mit einem Betonfuß auf dem
Grund des Meeres oder auf einer Müllhalde.«
»Das weißt du nicht, Tony«, widersprach Madame
Montagnola.
»Jean Watteau wird ihn ausgequetscht und kaltgemacht haben«,
meinte Tony. »Und da hätten Sie dann auch die Erklärung dafür,
wieso meines Vaters Feinde offenbar gut genug Bescheid wussten, um
ihn umzubringen. Er ist ins offene Messer gelaufen.«
Der Name Jean Watteau war mir natürlich ein Begriff. Watteau
war ein großer Hai im Hintergrund. Einer, an den wir normalerweise
nie herangekommen wären, da er andere für sich die Drecksarbeit
machen ließ. Geldwäsche, Drogen, illegale Müllentsorgung und
Waffenhandel. Es gab kaum ein Gebiet des organisierten Verbrechens,
in dem Jean Watteau nicht seine Finger hatte. Allerdings hatte er
es bislang geschafft, seine Weste zumindest rechtlich gesehen
erstaunlich weiß zu halten.
Dass Montagnolas Verbindungen zu Jean Watteau eng waren, war
uns seit Langem bekannt. Und auch wenn Watteau zur Zeit nicht von
einem anstehenden Gerichtsverfahren bedroht wurde, hatte er ganz
sicher befürchten müssen, dass durch Bruno Montagnolas Aussagen
Dinge ans Licht kamen, die selbst ihm gefährlich werden konnten.
Teflon-Mann – so lautete Jean Watteaus Spitzname, weil an ihm alles
abzuperlen schien und die Justiz ihm einfach nichts anhaben konnte.
Aber Bruno Montagnola hatte diesem Zustand vielleicht ein Ende
bereiten können. Und genau deshalb war Watteau natürlich auch
jemand, der sich als möglicher Hintermann des Anschlags an der
Autobahn geradezu aufdrängte.
»Gibt es irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, was Ihre
Vermutung bezüglich Roland Brique betrifft?«, fragte ich an Tony
gewandt.
»Nein, natürlich nicht«, gab Tony mit einem galligen Unterton
zurück. »Jemand wie Jean Watteau wird schon dafür sorgen, dass ihn
niemand mit einem Mord in Verbindung bringen kann.«
»Und was waren das für Probleme, die Brique hatte?«, fragte
ich.
»Angeblich soll Roland vor acht Jahren in den Tod einer jungen
Frau verwickelt gewesen sein«, berichtete Madame Montagnola. »Er
hatte nichts damit zu tun. Aber diese Frau gehörte zu einem Clan,
dessen Mitglieder da wohl anderer Ansicht waren.«
11
Während wir auf dem Rückweg nach Marseille waren, telefonierte
François mit unserem Kollegen Maxime Valois aus der
Fahndungsabteilung. Es ging dabei natürlich um Roland Brique.
Möglicherweise brachte es uns in diesem Fall weiter, wenn wir in
Erfahrung brachten, warum er so plötzlich verschwunden war.
»Ich kann mir nicht helfen, Pierre, aber dieser Tony kam mir
reichlich eigenartig vor.«
»Ein verwirrter Junge, der kurz vor seinem Schulabschluss
steht und aus seinem Leben gerissen wird, weil sein Vater das so
beschlossen hat«, sagte ich. »Ich kann mir schon vorstellen, dass
das nicht besonders angenehm ist.«
»Wobei man wohl erwähnen muss, dass seinem Vater kaum eine
andere Wahl blieb, Pierre.«
»Wenn man voraussetzt, dass er weder von seinen ehemaligen
Geschäftsfreunden umgebracht werden wollte, noch besonders Lust
dazu hatte, die nächsten Jahrzehnte auf Gefängnis zu
verbringen.«
»Trotzdem – der Junge kam mir eigenartig vor, und ich weiß
nicht, ob diese zugegebenermaßen sehr angespannte Gesamtsituation
wirklich erklären kann, was ich da wahrgenommen habe.«
»Du meinst, dass der Junge etwas mit der Sache zu tun hat?
François, das ist …«
»Absurd?«
»Genau das wollte ich gerade sagen.«
»Nein, Pierre, das ist alles andere als absurd.«
»Dann hilf doch bitte mal deinem begriffsstutzigen
Dienstpartner auf die Sprünge, François. Ich habe wohl registriert,
dass er sehr zornig war. Aber ich sagte ja schon, dass ich dafür
ein gewisses Maß an Verständnis habe.«
François unterdrückte ein Gähnen. Man merkte uns beiden
langsam an, dass es ein langer, ziemlich anstrengender Tag gewesen
war. Ein Tag, der ziemlich nervenaufreibend gewesen war. So
nervenaufreibend, dass wir wohl beide heute ein paar Jahre gealtert
waren. Zumindest bildete ich mir das ein.
»Ich weiß nicht, ob ich da ganz falsch liege, Pierre. Aber wir
sollten uns schlicht und ergreifend mal fragen, wem der Tod von
Bruno Montagnola eigentlich am meisten nützt.«
»Leider sehr vielen«, gab ich zurück.
»Natürlich drängen sich Montagnolas ehemalige Partner bei
seinen krummen Geschäften in dieser Hinsicht am meisten auf. Aber
die eigene Familie können wir dabei eigentlich nicht einfach von
vornherein aus dem Blick lassen, finde ich.«
»Du meinst, auch die Witwe und den Sohn?«, fragte ich
skeptisch.
»Du hast doch gesehen, wie wenig begeistert Tony von der Idee
seines Vaters gewesen zu sein scheint, mit den Behörden
zusammenzuarbeiten. Und für ihn ändert sich nicht nur, dass er
seinen Schulabschluss woanders machen wird und seine Freunde
verliert.«
Ich begriff, was François meinte. Er brauchte es nicht weiter
auszuführen. In ein paar Jahren hätte Tony vielleicht die
lukrativen Geschäfte seines Vaters übernehmen können. Er wäre ein
reicher Mann gewesen, ohne zunächst einmal selbst viel dafür tun zu
müssen. Diese Aussicht war jetzt natürlich gründlich verbaut. Zwar
war nicht anzunehmen, dass Bruno Montagnola seinen Start in ein
neues Leben vollkommen ohne Rücklagen geplant hatte – aber trotzdem
würde sich der Unterschied deutlich bemerkbar machen.
Trotzdem, ich glaubte nicht, dass das ein ausreichendes Motiv
für Tony war, eventuell mit den Feinden seines Vaters
zusammenzuarbeiten.
Ausschließen konnte man es auf der anderen Seite jedoch auch
nicht.
12
Es war bereits ziemlich spät, als wir uns in Monsieur Marteaus
Besprechungszimmer einfanden. Der Chef des Polizeipräsidiums
Marseille erwartete uns mit einem sehr ernsten Gesicht.
»Henri Lambert wird an Stelle von Bruno Montagnola aussagen.
Die Staatsanwaltschaft will ihm ein Angebot machen. Aber das wird
uns Bruno Montagnola natürlich nicht ersetzen können.«
»Dann steht Henri Lambert in meinen Augen von jetzt an ganz
oben auf die Liste derjenigen, die hinter dem Anschlag stecken
könnten«, meinte ich.
»Genau das war auch mein erster Gedanke«, stimmte Monsieur
Marteau mir zu. »Schließlich hätte Lambert wohl kaum auf einen Deal
hoffen können, wie mir selbst der Staatsanwalt bestätigt hat. Jetzt
allerdings, da man auf ihn angewiesen ist, werden die Karten
natürlich völlig neu gemischt.«
»Dann kann Henri Lambert damit rechnen, ziemlich günstig
davonzukommen«, glaubte ich. »Vor allem würde mich interessieren,
wie er so früh davon wissen konnte.«
»Ich schlage vor, Sie stellen ihm die Frage selbst«, schlug
Monsieur Marteau vor. »Ich habe morgen früh einen Termin
arrangiert, zu dem Sie ihn im Gefängnis treffen können.«
»Hauptsache, er lässt nicht nur seinen Anwalt reden«, meinte
François.
Als wir das Büro von Monsieur Marteau verließen, trafen wir
noch Maxime Valois auf dem Flur.
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr noch hier seid«,
sagte er.
Ich hob die Augenbrauen.
»Gibt es was Neues?«
»Ich kann euch das auch morgen früh beim Meeting
erzählen.«
»Nein, nein, ich will das jetzt hören«, meinte ich. Und ich
wusste, dass ich da auch für François sprach.
Das, was sich an der Autobahn abgespielt hatte, würde mich
sowieso in die Nacht verfolgen. Wenn man so etwas erlebt hat, kann
man nicht einfach abschalten und ein paar Stunden später so tun,
als würde man nur irgendeinen Job machen, in dem es einen
geregelten Feierabend gibt.
»Ich habe über Roland Brique einiges gefunden«, sagte Maxime.
»Es ist nach wie vor nicht klar, ob er mit dem Tod dieser Frau
etwas zu tun hat. Im Prozess konnte ihm nichts bewiesen werden, und
er hatte anscheinend auch ein Alibi für die Tatzeit. Nur hat ihm
das ein Clubbesitzer gegeben, für den Brique lange gearbeitet hat.
Könnte sein, dass das nur ein Gefälligkeitsalibi gewesen ist.
Zumindest ist das die Auffassung des Kollegen von der
Mordkommission, mit dem ich dazu telefoniert habe.«
»Gibt es irgendeine Spur von ihm?«, fragte ich.
»Pierre, wo denkst du hin! Wir können keine Wunder
vollbringen. So schnell geht das nicht. Nur eins steht fest: Die
Sache mit der toten Frau hat mit seinem Verschwinden sicher nichts
zu tun.«
»Wieso?«