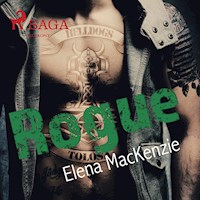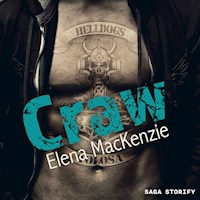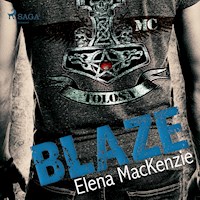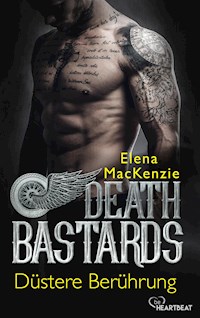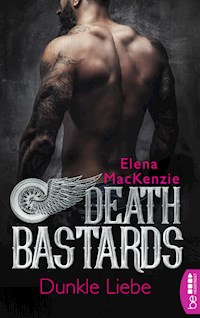5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romance Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es war einmal eine Schneekugel und ein Prinz, gefangen in einem schwarzen Palast Lenka ist fasziniert von der Schneekugel, die ihre Freundin ihr geschenkt hat. Sie könnte sich ewig den schwarzen Palast mit den bunten Glasfenstern darin ansehen. Als ihr die schwere Kugel aus den Händen rutscht, setzt sie ihre Gabe ein, um Schlimmeres zu verhindern. Etwas im Inneren der Schneekugel wird aktiviert und zieht Lenka in einen wahren Albtraum aus Feuer, Dämonen und dem Prinzen der Hölle. Marek ist seit mehr als hundert Jahren in Infernis gefangen. Eine Welt, die geschaffen wurde, um ihn zu bestrafen. Jeder neue Tag beginnt mit seinem Tod. Im Laufe der Zeit ist Marek schon auf unzählige Arten gestorben. Nichts kann den Fluch, den die Rote Königin über ihn gelegt hat, brechen. Als Lenka nach Infernis kommt, hofft Marek, dass sie ihn befreien kann. Und dafür würde er alles tun: Sie betrügen, sie belügen, ihr sogar den Thron überlassen. Nur Lieben, das kann er nicht. Ein magisch düsterer Roman über eine junge Hexe, die an ihren Herausforderungen wächst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Throne Of Fire
ELENA MACKENZIE
Inhalt
Über dieses Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Danksagung
1. Auflage 2024
Copyright: Elena MacKenzie
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Elena MacKenzie
unter Verwendung von
Bildmaterial von Adobe Photostock:
Dinaaf, Polygraphus, Andreas.
Innengestaltung: Elena MacKenzie unter
Verwendung von Bildmaterial von Adobe Photostock:
Christine Krahl.
Mapdesign: Elena MacKenzie
Kontakt: Elena MacKenzie
Dr.-Karl-Gelbke-Str. 16
08529 Plauen
Über dieses Buch
Es war einmal eine Schneekugel und ein Prinz, gefangen in einem schwarzen Palast …
Lenka ist fasziniert von der Schneekugel, die ihre Freundin ihr geschenkt hat. Sie könnte sich ewig den schwarzen Palast mit den bunten Glasfenstern darin ansehen. Als ihr die schwere Kugel aus den Händen rutscht, setzt sie ihre Gabe ein, um Schlimmeres zu verhindern. Etwas im Inneren der Schneekugel wird aktiviert und zieht Lenka in einen wahren Albtraum aus Feuer, Dämonen und dem Prinzen der Hölle.
Marek ist seit mehr als hundert Jahren in Infernis gefangen. Eine Welt, die geschaffen wurde, um ihn zu bestrafen. Jeder neue Tag beginnt mit seinem Tod. Im Laufe der Zeit ist Marek schon auf unzählige Arten gestorben. Nichts kann den Fluch, den die Rote Königin über ihn gelegt hat, brechen. Als Lenka nach Infernis kommt, hofft Marek, dass sie ihn befreien kann. Und dafür würde er alles tun: Sie betrügen, sie belügen, ihr sogar den Thron überlassen. Nur Lieben, das kann er nicht.
Ein magisch düsterer Roman über eine junge Hexe, die an ihren Herausforderungen wächst.
Für Shnaly
Prostor a čas,
Magie osvobozuje,
Vědomí je moc,
ve dne i v noci.
1
Der kleine Antiquitätenladen meiner Freundin befand sich in der Peroutkova Straße, ganz in der Nähe der Karlsbrücke. Die schönsten Dekostücke für mein Steinhäuschen fand ich hier. Meistens kam ich aber hierher, wenn mir nach einer guten Tasse Tee und einem netten Gespräch zumute war. Oder wie heute nach einem Besuch in meiner alten Trainingshalle, die gleich um die Ecke lag.
Nadja war nach meinem Onkel Karel der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie verstand und unterstützte mich. Sie kannte mein Geheimnis, weswegen ich es vor ihr nicht verbergen musste. Außer vor ihr musste ich meine Gabe vor jedem verbergen. Nicht einmal vor meinem Vater hatte ich sie anwenden dürfen. Wenn er es herausfand, wurde er wütend und bestrafte mich, indem er mich in mein Zimmer schickte und mir seine Liebe entzog. Es hatte mich als Kind frustriert und zornig gemacht, dass er mich zwang, einen Teil von mir zu verstecken, der mich mit meiner Mutter verband. Erst als ich älter wurde, begann ich zu verstehen, warum es wichtig war, meine Fähigkeiten vor anderen Menschen zu verstecken.
Ich war vier Jahre alt, als mir meine Mutter genommen wurde. Da wollte ich nicht auch noch das aufgeben müssen, was sie unsere wundervolle Gabe genannt hatte. Ich hatte nicht gewusst, wie ich mit der Frustration und Wut umgehen sollte, die ich darüber empfand. Bis Onkel Karel, der Bruder meines Vaters, mich eines Tages mit in sein Sportstudio genommen und mir gezeigt hatte, wie ich mithilfe meiner Fäuste loslassen konnte. Ich war sieben Jahre alt, als ich Kickboxen für mich entdeckte. Seit einem Jahr unterrichtete ich selbst Kinder im Gym meines Onkels, diese Arbeit bedeutete mir viel.
Beim Betreten des Ladens atmete ich den Duft nach altem Holz ein, und das Glöckchen über der Tür kündigte mein Kommen an. Nadja hatte mich bereits entdeckt und begrüßte mich mit einem strahlenden Grinsen. Ich schloss die Tür, verdrehte die Augen und stöhnte übertrieben. Mein Gesicht nahm den Ausdruck einer jungen Katze an, die gerade in einer Pfütze voll schmutzigen Straßenwassers gelandet war.
»Du siehst aus, als könntest du eine Tasse Tee gebrauchen, Lenka. Was ist passiert?«, wollte sie wissen. Der Duft nach Kräutern, Duftkerzen und altem Kram stieg in meine Nase und ließ mich sofort etwas besser fühlen.
»Die Stadt will die Unterstützung für die Kinder einstellen. Ich war den ganzen Tag unterwegs und habe versucht, Politiker zu überzeugen oder Sponsoren zu finden«, antwortete ich, trat zum Verkaufstresen und deutete auf den Wasserkocher. Ich ließ meine Sporttasche auf den Boden fallen. »Wieso sparen Politiker immer zuerst an den ärmsten unserer Gesellschaft, denen, die sich am wenigsten wehren können?«
»Weil Kinder keine Kreuze auf Wahlzettel setzen dürfen.«
»Eine Tasse von deinem Kräutertee wäre jetzt gut.« Ich atmete ein weiteres Mal schwer aus und fuhr mir über die kalten Wangen, in die der bereits frostige Oktober gebissen hatte. »Das ist ein schwerer Schlag für das Gym, wir brauchen das Geld dringend, um uns über Wasser zu halten. Die Sache hat mich so frustriert, dass ich ein paar Pfeile verschießen musste.« Mit zehn Jahren hielt ich auf einem Mittelalterfest auf der Prager Burg das erste Mal einen Bogen in den Händen und verliebte mich in das Gefühl, das mich überkam, wenn ein Pfeil in einer perfekten Bahn sein Ziel traf. Meine Nachmittage hatte ich seit diesem Tag entweder im Sportstudio oder mit dem Bogen in der Halle verbracht. Meine Fertigkeiten mit dem Bogen waren so gut, dass ich kurz vor der Auswahl für die Weltmeisterschaft stand, als mein Vater einen Herzstillstand erlitt und ich auch ihn verlor. Ich vergrub meinen Bogen in den Tiefen meiner Schränke und gab den Profisport auf, für den ich bis dahin so hart gearbeitet hatte. Nur manchmal griff ich noch zum Bogen und trainierte ein wenig in der Halle und ließ mich von meiner Sentimentalität treiben.
»Hast du dir ein paar Politikergesichter vorgestellt?«
»Das kannst du glauben«, gestand ich. »Es ist nicht nur, dass wir das Geld brauchen, es geht dabei auch um die Kinder. Wo sollen sie sonst hin? Ich weiß nicht, ob wir es ohne den Zuschuss der Stadt schaffen werden.«
»Hast du schon Vereine oder Geschäfte gefragt? Ich könnte euch unterstützen.« Nadja kniff die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. »Zumindest ein wenig.«
»Das geht nicht, du kannst den Laden kaum über Wasser halten«, wehrte ich ihr Angebot ab. Ich versuchte mit einem Lächeln die Stimmung davor zu retten, in den Keller zu sacken. Schließlich war ich nicht hier, um noch mehr meiner Sorgen auf Nadjas Schultern abzuladen. »Ich werde nächste Woche eben noch ein paar Türklinken putzen müssen. Und ich werde Onkel Karel davon überzeugen müssen, mehr Werbung zu machen, auch wenn er es hasst, sich ›anzubiedern‹.« Ich setzte das Wort, das mein Onkel mir immer schaudernd entgegenspuckte, wenn ich ihm vorschlug, Flyer drucken zu lassen, in Anführungsstriche.
»Da wird er wohl durch müssen. Sag ihm einfach, dass ihr kaum eine andere Wahl habt und sogar ich hin und wieder Flyer drucken lasse.« Sie wandte sich dem Wasserkocher zu. Nadja mischte ihre Kräutertees am liebsten selbst. In einer Ecke ihres Ladens verkaufte sie verschiedene Teemischungen, Kerzen mit Düften und Aromatherapieöle, die sie selbst herstellte. Sie kannte sich hervorragend mit der Wirkung verschiedenster Heilpflanzen aus. Ich bewunderte sie für ihr Interesse an Pflanzen. Allerdings konnte ich mit Pflanzen überhaupt nichts anfangen, nicht einmal dann, wenn Nadja eine ihrer langen Reden über Kamille, Weißdorn oder Frauenmantel hielt. Diese Informationen gingen bei mir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Nichts, wirklich kein bisschen, blieb dazwischen hängen.
»Heute etwas Entspannendes für dich«, sagte sie, als sie zwei Tassen mit würzig duftendem Tee vor uns auf den Tresen stellte. Ich zog mir den Barhocker heran, den sie wahrscheinlich nur für mich hier im Geschäft platziert hatte, und setzte mich.
»Und wie lief das Schießen?«, hakte sie nach, während wir beide an unseren Tassen nippten. Nadja löste ihren Haargummi und band ihre blonden Locken in einem neuen Zopf wieder zurück. Zusammen mit ihren unzähligen Sommersprossen im Gesicht sah sie nicht nur attraktiv, sondern auch besonders aus. Es gab niemanden, der nicht einen zweiten oder dritten Blick wagte, wenn er ihr zum ersten Mal begegnete. Selbst meine kupferrote Lockenmähne konnte da nicht mithalten. Die Leute betrachteten mich nicht auf dieselbe verzückte Art wie meine Freundin. Ich war weder süß noch hübsch, eher ein wenig schroff, mit Ecken und Kanten und einem gut durchtrainiertem Oberkörper vom Sport.
»Gut.« Ich blickte mich um; überall standen Kisten auf dem Boden. »Hast du neue Ware bekommen?« Nadja liebte Trödelmärkte, viele Artikel in ihren Regalen stammten von Trödelhändlern. Dafür fuhr sie bis nach Karlovy Vary, Bratislava, Wien oder Dresden. Manches entdeckte sie in Annoncen oder im Internet, aber die schönsten Stücke fand sie bei Wohnungsauflösungen. Anfangs hatte sie deswegen immer ein schlechtes Gewissen. Sie war fest davon überzeugt, sich mit schlechtem Karma zu beladen, weil sie sich an den Erinnerungen bereicherte, die verstorbene Menschen ihr Leben lang angeschafft hatten. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie diese Gedanken abgelegt und es als ihre Aufgabe gesehen hatte, diese Dinge zu erhalten und weiterzugeben.
»Das meiste ist Weihnachtsdekoration. Es sind ein paar hübsche Stücke darunter. Aber die Voraussetzung war, alles mitzunehmen. Der Erbe lebt im Ausland und musste die Räumung des Hauses von Taiwan aus dirigieren. Und es war direkt um die Ecke. Also dachte ich, es ist Oktober, warum nicht dieses Jahr den Laden etwas weihnachtlicher schmücken als sonst?«
Ich rieb meine Hände aneinander. »Und es kribbelt in meinen Händen. Ich will in diese Kisten gucken.«
Nadja warf einen Blick auf die große goldene Uhr, die über der Eingangstür hing. »Ich schließe gleich, wenn du Lust hast, dann könnten wir gemeinsam dekorieren.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Um ehrlich zu sein, habe ich gehofft, dass du mir hilfst. Du weißt, ich beneide dich für dein Auge fürs Detail, Dekoqueen. Bei mir wirkt alles immer ein wenig schmuddelig und unkoordiniert. Ich weiß gar nicht, warum meine Eltern geglaubt haben, mir einen solchen Laden anzuvertrauen, wäre eine gute Idee.« Das sagte Nadja immer wieder, aber gerade ihr kleines Chaos verlieh dem Laden seinen Charme und verleitete die Kunden zum Stöbern. Das hatte ich ihr schon so oft gesagt, aber sie wollte mir nicht glauben.
»Dekoqueen«, spuckte ich entsetzt aus. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht«, wehrte ich mich. Aber ich musste mir doch eingestehen, dass es genau so schlimm war. Ich beschenkte regelmäßig meine Follower auf Instagram mit einem Blick in mein Traumhäuschen. Die meisten folgten mir nicht, weil ich bis vor ein paar Jahren noch recht erfolgreiche Profischützin war, sie folgten mir, um sich Inspiration für ihr eigenes Zuhause zu holen. Aber ich dekorierte vor allem, weil es mich entspannte. Entspannung war wichtig, um meine Emotionen zu kontrollieren. Und ich brauchte Kontrolle über meine Emotionen, um meine Gabe im Griff zu behalten. Es passierte mir oft genug, dass ich meine Fähigkeit einsetzte, ohne darüber nachzudenken. Rein aus einem Reflex heraus. Noch schlimmer wurde es, wenn ich wütend war; dann verleitete mich das dazu, mir Luft oder einen Vorteil zu verschaffen, indem ich meine Gabe einsetzte. Ich tat es, obwohl ich wusste, welche schlimmen Konsequenzen das haben konnte.
Ich ging zur Tür, drehte das Schild in dem kleinen Fenster um und schloss ab. Nadja bereitete noch eine weitere Tasse Tee zu für uns, und während wir ihn tranken, setzten wir uns mitten im Laden auf den Boden, die Kisten in einem Kreis um uns herum, und begannen, uns durch sie hindurch zu stöbern. Es gab zwei Kisten mit Baumbehang, dessen Alter Nadja auf hundert Jahre schätzte. In einer Kiste befanden sich mehrere Spieluhren, deren Bemalung verblasst war. Und in einer anderen Kiste befanden sich Schneekugeln, die sehr detailliert gearbeitet waren, mit Schlitten darin, kleinen Häusern oder Rentieren. Es gab Spitzendeckchen und Ornamente aus Holz, Nussknacker und Walnussschalen, in die winzig kleine Welten gebaut waren.
»Diese hier ist gruselig, so düster«, kommentierte Nadja eine große Schneekugel. Sie betrachtete sie und verzog ihre Lippen zu schmalen Strichen, als sie sie hin und her bewegte, um ihr Inneres besser erkennen zu können. Aber je mehr sie die Kugel hin und her bewegte, desto mehr roter Sand stieg im Wasser auf und verdeckte den Blick auf das, was ein schwarzer Palast mit unzähligen Türmen zu sein schien. »Die ist nicht sehr weihnachtlich.«
Ich griff nach der Schneekugel, als Nadja sie an mich weiterreichte. Sie war sehr schwer. Viel schwerer als die anderen Schneekugeln. Ihr Sockel war aus schmutzig dunklem Gold, der Glaskörper gut so groß wie eine Honigmelone. Ich hielt sie ganz ruhig und wartete darauf, dass der Sand sich langsam wieder auf dem Boden absetzte. Er war so fein, dass er regelrecht im Wasser waberte, fast wie roter Nebel. Aber nach und nach trat der Palast aus diesem Dunst hervor. Nadja hatte recht, diese Schneekugel war weder weihnachtlich noch besonders schön. Aber das musste sie auch nicht sein, sie faszinierte mich mit ihrer detaillierten Arbeit. Die Burg war im gotischen Stil gestaltet, mit vielen Säulen und Spitzbögen. In den winzigen Fenstern konnte man Buntglas erkennen und unter den Dachgiebeln saßen Wasserspeier.
»Als hätte jemand den Veitsdom schwarz angemalt und geschrumpft«, flüsterte ich beeindruckt. Der Veitsdom war die gotische Kathedrale in der Mitte der Prager Burg, die am weitesten zu sehen war. »Eine große Version der kleinen Schneekugeln, die es in den Touristenshops gibt.«
Nadja beugte sich zu mir rüber und warf noch einmal einen Blick in das Innere der Kugel. »Stimmt, sieht aus wie der Veitsdom. Ich mag sie trotzdem nicht. Irgendwie jagt sie mir eine Gänsehaut ein.«
»Mir gefällt die Arbeit, so realistisch. Wie viel Zeit der Künstler in dieses Werk gesteckt haben muss. Ich kaufe sie.« Ich drückte die Kugel gegen meine Brust. »Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Ich habe vielleicht keine Ahnung von Kunst, aber mein Gefühl sagt mir, dass das hier eine sehr aufwendige Arbeit ist. Und zu Halloween wird sie perfekt in meinem Wohnzimmerfenster aussehen.«
»Ich schenke sie dir.«
»Tust du nicht. Du kannst mir nicht immer alles schenken. Der Laden ist dein Lebensunterhalt«, protestierte ich. »Ich werde dafür bezahlen.«
»Wie auch immer«, lenkte Nadja ab. Ihr war es schon immer unangenehm, Geld von mir zu nehmen, weswegen wir dieses Gespräch jedes Mal führten, wenn ich etwas in ihrem Laden fand, das mir gefiel. Am Ende nahm sie das Geld, weil ich ihr gar keine Wahl ließ und fluchtartig den Laden verließ, nachdem ich ihr das Geld auf den Tresen gelegt hatte. »Das war die letzte Kiste, wir haben alles ausgepackt, jetzt müssen wir es in den Regalen platzieren. Ich werde morgen an alles ein Preisschild kleben, damit die Kunden wissen, dass der Kram nicht nur Deko ist. Spätestens wenn der Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring endet, will ich dieses Zeug auch wieder los sein. Oder denkst du, es ist noch zu früh?«
»Ist es nicht. In ein paar Tagen ist Halloween, spätestens danach wird jeder anfangen, sich nach Weihnachtsdeko umzusehen.« Ich ließ die Schneekugel auf dem Boden stehen, kämpfte mich aus dem Schneidersitz und drehte mich einmal um mich selbst. Mit leicht zusammengekniffenen Augen musterte ich den Verkaufsraum und entschied, wo was am besten seine Wirkung entfalten konnte. Die schönsten Stücke platzierten wir in das Regal gleich neben der Eingangstür und im Schaufenster. Ein paar besondere Figuren und eine der detailreicheren Schneekugeln stellte ich auf den Verkaufstresen.
Um ein Deckenkarussel aus Holz richtig zur Geltung bringen zu können, schnappte ich mir die Holzleiter aus Nadjas kleinem Lager, kletterte nach oben und bat meine Freundin, mir das Karussell mit den Schlitten, Pferden und kleinen Kobolden nach oben zu reichen.
Nadja kämpfte mit dem Gewicht und damit, dass die Fäden, an denen sich die Figuren um den Mittelpunkt des Karussells drehten, nicht verhedderten, als sie es nach oben über ihren Kopf reichte. Ich wollte gerade nach der goldenen Öse in der rot-weiß gestreiften Spitze greifen, als das Karussell aus Nadjas Händen glitt. Es wäre ihr auf das Gesicht gefallen, wenn ich nicht sofort die Hand gehoben, mit den Fingern geschnippt und die Zeit angehalten hätte. Alles um mich herum erstarrte. Der Sekundenzeiger der Uhr über der Tür, das Karussell, das wie eingefroren in der Luft direkt über Nadjas Gesicht schwebte. Und auch Nadja selbst. Sie blinzelte nicht, sie atmete nicht. Wenn ich jetzt ihren Puls ertasten würde, wäre unter ihrer Haut nichts als Stille. Als wäre sie tot. Ich warf einen flüchtigen Blick auf die Straße durch das große Schaufenster, aber vor dem Laden war zum Glück niemand unterwegs. Meine Gabe hatte nur einen Wirkungskreis von ein paar Metern, deswegen musste ich besonders in der Öffentlichkeit vorsichtig sein. Ich schob das schlechte Gewissen beiseite, das mich immer befiel, wenn ich die Zeit anhielt. »Niemand hat etwas gesehen, Papa, hörst du?«
Ich zupfte das Karussell an seiner Öse aus der Luft, hängte es über mir an die Decke, und als ich damit fertig war, löste sich die Zeit auch schon wieder aus der Starre. Nadja blinzelte, sah das Karussell hängen und warf mir einen ermahnenden Blick zu.
»Es hätte dich erschlagen«, konterte ich entschuldigend.
»Besser dieses Teil hätte mir ein blaues Auge verpasst, als jemand dort draußen hätte gesehen, dass hier drinnen alles erstarrt ist.«
»Dieses Ding ist so schwer, du wärst mit Sicherheit nicht nur mit einem blauen Auge davongekommen.« Ich nickte mit dem Kinn zum großen Ladenfenster. »Und dort draußen war niemand, der etwas hätte sehen können. Und ohnehin habe ich einfach nur reagiert. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, ob ich dich retten will oder nicht. Du weißt, wie das funktioniert, manchmal tue ich es einfach.« Immerhin habe ich nur die Zeit angehalten und nicht die Sprinkleranlage ausgelöst, eine Fensterscheibe zerspringen lassen oder mein Bett angezündet. All das war mir passiert, als ich noch ein Kind war. Bevor Onkel Karel mir geholfen hatte, meine Gefühle zu kontrollieren. Und bevor mein Vater begonnen hatte, mich für jedes Mal, wenn ich meine Gabe nutzte – ob gewollt oder nicht – zu bestrafen, indem er mich einsperrte oder mich für Tage nicht beachtete. Diese gefährliche Seite meiner Gabe hatte ich gelernt, tief zu vergraben. So tief, dass sie verschwunden war. Nur die Zeit, die konnte ich noch immer anhalten.
Nadja holte Luft. »Schon gut. Ich höre nur jedes Mal die Stimme deines Vaters, wie er dich belehrt. Du weißt schon … wegen deiner Mutter. Ich will nicht, dass dir das auch passiert.«
Ich stieg von der Leiter. »Das will ich auch nicht. Aber, wenn ich dich retten muss, dann sind mir die Konsequenzen egal.« Ich schlang meine Arme um Nadjas Hals und zog sie an mich. »Mir muss nicht passieren, was ihr passiert ist. Auch wenn mein Vater das immer geglaubt hat.« Ich schob die Schuldgefühle, die mit der Erinnerung an meinen Vater kamen, zurück. Mein Vater und ich hatten kein gutes Verhältnis. Für mich war Onkel Karel immer mehr mein Vater gewesen als er. Was wahrscheinlich daran lag, dass es sich bei seiner Sorge um mich, wirklich um mich drehte. Während mein Vater nie verstecken konnte, dass er mir den Tod meiner Mutter nicht verzeihen konnte.
Nadja erwiderte meine Umarmung. »Danke. Und weil du mich gerettet hast, schulde ich dir etwas. Nimm diese hässliche Schneekugel mit. Sie macht mir Angst. Siehst du die Gänsehaut auf meiner Haut?« Sie hielt mir ihren Arm unter die Nase, auf dem die feinen Härchen sich aufgerichtet hatten.
»Die kommt nicht von der Schneekugel, sondern von der Magie.« Ich bewegte meine Finger in der Luft über ihrem Arm und ließ die Reste meiner Magie knistern. Ich wusste nicht, wie genau das alles funktionierte. Der einzige Mensch, der in der Lage gewesen wäre, mir meine Fähigkeiten zu erklären, war meine Mutter. Sie war gestorben, bevor ich alt genug war, Fragen stellen zu können. Aber sie hatte es immer unsere Gabe genannt. Mein Vater hatte es unser Geheimnis oder einen Fluch genannt. Und Nadja nannte es Magie. Ich selbst war mir noch nie sicher, wie ich es nennen wollte. Magie, Geheimnis, Gabe oder gar Fluch. Irgendwie war es von allem etwas. Egal, wie sehr ich nach einer Antwort gesucht hatte, ich kannte niemanden sonst, der Ähnliches konnte wie meine Mutter oder ich. Aber ich hatte auch zu große Angst davor, nach Antworten zu suchen. Ich wollte keine schlafenden Hunde wecken, davor hatte mein Vater mich immer gewarnt. Und er hatte allen Grund dazu.
2
Ich besaß kein eigenes Auto, weswegen Nadja mich, meine Sporttasche und die Schneekugel nach Hause fuhr. Hier in der kleinen Kopfsteinpflastergasse gab es keine Möglichkeit zu parken, weswegen ich gern auf ein eigenes Auto verzichtete. Die Gasse war gerade breit genug für ein Auto, weswegen sie auch nur in einer Richtung befahrbar war. Auf der anderen Seite der Häuserreihe befand sich der Čertovka-Kanal. Wenn ich aus meinem Schlafzimmerfenster schaute, konnte ich die Boote auf dem Wasser vorbeifahren sehen. Den kleinen Keller konnte ich deswegen gar nicht nutzen, weil er immer modrig und feucht war. Aber der Charme des alten Gebäudes machte alle Nachteile wieder wett.
Nadja schüttelte lächelnd den Kopf. Sie musterte die Dekoration der Fenster, die fast so hoch waren wie das Häuschen selber. Auf den Stufen zur Eingangstür stand ein Kürbis, eine bunte Blättergirlande umrahmte den Türrahmen und an der Tür hing eine auf einem Besen fliegende Hexe mit schwarzen zotteligen Haaren und einer fetten Warze auf der langen Nase.
»Wenigstens wird diese gruselige Schneekugel gut zu deinen merkwürdigen Masken passen. Was sind das für Dinger?« Sie deutete auf meine beiden Fenster, vor denen oft Touristen standen, um Fotos zu machen, getrieben von der gleichen Faszination für das kleine, dreihundert Jahre alte Haus, die mich dazu gebracht hatte, es zu kaufen.
»Das sind bemalte Gipsabdrücke von meinem Gesicht. Ein Insta-Tutorial. Ich fand die Idee gut. Ist mir nicht so gelungen. Aber es ist Halloween. Diese Dinger müssen nicht hübsch sein«, verteidigte ich meine missglückte Bastelarbeit. »Sie sollen erschrecken, und das tun sie.«
Nadja nickte zurückhaltend. An ihrer verkniffenen Miene konnte ich erkennen, dass sie gegen ein Lachen ankämpfte. Das Lachen brach aus ihr heraus, als sie sich mir zuwandte und sie meine hochgezogenen Augenbrauen bemerkte. »Tut mir leid, aber es ist nicht zu erkennen, was diese Masken darstellen sollen.«
»Einen Werwolf und einen Teufel«, erklärte ich grinsend. »Eigentlich kann man sie nur an ihrer Farbe unterscheiden.«
»Ich kann nicht glauben, dass du die in deinen Fenstern hängen hast.«
»Wieso?«, hakte ich nach. Ich wollte Nadja nicht ohne eine Erklärung davonkommen lassen, gerade, weil sie sich wand wie ein Fisch, der auf dem Trockenen lag. Sie wollte nie etwas sagen, womit sie andere verletzen könnte, deswegen verkniff sie sich meist jegliche Kritik. Aber ich fand, an Kritik konnten wir wachsen, weswegen sie wichtig war. Deswegen forderte ich Nadja immer wieder heraus, ehrlich zu sein und sich nicht dafür zu schämen.
»Sie sind …« Nadja wedelte nervös mit der Hand und suchte nach Worten, von denen sie hoffte, dass sie mich nicht verletzen würden.
»Raus damit, egal, was du sagst, du wirst mir damit nicht wehtun. Versprochen.«
»Es ist ein Stilbruch, im Vergleich mit deinem sonstigen Talent zu dekorieren. Du hast eigentlich einen unfehlbaren Geschmack. Ja, das ist es. Ein Stilbruch«, stotterte sie. Sie hatte recht. Die Masken waren scheußlich und sie passten überhaupt nicht zur restlichen Dekoration. Ich hatte sie nur aus Trotz aufgehängt, weil ich mir so viel Mühe damit gemacht hatte. Ich wollte das Geld für die Materialien nicht umsonst ausgegeben haben. Denn ich war geizig. Also mussten die Masken ihren Zweck erfüllen, bevor sie im Müll landeten. »Und deswegen ist es irgendwie schon wieder gut, obwohl sie wirklich hässlich sind.«
»Ich steige jetzt aus«, sagte ich entschlossen. »Und nur, damit du es weißt, ich finde sie hübsch. Wie du siehst, bin ich nicht die Dekoqueen, für die du mich hältst. Ich schaffe es manchmal auch, geschmacklich danebenzuliegen.« Ich grinste breit. »Ich hab dich lieb.«
»Du findest auch das Ding in dieser Kiste hübsch«, bestätigte Nadja lachend.
»Weil das Ding in der Kiste hübsch ist.« Anders als die Masken. »Du kannst jetzt aufhören, dich zu winden. Du hast recht, das nächste Mal verzichte ich darauf, selbst zu basteln. In diesen Videos sieht alles immer so einfach aus. Aber es ist nie einfach.«
»Sehen wir uns am Wochenende?«
»Ich weiß noch nicht, ich melde mich bei dir. Ich lese gerade dieses wirklich dicke Buch. Vielleicht mache ich es mir einfach auf meinem Sofa bequem, trinke eine deiner Teemischungen, werfe mir eine Decke über die Beine und mache gar nichts. Vor allem nicht basteln.«
»Wenn es dir nicht gutgeht …«, warf Nadja mit besorgtem Blick ein und ich unterbrach sie, bevor sie weitersprechen konnte.
»Es geht mir gut. Das mit dem Gym bekommen wir hin. Und wir werden auch einen Weg finden, die Kinder weiter zu trainieren.«
Nadja legte mir ihre Hand auf den Unterarm. »Ich hab dich auch lieb. Und jetzt raus aus meinem Auto, bevor ich einen Strafzettel bekomme, weil ich in einer Parkverbotszone parke.«
Ich hievte den Karton hoch, drückte ihn gegen meine Brust und stieg aus dem kleinen Ford aus. »Ich rufe dich an«, rief ich in das Auto hinein, bevor ich die Tür mit meiner Hüfte zuwarf und mit einem breiten Lächeln auf mein Häuschen mit den leicht schiefen Wänden und dem unebenen Dach zuging. Ich stellte den Karton auf der oberen Stufe neben dem Kürbis ab, kramte meinen Schlüssel hervor und winkte Nadja noch einmal, als sie den Motor des Autos startete und losfuhr.
Ich musste den Kopf einziehen, als ich durch die niedrige Tür in mein Haus trat. Alles hier war winzig, beengt und verwinkelt wie in einem Puppenhaus. Aber ich hatte mich sofort in den altmodischen Charme verliebt. Ich stellte die Kiste auf dem Tisch im Wohnzimmer ab, ließ meine Tasche mit dem Bogen und meinen Trainingssachen neben dem Sofa liegen und setzte mich seufzend. Das Kameraequipment, mit dem ich die Einrichtungsfotos für mein Instagram-Profil machte, stand noch immer in der Ecke, in der ich es heute Morgen aufgebaut hatte, um ein paar Bilder des Vintage-Organizers für Garnrollen zu machen, den ich vor ein paar Tagen erstanden hatte.
Die Erschöpfung schwemmte wie eine Welle über mich hinweg, legte sich in meine Muskeln und Knochen. In den vergangenen Tagen hatte ich es mir nicht erlaubt, erschöpft zu sein. Aber jetzt ließ ich es bewusst zu. Ich hatte nach der Nachricht der Stadt herumtelefoniert, versucht, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, die Kinder nicht im Stich zu lassen, hatte mich an Sponsoren gewendet, die uns früher mal unterstützt hatten und hatte versucht, verschiedene Vereine anzufragen, aber war gescheitert. Deswegen war ich heute nochmal unterwegs gewesen, weil ich gehofft hatte, mehr Erfolg verbuchen zu können, wenn ich den Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand.
Ich legte den Kopf in den Nacken, lauschte in die Stille des Hauses und atmete tief durch. Ich beugte mich vor, öffnete den Karton und zerrte die Schneekugel heraus. »Eigentlich bist du gar keine Schneekugel. Es gibt keinen Schnee in dir. Du bist also eine … Sandkugel. Oder Nebelkugel. Oder … wie würdest du dich selbst bezeichnen?« Ich wiegte sie vorsichtig hin und her und wirbelte den roten Sand auf, beobachtete fasziniert, wie er sich im Wasser verteilte, sich an einigen Stellen auf den spitzen Türmen des schwarzen Palastes ablegte. Ich wartete, bis der Sand ganz zu Boden gesunken war und studierte das kunstvoll gefertigte Gebäude. Ich stellte mir vor, wie es im Inneren aussehen würde. Wahrscheinlich wären die Wände blutrot, es würde viele goldene Akzente geben und die Decken wären mit Engeln oder Jagdszenen bemalt. Es würde einen Thronsaal geben, prunkvolle Gemächer, eine altertümliche Küche mit einer Feuerstelle, die groß genug wäre, um sich hineinzustellen. Es bräuchte eine Vielzahl Bediensteter, um einen solchen Palast zu unterhalten. Und der König und die Königin wären wahrscheinlich schon alt und müde von ihrer Herrschaft. So müde wie ich mich gerade fühlte. Oder es war eben doch nur eine Kathedrale mit viel Prunk, unzähligen Sitzreihen und einem vergoldeten Altar.
Mit der Kugel in den Händen stand ich auf und wandte mich den beiden Fenstern zu. Von hinten sahen die Masken einfach nur weiß und verformt aus. Der Gips war noch nicht hart genug gewesen, als ich sie von meinem Gesicht gehoben hatte. Obwohl ich bei der Zweiten einige Minuten länger gewartet hatte, hatte auch sie sich verformt. Die Fenster waren tief in das dicke Mauerwerk eingelassen, sodass die Bänke davor viel Platz boten. Da ich nicht gut mit Pflanzen umgehen konnte, hatte ich mich entschieden, sie den Jahreszeiten entsprechend zu schmücken.
Ich umrundete das Sofa und stolperte über meine Sporttasche. Ich hatte meine eigene Bequemlichkeit vergessen, dabei hatte ich die Tasche gerade vor wenigen Minuten erst abgestellt. Die Schneekugel rutschte aus meinen Händen. Ich stieß einen überraschten Fluch aus und folgte der Flugbahn der Kugel mit den Augen. Es war wie ein Film, der in Zeitlupe ablief. Reflexartig schnippte ich mit Daumen und Zeigefinger, noch bevor ich mit dem Gesicht auf dem orientalischen Bodenkissen landete, auf dem ich oft saß, um zu lesen. Nur eine handbreit über dem Steinboden, blieb die Kugel kopfüber in der Luft hängen.
»Das war knapp«, stieß ich erleichtert aus. Ich kämpfte mich auf die Knie, beugte mich ein Stück vor und griff nach dem Sockel der Kugel. In meinen Fingern knisterte noch die Magie, als ich nach der Schneekugel griff und kleine Funken zwischen mir und dem goldenen Sockel hin und her sprangen. Erschrocken stellte ich die Kugel auf dem Fußboden ab, als diese begann von innen heraus zu glühen, noch bevor ich meine Hände von ihr lösen konnte. Der Sockel wurde heiß, aber ich schaffte es nicht, die Hände wegzunehmen. Es war, als würde eine unsichtbare Kraft es nicht zulassen. Noch immer zuckten elektrische Blitze zwischen meinen Fingern und der Schneekugel hin und her.
Ein Kribbeln arbeitete sich von meinen Fingerspitzen meine Arme hoch, überzog meinen gesamten Körper und richtete jedes feine Härchen auf meiner Haut auf. Das Knistern wurde zu einem Pulsieren. Meine Muskeln schmerzten wie nach einem heftigen Stromschlag. Etwas zog und zerrte an mir. Die Welt um mich herum kippte und löste sich in bunten Wirbeln auf. Der Schrei, den ich ausstieß, wurde von der Dunkelheit verschluckt, in die ich gerissen wurde. Ich fiel. Ich raste einem endlosen Nichts entgegen. Die undurchdringliche Schwärze wich roten Streifen, die an mir vorbeidonnerten, wie die Landschaft in einem Auto, das mit Lichtgeschwindigkeit über die Autobahn raste.
Endlich gelang es mir, den Schrei auszustoßen, der in meiner Kehle saß. Nur um einen Atemzug später in brennende Hitze gespuckt zu werden. Ich landete auf allen Vieren. Meine Finger gruben sich in heißen, roten Sand. So heiß, dass ich meine Hände hochriss und sie hastig an meiner Kleidung abklopfte.
Noch ein Schrei. Er durchdrang mich, gellte in meinen Ohren wider. Aber es war nicht mein Schrei. Meine Augen erfassten zuerst winzige Feuer, die hier und da auf dem dunkelroten Sand züngelten. Ich erhob mich von meinen Knien, drehte mich um mich selbst und begriff nicht, was ich sah. Fontänen aus blauem Feuer schossen um mich herum meterhoch einem blutroten Himmel entgegen. Rinnsale aus Lava durchzogen den Sand. Über meinem Kopf kreisten Vögel, deren Flügel die Spannweite eines Segelflugzeugs hatten. Nein, es waren keine Vögel, denn diese Kreaturen hatten keine Federn. Nur ledrige, schwarze Haut. Und die gellenden Schreie kamen aus ihren Kehlen. Sie sahen aus wie übermenschlich große Fledermäuse. Und dort, nicht weit von mir entfernt, stand ein tiefschwarzer Palast mit Zinnen und bunten Fenstern und spitzen Türmen. Er sah aus wie der Palast in der Schneekugel.
Ich musste mir den Kopf bei meinem Sturz angeschlagen haben. Wahrscheinlich lag ich gerade ohnmächtig auf dem Fußboden im Wohnzimmer meines Hauses, die Schneekugel lag zerborsten neben mir und das Wasser und der Sand bildeten eine Pfütze auf dem grauen Stein.
Eine der Kreaturen stieß einen weiteren Schrei aus und stürzte sich auf mich. Ich hob meine Arme über meinen Kopf, um mich zu schützen, warf mich in den heißen Sand und hoffte, dass ich aufwachte. Schmerz durchfuhr mich, als Krallen durch den Stoff meiner Bluse drangen und die Haut meines Unterarms aufrissen. Ich schrie auf und betete, dass der Schmerz mich aus der Ohnmacht riss. Aber das tat er nicht. Die Kreatur stieg wieder in den feuerroten Himmel auf. Dorthin, wo vier weitere ihre Bahnen zogen. Neben mir schoss eine Feuerfontäne aus dem Sand bis weit nach oben. Nicht hoch genug, um die Kreaturen zu verbrennen. Aber mir wurde klar, dass diese Fontäne gut auch hätte mich verbrennen können.
Ich kämpfte mich auf die Füße. Die dünnen Sohlen meiner Turnschuhe hielten nicht viel von der Hitze ab, aber immerhin hatte ich noch Schuhe an den Füßen. Weil ich zu bequem war, sie abzustreifen, als ich nach Hause kam. Aus dem Himmel schoss eine Kreatur laut kreischend auf mich zu. Ich drückte meine Hand auf den beißenden Schmerz in meinem Arm. Der Stoff der Bluse hatte sich rot verfärbt und hing in Fetzen herunter. Es gab nur einen Ort, der aussah, als könnte er mich vor den geflügelten Monstern und den Feuern schützen: der unheimliche Palast. Also rannte ich los.
Ich übersprang einen Bach aus Lava, wich einer Fontäne aus und setzte über einen spitz aus dem Sand ragenden Felsen. Wie Drachenzähne ragten diese schwarzen, im Schein der Flammen glitzernden Gebilde überall aus dem Sand heraus. Über mir ertönte wieder ein Kreischen. Dieses Mal stürzten drei der Kreaturen auf mich zu. Noch einmal hob ich die Arme und schnippte mit den Fingern. Was ich brauchte, war Zeit, um den Palast zu erreichen. Den einzigen Unterschlupf weit und breit. Die Kreaturen erstarrten in der Luft. Ich beschleunigte meine Schritte und wagte nicht, ausgerechnet jetzt die Fragen zuzulassen, die auf mein Gehirn einhämmerten. Aber ich war erleichtert, dass mich meine Magie in diesem Albtraum nicht im Stich ließ.
Als würden sie sich durch eine Masse festen Puddings arbeiten, lösten sich die Kreaturen aus meinem Zauber und setzten ihren Angriff auf mich fort. Ich schnippte und schnippte, aber erst nach meinem dritten Versuch blieb die Zeit wieder stehen und die Monster erstarrten nur knapp über mir, ihre langen scharfen Klauen schon fast in meinem Haar. Ich musste meine Panik unter Kontrolle bekommen und mich besser konzentrieren, wenn ich nicht zulassen wollte, dass diese Kreaturen mich zerfleischten. Ich duckte mich unter ihnen hinweg und rannte weiter, setzte über ein dünnes Rinnsal aus züngelnden Flammen und hell glühender Lava und erreichte eine teilweise eingebrochene Mauer, die den Palast umgab. Hinter der Mauer ging ich in Deckung, als ich hörte, wie die Schwingen einer der Kreaturen ganz in der Nähe die Luft teilten. Die Kreatur kratzte mit ihren Klauen über den Rand der Mauer, stieg steil wieder nach oben und fauchte vor Frustration.
Sobald sie sich entfernt hatte, sprang ich wieder auf und hielt die Zeit an. Aber mich beschlich das Gefühl, dass die Monster sich jedes Mal schneller aus der Zeitstarre lösten, je häufiger ich meine Fähigkeit einsetzte. Normalerweise setzte ich meine Magie nur in Ausnahmesituationen ein. Aber je öfter nacheinander ich die Zeit anhielt, desto kürzer erstarrte sie und desto erschöpfter fühlte ich mich. Ich musste den Palast jetzt erreichen, denn schon mein nächster Versuch, meine Fähigkeit zu nutzen, konnte scheitern, weil meine Batterien leer waren. Es würde ein paar Minuten dauern, bis sie wieder aufgeladen waren. Ich hoffte, dass sich in der Ruine keine weiteren Kreaturen befanden und ich erstmal verschnaufen konnte und die Möglichkeit bekam, über meine Situation nachzudenken.
So schnell ich konnte, rannte ich auf die schief in ihren Angeln hängende doppelflügelige Eingangstür zu, die rechts und links von zwei hohen Gargoyles aus Stein flankiert wurde. Ich schob mich durch einen Spalt, der gerade groß genug für mich und die Klaue eines dieser Monster war. Ich duckte mich unter der Klaue hinweg und schob mich weiter in den Palast.
Krallen schlugen hinter mir in das Holz ein, scharrten und kratzten. Aber es gelang der Kreatur nicht, die schwere Tür zu öffnen, die sich gut fünf Meter nach oben erstreckte. Ich wich rückwärts zurück und wagte erst, meinen Blick zu lösen, als das Scharren, Fauchen und Kreischen verstummte. Zitternd atmete ich ein, hob meinen Blick zu dem Gewölbe über mir, dem ich verdankte, dass die Kreaturen mich nicht weiter angriffen. Ich konnte nicht viel mehr erkennen, als die Dunkelheit, in der sich die Stützen verloren. Eben war alles über mir noch blutrot gewesen, jetzt war ich von Dunkelheit umgeben. Die einzigen Lichtquellen waren die zuckenden Flammen der Fackeln an den Wänden. Unter meinen Schuhen knirschte der rote Sand, den ich mitgebracht hatte, auf glänzend schwarzen Steinfliesen. Ich stand in einem großzügigen Foyer.
Hinter mir erstreckte sich eine ausladende Treppe in die nächste Etage. Links und rechts öffneten sich zwei von burgunderroten Vorhängen eingefasste Rundbögen in weite Hallen. Ich wandte mich nach links, wo eine lange Tafel, festlich gedeckt mit unzähligen Speisen, den gesamten Raum dominierte. Es roch nach gebratenem Fleisch, Trdelník, Bier und Wein. Alles dampfte noch, als wäre der Tisch eben erst gedeckt worden. Aber ich war allein. Gefangen in einem Traum, einer Ohnmacht oder einem Koma, das so tief war, dass nicht einmal das Pochen der Fleischwunde an meinem Oberarm mich wecken konnte. Andererseits, was versuchte ich mir vorzumachen? Das alles hier war viel zu real. Ich hatte die Hitze der Feuer unter meinen Sohlen gespürt, den Wind, den die riesigen Schwingen verursacht hatten, in meinem Nacken, und der Geruch nach Schwefel brannte noch immer in meiner Nase. Nicht einmal der Braten konnte ihn vollends vertreiben. Mein Verstand sagte mir, dass das hier unmöglich echt sein konnte. Aber ich sah es, roch es, fühlte es. Ich war hier, auch wenn ich es nicht begreifen konnte.
Ich sah mich weiter um, in der Hoffnung, eine Antwort zu finden. An den Wänden hingen Gemälde, jedes einzelne so zerrissen, dass ich unmöglich hätte sagen können, was auf ihnen abgebildet war. Und über mir war der Himmel wieder blutrot, weil die Decke nicht mehr existierte. Fast, als wäre sie nie da gewesen. Die Kreaturen kreisten über dem Palast, als lauerten sie nur darauf, dass ich wieder heraustreten würde.
Zielstrebig ging ich auf eine Wand zu, an der Schwerter, Schilde und ein Reiterbogen hingen. Als hätte jemand ihn für mich hinterlassen, war er tief genug angebracht, dass ich ihn erreichen konnte. Ich zog vier Pfeile aus der Vorrichtung darunter, legte einen an und schob die anderen in den Bund meiner Hose.
Ihre Spitzen waren aus schwarzem Stein, ähnlich dem, aus dem auch die Drachenzähne bestanden. An ihren Enden waren braune Federn angebracht. Sie in den Bund meiner Hose zu stecken, war nicht die sicherste Lösung für die Pfeile. Aber ich wollte eine Hand freihaben, für den Fall, dass sich eine der Kreaturen auf mich stürzen würde und ich auf sie schießen oder die Zeit erstarren lassen musste.
Ich ging entlang der langen Tafel auf das andere Ende der Halle zu, wo sich ein Podest befand, auf dem ein Thron stand, dessen Beine auf vier Schädeln saßen, die mich aus ihren leeren Augenhöhlen angafften. Die Schädel waren nicht menschlich, weil ihre Zähne zu spitz und ihre Stirnen zu hoch waren. Ich kniff mir in den Arm, von dem Blut auf den staubigen Boden tropfte. Er schmerzte auch ohne, dass ich mich selbst malträtierte genug, aber ich wollte aufwachen. Jetzt.
3
Um das Podest herum stapelten sich abgegriffene lederne Bücher. Neugierig griff ich nach einem der Bände, als hinter mir etwas scharrte. Sofort legte ich meinen Bogen an, wandte mich um und zielte auf die Stelle, von der das Geräusch kam. Ich zielte auf zwei fremdartige Kreaturen mit schuppiger grüner Haut, leuchtend gelben Augen und Hörnern auf ihren Stirnen. Jede von ihnen hatte zwei größere und zwei kleinere schlamm-gelbe Hörner. Ihre Körper ähnelten trotz ihres merkwürdigen Aussehens denen von Menschen. In ihren klauenbewehrten Händen hielten sie Schwerter, die sie auf mich richteten, während sie sich zögerlich auf mich zubewegten. Eine der Kreaturen entblößte eine Reihe spitzer Zähne, als sie ein schauriges Fauchen von sich gab.
Ich hob meinen Bogen und spannte die Sehne, zögerte aber noch. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Pfeil lösen sollte. Auch wenn diese Kreaturen Furcht einflößend aussahen, noch griffen sie mich nicht an. Sie wirkten eher überrascht als angriffslustig. Sie wägten ab und versuchten wohl einzuschätzen, wie groß die Gefahr war, die von mir ausging. So wie ich versuchte, genau das über sie herauszufinden. Im Augenblick waren sie die Einzigen, die mir sagen konnten, wo ich war und wie ich wieder nach Hause kam. Wenn sie denn sprechen konnten.
Ich öffnete den Mund, um ihnen zu sagen, dass ich nicht vorhatte, sie anzugreifen. Aber eine der Kreaturen schien sich entschieden zu haben, mich als Eindringling zu betrachten. Sie kam mit erhobenem Schwert und grimmiger Miene zügig auf mich zu. Ich hatte noch nie auf jemanden oder etwas geschossen, das wahrscheinlich ein schlagendes Herz besaß. Immer nur auf leblose Gegenstände, wie Zielscheiben. Die Vorstellung ein Lebewesen zu töten, sei es auch nur eine Maus, hatte mich immer erschreckt. Aber jetzt löste ich die Sehne aus der grausigen Panik heraus, in die mich diese Wesen versetzten, ohne länger darüber nachzudenken.
Die Kreatur wischte meinen Pfeil im Flug einfach mit einer Bewegung ihres Arms aus der Luft. Er landete auf der langen Tafel und blieb in einer zweistöckigen Torte stecken. Ich legte den nächsten Pfeil nach. Die beiden in lederne Rüstungen gekleideten Kreaturen hoben knurrend ihre Schwerter und bewegten sich jetzt vorsichtiger auf mich zu. Ich konnte unmöglich beide gleichzeitig ausschalten, also gab ich den Plan mit dem Bogen auf und entschied mich, die Zeit anzuhalten, obwohl ich noch immer ausgelaugt davon war, dass ich meine Fähigkeit vorhin bei den fliegenden Kreaturen so oft benutzt hatte.
Sobald alles stillstand, sogar die fliegenden Ungetüme über unseren Köpfen, rannte ich an der langen Tafel entlang zwischen den Monstern hindurch. Ich hatte die Wahl zwischen diesen schuppigen oder den fliegenden Kreaturen über dem Palast. Irgendetwas machte mich glauben, dass es einfacher wäre, mich dort draußen den Kreaturen zu stellen, statt hier drinnen, wo ich hinter Mauern gefangen war und es vielleicht schwierig wurde, zu entkommen. Vielleicht irrte ich mich auch, schließlich hatte ich keinerlei Erfahrung darin, mich vor Angreifern mit Schwertern und Klauen zu schützen. Ich vertraute einfach meinem Instinkt, und der sagte mir, dass ich in diesem Palast noch weniger sicher war als dort draußen.
Im Eingang zur Halle kollidierte ich mit einem Körper. Ich hatte den Mann nicht gesehen. Er war so dunkel gekleidet, von Kopf bis Fuß in feinen schwarzen Stoff, mit silbernen Ornamenten auf den Aufschlägen seiner Tunika, dass er sich kaum von der Dunkelheit im Foyer abhob. In dem Augenblick, in dem ich in ihn hineinrannte, riss ich ihn durch meine Berührung aus der Starre. Er blinzelte mich verwundert an, sah an mir vorbei, wo die beiden Kreaturen noch immer in der Zeit feststeckten, und zog fragend eine Augenbraue hoch.
Ich trat weit genug von ihm zurück, um meinen Bogen wieder auf ihn richten zu können. Er hatte glänzend schwarze Haare, die sich in feinen Locken auf den steifen Kragen seiner Tunika legten. Seine Augen waren stahlgrau, eingerahmt von zwei kräftig dunklen Ringen. Sein Gesicht attraktiv, mit einer geraden Nase, verkniffen lächelnden Lippen und einem winzigen Grübchen in seinem Kinn. An ihm war alles normal – soweit ich es sehen konnte. Keine Hörner, keine Reißzähne, Flügel oder Klauen. Er schien einfach nur ein Mensch zu sein. Zumindest hoffte ich das, weil das bedeuten würde, dass er mich vielleicht nicht sofort töten wollte. Zumindest machte er keine Anstalten, mich anzugreifen. Stattdessen stand er mir gegenüber, sein Blick glitt mit starrer Maske über mich, meine Kleidung und den Bogen in meiner Hand.
»Milady«, kommentierte er mein Auftauchen mit deutlichem Spott in seiner Stimme.
»Bitte?«, hakte ich nach, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihn durch das Rauschen in meinen Ohren hindurch richtig verstanden hatte.
»Hattet Ihr vor, uns schon wieder zu verlassen? Und was habt Ihr mit meinen Soldaten gemacht, Hexe?« Das Wort Hexe stieß er mit so deutlicher Verachtung aus, dass er sogar sein Gesicht verzog und die Schultern sich schaudernd bewegten. Er wies auf die Monster hinter mir, die zwischenzeitlich wieder aus ihrer Starre erwacht waren. Ich warf einen Blick über die Schulter zurück und sah, wie sie sich langsam von hinten näherten. Er hatte sie seine Soldaten genannt, was bedeutete, sie gehörten zu ihm. »Was habt Ihr mit ihnen angestellt?«
Ich war eingeschlossen. Gefangen zwischen fremdartigen Wesen und diesem … Mann, der mich noch immer musterte, als wäre ich etwas, das er nicht einmal unter seinen Schuhen wollte. Ich zuckte mit dem Bogen, um seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ich bewaffnet war und mit einem Pfeil auf ihn zielte. »Ich werde schießen, wenn Sie mir nicht sofort aus dem Weg gehen.«
Der Mann grinste nur, in seinen Augen blitzte es abfällig auf. Er machte keinen Hehl daraus, dass er mich nicht fürchtete. Und auch nicht meine Waffe. Er zuckte nur mit den Schultern, hob eine Hand und betrachtete gelangweilt seine Fingernägel. »Schieß, kleines Mädchen«, forderte er mich heraus, als würde es ihm nichts ausmachen, wenn ich ihn erschießen würde. Oder als wäre es ihm egal, zu sterben. Vielleicht glaubte er nur einfach nicht daran, dass ich wirklich schießen könnte.
Ich senkte den Bogen. Wenn ich schoss, würden die Kreaturen hinter mir mich nicht ungestraft davonkommen lassen; das machten sie klar, als einer von ihnen mir die Spitze seines Schwerts in den Rücken bohrte. Es würde mir auch nicht weiterhelfen, den Mann zu töten. Er könnte der Einzige sein, der dazu in der Lage war, mir zu sagen, wo ich war und wie ich wieder nach Hause kam.
»Wo bin ich hier?« Ich klang weinerlich, das war mir bewusst, aber ich war verzweifelt. Allmählich konnte ich die Panik nicht mehr zurückhalten. Mein Herz trommelte so heftig, dass ich es in meinem Kopf hörte und bis in meine Zehen hinein spürte.
Er lachte höhnisch auf. Lachte so sehr, dass er den Kopf in den Nacken legte und sein Lachen von den Wänden widerhallte. Bis er sein Lachen abrupt verschluckte und seinen eisigen Blick auf mich richtete. »Auf ein neues Spiel, Hexe?« Er zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Wenn du meinst, spielen wir.« Er holte theatralisch Luft, räusperte sich und wedelte genervt mit einer Hand, als bereitete er sich tatsächlich auf eine Rolle vor. »Ich wüsste es zu schätzen, wenn Ihr mir zuerst sagen würdet, wer Ihr seid und woher Ihr gekommen seid? Immerhin seid Ihr in mein Zuhause eingedrungen. Es wäre nur folgerichtig, wenn ich die Fragen stelle und Ihr sie beantwortet. Recht so, Milady?«
Ich hatte keine Ahnung, was das sollte, beschloss aber, einfach mitzuspielen, wenn er mir dafür sagte, wo ich mich befand und wie ich wieder nach Hause kam. »Lenka«, ergab ich mich. »Eben war ich noch bei mir zu Hause. Und ich bin keine Hexe«, betonte ich mit Nachdruck, obwohl ich verstand, dass er mich für eine hielt. Ich hatte die Zeit angehalten. Selbst dort, wo ich herkam, würden die meisten Menschen mich für eine Hexe oder einen Freak halten. Meine Mutter hatten sie für einen Freak gehalten. Ich hatte keine Ahnung, wie man hier mit Hexen umging. In meiner Welt gab es eine Zeit, in der Hexen verfolgt wurden. Und so wie er das Wort ausgesprochen hatte, befürchtete ich, dass das hier vielleicht auch der Fall war. Wo immer hier auch war.
Mich traf ein Stoß in die Rippen, den ich mit zusammengekniffenen Lippen ignorierte.
»Darf ich auch erfahren, wer Sie sind?« Der Mann vor mir war etwa Anfang zwanzig und damit etwas jünger als ich. Seine Sprache war so altmodisch wie seine Kleidung. Er war gut aussehend, hatte einen verbitterten Ausdruck um seinen Mund und einen zornigen um seine Augen herum.
Eine der Kreaturen stieß mich nochmals grob in die Rippen. »Euer Hoheit. Ihr solltet Euch vor Prinz Marek verbeugen.« Sie konnten also doch sprechen, wenn auch mit einer sehr rauen, fast knurrenden Stimme.
Ich wandte mich zu ihr um und stieß das Schwert, das sich in meine Seite bohrte, weg. »Ich habe nicht vor, hierzubleiben. Wer hier welchen Status hat, interessiert mich nicht. Und dort, wo ich herkomme, sind Hoheiten ein überholtes Relikt. Ich werde mich also nicht verbeugen«, stellte ich wütend klar. Das Monster stieß ein grollendes Geräusch aus, das einem Knurren ähnelte, aber so tief war, dass es in meinem Körper vibrierte. Ich war verängstigt, schluckte meine Gefühle aber herunter, denn ich hatte nicht vor, diesem Ding zu zeigen, dass ich mich vor ihm fürchtete.
Je länger ich hier war, je mehr die Angst nach mir griff, desto verzweifelter wurde ich auch. Verzweiflung war noch nie ein guter Ratgeber. Sie brachte Menschen dazu, unüberlegt zu handeln. Ich holte tief Luft, um meine Emotionen zu zügeln. Die Kreatur drückte unbeeindruckt ihr Schwert wieder in meine Seite. Ich sah über die Schulter zurück. »Würdest du bitte damit aufhören? Noch nie etwas davon gehört, dass man anderen Leuten nicht ungefragt so nahekommt?«
Der Mann nickte den beiden zu, worauf sie sich etwas entfernten. Sein frustrierter Blick glitt sofort darauf wieder zu mir zurück. »Prinz Marek, Herrscher über all das, was du hier siehst.« Er klang nicht stolz oder überheblich, als er klarstellte, dass er an diesem Ort das Sagen hatte. Vielmehr wirkte er, als mache er sich über sich selbst lustig. Als bedeute ihm nichts davon etwas. Und als wäre ihm klar, dass dieser Palast kaum mehr als eine Ruine war und nicht gerade ein Beleg für Reichtum und Macht.
»Gemütlich hier«, kommentierte ich. »Ich würde jetzt wirklich gern wieder nach Hause gehen. Alles, was ich wissen will, ist, wie ich von hier wieder wegkomme.«
Prinz Marek sagte nichts. Noch immer musterte er mich mit einer Herablassung, die mich langsam wütend machte.
»Ich habe Ihre Fragen beantwortet. Es wäre nur höflich, wenn Sie mir auch antworten würden«, drängte ich mit wachsender Verzweiflung.
Er studierte meine Kleidung, als wüsste er nicht, was er mit mir anfangen sollte, aber so etwas wie Zweifel oder Unsicherheit huschte über sein Gesicht. Ich entschied mich, besser von hier wegzugehen, bevor er seinen Soldaten doch noch den Befehl gab, mich zu töten. Oder mich in den Kerker zu werfen.
»Ich muss gestehen, dass ich noch nicht entschieden habe, wie ich verfahren soll. Mir ist heute nicht nach Spielchen, also komm zum Ende, Marinka.«
»Lenka«, korrigierte ich ihn. Ich blinzelte verwirrt und versteckte meine größer werdende Angst, indem ich den Blick senkte und einen Schritt nach links machte, um mich zwischen ihm und dem Ausgang hindurchschieben zu können. Er ging nicht zur Seite, als ich versuchte, mich an ihm vorbei aus der Halle zu drängen. Stattdessen blieb er wie eine steinerne Mauer unbeirrt vor mir stehen und blockierte meinen Weg. Ich würde keine Antworten von ihm bekommen. Aber weiter hier zu stehen, brachte mich auch nicht nach Hause. Ich könnte die Zeit anhalten, um zu entkommen. Nur stand er so, dass ich nicht an ihm vorbeikommen konnte, ohne ihn zu berühren. Was ihn aus der Zeitstarre reißen würde, noch bevor ich an ihm vorbei wäre. Die Zeit anzuhalten, würde mir also nicht weiterhelfen.
Ich hob meine Hand, legte sie an seinen Oberarm und wollte ihn mit Druck dazu zwingen, mir Platz zu machen. Wahrscheinlich war es alles andere als eine kluge Entscheidung, einen Prinzen so anzufassen, aber er ließ mir keine andere Wahl. Marek packte meinen Unterarm. Ich stieß ein zischendes Geräusch aus, als sich seine Finger um meine Wunde schlossen. Er hielt inne, als er das Blut auf meiner Bluse entdeckte, zog den Stoff weg und musterte die Verletzung, die die Klauen hinterlassen hatten, mit einem fast schon desinteressierten Ausdruck in den Augen.
Er kniff die Augen zusammen, legte den Kopf schief und studierte mich noch intensiver. Die Unsicherheit stand ihm jetzt regelrecht ins Gesicht geschrieben. Er tauschte Blicke mit den Kreaturen hinter mir aus. Als ich über die Schulter zurücksah, zuckte einer der Soldaten nur unschlüssig mit den Schultern. Ich war mir nicht sicher, was hier vorging, aber ich vermutete, sie wussten wirklich nicht, was sie mit mir anstellen sollten.
»Du hast die Furien schon kennengelernt. Dann weißt du auch, dass du nirgendwo hin kannst«, sagte er geradezu entspannt, löste seine Finger um mein Handgelenk und trat zur Seite. »Aber wenn du es unbedingt versuchen willst, halte ich dich nicht auf.«
»Danke« Ich zögerte. »Ich bräuchte noch ein paar Pfeile.«
Die Augenbraue über seinem rechten Auge wanderte erstaunt nach oben. Was auch immer er sagen wollte, er sagte es nicht, stattdessen beschloss er, seine Chance zu nutzen und mit mir zu handeln. »Du bekommst mehr Pfeile, wenn du mir sagst, wie lange wir das hier noch spielen wollen.«
»Sag mir zuerst, wo ich hier bin, dann weiß ich vielleicht auch, wann dieses Spiel endet«, verlangte ich trotzig. Ich wusste nicht, was er glaubte, was für ein Spiel ich spielte, aber er deutete das jetzt schon zum wiederholten Mal an. Ich wollte ihn dazu zwingen, mir Informationen zu geben. Da er bisher nicht sehr freigiebig damit war, war er vielleicht bereit, mir im Austausch meine Fragen zu beantworten.
Er lachte düster. »Also gut. Dann erst deine Frage. Es ist die Hölle. Eine Hölle. Wahrscheinlich eine von Vielen. Ich nenne diese hier Infernis.« Er deutete auf die Kreaturen hinter mir und dann zum Himmel und nach draußen. »Dämonen, Furien, Feuer und Schwefel. Als wüsstest du das nicht längst.« Offensichtlich hatte er die altmodische Anrede aufgegeben. Vielleicht war er zu dem Schluss gekommen, dass ich die Mühe nicht wert war.
Ich schüttelte den Kopf. Ich war mir nicht sicher, ob das alles hier nicht doch ein Traum war. Mein Verstand sträubte sich dagegen, diese Kreaturen, diese Welt oder Marek für etwas anderes, als einen Traum zu halten. »Das hier ist wahrscheinlich alles nicht real.«
Er verdrehte die Augen. »Dieses Spiel wird nicht besser, je länger du dich dumm stellst. Aber wenn es unbedingt sein muss, dann ergebe ich mich und gebe dir, was du willst. Was sollte ich auch sonst tun?«
»Bekomme ich jetzt mehr Pfeile oder kannst du mir sagen, wie ich nach Prag zurückkomme?« Ich ging nicht davon aus, dass er Prag kannte. Aber er sprach die gleiche Sprache wie ich, auch wenn sein Tschechisch wie aus einem Historienfilm klang. Ich hatte also eine gewisse Hoffnung.
»Prag war auch einmal mein Zuhause«, erklärte er ohne jegliche Emotion. »Es gibt keinen Weg zurück. Du bist hier genauso gefangen wie ich. Wie meine Soldaten oder die Furien. Aber du bekommst, was du verlangst.« Er nickte den Dämonen kurz zu, worauf einer von ihnen sich murrend an mir vorbeischob und die Stufen nach oben nahm. Kurz darauf schwebten zwei geisterähnliche, halbdurchsichtige Wesen durch die Eingangshalle. Sie waren vollkommen weiß, ihr langes Haar und ihre Gewänder waberten, als würde ein starker Wind wehen. Aber es war windstill.
Eine der Gestalten schwebte auf mich zu. Obwohl ihre Hände transparent waren, hielt sie einen Köcher mit Pfeilen darin. Langsam glitt sie mehrere Zentimeter über dem Boden auf mich zu und hielt mir den Köcher wortlos entgegen. Ich unterdrückte ein Schaudern, als ich in die schwarzen Augenhöhlen der Kreatur sah. Sobald ich nach dem Köcher griff, löste sich das Wesen auf und erschien einen Augenblick später wieder neben dem anderen auf der Treppe. Sie verbeugten sich vor Marek und schwebten die Stufen nach oben, wo sie auf dem oberen Absatz stehenblieben, die Gesichter von uns abgewandt.
»Und das waren?«, fragte ich den dunkelhaarigen Mann ungläubig.
»Albträume. Das beschreibt diese Kreaturen wohl am besten.« Er deutete auf den Köcher. »Viel Glück, und wir sehen uns hoffentlich nicht allzu bald wieder.«
Ich murmelte ein leises Danke, ging um ihn herum auf die hohe Tür zu und schob mich durch den Spalt nach draußen. Sobald ich den Palast verlassen hatte, stieß eine der Furien einen Schrei aus, schlug aufgeregt mit den Schwingen und stürzte auf mich zu. Ich hielt die Zeit an, als sie nah genug war, um sie sicher zu treffen, hob den Bogen und schoss. Noch bevor sie sich komplett aus der Erstarrung gelöst hatte, fiel sie in den roten Sand, zappelte wie ein Fisch und blieb kurz darauf reglos liegen. Ich wandte mich zu Marek um und grinste zufrieden. »Ich denke, ich kann deine Glückwünsche gut gebrauchen.«
»Das war mehr, als ich erwartet hatte. Ich bin beeindruckt.« Er klang trotz allem, was er sagte, eher gelangweilt.
»Zeit anhalten, schießen«, murmelte ich, legte einen neuen Pfeil in den Bogen, trat mehrere Schritte vor, wartete, bis die nächste Furie sich auf mich stürzte, schnippte mit den Fingern und holte sie vom Himmel. Als Marek das nächste Mal aus der Zeitstarre erwachte, lagen drei der fünf Furien im roten Sand. »Gut möglich, dass ich es doch schaffen könnte«, sagte ich trocken, ging zu einer der Kreaturen und zog meinen Pfeil aus ihrer Brust. Ich wusste nicht, wie viele Furien mir auf meinem Weg noch begegnen würden. Ich wusste ja nicht einmal, wohin mein Weg mich führen würde. Oder wo genau ich überhaupt war. Wie ich hierherkam. Ich wusste nur, dass ich nicht hier sein wollte. In der Hölle. Welcher auch immer.
»Ich hatte keine Ahnung, dass du so bewandert im Umgang mit dem Bogen bist, Hexe.«
»Ich bin keine Hexe. Ich schieße schon mit dem Bogen, seit ich ein Kind war.«
»Die Zeit erstarren zu lassen, ist eine Kraft, die nur Hexen beherrschen. Und ich kenne mich gut mit Hexen aus«, entgegnete Marek. Er strich gelangweilt über seine Tunika und verschränkte die Arme wieder vor der Brust, als interessiere er sich eigentlich nicht für das, was um ihn herum geschah. Sein ganzes Verhalten war irritierend merkwürdig. Andererseits war nichts hier normal.
Ich hörte wieder die zahllosen Warnungen meines Vaters, niemandem zu zeigen, wozu ich fähig war. Aber Infernis war nicht die Welt, die ich verlassen hatte. Hier gab es Monster, einen roten Himmel und einen gruseligen Palast. Und meine Magie und der Bogen waren alles, was ich hatte, um mich zur Wehr zu setzen. Wahrscheinlich wäre es riskanter, meine Kräfte nicht zu nutzen.
»Ich kenne mich gar nicht mit Hexen aus«, erwiderte ich bissig. Es sollte mir egal sein, wofür er mich hielt, aber ich konnte das Unbehagen nicht abschütteln. Die Furcht vor meinen eigenen Fähigkeiten und davor, was geschehen könnte, wenn jemand davon erfuhr, saß tief. Nicht einmal in einer Situation wie dieser konnte ich die Warnungen meines Vaters und meine Schuldgefühle ablegen. »Ich will nur nach Hause.«
4
Marek war in seinem Palast verschwunden, noch bevor ich ihm etwas entgegnen konnte. Ich zog einen weiteren Pfeil aus dem Körper einer der Furien. Von der Spitze tropfte Blut und etwas hing daran, über das ich nicht näher nachdenken wollte. Aber bei dem Anblick würgte ich angewidert. Mit spitzen Fingern zupfte ich dieses Etwas von der Pfeilspitze und ließ es unter weiterem Würgen in den Sand fallen. Ich trat mehrere Schritte von der Mauer weg, die den Palast umgab, hob den Blick zum Himmel und suchte ihn nach Furien ab. Aber bis auf wenigen rosafarbenen Wolken, war der blutrote Himmel frei von Ungetümen.
Nicht weit entfernt schoss eine der Fontänen empor. Das flüssige Feuer landete klatschend auf dem Sand, züngelte für kurze Zeit und erlosch wieder. Ich wartete die nächste Fontäne ab und die nächste. Irgendwas ließ mich hoffen, dass ein Muster hinter den Fontänen steckte. Aber es gab kein Muster, an dem ich mich hätte orientieren können. Ich musste es ohne Hilfe schaffen. Ich hätte die Zeit immer wieder anhalten können, um der Gefahr zu entgehen, aber wenn ich meine Gabe zu oft nutzte, wurde ich schnell müde. Und wer wusste schon, wozu ich meine Kräfte noch brauchen würde. Ich entschied mich, es so zu versuchen.
So schnell ich konnte, lief ich auf die Stelle zu, an der ich angekommen war. Vor einem der glühenden Rinnsale hielt ich kurz inne, atmete mehrmals tief durch und betete, dass es nicht gerade in dem Augenblick eine Fontäne ausspucken würde, in dem ich übersetzte. Als mir klar wurde, dass die Gefahr größer wurde, je länger ich neben dem Lavabach stand, nahm ich meinen Mut zusammen und sprang über das flüssige Feuer hinweg.