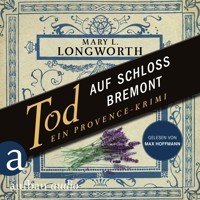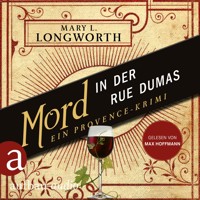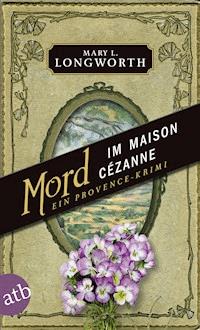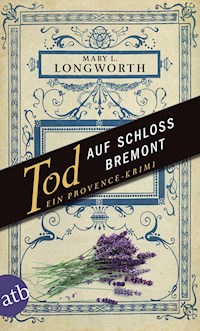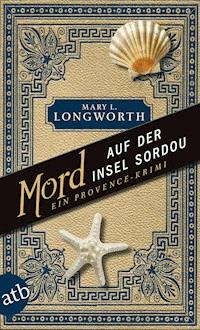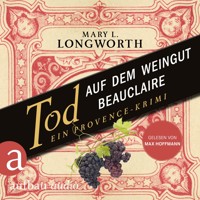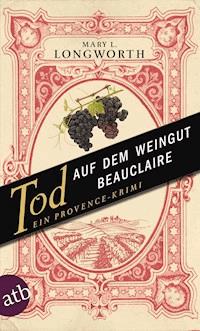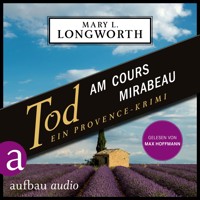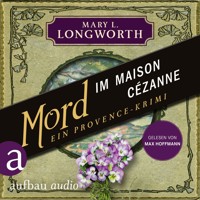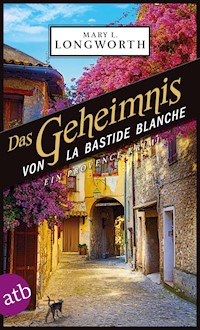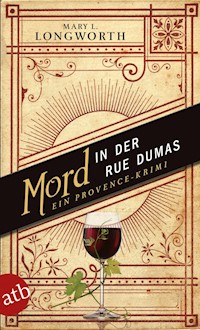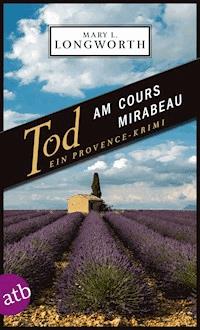
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Verlaque & Bonnet ermitteln
- Sprache: Deutsch
Mörderische Provence.
Marine Bonnet und Antoine Verlaque lieben das neue, angesagte Restaurant „La Fontaine“ unweit vom Cours Mirabeau, der berühmten Hauptstraße von Aix-en-Provence. Sie haben vor kurzem geheiratet und sind dort häufig zu Gast. Als der Besitzer noch ein paar Freisitze einrichten möchte, bekommt er Ärger mit einigen Nachbarn. Kurz darauf entdeckt sein Tellerwäscher unweit des Brunnens im Garten eine Leiche und plötzlich sind die Hälfte der Einwohner des noblen Innenstadtviertels Mazarin des Mordes verdächtig. Sogar der Pater der nahe gelegenen Kirche Saint-Jean-de-Malte verhält sich seltsam ...
Ein Krimi voller südfranzösischer Atmosphäre, Kochkunst und Liebe.
„Genau die richtige Sommerlektüre.“ Berliner Morgenpost.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Mary L. Longworth
Mary L. Longworth lebt seit 1997 in Aix-en-Provence. Sie hat für die »Washington Post«, die britische »Times«, den »Independent« und das Magazin »Bon Appétit« über die Region geschrieben. Außerdem ist sie die Verfasserin des zweisprachigen Essay-Bandes »Une Américaine en Provence«. Sie teilt ihre Zeit zwischen Aix, wo sie schreibt, und Paris, wo sie an der New York University das Schreiben lehrt. Im Aufbau Taschenbuch erschienen bisher »Tod auf Schloss Bremont« (2012), »Mord in der Rue Dumas« (2013), »Tod auf dem Weingut Beauclaire« (2014) und »Mord auf der Insel Sordou« (2015).
Dr. Helmut Ettinger, Dolmetscher und Übersetzer für Russisch, Englisch und Chinesisch. Er übersetzte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, Polina Daschkowa, Darja Donzowa und Sinaida Hippius, Michail Gorbatschow, Henry Kissinger, Roy Medwedew, Valentin Falin, Antony Beevor, Lew Besymenski, Gusel Jachina und viele andere ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Mörderische Provence
Marine Bonnet und Antoine Verlaque lieben das neue, angesagte Restaurant »La Fontaine« unweit vom Cours Mirabeau, der berühmten Hauptstraße von Aix-en-Provence. Sie haben vor kurzem geheiratet und sind dort häufig zu Gast. Als der Besitzer noch ein paar Freisitze einrichten möchte, bekommt er Ärger mit einigen Nachbarn. Kurz darauf entdeckt sein Tellerwäscher unweit des Brunnens im Garten eine Leiche. Plötzlich sind die Hälfte der Einwohner des noblen Innenstadtviertels Mazarin des Mordes verdächtig. Sogar der Pater der nahe gelegenen Kirche Saint-Jean-de-Malte verhält sich seltsam.
Ein Krimi voller südfranzösischer Atmosphäre, Kochkunst und Liebe.
»Genau die richtige Sommerlektüre.« Berliner Morgenpost
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mary L. Longworth
Tod am Cours Mirabeau
Ein Provence-Krimi
Aus dem Amerikanischen von Helmut Ettinger
Inhaltsübersicht
Über Mary L. Longworth
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog Dei Corallini
1. Kapitel Ein Herzog und sein Garten
2. Kapitel Die Welt aus der Sicht von Philomène Joubert
3. Kapitel Das Abendessen
4. Kapitel Bear bekommt Probleme
5. Kapitel Anchovispaste
6. Kapitel Mittagessen im La Fontaine
7. Kapitel Der Würfel entscheidet
8. Kapitel Ein ganz gewöhnlicher Tag
9. Kapitel Fünf Gespräche
10. Kapitel Auf der Suche nach Knochen
11. Kapitel Der verlorene Sohn
12. Kapitel Sanary-sur-Mer
13. Kapitel Philomène dreht ihre Runden
14. Kapitel Verlaques enttäuschendes Mittagessen
15. Kapitel Drei Brüder und eine Cousine
16. Kapitel La Fontaine läuft wieder
17. Kapitel Die ANF
18. Kapitel Die Geschichte von Richter Joisson
19. Kapitel Willkommen im Leben
20. Kapitel Die Esmeralda
21. Kapitel Das Blow-up
22. Kapitel Der Duc legt ein Geständnis ab
23. Kapitel Mordverdacht
24. Kapitel Suzettes Ingwer-Garnelen
25. Kapitel Goldman
26. Kapitel Gabriella de Serna
27. Kapitel Der Fluch des Brunnens
28. Kapitel Bahnbrecher
Epilog Das letzte Foto
Anmerkungen
Impressum
Für Laurence und Jacques
Anmerkung der Autorin
Aix-en-Provence hat zahlreiche Brunnen und Restaurants. Die beiden, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, sind jedoch eine Erfindung der Autorin.
Prolog Dei Corallini
Dei Corallini gefiel Antoine Verlaque ausnehmend gut. Fast tat es ihm leid, dass seine Hochzeit so klein ausfallen sollte. Dieses Kleinod barocker Baukunst war im 17. Jahrhundert mit Geld errichtet worden, das man mit Korallen aus dem Mittelmeer verdient hatte. Die Fischer der Gegend, die Gott für ihren Wohlstand danken wollten, finanzierten den Bau der Kirche. Die Handwerker, die sie damit beauftragten, waren darüber so stolz, dass sie jeden Stein mit größter Hingabe bearbeiteten. Das Ergebnis wirkte dennoch nicht überladen oder gar kitschig. Die Farbe des Natursteins war ein zartes Elfenbein, dessen Eleganz mit dem blassen Gelb, Rosa und Grün, in dem die verputzten Fassadenteile gestrichen waren, perfekt harmonierte.
Marines Eltern wäre eine große Hochzeit in ihrer Gemeindekirche Saint-Jean de Malte in Aix sicher lieber gewesen. Aber für eine solche traditionelle Zeremonie fühlte sich Verlaque zu alt. Er hatte auf Italien bestanden, weil er es ebenso liebte wie Marine. Tief in seinem Inneren wusste er jedoch, dass er nur dem Aufsehen in Aix-en-Provence entgehen wollte. Aix war der Ort, wo er lebte und arbeitete. Eine atemberaubende Stadt, aber für diese Gelegenheit schien sie ihm nicht geeignet. Er wünschte sich eine Hochzeit in aller Stille in einem ligurischen Dorf, ungestört von den neugierigen Blicken der Leute, die wie er in Aix wohnten. Es war, als könnte er sein Glück gar nicht fassen, als wollte er nicht das Risiko herausfordern, dass jemand in der Kirche hervortrat und mit lauter Stimme Einwände gegen ihren Lebensbund erhob. Bis er Marine kennenlernte – das geschah bei einem Abendessen, arrangiert von einem Anwaltskollegen, der später nach Paris zog –, hatte er sich nie vorstellen können, einmal Ehemann zu werden. Heiraten und glücklich sein war etwas für andere, nicht für ihn.
Die pastellfarbene Kirche mit der leicht geschwungenen Fassade, die über dem Kopfsteinpflaster des Platzes aufragte, war dem Meer zugewandt, als wollte sie es beschützen. Auf dem Hügel musste Dei Corallini für die Seeleute schon von weit draußen zu erkennen sein. Verlaque legte den Kopf in den Nacken und versuchte sich auf die Figuren in den Mauernischen zu konzentrieren. Er wollte sich ein wenig davon ablenken, was an diesem Vormittag in der Kirche geschehen sollte. Autos und Motorroller huschten tief unten die Straße entlang, die alle Küstenorte bis nach Imperia miteinander verband. Jemand im Dorf rief »Dario! Dario!« Eine Tür schlug zu. Verlaque ging durch den Sinn, dass dieser Tag, der für ihn so bedeutungsvoll werden sollte, für die Dorfbewohner ein ganz gewöhnlicher Samstag war.
Lächelnd ging er in Richtung Restaurant und ließ in Gedanken die Sitzordnung noch einmal Revue passieren. Eingeladen waren Marines Eltern – Anatole Bonnet, ein praktischer Arzt, und Florence Bonnet, eine emeritierte Theologieprofessorin –, Marines beste Freundin Sylvie mit ihrer elfjährigen Tochter Charlotte, Jean-Marc Sauvat, mit dem Marine und er befreundet waren, Bruno Paulik, der Kriminalkommissar von Aix, dessen Frau Hélène und deren ebenfalls elfjährige Tochter Léa, dazu Verlaques Vater Gabriel mit Freundin Rebecca Schultz und Verlaques Bruder Sébastien. Marine hatte Sylvie als Trauzeugin gewählt und er Sébastien. Warum, wusste er selber nicht, denn die beiden Brüder sahen sich selten. Sébastien fand den Immobilienhandel in Paris so aufregend, wie er Verlaque öde vorkam. Nach der obligatorischen standesamtlichen Trauung im Rathaus von Aix vor zwei Wochen hatten Marine und Verlaque gemeinsam mit dem Chef ihres Lieblingscafés am Cours Mirabeau für Freunde und Kollegen aus der Stadt einen Cocktailempfang gegeben. Man stieß mit Champagner an und reichte Platten mit kalten Häppchen herum. Anwohner und Touristen, die vorüberkamen, lächelten den Gästen zu, die sich anscheinend zu einer spontanen Party zusammengefunden hatten.
Marine und Verlaque hielten beide nichts davon, sich an einem berühmten Ort das Jawort zu geben. Das ligurische Dorf war kaum drei Stunden von Aix entfernt, woher die meisten Gäste kamen. Und schließlich verfrachteten sie ihre Hochzeitsgesellschaft ja nicht auf eine Insel in der Karibik. Einer von Marines Kollegen hatte von der Hochzeit eines Cousins in einem Urlaubshotel auf Barbados berichtet. Die Gäste, darunter zwei Großmütter, waren gezwungen, einen Flug von vierzehn Stunden zu einem Ort auf sich zu nehmen, der für Braut und Bräutigam keinerlei Bedeutung hatte. Doch in Paradiso – so nannte Marine das ligurische Dorf von klein auf – hatte sie mit ihren Eltern in einer winzigen Wohnung unten im Dorf unweit des Strands oft die Ferien verbracht. Antoine hatte sie es zum ersten Mal gezeigt, als sie sicher war, dass sie ihn liebte. Allerdings hatten sie weiter oben im älteren Teil des Dorfes Quartier genommen. Jeden Morgen waren sie mehrere hundert Stufen hinabgestiegen, wo sie das klare Wasser an den flachen Klippen jenseits des Sandstrands genossen.
Für Anfang April war das Wetter schon warm. Ein stiller Frühlingsmorgen. Im Dorf war es stets etwas feucht, und Verlaque hoffte, der Tag würde nicht zu heiß werden. Beinahe wäre er barfuß in seinen schwarzen Weston-Slippers aus dem Haus gelaufen. Marine hatte lachen müssen, als er in einem kobaltblauen Anzug, aber ohne Socken aus dem Badezimmer trat. »Meinst du nicht, du solltest Socken anziehen?«, hatte sie ihn gefragt. »Dieser italienische Macho-Stil passt doch nicht zu dir.«
Er schaute auf seine nackten Knöchel. »Wahrscheinlich hast du recht. Und du ziehst dich noch nicht an?«, fragte er dann und maß ihren Bademantel mit einem Blick.
»Das mache ich im Zimmer von Sylvie und Charlotte«, antwortete Marine. »Frühstücke du bitte mit meinen Eltern. Mein Kleid soll eine Überraschung sein.«
Verlaque rieb sich die Hände. »Kommst du mit großem Dekolleté? Oder mit nacktem Rücken?«
Lächelnd erhob sich Marine und hielt ihm die Tür auf. »Bis später.« Sie gab ihm einen Kuss und sagte: »Du siehst toll aus. Die Farbe steht dir.«
»Bist du aufgeregt?«
»Ja. Aufgeregt und glücklich, aber dann auch wieder merkwürdig ruhig, als ob ich schwebe. Und du?«
»Ich muss immer an die Pasta heute Abend denken«, gab Verlaque zurück. »Ich hoffe, die machen die Nudeln dick genug, damit sie richtig viel Soße aufnehmen.«
Marine starrte ihren gesetzlich Angetrauten einen Augenblick verdutzt an, dann musste sie lachen. »Zu denken, dass ich in einigen Stunden ganz und gar mit dir verheiratet bin …«
»Wir sind so glücklich«, sagte er und küsste sie. »Ich gehe jetzt hinunter zum Frühstück mit deinem hinreißenden Vater und deiner griesgrämigen Mutter. Dann springe ich noch schnell zum Restaurant hinüber, um aufzupassen, dass sie auch die richtigen Weingläser nehmen.«
Sie wusste, dass er das ernst meinte. »Na dann, viel Glück.«
»Wir sehen uns in der Kirche.«
Marine schloss die Tür hinter ihm und trat zu der Kommode, in deren unterster Schublade, sorgfältig in Seidenpapier gehüllt, ihr Kleid lag. Sie nahm es heraus, legte es auf das Bett und ging duschen. Sylvie hatte versprochen, ihr das Haar zu richten. Und da Charlotte dabei sein würde, hatte Marine auch Lea eingeladen, denn die zweite Elfjährige auszuschließen wäre ungerecht, wenn nicht gar grausam gewesen. Aus demselben Grund hatte sie auch kein Blumenmädchen vorgesehen.
Der Priester Piero, ein lockerer Fünfzigjähriger, mochte sein Amt offenbar sehr, denn er strahlte über das ganze runde Gesicht. Sie kannten ihn seit zwei Jahren. An einem Sommerabend, als ihr Lieblingsrestaurant überfüllt war, hatte man sie zu ihm an den Tisch gesetzt. Er sprach ausgezeichnet Französisch und war von Marines Italienisch beeindruckt. Jetzt hatten sie ihn in einem handschriftlichen Brief gebeten, Ihre Trauung vorzunehmen, wenn möglich, auf Französisch. Sie hatten ein Foto beigelegt, falls er sich nicht mehr an sie erinnerte. Aber er hatte seine Tischgenossen nicht vergessen und war stolz, einen so charmanten Giudice mit einer so schönen Professoressa vermählen zu dürfen. Er stellte nur eine Bedingung: Die Zeremonie sollte am Vormittag stattfinden, denn die Samstagnachmittage waren bereits für eineinhalb Jahre ausgebucht. Sie stimmten sofort zu, denn ihnen schwebte keine große Feier vor. Einen Tanzabend mit DJ brauchten sie nicht, eine Trauung am Morgen, gefolgt von einem Mittagessen, genügte vollauf. Piero hatte taktvoll angeboten, die Vermählung in diesem kleinen Kreis in einer Kapelle der Kirche vorzunehmen.
Verlaque schlenderte durch die mittelalterlichen Straßen, die kaum zwei Meter breit und mit runden glatten Flusssteinen gepflastert waren. Die Straßenmitte war mit roten Ziegeln ausgelegt. Zwar liebten sie Paradiso, aber besonders freundlich fanden sie die Dorfbewohner nicht, von Piero und dem Restaurantpersonal einmal abgesehen. An diesem Morgen kamen Verlaque vorwiegend alte Frauen entgegen, die ihn mit zusammengekniffenen Augen ohne ein Lächeln musterten und dann wegschauten. Diese unfreundliche Haltung ließ ihm einen Schauer über den Rücken laufen, obwohl es bereits warm wurde. Zum ersten Mal seit Monaten bereitete ihm die Hochzeit Unbehagen. War es die Heirat oder die Ehe? Marine Bonnet war perfekt, das wusste er. Von sich selber konnte er das nicht behaupten. Er konnte arrogant und rechthaberisch sein. Wenn er es recht bedachte, war er es gewesen, der darauf bestanden hatte, nicht in Aix, sondern in Ligurien zu heiraten. Marine ging sofort darauf ein, aber hatte er ihr überhaupt eine Wahl gelassen? Alle ihre Freunde und die Familie hatten sich über ihren Entschluss gefreut, doch immerzu hörte er sie sagen: »Was für ein Glückspilz du bist, Antoine.« Keiner sah es von der anderen Seite. Er war in der Tat glücklich, Marine an sich zu binden, aber vielleicht zog sie dabei den Kürzeren?
Verlaque schaute zu einem Palazzo auf. Eine runde Keramiktafel trug stolz das Baujahr 1578. Bougainvillea in leuchtendem Pink fiel wie ein Wasserfall über die blassgelbe Fassade herab. Er genoss es, wie dieses Pink und Gelb mit dem Dunkelgrün der Fensterläden harmonierte. Wer diese Farben ausgewählt hatte, musste einen Blick für Schönheit haben, und doch zeigten die zurückhaltenden Bewohner kaum ein Lächeln. Vielleicht mussten guter Geschmack und allgemeines Wohlbefinden nicht Hand in Hand gehen. Wie aufs Stichwort öffnete eine alte Frau die Tür des Palazzos, warf ihm einen Blick zu und schloss sie dann rasch wieder. Er hatte nicht einmal Gelegenheit, ihr Buon giorno zu sagen. Konnten diese Frauen ihm in die Seele schauen? Dachten sie etwa auch, dass Antoine Verlaque Marine Bonnet nicht verdiente?
Mit einem Seufzer schritt er weiter aus. Jetzt musste er den Kopf einziehen, als er unter einem steinernen Bogen hindurchging. Dort war es dunkel, und sein Blick suchte den Sonnenstrahl ein paar Schritte entfernt am Ende des engen Tunnels. Er konnte das Echo seiner Schritte hören, das die feuchten Mauern zurückwarfen. Antoine ging schneller. Die lange, unglückliche, ehrlose Ehe seiner Eltern ging ihm durch den Kopf, seine Affären, bevor er Marine begegnete, sein versnobter Lebensstil und seine rüde Art. Sahen die alten Dorfbewohnerinnen ihm das an und wandten sich deshalb angewidert von ihm ab? Marine hatte einen besseren, milderen Menschen aus ihm gemacht, das hatte sein bester Freund Jean-Marc ihm einmal gesagt. Aber was hatte er Marine gegeben? War sie durch ihn vollkommener geworden? Jetzt trat er aus dem dunklen Gang auf den in helles Sonnenlicht getauchten Platz hinaus. Blinzelnd konnte er erkennen, dass eine große, schwarz gekleidete Gestalt ihm entgegenkam. »Signore Verlaque! Il Giudice!« Es war Pater Piero. Verlaque schüttelte ihm die Hand. »Fühlen Sie sich gut?«, fragte Piero auf Französisch mit leichtem Akzent. »Oder ist Ihnen in dem Tunnel ein Geist begegnet?«
»Mein eigener«, gab Verlaque zurück.
Lächelnd nahm der Priester Verlaques Hand. »Sie heiraten heute. Da ist es normal, dass Sie sich ein wenig … unbehaglich fühlen.«
»Dort in dem Tunnel«, sagte Verlaque, bemüht, ruhiger zu atmen, »hatte ich das Gefühl, dass ich von all meinen Dämonen gehetzt werde.«
»Dämonen brauchen wir am Tag Ihrer Hochzeit nicht.«
Verlaque lächelte ihm zu. »Aber was soll ich machen?«
»Also, lieber Richter«, meinte Piero, legte Verlaque den Arm um die Schultern und führte ihn in der entgegengesetzten Richtung über den Platz. »Sie haben zwei Möglichkeiten. Erstens, die Beichte …«
Lachend blieb Verlaque stehen. »Ich habe nicht gebeichtet, seit …«
»Seit Ihrer Firmung?«
»So ungefähr.«
Darauf sagte Piero nichts. Sie gingen weiter.
»Und die zweite Möglichkeit?«, fragte Verlaque.
»Un caffè corretto.«
»Kaffee und Grappa? Diese Variante wäre mir lieber.«
»Das habe ich mir gedacht. Gehen wir also ins Café, lassen uns auf der Terrasse nieder und schauen aufs Meer. Sie sind ein guter Mann. Zu mir kommen viele Paare, die heiraten wollen. Sie, Antoine, haben sofort einen Blick dafür gehabt, wie schön dieses Dorf und seine Kirche sind. Hier heiratet man gern. Doch Menschen schließen die Ehe aus den verschiedensten Gründen, guten und schlechten. Ich kann nur meinen Rat und meinen Beistand anbieten, den Segen spenden und das Beste hoffen. Am Tag der Heirat sind alle nervös, so wie Sie jetzt. Die Männer bedauern meist, dass ihnen nun weniger Geld gehört und ihre wilden Jahre vorbei sind. Vielleicht bin ich altmodisch, und auch Frauen haben solche Gedanken.« Er lachte und bog dann in die schmale Straße ein, die zum Café führte. »Die meisten Frauen aber sorgen sich um die Feier. Die Blumen. Das Kleid. Den Abend. Das Essen. Die Gäste. Doch Ihre Professorin ist – wie soll ich das sagen? – so gelassen, als glaubte sie an das Zen. Sie wirkt glücklich, strahlt förmlich von innen. Und Sie sind der Mann, der sie glücklich macht.«
1. Kapitel Ein Herzog und sein Garten
Der Duc de Pradet (von seinen Freunden nur Michel Xavier genannt) hatte im Leben Glück gehabt, und das wusste er auch. Geboren 1946 in Paris, hatte er den Krieg und die deutsche Besatzung nicht miterleben müssen. Er war zu jung und von seinen Eltern gut behütet, um die Not und die Rationierung in den 1940er und Anfang der 1950er Jahre kennenzulernen. Als Jugendlicher durfte er das Fach studieren, das er liebte – nicht Jura, wozu man mehrere seiner Cousins zwang, sondern Geschichte. Sein Vater war kein besonders praktisch denkender Mensch gewesen. Mit 25 heiratete er Marguerite – aus Liebe, nicht wegen Ansehen oder Grund und Boden (obwohl Marguerite eine gute Partie war).
Sicher hatte sich auch sein Leben nicht immer einfach gestaltet. Sie konnten keine Kinder bekommen, was ihnen anfangs fast das Herz brach. Aber mit den Jahren gewöhnten sie sich an ihre Zweisamkeit. Um die Kinderlosigkeit zu überspielen, gingen sie auf lange Reisen. Und während andere Paare vielleicht ein Kind angenommen oder sich mehr für ihre Nichten und Neffen interessiert hätten, rückten Herzogin und Herzog enger zusammen. Sie kapselten sich nicht gerade ab, hatten viele Freunde und gesellschaftliche Verpflichtungen, aber im Alltag waren sie sich selbst genug. Sie kümmerten sich um Haus und Garten in Aix-en-Provence, um ein kleines Anwesen in Burgund und ein Appartement am linken Seineufer von Paris. Das war für sie ein erfülltes Leben. Dann starb Marguerite mit 63 Jahren an Brustkrebs.
Der Duc saß auf einer Holzbank in seinem Garten. Anfang der Woche hatte es geregnet, doch jetzt schien die warme Aprilsonne. Die Pflanzen prangten in frischem Grün, das im trockenen Sommer von Aix verblassen würde. Es war noch kühl genug, um draußen sitzen und die Sonne voll genießen zu können. Mit dem saftigen Grün würde auch diese Möglichkeit bald dahin sein und der Duc sich bis Mitte September in sein Landhaus nach Burgund zurückziehen.
Er stand auf, streckte sich und griff dann nach Korb, Heckenschere und den Arbeitshandschuhen aus Ziegenleder. Seine Pflanzen, besonders die Rosen, zu gießen war für den Duc eine heilige Handlung. Wenn er sich in Paris oder Burgund aufhielt, bezahlte er die Hausangestellte großzügig dafür, dass sie es an seiner Stelle tat. Die blassgelbe Lady Banks stand in voller Blüte, und eine wahre Flut der zarten, fast federartigen Röschen fiel über eine Wand des Stadthauses herab. Leise vor sich hin summend, schnitt er ein paar Rosen ab und legte sie vorsichtig in den Korb. Marguerite hatte sich hervorragend auf Blumenarrangements verstanden. Jetzt erledigte sein Diener und Koch Manuel diese Aufgabe für ihn.
An einem Nachbarhaus ging ein Fenster auf und wieder zu, ein Kind lachte, und jemand hustete. Es gab immer Geräusche in diesem Garten, den über ein Dutzend Häuser miteinander teilten. Doch den größten Lärm machten die Vögel. Sie übertönten die Stimmen der Fußgänger draußen auf der Rue d’Italie, ja sogar das Brummen der Autos und Busse, die über den Boulevard du Roi René fuhren. Der Duc musste lächeln, denn ein schöner zweiwöchiger Besuch bei seinen Freunden Lord und Lady Ashcroft fiel ihm ein, deren Stadthaus in Kensington ebenfalls an einem Gemeinschaftsgarten lag. Dort in London war er auf die Idee gekommen, sich eine Holzbank mit einem Schildchen an der geschnitzten Lehne zuzulegen, auf der stand: Pour Marguerite, qui adorait ce jardin.1
Als er es wieder husten hörte, wandte er sich um. »Mme Dreyfus«, sagte er lächelnd. Wegen ihres Alters sprach er sie mit Madame an, obwohl er wusste, dass sie nie geheiratet hatte. Sie war eine gutaussehende Frau, trug ihr dichtes weißes Haar kurz geschnitten, fast wie einen Bubikopf, was ihre tiefblauen Augen nur noch mehr zur Geltung brachte. Eine Schildpatt-Lesebrille an einer Kette um den Hals war ihr ständiger Begleiter, und sie schien sich nur in Schwarz und Weiß zu kleiden. Er schätzte die Antiquitätenhändlerin auf sein Alter, vielleicht auch etwas jünger.
»Sind die Rosen schön«, sagte sie.
»Möchten Sie ein paar mitnehmen?«, fragte der Duc und wies auf seinen Korb. »Sie haben bestimmt eine kleine elegante Vase, vielleicht aus Sèvres-Porzellan, in Ihrem Geschäft.«
»Ich habe eine, die perfekt passt«, antwortete sie. »Ja, ich hätte gern ein paar Rosen, wenn Sie sie entbehren können.«
»Ich gehe schnell ins Haus und bitte Manuel, sie für Sie einzupacken.«
»Das ist doch nicht nötig«, meinte sie.
»Aber die Dornen …«
»Mein Taschentuch genügt«, gab sie zurück und zog ein altmodisches leinenes Tüchlein aus der Tasche ihrer Strickjacke.
»Wie praktisch«, ließ der Duc hören, nahm das Tüchlein und legte es vorsichtig um die Stiele. »Wer passt jetzt auf Ihr Geschäft auf?«
Mme Dreyfus wies auf ihre Armbanduhr. »Ich habe Mittagspause.«
»Ja, natürlich«, antwortete er und schaute zum Himmel auf. »Ich habe die Zeit ganz vergessen.«
»Hören Sie nicht die Gäste im Restaurant?«, fragte sie und wies hinter sich. »Die Fenster stehen doch weit offen.«
»Nein, zum Glück nicht. Ich höre nur den Brunnen plätschern, besonders bei Nacht.« Jetzt fiel dem Duc ein, dass Gaëlle Dreyfus’ Geschäft und Wohnung nur zwei Häuser von dem Restaurant entfernt lagen, während er am entgegengesetzten Ende des Gartens wohnte. Von dem Restaurant hörte er keinen Laut, und auch die Rue Mistral ging er sehr selten entlang. Sie schien für ihn Welten entfernt.
»Deswegen bin ich eigentlich hier«, sagte jetzt Mme Dreyfus. »Wegen des Restaurants …«
»Nehmen Sie doch Platz.«
Gaëlle Dreyfus ließ sich auf der sehr englisch wirkenden Bank nieder. Als sie den Mann ansah, fiel ihr zum ersten Mal auf, dass er mit seinem Tweedjackett von Harris, seiner Strickweste und dem schütteren grauen Haar, das er ein wenig zu lang trug, viel mehr von einem englischen Lord als einem französischen Duc hatte. Doch die hohen Wangenknochen, die schmalen Lippen und die blauen Augen (ihren eigenen nicht unähnlich) sagten ihr, dass er in seiner Jugend ein gutaussehender Mann gewesen sein musste.
»Ein Kunde«, begann sie, »ein Architekt, hat mich informiert, dass der Chefkoch des Restaurants, der zugleich auch der Besitzer ist, bei der Stadt die Genehmigung beantragt hat, auch draußen Tische aufzustellen.«
»Die bekommt er nie«, antwortete der Duc rasch und verschränkte die Arme vor der Brust, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Es gibt nicht ein einziges Restaurant mit Terrasse in diesem Viertel.«
»Das mag ja sein«, erwiderte Mme Dreyfus. »Aber die neue Bürgermeisterin, so heißt es, soll mehr für die Geschäftsleute übrig haben und weniger für …«
»… die Anwohner.«
»Genau«, bestätigte sie. Die Beifügungen »privilegiert« und »adlig« sparte sie bewusst aus.
»Doch der Brunnen«, fuhr er fort, »steht unter Denkmalschutz.«
»Formal gesehen, liegt der Brunnen auf dem Grundstück des Restaurants, wenn der Garten auch uns allen gehört.«
»Schon meine Eltern haben dort Wasser geholt.«
Er meint sicher, sie haben ihre Diener zum Wasserholen geschickt, dachte Mme Dreyfus bei sich. »Das mache ich noch heute«, sagte sie stattdessen.
»Kann man es denn trinken?«
»Natürlich, es wird jedes Jahr kontrolliert«, stellte sie fest. »Wie alle Naturbrunnen.«
»Wenn das so ist …, was können wir dagegen tun?«
»Das ist ein Grund, weshalb ich zu Ihnen komme. Ich bin Mitglied der Historischen Gesellschaft von Aix, und wir möchten Sie um Ihre Hilfe bitten.«
»Natürlich, jederzeit«, antwortete der Duc leicht abwesend.
Mme Dreyfus musste lächeln. »Ich habe soeben erst angefangen, die anderen Nachbarn zu informieren«, fuhr sie fort. »Bénédicte und Serge Tivolle, die direkt neben dem Restaurant wohnen, kennen die Pläne des Chefkochs bereits … Bénédicte ist die Schatzmeisterin unserer Historischen Gesellschaft. Ich habe auch mit Thomas und Stéphanie Roche gesprochen, die ebenfalls in der Nähe des Restaurants wohnen, und mit Marine Bonnet. Professor Bonnet lehrt an der Universität Jura und wohnt ganz oben in dem Haus dort drüben.« Mme Dreyfus zeigte auf ein Appartement etwa in der Mitte des Gartens. Auf der dazugehörigen großen Terrasse gab es Kletterrosen, einen Jasminbusch, der sich um das Geländer rankte, und zwei Olivenbäume in Töpfen.
»Eine Juraprofessorin …«, murmelte der Duc. Vor Jahren waren sie sich einmal bei einem Abendessen begegnet. Ein interessantes Gespräch und ein lautes Lachen fielen ihm ein.
»Ja, sie hat kürzlich geheiratet – den Untersuchungsrichter von Aix.« Bei diesen Worten strahlte die Antiquitätenhändlerin, als hätte sie die Siegerantwort in einer Quizshow gewusst. Da ging die Tür zum Haus des Ducs auf, und der Duft von Käse und Eiern drang heraus. »Tut mir leid«, sagte Mme Dreyfus rasch, als sie Manuel Arruda in seiner gestärkten Schürze an der Tür zur Küche stehen sah. »Ich glaube, Ihr Mittagessen ist fertig.«
Der Duc wandte sich um und winkte Manuel zu. »Ich komme gleich!«, rief er. Gern hätte er Mme Dreyfus zum Essen eingeladen, aber er wusste nicht, wie viel Omelett oder Soufflé Manuel zubereitet hatte.
»Montaigne hat Zitate in die Deckenbalken seiner Bibliothek ritzen lassen«, sagte Bruder Joël, nachdem er einen Schluck von dem starken heißen Kaffee genommen hatte. »Ich bin oft dort gewesen, meine Großeltern haben in der Nähe gewohnt.«
»An die Bibliothek mit den geschnitzten Balken kann ich mich erinnern«, antwortete der Duc und hielt dem Mönch den Teller mit Plätzchen hin. »Aber ich weiß nicht mehr, was darauf stand.«
»Es waren Zitate von römischen Philosophen, darunter ein Ratschlag Senecas für ein gutes Leben.«
»Dieses Thema hat Montaigne sehr interessiert.«
»So ist es«, bestätigte Bruder Joël. »Dort heißt es, wenn man sich im Alter bedrückt oder gelangweilt fühlt, soll man sich dafür interessieren, wie vielgestaltig und erhaben die Dinge sind, die einen umgeben …«
»Ein Garten zum Beispiel«, sagte der Duc rasch.
»Ihre Rosen«, fügte Bruder Joël hinzu und schaute zu der Lady Banks hinauf. »Oder die historischen Gebäude von Aix.«
»Sie sollten sämtliche Bilder von Cézanne im Musée Granet sorgfältig studieren.«
Die beiden Männer mussten lachen, und jeder nahm sich ein Plätzchen von dem Porzellanteller, den Manuel ihnen hingestellt hatte. Das Museum von Aix besaß nur zehn Arbeiten vom berühmtesten Sohn der Stadt, dazu ziemlich unbedeutende.
Der Duc kaute eine Weile und fragte dann: »Wollen Sie mir sagen, dass ich bedrückt wirke? Oder gelangweilt?«
»Nein«, antwortete Bruder Joël nach kurzem Zögern. »Aber ich fürchte, etwas bereitet Ihnen Sorgen.«
Es war jetzt über ein Jahr her, dass Bruder Joël und der Duc begonnen hatten, fast täglich um fünf Uhr miteinander Kaffee zu trinken. Die teils gotische, teils romanische Kirche Saint-Jean de Malte hatte ebenfalls Anteil an dem gemeinsamen Garten. Ihr Zugang war eine kleine Holztür von der Rue Cardinale auf der Straßenseite gegenüber der Kirche. Der Duc hielt sich nicht gerade für gläubig oder gar fromm, aber er war so daran gewöhnt, zur Messe zu gehen, dass es ihm unmöglich schien, darauf zu verzichten, als sollte er kein Frühstück mehr zu sich nehmen oder sich nicht mehr waschen. Die aus Bayern stammende Marguerite war tief gläubig gewesen und hatte schön gesungen. Wenn er also jetzt zur Kirche ging, dann mehr, um dem Chor zu lauschen und Pater Jean-Lucs nachdenklich stimmenden Predigten zuzuhören, als sich bekehren zu lassen. Aber in Saint-Jean de Malte wurde niemand bekehrt, und obwohl der Duc Pater Jean-Luc bewunderte, fühlte er sich mehr zu dem jungen Bruder aus der Gascogne hingezogen, der seit zwei Jahren in der Kirche tätig war und wie der Duc neben anderen Fächern Geschichte studiert hatte.
Der Duc blickte seinen jungen Freund offen an und sagte: »Ich hatte ein ziemlich unangenehmes Gespräch mit meinem Arzt.«
Für einen Moment ließ Bruder Joël den Kopf sinken. Dann erwiderte er den Blick. »Das tut mir leid. Hat der Doktor eine Prognose gestellt?«
»Noch nicht«, antwortete der Duc. »Er braucht noch ein paar von diesen hässlichen Untersuchungen. Und bevor Sie mir sagen, ich sollte mir keine Sorgen machen: Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Wie Ihr Landsmann Montaigne. Ich erinnere mich nicht mehr, was auf seinen geschnitzten Deckenbalken stand, aber ich weiß, was er über den Tod gesagt hat: Man soll keine Sekunde lang an ihn denken.«
»Also ihn auch nicht fürchten«, fügte Bruder Joël rasch hinzu und versuchte ein Lächeln. »Möchten Sie trotzdem darüber reden?«
»Mich erleichtern?«, fragte der Duc. »Bevor …«
»So habe ich das nicht gemeint«, erwiderte Bruder Joël.
»Zur Beichte bin ich seit Jahren nicht gewesen. Seit Jahrzehnten.«
»Wir können das auch hier machen.«
»Im Garten?«, fragte der Duc und ließ den Blick über seine akkurat beschnittenen Hecken schweifen. »Meinetwegen. Es gibt da tatsächlich etwas, das ich Ihnen beichten möchte. Aber nicht heute. Doch auf das Schlimmste sollte ich mich schon vorbereiten. Wenn nötig, auch auf den Tod.«
»Ich an Ihrer Stelle …«
Der Duc musste lachen. »Zitieren Sie schon wieder Montaigne? Was hat er dazu geschrieben? ›Wenn du nicht weißt, wie man stirbt, sorge dich nicht. Die Natur wird es dich lehren. Sie vermag das wunderbar.‹«
2. Kapitel Die Welt aus der Sicht von Philomène Joubert
»Darf ich Ihnen gratulieren, Marine?«, sagte Philomène Joubert. Sie standen nebeneinander am selben Marktstand und beschauten den einheimischen Frühlingsspargel.
»Oui, merci beaucoup, Mme Joubert«, antwortete Marine mit einem Lächeln, nahm Mme Jouberts Hand und drückte sie. »Wir hatten eine kleine Hochzeitsfeier«, fügte sie rasch für den Fall hinzu, Philomène Joubert könnte denken, sie hätte den ganzen Chor von Saint-Jean de Malte einladen sollen. »In Italien …«
»Ihre Mutter hat uns Fotos gezeigt, letzten Sonntag vor der Messe«, erklärte Philomène.
»Tatsächlich?« Marine verbarg ihre Überraschung nicht. Was ihre Eltern betraf, so hätte sie bei ihrer Mutter am wenigsten Emotionen oder gar Begeisterung erwartet, besonders wenn es um sentimentale Dinge ging.
»Ja, ja«, rief Philomène. »Und Sie waren wunderschön.« Sie griff nach einem Bund Spargel und prüfte ihn sorgfältig. »Mme Martin«, rief sie und hielt das Bund hoch. »Haben Sie auch weißen?«
Marine lächelte in sich hinein. Sie hoffte, dass Mme Martin weißen Spargel für ihre Nachbarin vorrätig hatte und sie selbst mehr von dem grünen für das heutige Abendessen bekam. Über den hatte sie eine ältere Frau ins Bild gesetzt, die ihn aus einer kleinen Gondel in Venedig verkaufte. »Risotto, Risotto«, hatte sie dabei gerufen, und Marine hatte ihr den ganzen Vorrat abgekauft.
Mme Martin hielt der Kundin ein Bund dicker weißer Spargelstangen hin. Philomène musterte auch diese genau, nickte dann und ließ sie in ihrem Baumwollbeutel verschwinden. »Und dieses Schmuckstück von rosafarbener Kirche, die wirkte, wie aus Zucker gemacht oder wie eine Hochzeitstorte.« Sie musste über ihre Worte lachen, und Marine tat es ihr gleich.
»Schön, jemanden lachen zu hören«, konstatierte Mme Martin. »Bisher habe ich heute Morgen nur trübe Gesichter gesehen.«
»Tatsächlich?«, fragte Philomène. »Bei dem schönen Wetter?«
»Die Leute haben Langeweile«, stellte Mme Martin nüchtern fest.
Marine griff sich drei Bund der dünnsten grünen Spargelstangen, die sie finden konnte, und legte sie in ihren Korb. Philomène Joubert runzelte die Brauen. »Der hat aber nicht das gleiche Aroma wie der weiße.«
»Da haben Sie wohl recht«, antwortete Marine mit einem Lächeln.
»Den Leuten ist langweilig«, fuhr Mme Martin fort und redete sich warm.
»Wem ist langweilig?«, fragte Philomène, die inzwischen die frischen Artischocken inspizierte.
»Wenn man nichts zu tun hat, kriegt man Depressionen«, erklärte Mme Martin. »Schauen Sie sich doch um. Ich habe mindestens sieben, acht Freundinnen, die jeden Grund hätten, glücklich zu sein. Sie sind gesund, haben ein Dach über dem Kopf, leben in einem sicheren Land. Und trotzdem fühlen sie sich nicht wohl. Was fehlt ihnen denn?«
»Vielleicht …«, hob Philomène an.
»Ich sage es Ihnen«, unterbrach sie Mme Martin. Sie hielt ihre Hand hoch und zählte an den Fingern ab: »Nummer eins: Kinder, zumindest ein Kind. Wenn man sich um einen anderen Menschen kümmern muss, dann kann man nicht dauernd über die eigenen Problemchen nachgrübeln.«
»Ich habe drei wunderbare Söhne«, warf Philomène ein.
»Nummer zwei: Wenn man keine Kinder kriegen kann, und solche Leute gibt es viele, dann muss man eine Arbeit machen, die einem gefällt.«
Philomène hatte ihren Ehemann vierzig Jahre lang in seiner kleinen Druckerei unterstützt, und sie hatte es gern getan. Aber das behielt sie für sich. Sie warf Marine einen Blick zu, die lächelnd nickte. Eine frisch Vermählte, dachte sich Philomène. Schwebt im siebenten Himmel.
»Und wenn man beides nicht hat, dann braucht man ein Hobby«, kam es von Mme Martin. »Une passion!«
»Meine Passion ist es jetzt, schnell nach Hause zu kommen und diesen Spargel zu kochen!«, rief Philomène und reichte Mme Martin ein paar Münzen.
Marine griff nach einem Dutzend kleiner violetter Artischocken. Sie hatte beschlossen, sich an deren Zubereitung zu wagen, weil sie so gut zu der Lammkeule passten, die sie für ihr Abendessen plante. Sie zahlte rasch bei Mme Martin. Die hatte sich inzwischen einer anderen Kundin zugewandt, die etwas zu dem Thema sagen wollte. Sie hatte in einem Frauenmagazin einen Artikel darüber gelesen, wie wichtig es war, immer in Bewegung zu bleiben.
»Gehen Sie jetzt in Ihre Wohnung zurück?«, fragte Philomène. »Dann haben wir den gleichen Weg.«
»Stimmt«, erwiderte Marine.
»Werden Sie sie verkaufen?«
Marine musste schmunzeln. Dass ihre Nachbarin etwas so Privates fragte, wunderte sie nicht. Philomène Joubert war bekannt für ihre leicht aufdringliche Art. »Wir können uns nicht entscheiden«, sagte Marine. »Wir lieben beide unsere Wohnungen.«
»Ein echtes Luxusproblem.«
»Ein typisches Erste-Welt-Problem, würden meine Studenten sagen«, ließ Marine hören, als sie die Rue Thiers entlanggingen. »Wir können uns nicht beklagen und sind sehr glücklich.«
Philomène nickte zustimmend. »Wie sich diese Mme Martin aufgespult hat! Ist doch klar, dass es einem gutgeht, wenn man zu tun hat. Natürlich war auch ich hin und wieder traurig, zum Beispiel als unser François seine erste Frau verlor oder als wir unsere Druckerei endgültig geschlossen haben. Aber ich sage mir immer: ›Philomène, tue jeden Tag eine nützliche Sache.‹ Nur eine. Dann stehe ich eben auf und backe einen Kuchen oder erledige das Bügeln. Am nächsten Tag tue ich etwas mehr, und schon ist die Leere überwunden.«
Marine nickte. Ihr gefiel, dass Philomène von Leere statt von Trauer gesprochen hatte. Leere war das passendere, das stärkere Wort. Das nagende Gefühl in der Magengrube war wieder da. Es kam und ging schon die zweite Woche, aber sie hatte noch niemandem etwas davon gesagt. Es meldete sich, wenn sie es am wenigsten erwartete. Zum Beispiel in Augenblicken wie diesem, wenn sie zufrieden mit einer Nachbarin in der Morgensonne spazierte. »Zum Teil hatte Mme Martin recht«, sagte sie nun. »Als sie von der Passion, der Leidenschaft, gesprochen hat. Ich habe eine gute Arbeit, aber ich bin nicht sicher, wie sehr ich sie mag.«
»Sie würden sie keine Leidenschaft nennen?«, fragte Philomène und runzelte die Brauen, weil gerade zwei Schülerinnen vorüberkamen, die im Gehen Croissants aßen. »Bon appétit, les filles!«
»Sie haben keinen Ort, wo sie sich zum Essen niedersetzen können«, stellte Marine zur Verteidigung der Mädchen fest. »Wir brauchen mehr Bänke und Grünanlagen in der Stadt.« Wieder spürte sie einen Stich im Magen. Es kam ihr ein wenig merkwürdig vor, über ihre Arbeit mit jemandem zu sprechen, den sie nicht besonders gut kannte, statt mit Antoine, Sylvie oder ihren Eltern. Aber vielleicht war Philomène gerade deshalb eine geeignete Gesprächspartnerin. »Nein, meine Arbeit ist nicht mehr meine Leidenschaft. Sie war es einmal. Aber ich habe ein Hobby, das ich sehr mag.«
»Und was wäre das?« Philomène wusste, dass Marine Bonnet sehr kultiviert und gebildet war, ebenso ihr Ehemann. Sie hoffte, sie werde Professor Bonnets Antwort verstehen und diese werde sich nicht zu hochgestochen ausdrücken.
»Das Schreiben«, verkündete Marine.
»Aber das müssen Sie als Professorin doch auch, nicht wahr?« Philomène war froh, eine Antwort gefunden zu haben, und wurde gleich viel selbstsicherer.
»Ja, aber keine Artikel zu Rechtsfragen. Ich möchte über das Leben anderer Menschen schreiben.«
»Über das berühmter Leute?« Philomène konnte sich nicht vorstellen, dass Marine Bonnet über Filmstars oder Fußballer schrieb.
»Ja, ich wäre gern Biografin. Ich habe begonnen, das Leben von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre zu recherchieren. Ich möchte ein Buch über ihre Beziehung schreiben.«
Vor Staunen blieb Philomène Joubert mitten auf dem Gehweg stehen. Sie ließ einen Pfiff hören und meinte dann: »Ein Buch mit den Bettgeschichten dieser beiden wollen Sie verkaufen? So einen Schweinkram kriegen Sie nie los, Mme Verlaque!«
»So schlüpfrig war es vielleicht gar nicht«, entgegnete Marine.
»Na, na«, rief Philomène und drohte mit dem Finger. »Die hat es doch mit ihren Studenten getrieben …«, flüsterte sie und trat ganz nahe an Marine heran. »… und sogar mit den Studentinnen!«
Marine gab sich Mühe, nicht von ihr abzurücken. So sehr sie die Arbeitsmoral und die offene Beziehung der beiden bewunderte (die bei ihnen funktionierte, bei ihr selber aber auf gar keinen Fall), fühlte auch sie sich davon abgestoßen, dass Simone de Beauvoir mit ihren Studenten, ob männlich oder weiblich, geschlafen hatte. Aber sie wollte kein moralisches Urteil fällen. Sie wollte forschen und lesen, so viel sie konnte, und dann die Tatsachen vor den Lesern ausbreiten. War das nicht die Aufgabe eines Biografen? Selbst ihr geliebter Montaigne räumte ein, dass er nicht alle Antworten kannte. Er hatte beobachtet, Fragen gestellt und geschrieben, häufig in Sätzen, die mit den Worten endeten: »Aber eigentlich weiß ich es nicht genau.« Das Problem war nur, dass Marine Bonnet es wissen wollte. Verunsicherung zuzugeben ging ihr gegen den Strich. Das war einer der Gründe, weshalb Antoine Verlaque ihr so guttat: Er half ihr, die Dinge gelassener zu sehen, weniger perfekt sein zu wollen, entspannter durchs Leben zu gehen.
Bear Valets lief die Rue Thiers entlang, die Arme weit von sich gestreckt, denn er schleppte zwei große Taschen mit Artischocken aller Sorten und Größen, als er die beiden Frauen vor sich sah, die ins Gespräch vertieft dahinschlenderten. Er musste langsamer gehen, blieb schließlich stehen, setzte die eine der schweren Taschen ab und schaute auf die Uhr. Es war fast neun. Er nahm die Artischocken wieder auf und ging hinter den Frauen her. Die größere und jüngere gehörte zu den Gästen seines Restaurants, die er besonders mochte. Er wusste ihren Namen nicht, aber sie kam immer mit einem Kerl, der eine gebrochene Nase hatte und daher nicht gerade von klassisch gutem Aussehen war, aber Bear faszinierte. Er wirkte Respekt einflößend und seriös zugleich (besonders, wenn er die Weinkarte studierte, die viele italienische Spitzenweine enthielt). Doch wenn er die Frau über den Tisch hinweg ansah, dann war er nur noch ein sehr verliebter Mann.
Valets arbeitete in einer offenen Küche, wie er es von London her kannte, und warf gern einen Blick auf seine Gäste, sobald er die Gelegenheit dazu hatte. Wenn die letzten mit dem Hauptgang fertig waren, machte er seine Runde durch den kleinen Gastraum. Mit diesem Paar hatte er bereits mehrmals gesprochen, wobei ihm die noch neu glänzenden Eheringe aufgefallen waren. Sie spielte mit ihrem, als müsste sie sich noch daran gewöhnen, bei ihm hingegen sah es aus, als trüge er ihn schon eine Ewigkeit. Sie hatten viele Fragen zu seinen Gerichten. Und wie stets wollten auch sie wissen, wie er, ein junger französischer Koch, zu dem englischen Namen Bear gekommen war. »Als ich nach dem Gymnasium nach England ging, konnten die Kumpels dort meinen Namen Sigisbert nicht aussprechen«, antwortete er. »Seitdem bin ich Bear.«
Er hatte in der Tat etwas von einem Bären, stellten Marine und Verlaque auf dem Rückweg zu Marines Wohnung fest. Der Chefkoch war von untersetzter, kräftiger Gestalt, hatte den Kopf voller dichter schwarzer Locken, dazu Koteletten, die nur wenige Millimeter vor seinen breit lächelnden Mundwinkeln endeten. Er gefiel Antoine Verlaque sofort.
Bear Valets, der in Aix geboren und aufgewachsen war, hatte das Gymnasium mit einer Punktzahl von 18,5 in den Hauptfächern absolviert. Statt sich an einer französischen Hochschule in Medizin oder Pharmazie zu bewerben, verließ er Frankreich und ging nach London, um am dortigen University College Biologie zu studieren. Englisch war immer eines seiner Lieblingsfächer gewesen. Er hatte die Sommerferien bei Familien in Wales, Wyoming und Yorkshire verbracht, um seine Sprachkenntnisse zu vervollkommnen. Er kam gut durch das erste Studienjahr, aber mitten im zweiten schlug die Rezession zu, und sein Vater verlor seine Arbeit als Direktor eines kleinen Pharma-Betriebes in Frankreich. Bear gab sich alle Mühe, mit seinem mageren Stipendium auszukommen, aber es reichte nicht, um weiter im Zentrum von London zu wohnen oder die Fahrkarten für den Pendlerzug in einen Vorort zu bezahlen. »Mach es wie ich«, hatte ihm sein Mitbewohner, ein brillanter indischer Student, geraten. »Such dir einen Nebenjob in einem Restaurant.«
Jetzt wusste Bear wieder, warum ihn die Frau so faszinierte, dass er ihr an diesem Morgen langsam durch die Rue Thiers folgte und dabei riskierte, zu spät in sein Restaurant zu kommen. Sie erinnerte ihn an Jane. Jane Clark war seine inspirierende Chefin im Cavolo Nero, einem schicken Restaurant an der Themse, gewesen. Er war im Bus daran vorübergefahren, hatte den Namen und die hellblauen Markisen vor den großen Fenstern des Gebäudes gesehen, das einmal eine Fabrik gewesen war. Er hatte den Halteknopf gedrückt, war aus dem Bus gesprungen und um halb sechs Uhr abends in das Restaurant marschiert, eine zusammengelegte Kurzbiografie in der Gesäßtasche. Jane und Judith hatten am Tresen gestanden, zwei Tässchen mit einem starken Espresso vor sich, und waren mit Stift und Radiergummi die Abendkarte durchgegangen. Er erkannte sie sofort wieder, denn er hatte im »Guardian« einen Artikel über sie gelesen. Jane und ihre Geschäftspartnerin Judith Hodges, das einzige Chefköchinnen-Duo von London, hatten sich dadurch einen Namen gemacht, dass sie rustikale italienische Küche, die Jane von ihrer italienischen Schwiegermutter kannte, auf die öden, verstaubten, von den Alt-Herren-Klubs beeinflussten Londoner Speisekarten brachten. Bear Valets tat so, als spiele er mit seinem Handy, während er ihrem Gespräch lauschte.
»Für den Artischockensalat nehmen wir Capri-Rucola. Haben wir genug davon?«, hatte Jane gefragt.
»Ja«, war Judiths Antwort gewesen. »Es reicht gerade so.« Jane war groß und schlank mit kastanienbraunem Haar, Judith hingegen klein, mit einer schwarzen Igelfrisur und olivfarbenem Teint.
Das Mittagsmenü stand noch auf dem weißen Marmortresen. Bear steckte sein Handy ein und schaute es sich genauer an. Das war wie eine Reise nach Italien, die er mit seiner Familie so oft unternommen hatte. Die kantigen, gestreiften Zucchini für die Suppe kamen aus einem Garten in Suffolk, die Linguine mit Miesmuscheln wurden mit einem seltenen Wein aus Ligurien namens Pigato zubereitet, das gebratene Biohähnchen war mit Mascarpone und Rosmarin gefüllt. Bei Mascarpone fiel ihm ein dicker Sahnequark ein, aber da war er sich nicht sicher.
»Können wir Ihnen helfen, junger Mann?«, fragte Judith und setzte ihr weißes Espressotässchen ab.
In dem Gastraum roch es nach Kräutern und Olivenöl, von der Küche drang Tellerklappern und Gelächter herüber. Durch die Fenster auf der Rückseite des Hauses, die er von der Straße her nicht gesehen hatte, ging der Blick in einen Garten und auf die rasch dahinströmende Themse hinaus, die, wie er wusste, je nach den Gezeiten in beide Richtungen fließen konnte.
»Ich möchte bei Ihnen arbeiten«, entfuhr es ihm. »Was Sie wollen«. Er trat an die beiden Frauen heran, schüttelte ihnen die Hand, zog seine Kurzbiografie hervor und entschied, sie der netteren von beiden, Jane Clark, zu geben. Die las sich die wenigen Zeilen in aller Ruhe durch, während Judith Bear mit leicht hochgezogenen Augenbrauen musterte. »Haben Sie schon mal in einem Restaurant gearbeitet?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete Jane, bevor Bear etwas sagen konnte.
»Ich bin Student am University College«, sagte Bear mit belegter Stimme. »Ich bin Franzose und habe das Abitur mit 18,5 Punkten gemacht.«
»Niemand macht ein französisches Abitur mit 18,5 Punkten«, warf Judith ein. »Das weiß sogar ich.«
Jane hielt ihr Bears Vita hin.
»Mein Vater hat seine Arbeit verloren«, fuhr Bear fort und schaute Jane in die sympathischen grünen Augen. »Ich brauche das Geld. Ich bin ein guter Arbeiter und liebe die italienische Küche. Ich mache, was Sie wollen.«
Er glaubte, in Judiths Mundwinkeln ein kleines Grinsen zu entdecken, aber Jane legte ihrer Kollegin die Hand auf die Schulter. »Geben Sie uns eine Sekunde … Wie spricht sich Ihr Name aus?«
»Si-gis-bert. Aber an der Uni nennen sie mich nur Bear.«
»Das passt«, sagte Judith. Die beiden Frauen kamen hinter dem Tresen hervor und zogen sich in die Küche zurück. Da die Tür halb offen stand, konnte er sie miteinander reden sehen. Im Hintergrund holten ein paar Angestellte, meist jung und sehr gutaussehend, Gemüse aus Kisten oder hackten Kräuter. Er sah, wie Judith die Hände hob und dann etwas zu einem jungen Mann sagte, der mit einem Fisch hantierte. Jane kam zurück und lächelte. »Haben Sie heute Abend Zeit? Uns fehlt eine Person. Ich wollte gerade meinen Mann zu Hilfe rufen.« Sie wies zur Decke hinauf. »Er hat oben sein Architekturbüro.«
Bear lächelte breit. Ihr Humor gefiel ihm. Der berühmte, sogar sehr berühmte Architekt im Obergeschoss war ihm bekannt, denn auch von ihm war in dem Zeitungsartikel die Rede gewesen. »Ja, ich kann sofort anfangen.«
»Sie räumen die Tische ab«, erklärte Jane. »Jamie – der Junge dort drüben mit dem struppigen blonden Haar – weist Sie ein. Bei uns geht es locker zu – das Bedienungspersonal hilft auch in der Küche aus. Ist das für Sie okay?«
»Sì!«, gab Bear grinsend zurück.
»Na, wunderbar«, antwortete Jane. »Haben Sie Fragen, bis Jamie eine passende Schürze für Sie findet?«
Bear biss sich auf die Zunge, denn beinahe hätte er gefragt, ob alle Vornamen in diesem Restaurant mit J. anfingen. Stattdessen fragte er: »Was ist ein cavolo nero?«
3. Kapitel Das Abendessen
Marine trug ein kurzes weißes Kleid, das bis zum Busen eng anlag, von wo ein weiter Rock in mehreren Lagen herabfiel und knapp über den Knien endete. Das Material nannte man Batist mit Noppen, soweit sich Verlaque erinnerte. Zu seiner großen Enttäuschung war Marine nicht auf sein Angebot eingegangen, mit ihm zu einer Einkaufstour nach Paris oder Rom zu reisen. Stattdessen hatte sie das Kleid im Internet erstanden. Es hatte einen U-förmigen Ausschnitt und kurze Ärmel, die ihre Arme – schlank, leicht gebräunt und von Tausenden Sommersprossen bedeckt – gut zur Geltung brachten. Er hob das Album ganz dicht vor sein Gesicht, um seine Angetraute genau in Augenschein zu nehmen. In den Händen hielt sie einen Strauß rosa und weißer Pfingstrosen, die sie an einem Stand neben einer Tankstelle gleich hinter der Grenze gekauft hatten. Es war Pfingstrosenzeit, und Marine hatte vergessen, in Aix Blumen zu besorgen. Sie hatten ganze fünfzehn Euro gekostet. Marine hatte sie mit einem Picknickmesser aus Verlaques Handschuhfach kurz geschnitten und mit einem Gummiband aus ihrem Haar zusammengebunden. Im Hotel angekommen, hatte sie den Strauß zum Frischhalten ins Waschbecken gelegt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: