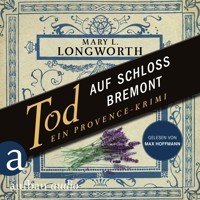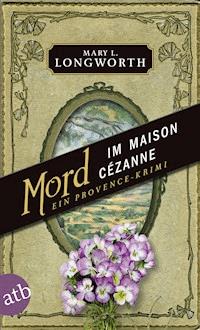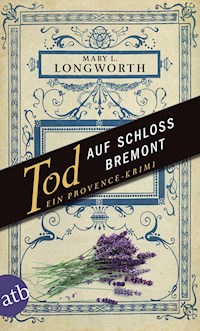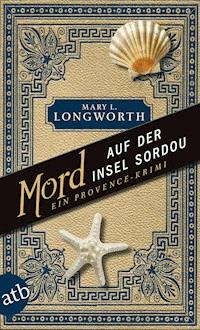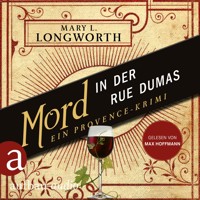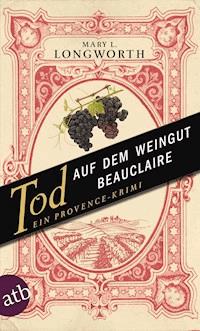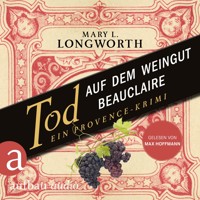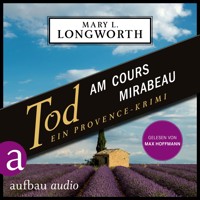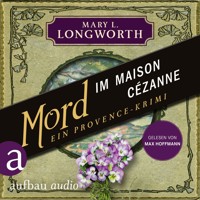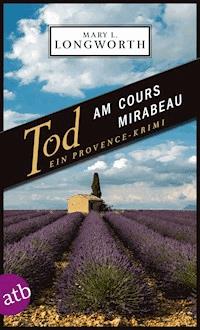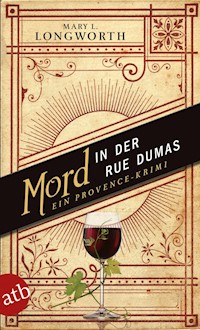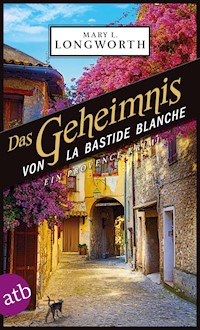
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Verlaque & Bonnet ermitteln
- Sprache: Deutsch
Das Geisterhaus in der Provence.
Der weltberühmte Schriftsteller Valère Barbier zieht in sein neues Haus, Bastide Blanche, ein altes romantisches Anwesen in der Provence. Doch schon bald merkt er, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Er verbringt keine einzige ruhige Nacht in seinem neuen Zuhause. Als sein Stiefsohn entführt wird, holen Barbier die Geister der Vergangenheit ein, und er muss sich mit alten Geheimnissen auseinandersetzen. War wirklich ein Unfall die Ursache für den Tod seiner Frau Agathe?
Antoine Verlaque, Marine Bonnet und Bruno Paulik begeben sich wieder auf eine unheimliche Spurensuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Mary L. Longworth
Mary L. Longworth lebt seit 1997 in Aix-en-Provence. Sie hat für die »Washington Post«, die britische »Times«, den »Independent« und das Magazin »Bon Appétit« über die Region geschrieben. Außerdem ist sie die Verfasserin des zweisprachigen Essay-Bandes »Une Américaine en Provence«. Sie teilt ihre Zeit zwischen Aix, wo sie schreibt, und Paris, wo sie an der New York University das Schreiben lehrt. Im Aufbau Taschenbuch erschienen bisher »Tod auf Schloss Bremont« (2012), »Mord in der Rue Dumas« (2013), »Tod auf dem Weingut Beauclaire« (2014) und »Mord auf der Insel Sordou« (2015).
Dr. Helmut Ettinger ist Dolmetscher und Übersetzer für Russisch, Englisch und Chinesisch. Er übersetzte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, Gusel Jachina, Polina Daschkowa, Darja Donzowa und Sinaida Hippius, Michail Gorbatschow, Henry Kissinger, Roy Medwedew, Valentin Falin, Antony Beevor, Lew Besymenski und viele andere ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Das Geisterhaus in der Provence.
Der weltberühmte Schriftsteller Valère Barbier zieht in sein neues Haus, Bastide Blanche, ein altes romantisches Anwesen in der Provence. Doch schon bald merkt er, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Er verbringt keine einzige ruhige Nacht in seinem neuen Zuhause. Als sein Stiefsohn entführt wird, holen Barbier die Geister der Vergangenheit ein, und er muss sich mit alten Geheimnissen auseinandersetzen. War wirklich ein Unfall die Ursache für den Tod seiner Frau Agathe? Antoine Verlaque, Marine Bonnet und Bruno Paulik begeben sich auf eine unheimliche Spurensuche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mary L. Longworth
Das Geheimnisvon La Bastide Blanche
Ein Provence-Krimi
Aus dem Amerikanischenvon Helmut Ettinger
Inhaltsübersicht
Über Mary L. Longworth
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel: New York City, 22. September 2010
2. Kapitel: New York City, 22.September2010
3. Kapitel: Aix-en-Provence, Sonntag, 4.Juli2010
4. Kapitel: Aix-en-Provence, Montag, 5.Juli2010
5. Kapitel: New York City, 22.September2010
6. Kapitel: New York City, 22.September2010
7. Kapitel: Aix-en-Provence, Montag, 5.Juli2010
8. Kapitel: New York City, 22.September2010
9. Kapitel: Aix-en-Provence, Dienstag, 6.Juli2010
10. Kapitel: New York City, 22.September2010
11. Kapitel: Aix-en-Provence, Dienstag, 6.Juli2010
12. Kapitel: New York City, 22.September2010
13. Kapitel: Aix-en-Provence, Mittwoch, 7.Juli2010
14. Kapitel: Aix-en-Provence, Mittwoch, 7.Juli2010
15. Kapitel: New York City, 22.September2010
16. Kapitel: Paris, Donnerstag, 8.Juli2010
17. Kapitel: New York City, 22.September2010
18. Kapitel: Aix-en-Provence, Freitag, 9.Juli2010
19. Kapitel: New York City, 22.September2010
20. Kapitel: Aix-en-Provence, Freitag, 9.Juli2010
21. Kapitel: New York City, 22.September2010
22. Kapitel: Aix-en-Provence, Sonnabend, 10.Juli2010
23. Kapitel: Aix-en-Provence, Sonnabend, 10.Juli2010
24. Kapitel: Aix-en-Provence, Sonntag, 11.Juli2010
25. Kapitel: New York City, 22.September2010
26. Kapitel: Paris und Aix-en-Provence, Montag, 12.Juli2010
27. Kapitel: Aix-en-Provence, Montag, 12.Juli2010
28. Kapitel: Aix-en-Provence, Dienstag, 13.Juli2010
29. Kapitel: New York City, 23.September2010
30. Kapitel: Aix-en-Provence, Dienstag, 13., und Mittwoch, 14.Juli2010
31. Kapitel: Aix-en-Provence, Mittwoch, 21.Juli2010
32. Kapitel: New York City, 23.September2010
Anmerkungen
Impressum
Für Kathy, Bev und Sue
Ich halt dich, du hältst mich
fest gepackt am Kinn.
Wer von uns als Erster lacht,
kriegt ’ne Schelle ’rin.
(Französisches Kinderspiel)
… wenn die Nacht ihre unheimliche Stille erklingen lässt.
Percy Bysshe Shelley, Alastor or The Spirit of Solitude
1. KapitelNew York City, 22. September 2010
Justin Wong war in New York City aufgewachsen, aber noch nie hatte er die Stadt so rasch und zielbewusst durchquert wie an diesem Nachmittag. Ihm schien, er könnte fliegen. Erst vor sieben Jahren hatte er die Fakultät für Geisteswissenschaften der New York University absolviert. Und heute, als Angestellter eines großen Verlages, wenn auch nur als kleiner Lektoratsassistent, war er drauf und dran, einen der berühmtesten Schriftsteller der Welt kennenzulernen. 1982: Prix Goncourt. 1986: Ritter der Französischen Ehrenlegion. 1987: auf der Shortlist für den Nobelpreis. Millionen verkaufter Bücher, Übersetzungen in 42 Sprachen. Justin blieb kurz stehen. Die Hände in die Hüften gestützt und leicht vornübergebeugt, rang er nach Luft. Vermassele es nicht, ermahnte er sich. Dieser Deal muss gelingen. Dann vergeben dir Dad und Mom vielleicht, dass du nicht Medizin studiert hast.
Er richtete sich auf und warf einen Blick auf sein Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe. Mittelgroß, schlank, das pechschwarze Haar frisch geschnitten. Für diesen Abend war er in nagelneue Sachen geschlüpft (Chinos, ein frisch gebügeltes weißes Baumwollhemd und, um besonders flott zu wirken, eine blau-grün karierte Weste und dazu elegante blaue Lederhalbschuhe, die selbst im Ausverkauf noch zu teuer waren). Er war bereit.
Am Flatiron bog er ab und wurde immer langsamer, je näher er der East Twentieth Street kam. Er kannte die Gegend gut, mit ein paar Freunden besuchte er ab und zu einen billigen Jazzklub in der Nähe. Die Verlegerin hatte Justin zu sich gerufen, um über den Ort dieses Treffens zu beraten. Sie entschieden sich für ein Restaurant, das für seine Küche und sein reiches Angebot an französischen Weinen berühmt war. Man wusste, dass dieser Autor Wein und Zigarren schätzte. Justin mochte beides, aber nicht deshalb hatte man ihn für diese Begegnung ausgewählt. Eigentlich hätten der Verlagsdirektor oder die Verlegerin persönlich hingehen müssen. Doch der große Autor selbst hatte ausgerechnet ihn, Justin, ausgewählt. Von dessen Anwalt ging ein Brief auf altmodischem Papier mit Prägedruck in New York ein. Justin schritt jetzt langsamer aus, denn er war eindeutig zu früh. Ein breites Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er sich zum millionsten Mal die Sätze ins Gedächtnis rief: »Mein Mandant, Valère Barbier, möchte Mr. Justin Wong, einen Angestellten Ihres hoch geschätzten Verlages, treffen. M.Barbier wird im September für drei Tage nach New York kommen. Merci beaucoup. Maître Guillaume Matton, 15 avenue Hoche, 75008, Paris.«
Der Brief war eine Überraschung für Justin ebenso wie für die Verlegerin, die ihn sofort zu sich befahl. (In dem großen Haus war er ihr noch nie begegnet.) »Haben Sie Barbiers Anwalt, diesen Maître Matton, etwa angerufen?«, fuhr sie ihn an und schritt aufgebracht in ihrem Büro hin und her. »Woher kennt er Ihren Namen? Sie können doch nicht einfach mit weltberühmten Autoren in Kontakt treten, ohne Ihre Vorgesetzte zu fragen!« Sie war hochrot im Gesicht, fast so rot wie die Chanel-Jacke, die sie trug. Justin schaute zu Boden, krampfhaft bemüht, ein Grinsen zu verbergen. Das kam wie von selbst, wenn ihm etwas Angst machte. Er wurde immer kleiner in dem Ledersessel, die schwitzenden Handflächen auf die Oberschenkel gepresst. Er musste das irgendwie erklären. Denk nach. Welche Verbindung besteht zu diesem französischen Schriftsteller? Er hatte ein Jahr an der Pariser Außenstelle der New York University studiert, aber in dieser Zeit kein einziges Buch von Valère Barbier gelesen. Die französischen Mädchen hatten ihn viel mehr interessiert. Außerdem hatte Barbier damals gerade das Genre gewechselt, was seine Kritiker entrüstete, ihm aber nur noch mehr Leser einbrachte.
Clothilde hatte diesen Vorgang für einen schlechten Witz gehalten. »Das ist so typisch für uns!«, rief sie bei einem Bier im Quartier Latin und lachte laut. »Wir Franzosen sind solche Snobs! Und Valère Barbier schleudert uns das mitten in unser Galliergesicht!« Sie hatte sich über den Tisch gebeugt und Justin die Wange getätschelt, daran erinnerte er sich genau. »Du bist so ein süßer kleiner New Yorker!«, hatte sie dabei gesagt. »So sü-ü-ü-ß, dass ich dich heute Abend glatt nach Hause mitnehme!«
»Clothilde!«, sagte er laut.
»Wie bitte?«, fragte die Verlegerin. »Wer ist Clothilde?«
»Clothilde ist eine junge Französin, die ich beim Studium in Paris kennengelernt habe«, setzte Justin zu einer Erklärung an. Das war die einzige Verbindung, die ihm einfiel. »Sie hat eine Arbeit über Barbier geschrieben.«
»Na und?«, gab die Verlegerin zurück. »Das haben bestimmt noch mehr Leute getan, zumindest bis Barbier die Orientierung verloren hat.«
»Clothilde hat ihn aufgesucht und eine Weile als eine Art Sekretärin für ihn gearbeitet. Erst vor ein paar Tagen hat sie mir eine merkwürdige E-Mail geschickt, auf die ich mir keinen Reim machen konnte …«
»Lesen Sie mir den Text vor!«
Justin griff nach seinem Smartphone und wischte über das Display, bis er die Mail gefunden hatte. Er las vor, wobei er das neckische Geplänkel am Anfang ausließ. »Justin, chéri, du wirst in Kürze dein Wissen über französische Weine auffrischen müssen. Davon kann deine Karriere abhängen. Küsschen!«
Die Verlegerin blieb stehen. »Das passt zu Barbier. Er hat einmal mit drei verschiedenen Verlegern ein Quiz über Weine veranstaltet, um zu entscheiden, bei wem er herauskommen will.« Sie schaute ihren jungen Lektor prüfend an. »Kennen Sie sich mit französischen Weinen aus? Ich trinke nicht.«
Justin nickte.
Sie schaute auf die Uhr. »In Paris ist jetzt schon Abend. Schicken Sie dieser Clothilde eine Textnachricht oder eine Mail. Fragen Sie sie, was da los ist.« Justin ging rasch sein Adressbuch durch, selbst erstaunt, dass er Clothildes Nummer noch fand. Er schrieb ihr die Nachricht, und während sie warteten, entdeckte er bei Facebook, dass Clothilde und er Freunde waren. Sie konnte also mit Leichtigkeit herausfinden, wo er angestellt war. Fotos oder Nachrichten hatten sie seitdem nicht gewechselt, aber auch er konnte ihren aktuellen Status einsehen. Sie arbeitete zurzeit für Canal+, eine der großen Film- und Fernsehgesellschaften Frankreichs. Das überraschte ihn nicht.
Minuten später piepte sein Smartphone. Die Verlegerin, die die ganze Zeit aus ihrem Fenster im elften Stock auf den Hudson River geschaut hatte, fuhr herum. Justin las Clothildes Text vor, natürlich ohne die erneute Anzüglichkeit: »Ich habe immer noch Kontakt zu Valère Barbier, cher Justin. In meinem Job bin ich ihm vor ein paar Tagen zufällig begegnet, und wir haben zusammen ein paar Mojitos getrunken. Stell dir das vor! Mojitos mit Barbier! Klingt wie ein Filmtitel, n’est-ce pas? Er hat mir erzählt, dass er mit seinem Verleger unzufrieden ist, einem großen Konkurrenten von euch. Da habe ich ihm deinen Namen gegeben. Sein nächstes Buch soll eine Autobiographie werden! Voilà! Und ich habe ihm gesagt, dass du Frankreich liebst.« Justin hielt einen Moment inne und sagte dann: »Das stimmt … und ich liebe seine neuen Bücher«, las er weiter, warf dann der Verlegerin einen Blick zu, zog eine Grimasse und schüttelte den Kopf. Den Rest behielt er für sich. Da stand: »Das Leben ist schön. Ciao, Darling! Du sü-ü-ü-ßer!« Die Verlegerin hatte inzwischen wieder Platz genommen und faltete die Hände auf der Schreibtischplatte. »So ist das also«, sagte sie dann. »Wer wird dem großen Mann widersprechen?« Justin konnte gar nicht glauben, dass sie ihm die Erlaubnis gab, die Sache zu übernehmen. Er sprang auf, schüttelte ihre Hand und dankte ihr überschwänglich.
Sie erwiderte seinen Händedruck und lächelte dabei. »Wie dumm ich doch als Studentin war.«
Justin schaute sie verständnislos an.
»Ich habe auch ein Jahr in Paris studiert. Aber eine Liebesaffäre hatte ich nicht.«
All das ging Justin durch den Kopf, als er das Restaurant erreichte. Er schaute auf die Uhr: Es war zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit. Er öffnete die schwere Glastür und trat ein. Die Verlegerin hatte um den abgeschiedensten Tisch gebeten. Justin stellte sich der langbeinigen Empfangsdame vor und folgte ihr, als sie ihn quer durch das fast leere Restaurant zu einem gemütlichen Separee führte. Es war in einem Goldton gehalten, hatte gedämpftes Licht, und an drei Wänden standen Regale voller Weinflaschen vom Boden bis zur Decke. Justin fürchtete, der Raum könnte nicht klimatisiert sein, aber vielleicht waren das ja billige Weine oder sehr häufig gewünschte Sorten. »Hier ist ein Vorhang, wenn Sie sich noch mehr zurückziehen wollen«, sagte die Dame und zupfte leicht an dem beigefarbenen Samt zu beiden Seiten des Eingangs.
»Danke«, sagte Justin. »Wir lassen ihn offen, bis mein … äh … Bekannter eintrifft.« Beinahe hätte er Valère Barbier seinen Freund genannt. So stark stand er schon unter dem Einfluss der hyperaktiven Clothilde. Zu sü-ü-ü-ß! »Er ist etwas älter. Um die sechzig. Mit dichtem weißem Haar und französischem Akzent.«
Die Empfangsdame nickte. »Möchten Sie etwas trinken, während Sie auf ihn warten?«
»Wasser, bitte.« Justin musste sich räuspern. Erst jetzt spürte er, wie nervös er war. »Mit Sprudel.« Eigentlich könnte ich mir mehr leisten, dachte er bei sich. Immerhin mein erstes Essen auf Verlagskosten.
»Das Sprudelwasser können Sie streichen«, ertönte da hinter der Angestellten eine markante Stimme. »Bringen Sie zwei Gläser vom Champagner des Hauses.«
Justin fuhr hoch, die Dame nickte dem Franzosen kühl zu und entfernte sich.
»Der Champagner des Hauses ist doch gut, oder etwa nicht?«, fragte Valère Barbier in perfektem Englisch mit einem schwachen französischen Akzent.
»Oui«, antwortete Justin und räusperte sich erneut. »Il est très bon.«
»Wir können Englisch miteinander sprechen«, erklärte Barbier. »Ich habe fünf Jahre lang in New York gelebt, um nach meinem berüchtigten Genrewechsel der französischen Presse zu entkommen.« Er lächelte. »Woher wissen Sie, dass der Champagner des Hauses gut ist?«
»Ich habe mir vorher die Weinkarte angeschaut. Er ist von Drappier.«
»Ausgezeichnet!«, rief Valère. »Sie haben Ihre … devoirs gemacht!«
»Meine Hausaufgaben. Das hoffe ich. Aber nehmen Sie doch Platz.«
Valère Barbier ließ sich dem Lektor gegenüber nieder. Dessen Jugend verblüffte ihn. Aber Clothilde hatte gesagt, Justin Wong sei ein Freund, sie mussten also etwa gleichaltrig sein. Das heißt, um die dreißig. Valère ging durch den Kopf, dass er selbst in diesem Alter bereits eine Menge erreicht hatte. »Ich mag Menschen über achtzig und unter dreißig. Eine meiner besten Freundinnen in Aix-en-Provence ist zehn. Die Jahre dazwischen sind voll von la merde! Wie alt sind Sie?«
»Neunundzwanzig«, erwiderte Justin. »Noch ein Jahr von la merde entfernt.«
Valère schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Was für eine Antwort! Sie sind ja ein Typ!«
Justin musste lächeln. Er fragte sich, ob der Autor bereits etwas getrunken hatte. Aber das spielte jetzt keine Rolle. Da kam die Dame mit zwei Gläsern Champagner zurück. Valère griff zu und nahm sie rasch vom Tablett. »Merci beaucoup!«
»Sagen Sie mir, welches meiner Bücher mögen Sie am meisten?«, fragte Valère, hob sein Glas und stieß kräftig mit Justin an. »Santé!«
»Also«, ließ Justin hören. »Als mir klar wurde, dass wir uns treffen werden, habe ich Ein ehrenwerter Mann angefangen.«
Valère beugte sich nach vorn. »Und sind Sie damit fertig?«
»Mit der Hälfte.«
»Sie erstaunen mich schon wieder! Sie lügen nicht und behaupten, Sie hätten alle meine Bücher gelesen?«
»Nein«, antwortete Justin.
Valère nahm einen großen Schluck Champagner. »Und warum haben Sie gerade zu diesem gegriffen?«
»Es ist Ihr erstes Buch, und Sie haben es geschrieben, als Sie so alt waren wie ich. Neunundzwanzig. Bevor Sie …«
»Bevor ich ein Scheißkerl geworden bin!«, kreischte Valère.
Justin war peinlich berührt. So hatte er den Satz nicht vollenden wollen. »Lassen Sie uns zur Sache kommen«, sagte er stattdessen.
»Verhandlungen? Jetzt schon?«
Nun musste Justin lachen. »Nein, M.Barbier. Ich meine die Speisekarte und die Weine.«
Justin achtete darauf, nicht zu viel über Wein zu reden. Er war hier, um Valère Barbier als Autor für den Verlag zu gewinnen, nicht um mit seinem Wissen zu prahlen. Er hatte um die Karte der gängigsten Weine gebeten, nicht um das volle Verzeichnis dessen, was der Keller hergab. Er wollte nicht die ganze vom Verlag bereitgestellte Summe ausgeben. So war er erzogen. Und er ging davon aus, dass in einem seriösen Restaurant wie diesem auch ein erstklassiger Wein zu einem vernünftigen Preis zu haben sein musste. Diesen Gedanken äußerte er gegenüber Barbier, der beeindruckt war und sofort zustimmte. Bei sich dachte Valère, jeder andere Verlagsmitarbeiter hätte aus der dicken Bestandsliste gewählt. Sie einigten sich schließlich auf einen mehrere Jahre alten Burgunder aus Puligny-Montrachet.
»Wir lassen es uns gut gehen«, verkündete Valère. »Und auch noch zu einem mäßigen Preis, was?«
»Stimmt«, bestätigte Justin. »Ich trinke einen solchen Wein zum ersten Mal.«
Valère musste lachen. Der Kellner, ein junger Mann mit feuerroter Haartolle und Sommersprossen, trat ein und verkündete die Vorspeise: »Felsenkrabbe in Gurkenrolle.« Er stellte einen Teller vor jeden Gast und fuhr fort: »Mit geräuchertem Maisbrei und einem Sorbet aus gelben Tomaten und Balsamico.«
»Merci«, sagte Valère, und der Kellner zog sich zurück. Der Autor beugte sich zu Justin und fragte: »Was ist eine Felsenkrabbe?«
»In New York zurzeit der letzte Schrei. Dabei ist es eine Krabbe aus dem Atlantik, nur mit einwärts gebogenen Beinen.«
Valère hob eine Augenbraue und meinte: »Sie scheinen sich mit gutem Essen und Wein auszukennen. In Ihrem Alter habe ich zwar schon Bücher verkauft, musste aber immer noch jeden Centime umdrehen.«
Justin lächelte. »Ich lese gern Zeitschriften über Essen und Trinken. Aber nur mit gefülltem Magen.«
Valère lachte, wählte ein Löffelchen und tauchte es in den Tomatensorbet. »Bon appétit.«
»Danke, gleichfalls. Dieser Sorbet sieht gut aus. Er erinnert mich an Eigelb.«
»Das ging mir eben auch durch den Kopf«, sagte Valère. »Es könnte aber auch Zabaione, diese italienische Weinschaumcreme, sein. Sehr phantasievoll …«
Als Justin fertig war, legte er den Löffel ab und schaute Barbier direkt an. »Ich habe viel über Ihr Leben gelesen, da sind mir Fragen gekommen.«
Valère hob den Kopf und legte ebenfalls das Besteck aus der Hand. »Nur zu.«
Justin bemerkte, dass sich etwas im Blick des Autors verändert hatte. Bis eben hatte er noch den Bonvivant gegeben, der ohne Sorgen durchs Leben geht. Jetzt wirkte er plötzlich älter und nachdenklicher. Die großen braunen Augen wurden schmaler, und ein paar Fältchen erschienen auf seiner Stirn.
»Dieses Schloss, das Sie bei Aix-en-Provence gekauft haben«, begann Justin.
»Nur eine Bastide, ein Landhaus«, korrigierte Valère. »Die Bastide Blanche.«
»Richtig. Ich habe ein paar Artikel über den Brand gelesen, den es diesen Sommer dort gegeben hat. Das Thema hat mich gepackt.«
»Erzählen Sie mir, was Sie darüber wissen«, bat Valère.
»Also, dass die Bastide abgebrannt ist und – nehmen Sie es mir bitte nicht übel – dass einige Leute Ihnen das zum Vorwurf machen, obwohl es nicht bewiesen ist.«
»Nein, es ist nicht bewiesen.«
»Aber Sie sind dort gewesen, als es passierte?«
Valère nickte und begann zu essen. »Ich kann mich nur schlecht an diese Nacht erinnern«, sagte er. »Es heißt, ich hätte nach Agathe gerufen …«
»Ihrer verstorbenen Frau.«
»Stimmt«, bestätigte Valère. »Es gab eine Zeit, da Agathe berühmter war als ich. Aber die dauerte nicht lange. Was wissen Sie über sie?«
»Ich weiß, dass sie bildende Künstlerin war, dass Sie beide eine lange Ehe geführt haben und sie 1988 gestorben ist.« Unter rätselhaften Umständen, wollte er noch sagen, unterließ es aber.
Valère lächelte und griff nach dem Sektkelch. »Glauben Sie an Gespenster, Justin?«
Sprach Barbier von Agathe? Justin stützte das Kinn auf die gefalteten Hände und suchte nach einer ehrlichen Antwort, die Barbier aber dazu anregen sollte, mehr zu erzählen. Da fiel ihm ein, dass der angeblich behauptet hatte, in der Brandnacht hätte es im Haus gespukt. »Ja, in der Tat«, antwortete Justin. »Ich glaube daran, dass die Toten nachts durch alte Gemäuer wandern, weil sie glauben, noch immer dort zu wohnen. An der Highschool mussten wir einmal ein Gedicht lernen. Ich habe mich für Shelley entschieden. Davon ist mir nur eine Zeile im Gedächtnis geblieben: ›… wenn die Nacht ihre unheimliche Stille erklingen lässt.‹«
»Das ist es … In der Bastide habe ich nachts kaum ein Auge zugetan«, erklärte Valère mit einem Seufzer. »Es war ihre Zeit.«
»Ihre Zeit?«, fragte Justin.
»Das ist eine lange Geschichte«, murmelte Valère und leerte das Champagnerglas. »Aber der Abend ist ja noch jung. Wenn ich mein letztes Buch schreibe, dann muss mein künftiger Lektor meine Geschichte anhören und mir auch glauben. Sind Sie dazu bereit?«
»Oui, Monsieur.«
2. KapitelNew York City, 22.September2010
Valère erzählt seine Geschichte
Wie der Name sagt, hatte die Bastide Blanche, als ich sie erwarb, eine weiß gestrichene Fassade, an der der Putz gesprungen und an mehreren Stellen bereits abgefallen war. Das Haus wies eine perfekte Symmetrie auf, wie das bei solchen Landhäusern üblich ist: In der Mitte die einen Meter breite hölzerne Eingangstür, flankiert zu beiden Seiten von zwei hohen Fenstern. Darüber jeweils zwei Fenster der gleichen Größe und über der Haustür ein noch größeres mit einem schmalen Balkon. Das schmiedeeiserne Gitter trug ein großes B.Die dritte Etage, etwas niedriger als die beiden anderen, bot Raum für fünf ovale Bullaugen, die liegend, nicht aufrecht eingelassen waren. Das für die Provence typische Ziegeldach wies einen Mischmasch aus Ziegeln aller Schattierungen zwischen Rot, Orange und Gelb auf, die man über die Jahrhunderte dort verlegt hatte. Ich stellte mir vor, die Fassade neu verputzen und gelb tünchen zu lassen. Die Fensterläden, jetzt in verblasstem Rot, sollten olivgrün gestrichen werden.
Als ich die Bastide Blanche letzten Winter kaufte, dachte ich dabei an die heißen, trockenen Sommer der Provence. Wir hatten häufig genug unseren Urlaub im Süden verbracht, dass ich mich gut an das tägliche Ritual erinnern konnte, Fenster und Läden in allen Zimmern morgens zu schließen und erst spätabends wieder zu öffnen. Agathe bestand darauf, dass dies in unserem gemieteten Ferienhaus stets um sieben Uhr morgens geschah. Ich bin ein unverbesserlicher Faulpelz und liebe es, morgens auszuschlafen. Zu meinen teuersten Erinnerungen gehört, wie Agathe, die Hände in die Hüften gestemmt, vor meinem Bett stand und mich weckte. »Les volets! Les fenêtres!«, sagte sie, griff unter das Baumwolllaken und kitzelte mich an den Fußsohlen. »Ich habe Urlaub!«, brummte ich und zog die Füße weg. Der Grund war natürlich, dass Agathe mehr arbeitete, als es mir je gelungen ist. Als Töpferin – oder Keramikerin, sollte ich wohl besser sagen – war sie auch körperlich die Stärkere. Aber das wissen Sie sicher.
Eine meiner ersten Erinnerungen an die Bastide Blanche stammt vom 5.Juli, dem Tag, da all die Probleme anfingen. Als ich Fenster und Läden geöffnet hatte, entfuhr mir der Schrei: »Schaltet sie ab!« Dass es schon morgens heiß war, wusste ich noch, aber die cigales hatte ich vergessen. Sie schauen verwirrt: Ich meine die Zikaden. Es war gegen neun Uhr morgens, und sie zirpten, was das Zeug hielt. Ich beugte mich aus einem der drei riesigen Schlafzimmerfenster und stieß die verwitterten Läden weit auf. Jetzt klang der Zikadenchor wie ein Dutzend Pariser Autohupen oder tausend winzige Kettensägen. Noch einmal rief ich theatralisch: »Schaltet sie ab, habe ich gesagt!« Dann ließ ich Läden und Fensterflügel krachend zufallen. Ich hatte das Gefühl, Agathe sähe mir dabei zu, ärgerlich, dass es bereits neun Uhr war. Eilig lief ich über die Bodenfliesen des Raumes, die mir angenehm die Fußsohlen kühlten, und schloss auch die beiden anderen Fenster samt Läden an der Südseite des Hauses.
Als wir früher in der Provence Urlaub machten, fand ich die Zikaden reizend, ein Symbol für Süden, Sommer, Freunde und Rosé-Wein, für opulente Mittagessen, Siestas, Aperitifs und lange Abende. Damals hatten wir Ferien und dachten nicht an Arbeit. In dieser Julinacht jedoch hatte ich bis drei Uhr gearbeitet und war erst gegen vier eingeschlafen.
Es war kein erholsamer Schlaf gewesen. Aber davon später.
Kurz bevor ich den letzten Fensterladen schloss, warf ich noch einen Blick auf die Landschaft und versuchte mir ins Gedächtnis zu rufen, weshalb ich dieses riesige Haus erworben hatte. Unterhalb des Gartens gab es eine mit Kies bedeckte Terrasse. Dort hatte ich bei einem bekannten Antiquitätenhändler in L’Îsle-sur-la-Sorgue teuer eingekaufte schmiedeeiserne Gartenmöbel aufgestellt. Die Terrasse war von einer Reihe Lavendelsträucher umgeben, die zu der Zeit, da meine Geschichte beginnt, in voller Blüte standen. Jenseits der Terrasse breitete sich ein Hain silbrig grüner Olivenbäume aus, um die ich mich selbst kümmern wollte. Was war schon dabei, jeden Winter Oliven zu ernten? Dahinter schlossen sich Hügel mit Weingärten an, von denen einige mir und die anderen einem Nachbarn gehörten, dessen Bauernhaus aus goldfarbenem Stein mit frisch gestrichenen weißen Fensterläden in der Ferne zu sehen war. Hinter den Weingärten thronte das Dorf Puyloubier seit Jahrhunderten auf einer Anhöhe aus weißem Fels. Nach Aix sind es mit dem Auto nur zwanzig Minuten, was mich zusätzlich bewegte, das Haus zu kaufen. Ich kenne wenige Städte, die so klein sind wie Aix – wie viele Einwohner wird es haben, 150000? – und zugleich von einer solchen Schönheit, Gelassenheit und Kultur. Daher ist es geradezu eine Ironie, dass ich in diesem Sommer kaum in die Stadt gekommen bin.
An jenem Morgen machte ich sorgfältig mein Bett, um der Versuchung zu widerstehen, noch einmal hineinzuschlüpfen. Ich sah mich in dem riesigen Raum um und seufzte wegen der Arbeit, die mir bevorstand. Überall an den Wänden stapelten sich Kartons, die darauf warteten, ausgepackt zu werden. Sie enthielten zumeist Bücher. Daneben Koffer aller Größen, die wir auf unseren Reisen benutzt hatten. Konnte ich die nicht einfach in einem Anbau verschwinden lassen? Oder auf dem Dachboden? Meine Kleidung lag in einem Haufen zerknüllt am Boden. Ich beugte mich nieder, raffte alles zusammen und warf es in einen Wäschekorb.
Da fiel mir ein, dass ich, was für mich gar nicht typisch ist, die Nachbarn am Nachmittag zum Tee eingeladen hatte. Am Tag zuvor war ich ihnen an der Straße vor meiner Einfahrt begegnet. Unsere Briefkästen stehen nebeneinander. Ich wusste, dass Hélène Winzerin ist. Ich kannte ihren Namen und ihr Gesicht aus guten Weinmagazinen. Ihr Mann ist ein Riesenkerl mit kahlem Kopf, aber braunen Hundeaugen und langen, dunklen Wimpern. Die Tochter, etwa zehn Jahre alt, fand ich einfach bezaubernd. Ihretwegen habe ich die Familie spontan zu mir eingeladen. Kinder haben mir nie viel bedeutet. Als Agathe und ich herausfanden, dass ich nur mit Platzpatronen schoss – verzeihen Sie den Ausdruck –, schien ihr das nicht viel auszumachen. Sie hatte bereits einen Sohn, einen ziemlichen Einfaltspinsel, von dem noch die Rede sein wird. Aber Léa, so heißt das Mädchen, schien mir gescheit und einzigartig.
Hélène, die Winzerin, war sichtlich aufgeregt, als ich ihr die Hand schüttelte. Das war ich gewohnt. Der Mann tat gelangweilt, auch das kannte ich. Doch die Tochter sprang aus dem Wagen, um sich den Wein anzuschauen, der in großen, dicken Trauben von den uralten, knorrigen Stöcken hing. Mich und die trockene, glühende Hitze schien sie gar nicht zu bemerken. »Léa, komm und begrüße unseren Nachbarn«, sagte Hélène, nahm die Tochter bei der Hand und führte sie zu mir. Léa lächelte, und ich beugte mich herunter, damit sie mir Küsschen geben konnte. »Sehr angenehm, Sie zu treffen«, sagte sie und küsste mich auf beide Wangen. »Es ist schön hier, nicht wahr?«
»Wunderschön«, gab ich zurück. Ich konnte ihre weiche Wange spüren, die nach frischer Luft, Staub und noch etwas roch. Nach Äpfeln vielleicht.
»Jetzt sind die Weinbeeren noch grün, aber bald sind sie rot«, fuhr Léa fort. »Sie werden sehen.«
»Kommen Sie doch auf einen Tee herüber«, sagte ich, ohne nachzudenken. Ich hauste bereits über eine Woche an dem neuen Ort und fühlte mich einsam. »Morgen Nachmittag gegen vier? Ich habe noch keinen Strom, aber einen Gasherd. Tee kann ich schon machen.«
»Danke. Ich bringe Kuchen mit«, bot Hélène an. »Die Boulangerie im Dorf ist recht gut und führt ein großes Angebot. In dieser Hinsicht haben wir Glück.«
Der riesige Mann lächelte und legte den Arm um seine Frau. »Dann bis morgen«, sagte ich. Mir gelang es nicht gleich, die Post rasch aus dem Kasten zu nehmen. Hélène und ihr Mann taten, als bemerkten sie nichts, aber Léa beobachtete mich genau. Sie sah, dass mir das peinlich war. Seit Agathes Tod fällt es mir schwer, bei einem glücklichen Paar unbefangen zu bleiben.
An jenem Julimorgen ging ich, noch immer im Schlafanzug, die breite Treppe zur Küche hinunter. »Was für ein lächerliches Haus«, sagte ich laut vor mich hin. Das riesige Wandbild aus der Mitte des 18.Jahrhunderts über der großen Treppe musste dringend restauriert werden. Von dort schauten mich zwei Damen in weißen Perücken und drei Herren an, die einen roten Samtvorhang beiseitezuschieben schienen, als stünden sie auf einer Bühne. Hinter ihnen war eine Landschaft der Provence zu erkennen, fast wie jene, die sich mir gerade von meinem Schlafzimmerfenster aus dargeboten hatte. Das Bild musste von einem Laien stammen: Die schlanken Zypressen im Vordergrund waren nicht größer als die edlen Damen und Herren, und die Gebäude in der Ferne hätten eher in Venedig als in Frankreich stehen können. Aber die Figuren besaßen Charme, besonders die hochgewachsene, in blassrosa Chiffon gekleidete Dame in der Mitte der Gruppe, die den Eindruck machte, sie werde gleich aus dem Bild heraus mitten auf meine Treppe springen.
Meinen Anwalt Matton hatte es fast umgehauen, als er nur Minuten vor Beginn der Auktion die verschwommenen Fotos der Bastide sah. »Wenn Sie das Haus nicht kaufen, Barbier, dann tue ich es«, sagte er zu mir. Er war seit Jahrzehnten mein Anwalt, und wir nannten uns wie Schuljungen immer noch beim Familiennamen. Das war mir bisher noch nie aufgefallen.
Die Fotos logen nicht, das Haus hatte tatsächlich Wand- und Deckenbilder, Fußböden aus jahrhundertealten Fliesen, Doppelfenster und Marmorkamine in den meisten Räumen. Sie zeigten allerdings auch zerbrochene Fensterscheiben, ein Taubenpärchen, das sich stolz im Salon niedergelassen hatte, die Bierflaschen und die Feuerstelle, die von Feiern der Teenager aus dem Dorf mitten im Speisezimmer übrig geblieben waren. Einer hatte sogar an die Wand aus falschem Marmor gesprüht: Dylan und Maéva für immer und ewig! »Was für lächerliche Namen«, raunte ich Matton zu.
Als die Auktion zu Ende war – wir hatten einen Modedesigner und einen chinesischen Milliardär ausgebootet –, gratulierte mir Matton und flüsterte mir zu: »Keine Sorge, ich habe eine Nichte in der Nähe von Puyloubier, die das Haus putzt, bevor du eintriffst. Mein Geschenk.« Sein Geschenk? Maître Matton, dessen Anwesenheit bei einer Auktion das französische Recht verlangt, hatte dafür ordentlich kassiert. Immerhin, das Angebot war schon bemerkenswert. In all den Jahren, die ich ihn kannte, war er mir nie als besonders freigiebig aufgefallen. Wenn ich es recht bedenke, hatte ich ihn gerade deswegen als Anwalt haben wollen.
Ich muss zugeben, Mattons Nichte hatte das Haus sehr ordentlich gesäubert. Ich ging daran, mir auf dem Gaskocher Kaffee zu machen. Sie hatte einen mit Sandrine Matton unterschriebenen Zettel auf dem Küchentisch hinterlassen. Ich könne sie anrufen, sollte ich weitere Hilfe brauchen. »Es ist noch so viel zu tun«, schrieb sie unter ihre Telefonnummer. Der Zettel enthielt zwar einen Rechtschreibfehler, aber Sandrine schien offenbar gut organisiert zu sein, und ich wusste, dass ich sie brauchen würde. Ich lebte schon zu lange zwischen Kartons, und die Électricité de France, mein Stromversorger, machte Ärger wegen der uralten Leitungen im Haus. Deswegen war ich noch immer ohne Strom. Sandrine war sogar zu IKEA gefahren und hatte alle möglichen Dinge für den Haushalt eingekauft, von denen sie zu Recht annahm, dass ich sie nicht aus Paris mitbringen würde: Besen und Kehrschaufel, verschiedenes Küchengerät, einen Satz genau der richtigen Teller und Schüsseln, Hand- und Geschirrtücher, weiße Bettlaken. Dein Onkel Guillaume muss dich gut bezahlt und einiges vorgeschossen haben, dachte ich bei mir. Bettwäsche war selbst bei IKEA teuer. Der Karton der Teller und Schüsseln fiel mir auf. Darauf stand in den typischen schwarzen Blockbuchstaben von IKEA »Starter Set«. Ich musste lächeln. In der Tat, mit achtundsechzig Jahren war das für mich wohl ein neuer Anfang.
An diesem Vormittag brachte ich nicht mehr viel zustande. Zumindest gelang es mir, Sandrine Matton anzurufen und auf ihrem Anrufbeantworter zu hinterlassen, sie möge so bald wie möglich kommen. Ein paar Stunden später klopfte es an der Haustür, und ich fuhr hoch. Auf der schwarzen Lederliege von Mies van der Rohe war ich wohl eingenickt. Die hatten wir gekauft, als wir jung verheiratet waren, uns gerade einen Namen machten und als junge kultivierte Stadtbewohner fühlten. Ich tappte zur Tür und warf rasch noch einen kurzen Blick in den blank geputzten Spiegel in der Diele, strich meine dicke weiße Haartolle glatt und rieb mir die Augen. Als junger Mann wurde ich im Sommer rasch braun und wirkte dann »kantig«, wie Agathe es nannte. Inzwischen hatten mir die Ärzte verordnet, die Sonne zu meiden.
Da hörte ich Stimmen vor der Haustür. »Ich bin hier!«, rief ich, beruhigt, dass ich vor meiner ungeplanten Siesta in ein sauberes weißes Hemd und eine Leinenhose geschlüpft war. Als ich einen Türflügel öffnete, füllte der Gesang der Zikaden sofort den ganzen Raum. »Bitte treten Sie ein«, sagte ich, »damit wir diese lärmenden Insekten los sind.«
Als ich sah, dass Hélène eine Schachtel in den Händen hielt, fiel mir ihr Angebot wieder ein. »Danke, Hélène«, sagte ich.
»Wenn wir ungelegen kommen …«, ließ ihr Mann hören. Ich konnte in seinem Gesicht lesen, dass er eigentlich nicht hier sein wollte und hoffte, ich hätte meine Einladung vergessen.
»Nein, nein«, sagte ich. »Alles in Ordnung. Ich gehe nur rasch in die Küche, lege den Kuchen auf einen Teller und setze Wasser auf. Oder ist es für Tee zu heiß?«
»Hier drin nicht«, ließ Hélène hören. »Diese alten Häuser mögen ihre Probleme haben, aber im Sommer sind sie herrlich kühl.«
»Im Winter auch«, warf ihr Mann ein.
»Entschuldigung, ich habe Ihren Namen …«, sagte ich.
»Bruno, Bruno Paulik«, antwortete er. Er legte den Arm um seine Tochter. »Und das ist Léa.«
Auch ihren Namen wusste ich nicht mehr. Das Mädchen schien von dem Wandbild im Treppenhaus fasziniert zu sein. »Geh und schau dir das Bild genauer an, wenn du möchtest«, sagte ich.
Sie nickte und stieg langsam die ausgetretenen Steinstufen hinauf, eine Hand an dem schmiedeeisernen Geländer. »Wir sind im großen Salon«, sagte ich. »Der Raum links, wenn du wieder herunterkommst.«
»In Ordnung«, rief sie zurück.
Ich mochte sie. Sie war kein Plappermäulchen, redete nicht ungefragt und versuchte auch nicht, das Gespräch zu dominieren, wie manche Kinder es tun oder tun dürfen. Sie war klug, das sah ich daran, wie sie mich anschaute und die Brauen runzelte. Und sie hatte Talent, nur wusste ich noch nicht, wofür. Reiten vielleicht, oder Zeichnen.
»Tut mir leid«, sagte ich und umfasste mit einer Geste den Raum, »ich bin noch gar nicht richtig eingezogen.« Im Salon standen zwar Möbel, aber an den Wänden reihten sich die Kartons, es fehlten Vorhänge und Lampen, die während der langen Jahre, da das Haus leer stand, nach und nach verschwunden waren. »Bitte machen Sie es sich bequem, ich bin in ein paar Minuten wieder da.«
»Danke«, sagte Hélène. »Und rufen Sie, wenn Sie Unterstützung brauchen.«
Ich schenkte ihr mein schönstes Lächeln – das Belmondo-Lächeln, wie Agathe mich zu necken pflegte – und ließ sie allein. Während ich zur Küche lief, hoffte ich, Sandrine hätte an Erfrischungsgetränke oder Saft gedacht. Als ich den Kühlschrank öffnete, atmete ich erleichtert auf, denn dort stand Orangensaft. Mit Kindern kannte ich mich nicht gut aus, war aber ziemlich sicher, dass eine Zehnjährige bestimmt keinen Tee trank.
Ich konnte hören, wie Hélène und Bruno im Salon hin und her gingen. Die Läden waren wegen der Hitze geschlossen, und es roch muffig mit einem Hauch von Möbelpolitur oder Fußbodenreiniger. Die beiden flüsterten miteinander, zweifellos ging es dabei um mich. Unvermittelt sagte Hélène in normaler Lautstärke: »Der Kamin sieht aus wie unserer.«
»Das ist orangefarbener und gelber Marmor vom Sainte-Victoire. Da braucht man nicht weit zu gehen«, erwiderte Bruno.
»Er springt einem ins Auge«, warf ich ein, als ich wieder in den Salon trat, in den Händen das Tablett, auf dem Tassen, eine Teekanne und der Orangensaft für Léa standen. »Die anderen Kamine sind alle aus weißem Marmor.« Ich spürte, wie versnobt das klang, besonders da Hélène eben erwähnt hatte, sie hätten einen ähnlichen Kamin.
»Mir hat unserer immer gefallen«, gab Bruno achselzuckend zurück.
»Kann ich Ihnen helfen, Monsieur Barbier?«, fragte mich Hélène.
»Danke, nein. Ich stelle das nur ab und hole den Kuchen.« Als ich es gerade tun wollte, kam Léa in den Salon gelaufen. Atemlos und mit puterrotem Gesicht stürzte sie sich in Brunos Arme und klammerte sich an ihm fest. Zu keiner Bewegung fähig, starrte ich sie an. Das Tablett in meinen Händen begann zu zittern.
»Was ist denn, chérie?«, fragte Hélène.
Léa atmete ein paarmal tief durch und wandte dann das Gesicht ihrer Mutter zu, ohne Bruno loszulassen. Hélène trat zu ihr und legte ihr die Hand auf die Stirn. »Du bist ja glühend heiß«, sagte sie.
»Mir geht es gut«, erwiderte Léa und atmete schon etwas ruhiger.
Hélène warf mir einen Blick zu, der mir das Blut in den Adern stocken ließ.
»Du schaust, als hättest du ein Gespenst gesehen«, sagte Bruno zu Léa und versuchte ein Lachen.
Das Mädchen schien zu schwanken, was sie ihrem Vater antworten sollte. »Gesehen nicht gerade …«, murmelte sie dann.
»Ich denke, du solltest dich hinlegen«, sagte Hélène. »Du fühlst dich fiebrig an.«
»Aber es ist nichts, Mama!«
»Das kommt von der Hitze«, meinte Hélène.
»Wir können unseren Teenachmittag auch verschieben«, schlug ich vor. Ich setzte das Tablett auf einem uralten geschnitzten Holztisch ab, den ich aus Paris mitgebracht hatte. Nicht auch noch die Kleine, dachte ich bei mir. Plötzlich fühlte ich mich sehr erschöpft.
»Ich fürchte, wir müssen uns tatsächlich vertagen, M.Barbier«, sagte Bruno. »Die Kleine muss nach Hause.«
»Was war mit Léa passiert?«, fragte Justin. Er stellte sein Weinglas ab, als ihm bewusst wurde, dass er es mit beiden Händen umklammerte. Jetzt nahm er auch die Geräusche des Restaurants wieder wahr – das Klappern von Bestecken und gedämpftes Stimmengewirr. Er hatte ganz vergessen, wo er sich befand.
»Als Léa in den Salon gelaufen kam, erfasste mich Panik«, berichtete Barbier. »Es war verantwortungslos von mir gewesen, sie allein in dem alten Kasten umherwandern zu lassen.«
»Aber was hatte sie gesehen?«
Valère zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Was sie gesehen … oder gespürt hat, sie hat es für sich behalten.«
»Und es hat sie nicht erschreckt?«
»Nein«, sagte Valère. »Mich dafür umso mehr.«
»Fahren Sie fort«, bat Justin. »Ich habe Sie unterbrochen.«
An diesem Abend aß ich ein Drittel von Hélènes Kuchen und spülte ihn mit Whisky hinunter. Erstaunlich, wie gut ein Single Malt zu süßem Backwerk schmeckt. Es hielt mich nicht im Haus. Da es draußen noch hell und die Luft angenehm warm war, wanderte ich auf meinem Grundstück hin und her. Dann ließ ich mich auf einer Gartenliege nieder, zündete mir eine kubanische Zigarre an und dachte an Agathe.
Ob es nun an dem Umzug oder den alten Sachen lag, die ich ausgepackt hatte, jedenfalls kamen mir unsere frühen Jahre, die 1970er in Paris, in den Sinn. Wir waren arm, doch als Agathe von der Supermarktkette Le Bon Marché den Auftrag erhielt, eine Serie Speisegeschirr zu entwerfen, konnte ich die Redaktion von Le Monde verlassen und mich ganz dem Schreiben widmen. Heute werden Agathes Geschirrteile für Bon Marché bei eBay für astronomische Summen versteigert. Die Kritiken meiner Bücher wurden nach und nach besser, die Romane verkauften sich gut, und nach einer besonders enthusiastischen Besprechung im Figaro konnte ich mich vor Einladungen von Verlegern, Journalisten und berühmten Schriftstellerkollegen kaum retten. Gelegentlich begleitete mich Agathe zu solchen Partys, aber meist ging ich allein hin. Sie fand sie kindisch und anmaßend. Nach Rote Erde, das 1975 erschien, wurde ein Kurzfilm gedreht, aber als mein nächster Roman, Der Empfangschef, das Drehbuch für einen Spielfilm abgab, der gar die Goldene Palme gewann, überstieg mein Ruhm den Agathes. Haben Sie den Empfangschef gesehen, Justin? Den kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Die Hauptrolle spielte Alain Denis, der ein paar Jahre später auf der Insel Sordou vor der Küste von Marseille ermordet wurde.1 Ich schrieb weitere Bücher und gewann mehrere Preise, die ich nach meinem Gefühl immer weniger verdiente. Es kam mir vor wie ein Schwindel.
Das Schwelgen in alten Erinnerungen endete abrupt, als mein Smartphone klingelte. Ich hatte es am Zigarettenanzünder meines Mercedes aufgeladen. Es war Sandrine Matton, die für den nächsten Tag ihr Kommen ankündigte. Ihre Stimme gefiel mir, sie sprach mit starkem provenzalischen Akzent. Sie wollte Brot mitbringen und fragte, ob ich noch etwas brauche. Kaffee? Milch? Ihr Wortschwall war nicht zu zügeln. Doch ich verspürte Erleichterung, dass Hilfe unterwegs war.
Ich dankte ihr und beendete das Gespräch. Da bemerkte ich die Stille ringsum. Die Zikaden waren verstummt. Ich zündete meine Zigarre wieder an und ließ mich in der Dunkelheit nieder. In der Ferne sah ich das alte Steinhaus der Pauliks hell erleuchtet und versuchte mir vorzustellen, was sie gerade taten. Saß Hélène abends, wenn die Weingärten schliefen, noch über ihren Papieren? Ob Bruno ihr dabei half? Mir wurde klar, dass ich keine Vorstellung hatte, womit M.Paulik sein Geld verdiente.
Ohne den Lärm der Zikaden war es jetzt ganz still. Als es daher im Olivenhain zu rascheln begann und Zweige knackten, ließ ich vor Schreck die Zigarre fallen. Ich hob sie auf, legte sie im Aschenbecher ab, setzte mich kerzengerade auf und spitzte die Ohren. Als es erneut knackte und ein-, zweimal grunzte, wie mir schien, entschied ich, mich ins Haus zurückzuziehen, bevor das Wildschwein, oder was immer es war, noch näher kam. Drinnen fühlte ich mich erschöpft, aber ruhig und von Whisky und Zigarre sogar ein wenig angeheitert.
Ich verfluchte die EDF, weil man eine Woche lang niemanden geschickt hatte, um die Stromleitungen in Ordnung zu bringen, doch zum Glück stand in der Diele ein Körbchen mit Kerzen. Ich steckte eine in eine leere Weinflasche, zündete sie an und ging im Parterre herum, um Fenster und Läden zu öffnen. Dieben wird es im Sommer in der Provence leichtgemacht, in Häuser einzusteigen. Vielleicht sichern viele Leute ihre Einfahrten deshalb mit diesen riesigen, abscheulichen Toren. Ich verzichtete darauf und hatte bereits bemerkt, dass die Pauliks es mir gleichtaten.
Auf halber Treppe blieb ich stehen. Die Frau in Rosa lächelte mir zu, und ich hätte schwören können, dass ihr gemaltes Gesicht vom Licht meiner Kerze erstrahlte. Ich wünschte ihr eine gute Nacht, was ich absichtlich laut tat; meine Stimme sollte so leicht und unbeschwert wie möglich klingen. Ich ging herum und öffnete alle Läden, um die Luft zirkulieren zu lassen. Aber auch gegen zehn war es im Obergeschoss immer noch heiß. Die Luft war zum Schneiden dick, und es roch nach Staub. Ich wollte Sandrine bitten, alle Räume feucht durchzuwischen.
Mein eigenes Zimmer betrat ich wie stets als Letztes. Als ich langsam die Tür öffnete, sah ich, wie die Dame in Rosa mir aus dem Treppenhaus schmunzelnd nachsah. Die kleine Léa fiel mir ein. Was sie hier am Nachmittag wohl erlebt hatte?
Sie erinnern sich, dass ich das schmiedeeiserne B am Balkon im ersten Stock erwähnt habe. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass mein Name mit diesem Buchstaben beginnt. Ich hatte das Haus aus einer Laune heraus gekauft und immer geglaubt, das B stünde für Bastide Blanche. Als ich dann aber den Scheck mit dem irrsinnig hohen Betrag unterzeichnet hatte und das Haus wirklich mein Eigen war, begann Matton in seiner Vergangenheit zu wühlen. Aufgeregt berichtete er mir, dass der erste Besitzer eine Familie de Besse gewesen sei. Daher das B.Offenbar hatten Generationen fetter, fauler, aus Inzucht hervorgegangener Angehöriger dieser Sippe die Bastide bewohnt, bis ein Notar sie Anfang des 20.Jahrhunderts der schillernden Adelsfamilie abkaufte, weil diese das ganze Familienvermögen verjubelt hatte. Matton rief mich zu jeder Tages- und Nachtzeit an, weil er immer wieder Neuigkeiten verkünden wollte. Der Clou des Ganzen war Hugues de Besse, der Sohn des ersten Besitzers. 1688 geboren, lebte er bis 1760, was ihm Gelegenheit gab, die anderen Bewohner der Bastide jahrzehntelang zu drangsalieren. Von dem Kerl wird noch die Rede sein.
Ich hob die Kerze und blickte mich in dem Raum um. Ich glaubte nicht, dass ich viel erkennen würde, aber ich musste zumindest sicher sein, dass ich mich allein darin befand. Ich schaute in alle Ecken des Zimmers und richtete das Licht dann auf das Bett. Sie erinnern sich, Justin, dass ich es am Morgen selbst sorgfältig gemacht hatte. Das beherrsche ich so gut wie die Zimmerfrauen im Hotel, die Überdecke und Laken straff unter die Matratze stecken. Agathe konnte ich damit zur Verzweiflung bringen. Sie war groß und beklagte sich stets, wenn ich das Bett gemacht hatte, fühle sie sich an den Füßen wie gefesselt. Wie dem auch sei, an jenem Abend sah ich, dass meine Seite des Doppelbetts völlig unberührt und die Überdecke noch straff über das Kissen gezogen war. Aber auf der anderen Seite hatte jemand auf dem Überwurf gelegen. Das wiederholte sich jeden Abend, seit ich in das Haus eingezogen war. Ein Kopf war in das Kissen eingesunken, und die Überdecke war eingedrückt, wo Schultern und Hüften lagen. Wer dort geruht hatte, war groß wie Agathe. Ich stellte die Kerze auf das Nachtschränkchen und schüttelte den Kopf. Agathe hatte mich immer gehänselt, wenn ich mich beklagte, die Literaturpreise nicht zu verdienen. »Valère, du hast eine blühende Phantasie«, pflegte sie dann zu sagen. Aber war das etwa Phantasie, Justin, als ich in dieser Nacht erwachte, weil jemand von der anderen Seite des Bettes an der Decke zog?
3. KapitelAix-en-Provence, Sonntag, 4.Juli2010
»Tut mir leid, dass ich zu spät komme«, sagte Antoine Verlaque und gab Marine Bonnet einen Kuss. Er rückte sich einen Stuhl zurecht und setzte sich ihr gegenüber an das Cafétischchen. Die Uhr zeigte kurz nach neunzehn Uhr, und der von Gebäuden aus honigfarbenem Stein, darunter das wuchtige Rathaus von Aix, umgebene große Platz war voller Menschen. Der Springbrunnen in der Mitte war von Tischen und Stühlen dicht umdrängt, und die Zikaden in den alten Platanen ließen ihr sägendes Geräusch hören.
»Kein Problem«, erwiderte Marine. »Ich habe ein gutes Buch bei mir.«
Verlaque lehnte sich neugierig vor und schaute nach dem Titel. »Der neue Claude Petitjean! Bekomme ich den dann als Nächster?«
»Das Buch gehört Sylvie. Aber ich kann sie fragen.«
»Wovon handelt es denn? In ein paar kurzen Sätzen.«
»In ein paar kurzen Sätzen ist es die Geschichte eines Jungen und eines Mädchens, die in den fünfziger Jahren im gleichen Viertel des 13.Arrondissements von Paris aufwachsen und miteinander befreundet sind. Später studieren sie und machen beide eine große Karriere. Erst als sie über siebzig sind, begegnen sie sich wieder.«
Da erschien der Kellner, und Verlaque wies auf Marines Pastis. »Das Gleiche«, sagte er.
»Ich mag Frauen, die Pastis trinken«, meinte der Kellner. »Die sind heute selten.«
»Stimmt«, antwortete Verlaque mit einem Lächeln. Der Kellner ging, und Antoine wandte sich wieder Marine zu. »In Le Monde habe ich gelesen, dieses Buch sei so gut wie die frühen Romane von Valère Barbier.«
Marine nickte. »Das stimmt. Es ist der gleiche mit Weisheit gemischte Humor, dazu wie bei Barbier ein Schuss Melancholie und Sarkasmus.«
Verlaque lachte, lehnte sich zurück und ließ seinen Blick über den Platz schweifen. Am Morgen war er noch ein riesiger Blumen- und Pflanzenmarkt gewesen. All das Grün, das in der Vormittagshitze dampfte, hatte jetzt Tischen mit Bier, Pastis, Wein und Softdrinks Platz gemacht. »Merkwürdig«, sagte er, »wir haben eine schöne Wohnung mit wunderbarer Terrasse, aber manchmal ist es einfach nett …«
»… auf einem belebten Platz mitten unter so vielen Leuten zu sitzen?«
»Genau. Sie lachen und schwatzen zu hören …«
»Dazu ein betrunkener Straßenmusiker mit seiner Gitarre«, fuhr Marine fort und warf einen Blick über ihre Schulter. »Der Bursche sitzt schon seit Jahren hier.« Abgesehen von den Jahren des Studiums in Paris, hatte sie immer in Aix gelebt.
Der Kellner brachte Verlaque einen Pastis. Der hob sein Glas und stieß mit Marine an. »Auf das bunte Straßenleben überall.«
Sie redeten über ihren Tag, wurden aber häufig von Freunden und Kollegen unterbrochen, die entweder Marine, Verlaque oder beide kannten. Man wechselte einen Händedruck oder Küsschen mit guten Freunden und tauschte die letzten Neuigkeiten aus. Doch Verlaque war froh, dass die Nachbartische alle besetzt waren. Der Oberste Untersuchungsrichter von Aix hatte einen langen Arbeitstag hinter sich und schätzte die Zeit der Zweisamkeit mit seiner frisch angetrauten Ehefrau.
»Noch einen?«, fragte er Marine, als sie endlich allein waren.
»Warum nicht? Ich hatte schon ganz vergessen, dass man natürlich dauernd unterbrochen wird, wenn man an einem so schönen, warmen Sommerabend gegenüber dem Rathaus sitzt.«
»Du bist einfach zu beliebt.«
»Vielleicht sollten wir nach Hause gehen …?«
»Zu spät«, bemerkte jetzt Verlaque. »Das nächste Paar, das wir kennen, glaube ich. Sie lächeln uns schon zu.« Als die beiden näher kamen, sah Verlaque, dass es Leute aus einem der Nachbarhäuser in ihrer Straße waren. Sie gaben sich die Hand, und Verlaque war beeindruckt, dass Marine sogar ihre Namen kannte und wusste, dass sie gerade von einem Urlaub in Lissabon zurück waren.
»Wir haben in Portugal wie die Könige gelebt«, verkündete der Mann. »Alles nur halb so teuer wie in Aix.«
Verlaque zuckte zusammen. Er mochte es nicht, wenn Leute aus einem wohlhabenden Land die schwache Wirtschaft anderswo für sich nutzten. Aber als er ein wenig zuhörte, wurde er versöhnlicher gestimmt. Die beiden waren wirklich begeistert von einer Stadt, die er noch nicht kannte und wohl dringend besuchen sollte. Ihm und Marine gefielen die Geschichten von Lissabons herrlichen Museen, dem guten Essen, den hervorragenden Weinen und der altmodischen Tram, die über die schmalen, steilen Straßen zuckelt. Dabei musste er dauernd an das zerlesene Exemplar von Tobias Smolletts Reisen durch Frankreich und Italien