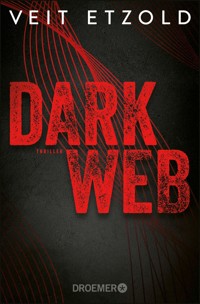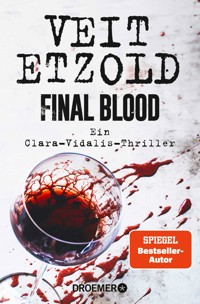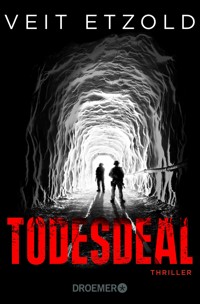
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im afrikanischen Kongo wütet seit Jahrzehnten ein grausamer Krieg. Es ist ein Kampf um die kostbaren Rohstoffe, die dieses ansonsten so bitterarme Land in Fülle abbaut und die in jedem digitalen Gerät stecken. Martin, ein junger Berliner Journalist, reist für seinen ersten großen Rechercheauftrag in den Kongo. Kurz nach seiner Ankunft wird er von den Milizen eines Warlords in Geiselhaft genommen. Ausgelöst wird er von einer Geschäftsfrau aus Ruanda. So gerät der unerfahrene Journalist in die gnadenlosen Hände von russischen Oligarchen, chinesischen Investoren und deutschen Waffenhändlern. Zu spät stellt Martin fest, dass auch er nur Verhandlungsmasse in einem geopolitischen Schachspiel ist, in dem die Rohstoffverteilung für das 21. Jahrhundert festgelegt wird. Und dass dieser erste große Rechercheauftrag vielleicht sein letzter sein könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Veit Etzold
Todesdeal
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue Thriller des SPIEGEL-Bestseller-Autors
In jedem Handy steckt ein Stückchen Kongo: Chinesische Investoren, deutsche Waffenhändler, russische Oligarchen: Im afrikanischen Kongo wütet seit Jahrzehnten ein grausamer Krieg. Es ist der Kampf um kostbare Rohstoffe, die in jedem digitalen Gerät auf der Welt stecken. Für seinen ersten großen Rechercheauftrag reist der junge Journalist Martinin den Kongo. Kurz nach seiner Ankunft wird er von den Milizen eines Warlords in Geiselhaft genommen und kämpft um sein Leben. Zu spät stellt er fest, dass auch er nur Verhandlungsmasse in einem internationalen Schachspiel ist, in dem die Rohstoffverteilung für das 21. Jahrhundert festgelegt wird.
»Brandheißes Thema! Für mich der Polit-Thriller des Jahres.« Andreas Eschbach
»Der Ost-Kongo gehörte immer schon – nicht erst seit König Leopolds Zeiten – zu den schönsten, reichsten aber auch gefährlichsten Regionen in Afrika. Veit Etzold hat Stimmung und Umwälzungen an diesem Krisenplatz genau getroffen – ein Muss für jeden Afrika-Kenner.« Volker Schlegel, Botschafter und Staatsrat a.D., organisierte im Auswärtigen Amt den offiziellen Besuch von Präsident Mobutu (jetzt Kongo, damals: Zaire) in Deutschland zur Zeit von Bundeskanzler Willy Brandt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Die handelnden Personen
BUCH 1: KOMMANDOHÖHEN
Prolog
ZWEI WOCHEN ZUVOR
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
BUCH 2: TÖDLICHES WISSEN
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
BUCH 3: VERHANDLUNGSMASSE
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Epilog
Dankeswort
Für Saskia
Staaten haben keine Freunde.
Nur Interessen.
Otto von Bismarck
Die handelnden Personen
Die Deutschen:
Martin Fischer, Journalist bei Global News, Berlin
Janine Drieling, Anwärterin für den höheren Dienst im Auswärtigen Amt
Andreas Schmidt, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Gründer der geheimen Gruppe »Tiamat«, Berlin
Eugen Freiherr von Stein, Leiter der Abteilung Einsatzgebiete/Auslandsbeziehungen beim Bundesnachrichtendienst, BND, Pullach und Berlin
Bernd Köppke, Global News, Berlin
Florian Wolters, genannt »Flori das Fass«, Leiter des Berliner Büros von Global News
Thomas Haller, Mitglied der Abteilung für Strategische Planung, Bundeskanzleramt, Berlin
Christian Kuhn, ehemaliger KSK-Elitekämpfer und freiberuflicher »Problemlöser« des BND, Berlin
Die Afrikaner:
Robert Otega, Kongo-Warlord und Anführer der kongolesischen Stammesarmee »Engel des Herrn«, Virunga-Nationalpark/Kongo
Joseph Kabila, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa/Kongo
Albert Bugali, Chef des ruandesischen Geheimdienstes, Kigali/Ruanda
Sophie Mureki, Vizechefin des Ruanda Development Boards, Kigali/Ruanda
Buri Begali, Fahrer von Martin und Bernd, Kigali/Ruanda
Joseph Katanga, Vertrauter von Robert Otega und zweiter Mann bei den »Engeln des Herrn«, Virunga-Nationalpark/Kongo
Jacques Kalisa, Leutnant bei den »Engeln des Herrn«, Virunga-Nationalpark/Kongo
Die Chinesen:
Der Präsident der Volksrepublik China, Peking
Ku Shang Ku, Direktor des staatseigenen Rohstoffkonzerns CMCC (China Minerals and Commodities Corporation), Peking
Lucia Ming, Investmentmanagerin beim chinesischen Staatsfonds SAFE in Hongkong
Huan Yi, Leiter des Hongkong Büros des chinesischen Staatsfonds SAFE in Hongkong
Levin Wang, Leiter des internationalen Geschäfts der China Development Bank in Hongkong
Die Russen:
Wasily Worotnikow, genannt »der Eisbär«, ehemaliger »roter Direktor« eines Nickelkombinats in Sibirien und heute Afrika-Chef des russischen Rohstoffkonzerns Alcorp, Moskau
Walter und Brian, Leibwächter von Wasily Worotnikow, Moskau und Goma/Kongo
Sascha Rasamov, genannt »die Katze«, Strippenzieher und Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, Moskau
BUCH 1: KOMMANDOHÖHEN
Es kann sinnvoll sein, die Marktkräfte zuzulassen und Teile der Industrie in private Hand zu legen. Doch die Kommandohöhen von Wirtschaft, Energie, Stahl, Rohstoffen und Infrastruktur müssen für immer in der Hand des Staates bleiben.
Vladimir Iljitsch Uljanow alias Lenin, 1922
Prolog
Martin rannte.
Hinter ihm fauchten Schüsse. Pfeilschnelle Projektile, die rechts und links von ihm zischend durch das Unterholz des Regenwaldes peitschten.
Wenn ihn eines erwischte, würde er für den Rest seines Lebens ein Krüppel sein. Er würde … Nein, Unsinn. Wenn diese Leute ihn fangen würden, wäre er genauso tot wie Bernd, den er vor nicht einmal einer Minute hatte sterben sehen.
Er rannte.
Zwang sich dazu, sich nicht umzusehen.
Die Schreie kamen dennoch näher. Dann waren sie wieder weiter weg. Es war wie in diesen schlechten Filmen, in denen der Held nie weiß, wo der Feind ist, in denen ein Mann mit verbundenen Augen einen Weg entlanglaufen muss und jederzeit erschossen werden kann, ein Scharfschütze hinter ihm mit dem Gewehr im Anschlag.
Er rannte schneller.
Allein und verlassen. Die einzigen Menschen in seiner Nähe waren hinter ihm her und wollten seinen Tod.
Er wusste nicht, wohin er rennen sollte. Er wusste nur, dass er wegmusste. Weg von einem Ort, wo man ihn töten wollte, hin zu einem Ort, den er nicht kannte. Und noch etwas wusste er: Wenn er stehen blieb, war er tot.
Äste peitschten sein Gesicht. Mit einem Sprung hechtete er über einen Graben, tiefer, immer tiefer ins Unterholz des Kongos, während die Schreie hinter ihm lauter und leiser und wieder lauter wurden und hier und da eines der tödlichen Geschosse, mal mehr, mal weniger knapp an ihm vorbeiflog. Wasser spritzte auf, und Erde stob in die Luft, dort, wo die Geschosse landeten. Es war gut, dass er keine Zeit hatte, sich vorzustellen, wie es aussehen würde, wenn ihn eine von diesen Kugeln treffen würde.
Was würde bei ihm fontänenartig in die Luft spritzen? Blut, Eingeweide und Knochensplitter, die an den Bäumen des Regenwaldes kleben würden, während seine Überreste im sumpfigen Wasser des Grabens verfaulten?
Die Eindrücke der letzten Minuten blitzten vor seinem inneren Auge auf wie Momentaufnahmen direkt aus der Hölle. Er sah seinen Jeep, der vor wenigen Minuten von einer paramilitärischen Einheit angehalten worden war. Der Guide und sein Begleiter, die von den Kindersoldaten des Warlords erschossen wurden. Das Gesicht seines Freundes, die Augen schielend nach innen gedreht, als wollte er dem Flug der Patrone in seinen Kopf hinein folgen, der Patrone, die seine Stirn zwischen den Augen durchschlagen, seinen Schädel gesprengt und sein Gehirn über die staubige Straßenpiste verteilt hatte.
Er verlangsamte kurz seine Schritte. Die Schreie wurden leiser, doch das hatte nichts zu bedeuten. Vielleicht waren sie ganz nah, leise und lauernd, wie eine Spinne, die ihre Beute schon beinahe in ihrer Gewalt hatte.
Er musste weiter rennen, weiter, immer weiter, hier im Nirgendwo, im Grenzgebiet. Irgendwo zwischen Ruanda und dem Kongo. Ein Weißer sollte hier niemals allein unterwegs sein. Doch er war es.
Die Schreie waren nicht mehr zu hören. Hatte er sie abgehängt?
Seine Lungen stachen, als wären sie mit Chlorwasserstoff gefüllt, und sein Atem rasselte.
Ihm war, als wäre er kurz vor dem Ersticken. Er sog die feuchte Luft des Waldes ein, dankbar und tief, als hätte er seit Jahrhunderten nicht mehr geatmet. Er lehnte sich vornübergebeugt an einen Baum, die Arme ausgestreckt, die Handflächen an der Rinde. Und atmete. Eine Sekunde. Zwei. Drei.
Die Geräusche des Regenwaldes drangen an sein Ohr. Jetzt nahm er sie erst wahr. Das Zirpen von Insekten, das Rauschen der Blätter in den riesigen Bäumen. Irgendwelche Tiere, die sich, unsichtbar für ihn, durch den Wald bewegten. Und der Geruch. Der Geruch nach Regen, vermischt mit einem leichten Zimt-Einschlag. Früher hätte er Geruch nach Abenteuer gesagt, doch das Wort Abenteuer hatte alles Positive für ihn verloren.
Dann kamen wieder die Bilder.
Bilder, die nur wenige Minuten alt waren, aber so schrecklich, dass er glaubte, sie wären aus einer anderen Welt.
Die Lichtung, auf die sie gelangt waren. Die Lichtung mit den Stammessymbolen, den Schädeln, den Tierknochen und den Amuletten, die in seltsamer Anordnung an den Bäumen hingen. Die Lichtung, die sie niemals hätten betreten dürfen.
Dann der dumpfe Knall. Erde war meterhoch in die Luft geflogen, daneben Schädel und Stammesschmuck. Wie in einem morbiden Extrembild von Max Ernst waren Knochen und Gerippe in die Luft geschleudert worden, Kleidungsfetzen und Leichenteile, in unterschiedlichen Zuständen der Verwesung. Dann kamen die Bagger und die Sandschieber.
»Scheiße«, hatte sein Begleiter zu ihm gesagt, und sein Gesicht war so weiß geworden wie die bleichen Knochen, die in den Bäumen hingen, »die sprengen den Friedhof. Irgendjemand sprengt den Stammesfriedhof.«
Sie sprengen den Stammesfriedhof. Warum? Um ihn – umzugraben. Weil etwas darunter war. Etwas Wertvolles.
Dann waren sie aufgetaucht. Die Stammeskrieger, die sich mit Macheten auf die Arbeiter in den Baggern und Sandschiebern gestürzt hatten. Die ihnen die Hände und Köpfe abhackten.
Er sah noch die Hand. Die Hand am Lenkrad. Am Lenkrad des Sandschiebers. Noch immer hatte sich das groteske Bild in seinem Gehirn gehalten. Denn was er gesehen hatte, war nur die Hand, die die Machete des Stammeskriegers abgeschlagen hatte und die das Lenkrad der Baumaschine umfasst hielt wie ein satanischer Talisman.
Die Schmerzens- und Todesschreie hallten noch in seinem Kopf wider. Auf Englisch, auf Französisch. Und in einer Sprache, von der er glaubte, es sei Chinesisch.
Das Massaker war fürchterlich gewesen.
Doch damit war es noch nicht vorbei.
Denn dann waren die anderen gekommen.
Die Stammesarmee, die für die Gegenseite kämpfte. Die keine Speere hatte, sondern Kalaschnikows. Die die schwarzen Angreifer unter Beschuss nahm und sie in eine zerrissene Masse aus blutigem Nebel verwandelte.
Da hatte Martin gewusst: Was hier geschieht, durfte nicht geschehen.
Aber es geschah trotzdem.
Und er wusste auch: Wenn sie hier jemand entdeckte, waren sie genauso tot wie all die Schwarzen und Chinesen, die am Boden lagen.
Jetzt war der Guide tot.
Sein Freund war tot.
Martin sollte tot sein. Doch er war noch am Leben.
Die Frage war nur, wie lange noch.
Er spürte den Stich in seinem Magen und die Angst, die ihm die Kehle zudrückte: Die Schreie und die Schüsse waren wieder da.
Lauter als je zuvor. Näher als je zuvor.
ZWEI WOCHEN ZUVOR
Kapitel 1
Berlin
Berliner Korrespondenzbüro Global News, Friedrichstraße
Martin hetzte durch die Gänge der Großraumredaktion.
Einunddreißig Jahre alt, mit blonden Locken, blauen Augen und seiner sportlichen Statur war er das, was man einen »Surfertyp« nannte, obwohl er noch nie auf einem Surfbrett gestanden hatte.
Das Redaktionsbüro von Global News war in einem hässlichen, postmodernen Beton- und-Glasklotz nahe dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte untergebracht. Und wenn man diesen Betonklotz sah, konnte man kaum glauben, dass sich irgendetwas Lebendiges in seinem Inneren befinden konnte. Doch der Eindruck täuschte.
Er rannte den Korridor hinunter, den USB-Stick mit den Bildern in der Hand, die allesamt so groß waren, dass man sie unmöglich per Mail schicken konnte. Aber so mussten sie sein. »Bigger is better«, sagte sein Boss immer. Auf seinen Boss traf das übrigens auch zu. Nicht nur, was seine Netzwerke anging, sondern auch im Hinblick auf seine Statur.
Global News, die Zeitung, bei der Martin seit sechs Wochen arbeitete, war ein internationales Nachrichtenunternehmen, das sich eigentlich auf seriöse Berichterstattung spezialisiert hatte, aber auch reißerischen Boulevardmeldungen nicht abgeneigt war.
»Die Leute wollen sich informieren, aber sie wollen auch unterhalten werden«, sagte Florian immer, der Chef des Berliner Büros der Global-News-Redaktion, den alle, wegen seines beträchtlichen Leibesumfangs, »Flori das Fass« nannten. Manchmal hieß er auch nur »das Fass«. Denn dieser Name passte doppelt. Wenn er sich mal an etwas festgebissen hatte, »fass« machte, ließ er so schnell nicht mehr los. Die »Ameisen«, wie das Fass seine Untergebenen nannte, sahen ihn meist im »Aquarium«, einem einzelnen Glasbüro jenseits des großen Redaktionsraumes, wo er häufig mit dem Telefon in der Hand wie ein Raubtier an der Kette hin und her rannte, in den Hörer schrie und Donuts in sich hineinstopfte. Martin glaubte manchmal, Flori würde in seinem Glasbüro übernachten, und fragte sich, wie sich das Fass das riesige Netzwerk aus Politikern, Lobby-Leuten, Informanten und Paparazzi aufgebaut hatte, über die es verfügte wie ein antiker Zauberer über ein Heer von Heuschrecken und andere Plagen.
»Nun mach mal mit den Fotos!«, brüllte ihm sein Kollege Bernd vom anderen Ende der Redaktion zu. »Das soll noch in die Printausgabe!«
Martin spurtete an mit Papieren vollgestopften Tischen, blinkenden Bildschirmen und halb leeren Kaffeebechern vorbei. Bernd streckte ungeduldig seine Finger aus, die von Katjes und Gummibärchen wieder klebrig waren wie ein Pritt-Stift.
Entgegen seiner Jobbeschreibung hatte Martin einen typischen Paparazzi-Job machen müssen, was aber manchmal nicht anders ginge, wie man ihn belehrt hatte. Er hatte gerade erst sein Journalismusstudium beendet und sich danach einen längeren Urlaub gegönnt. Dass er dann gleich einen Job bei Global News bekommen hatte, war Glück. Dass er dabei hauptsächlich B-Promis hinterherrennen musste, war nicht ganz so glücklich. Aber was hätte er tun sollen, wenn nun einmal gerade diese Aufgaben gefragter waren als Qualitätsjournalismus? Was ihn aber nicht davon abhielt, weiterhin von der großen, internationalen Reportage zu träumen, die er einmal schreiben wollte. Oder besser: schreiben würde.
Denn statt von UNO-Gipfeltreffen und globalen Kooperationen zu berichten, hatte er zwei Stunden in Tegel auf der Lauer gelegen, bevor er endlich losknipsen konnte. Am Flughafen Tegel, in Restaurants in Berlin, einmal am Potsdamer Platz und dann noch mal in Schönefeld. Jetzt waren endlich genug Fotos zustande gekommen. Was war geschehen? Flori das Fass hatte herausgefunden, dass Gil Collins, ein berühmter Schauspieler, mehrere Tage hintereinander in der Stadt war, ein Mann, dem alle Frauen zu Füßen lagen, der aber leider nicht an ihnen interessiert war, da er zum Leidwesen aller Frauen stockschwul war. Inoffiziell jedenfalls. Die meisten Boulevardblätter wussten das zwar, ignorierten es aber, was vielleicht daran lag, dass Collins sich abwechselnd mit mehr oder weniger schönen Frauen zeigte, die aber niemand kannte. Global News hingegen war den Klatschblättern voraus. Denn nur hier wusste man, dass die Schönheiten nicht nur von Collins’ wahrem Sexualleben ablenken sollten, sondern auch einen hübschen Nebenverdienst darstellten. Denn der Mann wurde von Casting Agenturen dafür bezahlt, sich mit ihren Sternchen blicken zu lassen – und fotografiert zu werden. Fünfzig Riesen pro Begleitung kostete der Spaß wohl. Und sobald irgendein bis dahin unbekannter Feger an seiner Seite gesehen wurde, war dieser auf einmal von Zero zu Hero geworden und ruck, zuck der Star aller ersten Seiten. Und da die Medien die Stars machten, waren diese Frauen, die einmal an seiner Seite fotografiert wurden, die Stars von morgen. Ihre Agenturen wussten das. Und zahlten dafür.
So wie König Midas, hatte Florian gesagt, da ist auch alles zu Gold geworden, was er angefasst hat. Also, Martin, besorgen Sie Beweise, die zeigen, dass wir recht haben!
»Zeig endlich her«, sagte Bernd und grapschte nach dem Stick. Bernd hatte das gleiche Problem wie Martin. Er hatte eigentlich Berichterstattungen zur großen Politik machen wollen, war dann aber auch in der B-Promi-Abteilung gelandet. Das allerdings schon seit zwei Jahren. Was Martin wenig Hoffnung auf die Zukunft machte. Es blinkte, als der Rechner die Bilder auf die Festplatte zog. Bernd klickte mit seiner klebrigen Hand auf die Maus und der Pfeil sauste über den Bildschirm. Die Fotos verschiedener attraktiver Frauen tauchten auf.
»Siehst du?«, stellte Bernd fest. »Das Fass hat recht gehabt. Mal blond, mal brünett, mal rothaarig, da passt doch gar nichts zusammen. Collins ist entweder farbenblind, oder unsere Story muss wahr sein. Wie nennen wir das am besten?«
Da passt doch gar nichts zusammen, wiederholte Martin die Worte, die er gerade gehört hatte. Genauso wenig wie bei ihm. Er musste endlich den Kopf frei kriegen von seiner früheren Freundin, zu der er sich immer noch hingezogen fühlte, die ihm aber letztendlich zu langweilig war. Seitdem sie auseinander waren, hatte sie richtig Karriere gemacht. Ob ihm das selbst gelungen war, konnte er immer weniger beurteilen, als er die reißerischen Überschriften der Artikel sah, die er für Global News schreiben musste und die von der Abteilung für internationales Geschehen so weit weg waren wie die Hölle vom Himmel. Hätte er sich mit dem Blatt vor seiner Bewerbung etwas intensiver auseinandergesetzt, hätte er wahrscheinlich gesehen, dass die Klatschspalte von Global News der größte Umsatzbringer war. Aber wer nicht hören oder lesen wollte, musste offenbar fühlen.
»Hey«, sagte Bernd, »wie nennen wir das?«
Martin dachte einen Moment nach. »Da war doch Ende der Neunziger diese Sache mit Damien Hirst und der Tate Gallery.«
Bernd verdrehte die Augen. »Ich hab doch keine Ahnung von Kunst. Und was hat das mit Collins zu tun? Genauer!«
»Na ja«, meinte Martin und setzte sich auf einen leeren Drehstuhl zu Bernd, »der Werbeexperte Saatchi & Saatchi in London wollte damals Damien Hirst und die Young British Artists hypen. Und dafür soll er angeblich die Tate Gallery geschmiert haben, damit die alles von denen ausstellen. Denn was immer in der Tate ausgestellt wurde, war hinterher auf der Auktion bei Christie’s und Sotheby’s doppelt so teuer, und wenn es sich um benutztes Scheißhauspapier handelte.«
»So eine Art Prozessbeschleuniger?«, fragte Bernd. »Katalysator? Und die Tussen von Collins sind die Bilder, und Collins ist die Tate?«
Martin zuckte die Schultern.
»So in etwa.«
Bernd wackelte mit dem Kopf und verzog die Lippen. »Zu kompliziert, fürchte ich. Der Zusammenhang wird nicht sofort klar. Das kapiert Johnny 08/15 nicht.« Er murmelte vor sich hin. »Collins, die Tate? Nein. Collins, der Katalysator? Nein. Collins, der Starmacher? Nein.«
»Martin!«
Eine Stimme rief von irgendwoher.
Er blickte sich um, während er Bernd weiter murmeln hörte.
»Collins, der Tussenbefreier? Nein.«
»Ich hab’s«, sagte Martin.
»Schieß los!«
»Erst an Collins Seite, und dann auf Seite eins!«
Bernd schlug ihm auf die Schulter. »Perfekt!«
»Martin!« Die Stimme rief noch einmal.
Er stand auf.
»Ja, was ist denn?«
»Komm mal rüber hier«, sagte ein Kollege, dessen Namen Martin immer vergaß, »das Fass will dich sprechen.«
»Bin gleich wieder da«, kündigte Martin Bernd an und ging zu dem Kollegen, der seinen Schreibtisch nahe dem Aquarium von Florian hatte.
»Hat er gesagt, worum es geht?«, fragte Martin. Einzelgespräche beim Fass waren nicht immer ein gutes Zeichen.
»Ein Auftrag für dich.«
»Und was?«
Der Kollege zuckte die Schultern. »Irgendwas mit Afrika.«
Kapitel 2
Berlin
Verteidigungsministerium, Reichpietschufer
Andreas Schmidt, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, stieg aus seiner schwarzen Limousine. Er ging mit eiligen Schritten, umschirmt von seinen Leibwächtern, die Treppen hinauf, durch einen Wald von Mikrophonen, die ihn an einen antiken Spießrutenlauf erinnerten. Blitze aus Kameras zuckten, als hätte ihn der Zorn der Götter getroffen, und Reporter und Journalisten mit Diktiergeräten und Notizblöcken stellten sich ihm in den Weg, um kurz darauf von seinen Leibwächtern unsanft zur Seite befördert zu werden.
Das Stakkato der Fragen donnerte durch seinen Kopf.
Was hat die Bundesregierung von dem Syrien-Deal gewusst?
Sind tatsächlich al-Qaida- oder gar ISIS-Kämpfer unter den Rebellen?
Warum unterstützt Deutschland eine Diktatur mit Panzern?
Werden Sie zurücktreten?
Oder der Verteidigungsminister?
Die Türen schlossen sich hinter ihm und die Stimmen flauten ab. Zwei Reporter schlugen gegen die Scheibe und wurden von den Security-Leuten des Ministeriums zurückgehalten.
»Alles in Ordnung?«, fragte einer der Leibwächter.
Schmidt atmete durch und fuhr sich durch seine schweißnassen, schwarz-grauen Haare.
»Soweit man das in Ordnung nennen kann.«
Er nahm den Gang zu seinem Büro. In der Hand die Titelseite einer Boulevard-Zeitung, auf dem Cover sein Bild. Seine Finger waren schweißnass, die Druckerschwärze der Zeitung hatte sich mit dem Schweiß vermischt, so dass seine Hand aussah, als wäre er gerade aus einer Kohlenmine gekommen.
Scheißboulevardzeitung, dachte er, immer so viel Farbe wie möglich.
Er schaute auf das Cover, auch wenn ihm seine innere Stimme sagte, dass er es besser nicht tun sollte. Das Papier war gewellt, so sehr hatte er es auf dem Weg hierher umklammert.
»Der Todesengel« lautete die Überschrift. Darunter ein Bild von ihm.
Er betrat sein Büro. Setzte sich an seinen Schreibtisch, kramte mit zitternden Händen ein Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn und die Druckerschwärze von den Händen. Draußen, vor dem Tor des Verteidigungsministeriums, sah er noch immer die Horden von Journalisten stehen.
Dass ihm so etwas passieren konnte …
Das Telefon klingelte.
Er zuckte zusammen, als stünde der Henker in der Tür. Aber es war nur seine Sekretärin, er erkannte die Nummer.
»Was gibt’s?«
»Ihre Frau.«
»Sagen Sie ihr, ich bin noch nicht zurück!«
Er legte auf.
Lehnte sich zurück.
Er hatte seiner Frau noch nichts davon erzählt. Oder besser, seiner Ex-Frau. Seinen Kindern (oder Ex-Kindern) auch noch nicht. Jetzt erfuhren sie es halt aus der Presse. Dann war es halt so. Trotzdem hatte er nicht die Kraft, jetzt noch lange mit seiner Frau zu streiten und ihr alles hundertmal zu erklären. Jetzt musste er sich erst einmal selber retten.
Sein Handy klingelte.
Wieder zuckte er zusammen.
Es war die Handynummer seiner Ex-Frau, die sich immer noch öfter bei ihm meldete als er bei ihr.
Er ließ das Handy klingeln und fühlte sich schlecht dabei.
Dann öffnete er seine Sakkotasche, fingerte ein Aspirin hervor und schluckte die Tablette ohne Wasser.
Alles war schiefgegangen, dachte er, als sich der bittere Geschmack in seiner Mundhöhle verteilte.
Syrien.
Der Todesengel.
Schmidt war zuständig gewesen für eine Panzerlieferung nach Syrien. Kampfpanzer Leopard. Eigentlich Business as usual. Schließlich war Deutschland der drittgrößte Waffenlieferant der Welt. Und auch wenn das Regime von Assad damit mehrheitlich al-Qaida-Kämpfer ausschalten sollte, war die Story nicht nur an die Oberfläche geraten, wo sie nicht hin sollte, sondern es sah auch noch so aus, als würde Deutschland den Freiheitskampf in Syrien mit Waffenlieferungen verhindern. Die USA waren brüskiert, dass Deutschland indirekt das Assad-Regime unterstützt, das Präsident Obama gerade bekämpfen wollte. Als ob die USA sonst etwas dagegen hatten, wenn man die Armee unterstützte, dachte Schmidt bitter, und dabei gleichzeitig noch ein paar al-Qaida Terroristen ausschaltet.
Die ganze Sache war an sich nichts Ungewöhnliches.
Schlecht war nur, dass es herausgekommen war.
Die Lieferung und der folgende Skandal waren gut und böse in einer Form, wie so vieles, was sich Deutschland als eines der mächtigsten Länder der Welt über den Hintereingang erlaubte, da es dies durch die Vordertür aufgrund seiner Vergangenheit nicht durfte. Nur war es eben öffentlich geworden, »surfaced«, wie ein Journalist vom Economist vorhin gesagt hatte. Und jetzt wollte natürlich niemand mehr etwas damit zu tun haben. Irgendeiner musste geköpft werden, damit Kanzler und Verteidigungsminister ihre Posten behalten konnten.
Und Schmidt war als Bauernopfer vors Loch geschoben worden, um den Verteidigungsminister zu entlasten.
Langsam beruhigte sich sein Puls. Was konnte ihm schlimmstenfalls passieren? Abgesichert wäre er als Staatssekretär, auch wenn er keinen »Ehrensold« bekommen würde, wie manche Bundespräsidenten nach nur sehr kurzer Amtszeit. Aber würde er noch irgendwo einen Job bekommen? Würde er sich noch irgendwo blicken lassen können? Auf den Empfängen, auf die er manchmal seine Ex-Frau mitnahm, um eine heile Familie vorzugaukeln, obwohl sie seit zwei Jahren geschieden waren, was er niemandem erzählt hatte? Auf all die Partys und Events der Hauptstadt, wo man Champagner- oder Rotweingläser schwenkend herumstand und Belanglosigkeiten austauschte, die aber sehr schnell zu konkreten Karrieremöglichkeiten werden konnten? Er sah sich schon als Sicherheitsberater korrupter Oligarchen und zwielichtiger Scheichs, irgendwo in Kasachstan oder im Jemen, einer, der auf Honorarbasis arbeitete und seiner Frau niemals sagen könnte, was er wirklich machte. Was war von dem Andreas Schmidt übrig geblieben, der einmal angetreten war, um für Ruhe und Frieden in der Welt zu sorgen?
Du weichst deiner Ex-Frau aus, dachte er, und später wirst du sie belügen. Genauso wie du die anderen belügst und ihnen sagst, dass sie noch deine Frau ist, obwohl du gar nicht mehr in dem gemeinsamen Haus wohnst, sondern heimlich in einer Zweizimmerwohnung in Tiergarten? Und dann wunderst du dich, wenn die Presse dir auch nicht glaubt?
Vielleicht war er wirklich schuldig, dachte er. Vielleicht sollte es ihn treffen?
Er zuckte zusammen.
Sein Handy klingelte schon wieder.
Kaum jemand hatte diese Nummer. Wer konnte das sein?
Er schaute auf das Display.
Eine Münchener Nummer.
Vielleicht war es wichtig.
Er nahm den Anruf an.
»Schmidt.«
»Schmidt«, wiederholte die Stimme am anderen Ende, »Sie scheinen ein paar Probleme zu haben?«
Eigentlich war es keine Frage. Es war eine Feststellung.
Irgendwo hatte er die Stimme schon einmal gehört. Sie war vertraut und unheimlich zugleich. Da sprach der Anrufer schon weiter.
»Vielleicht sollten Sie eine Weile untertauchen? Ihrem Vaterland können Sie trotzdem weiter dienen.«
Kapitel 3
Sonderverwaltungszone Hongkong
The Landmark
Lucia Ming eilte durch den gläsernen Korridor, vorbei am Konferenzraum im dreißigsten Stock des Landmark Towers. Sie blickte, während sie lief, über den Hafen von Hongkong, sah die riesigen Türme der Bank of China und der HSBC, der Hongkong and Shanghai Banking Corporation, die im 19. Jahrhundert vom Britischen Empire gegründet wurde, um das China-Geschäft zu finanzieren.
Ihr Chef hatte sie gerufen, und wenn er etwas wollte, war es immer eilig und immer wichtig. Beides zugleich. Grundsätzlich. Und wie immer hatte sie ein mulmiges Gefühl dabei.
Während sie aus dem Fenster blickte, ertappte sie sich dabei, wie sie die Passage von »Für Elise« von Ludwig van Beethoven auf der Rückseite des iPad spielte, das sie wie einen Schutzschild vor sich trug. Eine Melodie, die sie liebte, aber irgendwie auch hasste. Die Art und Weise, wie man dabei kleinen Finger und Ringfinger parallel einsetzt, hatte ihr die schlimmsten Stunden ihrer Kindheit verschafft, und ihr Klavierlehrer, der alle zwei Tage zwei Stunden auf sie angesetzt wurde, hatte ihr damals die Finger auseinandergebogen, bis sie glaubte, sie würden brechen, und sie, mit Tränen in den Augen, fast geschrien hatte. Und das war nicht die einzige Plackerei gewesen. Ihre Eltern hatten sie zur Vorbereitung des Gaokao, der Abschlussprüfung in der Schule, die zum Besuch einer Universität berechtigte, nach Maotanchang geschleift. Maotanchang. »MTC« nannten die Chinesen diesen Ort auch. Das klang gut. So ähnlich wie MIT, das amerikanische Elite-College Massachusetts Institute of Technology. Im MTC wurden die Schüler auf die Abschlussprüfung vorbereitet, jedenfalls die, deren Eltern es sich leisten konnten. Wobei »Vorbereitung« eine harmlose Bezeichnung war für den Drill, der dort an sieben Tagen die Woche durchgezogen wurde. Es gab kein Fernsehen, keine Musik, keine Ablenkung, keine Freunde. Nur Büffeln, nahezu vierundzwanzig Stunden am Tag. Es gab Übungsklassen, in denen den Schülern von der Decke aus Aminosäure in die Venen injiziert wurde. Die Schulleitung sagte, dass die intravenöse Energiezufuhr Zeit sparen würde.
MTC, dachte Lucia. Und Für Elise. Sie war froh, dass sie mit all dem durch war. Auch wenn ihr Leben nicht gerade ruhiger geworden war. Wer die Prüfung, das Gaokao, bestand, dem stand die Welt offen. Wer durchfiel, der beging oft Suizid. Und seine oder ihre Eltern gleich mit. Und irgendwann hatte Lucia gewusst, dass der Klavierdrill ihrer Kindheit keine dunkle Wolke über einer unbeschwerten Zeit war, sondern der Beginn der Normalität. Der Klavierlehrer hatte ihr dann immer die Geschichte von der chinesischen Mauer erzählt. Die ist viertausendachthundert Kilometer lang, hatte er gesagt, und du kannst dir wohl den Schmerz vorstellen, den all die Menschen gespürt haben, die so etwas Großes bauen mussten. Er hatte ihr noch andere Dinge erzählt, dass die Körper derer, die beim Mauerbau erschöpft zusammengebrochen waren, ebenfalls zu Baumaterial verwandelt und damit Teil der Mauer wurden. Die Lehrer am MTC hatten ähnliche Geschichten erzählt. Seitdem hatte Lucia immer Angst vor ihrem Klavierlehrer gehabt. Doch seltsamerweise mochte sie das Stück, Für Elise, noch immer und spielte es immer wieder gern.
Für Elise.
Oder Für Lucia? Ob das mal jemand schreiben oder auch nur sagen würde? Mit neunundzwanzig Jahren hatte sie eigentlich das Alter erreicht, in dem sie heiraten und eine Familie gründen sollte. In den spiegelnden Scheiben sah sie ihr hübsches Gesicht und ihre schlanke, attraktive Gestalt, die hypnotischen Augen und die schwarzen, hochgesteckten Haare, die ihr ein etwas strenges und kontrolliertes Äußeres verschafften, was allerdings im Kontrast zu ihrer weißen Bluse stand, bei der stets ein Knopf mehr geöffnet war, als es eigentlich dem Protokoll entsprach. Im Gegenlicht sah es so aus, als wäre ihr Spiegelbild ein Teil der Skyline von Hongkong und als würde sie, während sie über den Gang jagte, über den Wolkenkratzern schweben. Und im Raum schwebte sie tatsächlich. Denn sie wusste, es konnte nicht an ihrem Äußeren liegen, dass sie ohne feste Bindung durchs Leben ging. Der Grund dafür lag eher im Inneren dieses riesigen Bürogebäudes, des Landmark Towers, der sich inmitten von Hongkongs blitzender Skyline in den stahlblauen Himmel erhob.
Denn für Freizeit blieben bei ihrem Job pro Tag nur etwa ein bis zwei Stunden übrig. Als einzige Tochter ihres Vaters Ming Yao war es umso wichtiger, dass aus Ming Lia ebenfalls etwas Großes wurde. In China hieß sie Ming Lia. Erst der Nachname, dann der Vorname. Für die westliche Welt nannte sie sich Lucia Ming. Erst der Vorname in westlicher Form und dann der Nachname. So machten es die Hongkong-Chinesen schon seit Jahrzehnten. Auch Bruce Lee hieß eigentlich Lee Siu-Lung. Und auch er lebte in Hongkong. Und Lucias Vater mochte Bruce Lee. Wenn er einmal Zeit fand, die Filme anzuschauen. Denn ihr Vater war nicht nur Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas gewesen, sondern auch Bereichsleiter von Sinopec, einem riesigen staatseigenen Rohstoff- und Raffineriekonzern. Ihr Vater hatte für den Konzern mittelgroße Ölförderfirmen im Nahen Osten zusammengekauft. Jetzt war er schon seit zehn Jahren tot, gestorben an einem Herzinfarkt. Bis dahin hatte er sich um seine Tochter allerdings nie gekümmert, sondern die Erziehung anderen und Lucias Mutter überlassen. Das Einzige, was er Lucia hinterlassen hatte, war der Druck, genau die gleiche Karriere wie er hinzulegen. Da galt es als große Schande, wenn seine einzige Tochter nicht eine ähnliche Karriere schaffte.
Ihr Vater.
Selbst in seinem Tod hatte er Lucia allein gelassen. Vielleicht lag es daran, dass sie sich einerseits eine Familie wünschte und besonders einen Mann, den sie nicht hatte, andererseits aber kaum jemanden an sich heranließ. Denn wer Nähe und Vertrauen brachte, der konnte enttäuscht werden. Man öffnete sich, machte sich verwundbar. Jemand anderes konnte zustoßen. Die Gefahr war weit geringer, wenn man sich gar nicht öffnete.
Für Elise.
Sie tippte wieder die Reihenfolge der Klänge und Tasten auf ihrem iPad, als sie sich dem Büro näherte.
Für Lucia?
Sie hatte das Büro ihres Chefs erreicht.
Schaute noch einmal in die gespiegelte Fassade.
Sah ihr Gesicht. Korrekt, besorgt.
Und betrat das Zimmer.
Kapitel 4
Berlin
Redaktionsbüro Global News, Friedrichstraße
»Interessiert mich nicht«, bellte Flori. »Ich will wissen, ob die jetzt schwanger ist oder nicht.« Er gab Martin, der eben das Aquarium betreten hatte, mit einer knappen Geste zu verstehen, dass er sich setzen sollte. Martin ließ sich vorsichtig auf dem Stuhl vor dem gigantischen Tisch nieder, der mit Zeitungen, Papier, CDs, DVDs und Visitenkarten überhäuft war und aus dem hier und da eine Kaffeetasse und ein oder zwei angebissene Donuts hervorragten.
»Was?«, rief Flori. »Die hat zugenommen? Ihr werdet doch wohl rausfinden, ob die jetzt zugenommen hat oder wirklich schwanger ist!« Er kratzte sich am Kopf und schaute aus dem Fenster auf die Friedrichstraße hinunter. »Ja, das ist doch gerade der Skandal. Hast du’s endlich kapiert. Genau, wie soll so eine Drogentussi ein Kind aufziehen?« Er blätterte durch ein paar Seiten.
Interessiert blickte Martin auf den riesigen Ventilator auf Floris Fensterbank, der volle Kraft blies und ein ums andere Mal Dutzende von Notizblättern und zerknitterten Zetteln von Floris Schreibtisch Richtung Fußboden fegte, ohne dass Flori davon irgendeine Notiz nahm. »Das ist kein Lebenslauf, was ich hier habe, das ist ’ne Polizeiakte«, schnappte Flori. »Also, beweg deinen Arsch und finde raus, ob sie wirklich schwanger ist.« Er hörte ein paar Sekunden zu.
»Was? Wenn sie es nicht ist? Dann behaupten wir es halt so lange, bis sie es ist. Was?« Er schaute Martin kurz an, während er weiter mit dem Anrufer stritt. »Passt nicht zu den Fakten?« Er atmete tief ein. »Schlecht für die Fakten!«
Er ließ den Hörer krachend auf die Gabel fallen und sich selbst schnaufend auf seinen riesigen, schwarzen Lederstuhl. Von dort aus durchbohrte er Martin geschlagene dreißig Sekunden lang mit seinen Blicken.
»Martin Fischer«, sagte er schließlich in einem Ton, der jedem Bewährungshelfer gut zu Gesicht gestanden hätte.
Martin versuchte, nicht auf dem Stuhl hin und her zu rutschen oder seine Hände zu bewegen. Ebenso wusste er nicht, was er darauf antworten sollte, bis auf Ja, der bin ich, aber das wusste das Fass wohl selbst. Also sagte er erst einmal gar nichts, was auch nicht verkehrt war, da die Worte schon aus Floris Mund heraussprudelten.
»Sie wollen nicht immer nur Sensationsjournalismus machen? Wollen auch mal die weite Welt sehen? Hä?«
Martin wusste nicht, ob er da gerade in eine Falle tappen sollte, in der jede Antwort falsch sein könnte, da sprach Flori schon weiter. »Wie wäre es mit Afrika?«
Das hatte Martin nicht erwartet. Das klang nach Abenteuer, nach großer, globaler Reportage. Nach Öl und Rohstoffen, Hunger und Elend, aber auch wundervollen Landschaften. Es klang aber auch ein bisschen gefährlich. Gefährlicher jedenfalls, als von New York aus über das Weltbank-Treffen zu berichten. Aber es war in jedem Fall internationaler, als in Tegel wegen irgendwelcher B-Promis auf der Lauer zu liegen.
»Ja, gerne«, antwortete er.
»Gut. Sie wollen nach Afrika? Sie können nach Afrika.«
Er kramte aus dem Stapel von Papier einen Klemmhefter heraus, öffnete ihn und hielt Martin ein Foto unter die Nase.
»Kennen Sie die?«
Martin blinzelte auf das Foto. Eine braunhaarige, etwas ältere Dame.
»Dian Fossey«, sagte Flori nach ein paar Sekunden. Als von Martin noch immer nichts kam, sprach er weiter. »Gorillas im Nebel? Davon schon mal gehört?«
»Klar«, entgegnete Martin jetzt. »War das nicht so ein Bestseller in den achtziger Jahren?« Er erinnerte sich dunkel.
»Allerdings.« Flori nickte. »Habe ich auch nie verstanden, warum das damals so hip war. Überhaupt, die Achtziger. Das Wasser steht der Welt mal wieder bis zum Hals, Sowjets und Amis rüsten sich tot, Gaddafi spielt tollwütiger Hund, und Tschernobyl fliegt in die Luft. Und was machen die Leute? Sie interessieren sich auf einmal für Berggorillas in einem Land, das sie wahrscheinlich niemals sehen werden.«
»Ist das nicht irgendwo in Ruanda?«, fragte Martin.
»Virunga-Nationalpark.« Flori stopfte sich einen alten Donut in den Mund. »Zwischen Kongo und Ruanda, genau genommen. Waren Sie schon mal dort?«
»Leider noch nicht.«
»Aber ihr Kollege Bernd war schon einmal dort«, sagte Flori. Er stand auf, und Martin sah, wie sich Floris weißes Hemd beachtlich über seinem Bauch spannte. In dem Moment erinnerte er ihn an ein weißes Sanitätszelt. »Und wissen Sie was? Er nimmt Sie mit!«
Martins Züge hellten sich auf. Er sah schon am Horizont die große, internationale Reportage über … ja, über was eigentlich?
»Worum wird es gehen?«, fragte er.
»In diesem Jahr wird Fossey achtzig Jahre alt. Oder wäre achtzig Jahre alt geworden.« Er schaute aus dem Fenster. »Sie wissen ja, sie ist 1985 mit erschlagenem Schädel in ihrem Camp Karisoke in Ruanda gefunden worden. Manche sagen, sie wäre von Wilderern aus dem Kongo ermordet worden, die die Berggorillas lieber an reiche Japaner verkauft hätten.«
»Und komisch ist ja auch, dass sie in ihrer Hütte ermordet wurde«, sagte Martin. »Im Wald wäre es einfacher gewesen.«
»Das ist wahr. Es scheint auch einen Kampf in der Hütte gegeben zu haben, angeblich hat Fossey auch noch zu ihrer Pistole gegriffen, hatte da aber die falsche Munition drin.«
»Ich habe gehört, dass sie der Ausschlachtung der Gorillas als Touristenattraktion im Wege war«, sagte Martin.
Flori zuckte die Schultern. »Möglich. Andere sagen, es wäre ein Suizid gewesen. Umstritten war Fossey allerdings schon zu Lebenszeiten.« Er drehte sich zu Martin um.
»Für die einen war sie die selbstlose Retterin der Berggorillas, der erste Mensch, dem eine echte Kontaktaufnahme zu den Menschenaffen gelang. Ich bin da etwas skeptisch, ob so was geht, aber sollen die Leute glauben, was sie wollen. Ich habe letztens gelesen, dass manche auch glauben, sie hätten ein Verhältnis zu ihrer Katze aufgebaut. Egal!« Er stemmte die Hände in die Hüften. Draußen fuhr mit ohrenbetäubender Lautstärke ein Feuerwehrauto vorbei. »Wieder so ein Asozialer, der beim Rauchen eingeschlafen ist«, sagte Flori und schaute blinzelnd aus dem Fenster. Dann kam er zurück zum Thema. »Andere beschreiben Fossey als unbeherrschte und verbitterte Frau, die Kollegen brüskierte und Afrikanern mit Herablassung begegnete. So nach dem Motto Ich zeige euch blöden Schwarzen mal, wie man mit Tieren richtig umgeht. Und auch heute noch spaltet sie die Gemüter. Und …«
»Und was?«
»Und sie würde dieses Jahr achtzig Jahre alt, wie ich schon sagte.«
»Und daraus machen wir eine Story?«, fragte Martin.
»Was heißt hier wir? Sie!« Flori ging zurück zum Schreibtisch und zog ein Exemplar der Financial Times hervor. Martin erkannte das lachsfarbene Papier sofort. Es war die englische Ausgabe. Floris Blick flog über die Seiten.
»Hier steht’s.« Er drückte seinen dicken Daumen auf eine Textstelle, die er schon einmal markiert hatte. »Der Virunga- Nationalpark, der sich sowohl auf den Kongo als auch auf Ruanda erstreckt, wird zunehmend zum Zankapfel der beiden Länder. Und einer der größten Zankäpfel sind die Berggorillas.«
Martin nickte. »Soweit ich weiß, sind sie eine ziemliche Touristenattraktion geworden. Kann an dem Buch von Fossey liegen. Verfilmt wurde es ja auch, soweit ich weiß?«
»Wurde es«, sagte Flori und setzte sich wieder. »Und eine ziemliche Touristenattraktion ist untertrieben. Diese Parks sind mit mehr als zweihundertfünfzig Millionen Dollar Jahreseinnahmen der größte Bringer von Auslandsdevisen in ganz Ruanda.«
Martin hob die Augenbrauen. »Das wusste ich nicht.«
»Jetzt wissen Sie’s! Das ist eine Superstory. Achtzig Jahre Dian Fossey, ihr Tod, der noch immer nicht aufgeklärt ist, das Aufflackern eines neuen Krieges zwischen Kongo und Ruanda und mittendrin die Berggorillas. Sie schreiben einen schönen Artikel, machen haufenweise Fotos, und filmen werden Sie auch.«
Martin dachte eine kurze Weile nach.
»Das heißt, ich soll nach Afrika?«
Flori sah ihn erstaunt an. »Wenn Sie hier in der Friedrichstraße Berggorillas finden, können Sie auch über die schreiben.«
»Na ja, aber das kostet doch ein … ähm …« Martin wunderte sich, dass für eine solche Aktion auf einmal Budget da war.
»Das kostet eine Stange Geld?«, ergänzte Flori. »Tja, da können Sie mal sehen, wie wichtig uns gute Reportagen sind. Aber die Wahrheit ist …« Er blickte kurz zur Decke. »Das Medienboard und die Filmförderung Berlin Brandenburg haben einen Afrika-Preis ausgeschrieben. Wenn wir den kriegen, haben wir die Kosten doppelt drin.«
Martin stand auf. »Den kriegen wir. Das wird eine super Story.«
»Hoffe ich auch«, sagte Flori, und Martin hatte die leise Drohung darin nicht überhört. »Klären Sie das mit Bernd, er soll bei der Logistik helfen. Ich muss wissen, was Sie dafür brauchen, wen wir in Afrika aktivieren müssen und vor allem, was das Ganze kostet. Die Büros in Johannesburg und Nairobi können dabei helfen. Kriegen Sie das hin bis morgen?«
»Bin schon unterwegs.«
»Bestens«, entgegnete Flori. »Dann Abmarsch!« Er zeigte Richtung Tür. »Es gibt viel zu tun.«
Martin blieb kurz stehen. Etwas war ihm noch eingefallen, und er bereute es schon, dass er überhaupt seinen Mund aufgemacht hatte. Aber da waren die Worte schon draußen. »Ich bin kein Afrika-Experte«, sagte er und trat von einem Fuß auf den anderen, »aber liegt der Virunga-Nationalpark nicht im Dreiländereck von Ruanda, Uganda und Kongo?«
Flori nickte. »Das ist korrekt.«
»Die drei Länder waren doch noch nie ganz, ähm, konfliktfrei.«
Flori schaute ihn erstaunt an. »Haben Sie etwa Angst?«
»Nein«, log Martin, obwohl er welche hatte, »ich denke, die Länder waren deswegen noch nie ohne Kriege, weil sich dort zum Teil die größten Rohstoffvorräte der Welt befinden …«
Flori blinzelte ihn an.
»… insbesondere Kobalt und Coltan.«
»Und?«, fragte Flori.
»Das wäre doch auch eine interessante Story!«
»Coltan ist Coltan, und Dian Fossey ist Dian Fossey. Sie…«, er zeigte auf Martin, »berichten über Letzteres. Oder Sie bleiben hier! Klar?«
»Klar!«
»Gut, dann Abmarsch!«
Martin verließ das Büro des Chefredakteurs. Und stellte gerade fest, dass das Wort Berggorilla auch gut zu Flori passen würde.
Kapitel 5
Berlin
Auswärtiges Amt, Werderscher Markt
Janine Drieling hatte es geschafft. Die vierzehnmonatige Ausbildung für den höheren Dienst im Auswärtigen Amt war beendet. Der Umschlag lag auf dem Tisch. Und selten war sie beim Anblick eines einfachen Gegenstandes so aufgeregt gewesen wie jetzt in diesem Moment. Vielleicht zuletzt als Kind zu Weihnachten.
Der Weg zu diesem Umschlag war so hart und steinig gewesen, wie sie es sich vorgestellt hatte, und es würde nicht unbedingt angenehmer werden in einem Job, bei dem man alle drei bis vier Jahre versetzt werden konnte, und das nicht nur innerhalb von Europa, sondern weltweit.
Vielleicht war das ständige Reisen, das jetzt auf sie zukam, auch nur eine Flucht gewesen, um die Gegenwart hinter sich zu lassen, den Mann zu vergessen, dem sie immer noch hinterhertrauerte, auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte. Den Mann, der sie verlassen hatte, weil »aus der Beziehung irgendwie die Luft raus war«. Vielleicht war es deshalb wirklich am besten, so weit wie möglich zu verreisen, zu verschwinden, bis man nicht mehr wusste, wer man war oder was die Vergangenheit war. Doch konnte sie vor sich selbst davonlaufen? Wohl kaum. Ein Mensch konnte sich schließlich auch nicht selbst tragen, indem er sich auf seine Hände setzte, wie es ihre Mutter ihr immer als Kind erzählt hatte.
Die Ausbildung war hart gewesen, und Janine war für jede Ablenkung dankbar. Zuerst das schriftliche Auswahlverfahren, dann die Einladung zu den mündlichen Gesprächen in die Villa Borsig, die einst einer Berliner Industriellenfamilie gehörte und in der jetzt die Akademie des Auswärtigen Amtes untergebracht war. Das Vorstellungsgespräch vor dem Auswahlausschuss, in dem sie zur Euro-Staatsschuldenkrise gegrillt wurde, eines der wenigen Themen, bei denen sie sich nicht so gut auskannte, wie bei fast allen anderen, dann das Kurzplädoyer, das sie halten musste. All das hatte Janine gefordert, aber nicht überfordert. Leidenschaftlich plädierte sie für Freiheit, Verantwortung und Demokratie, obwohl sie im Inneren wusste, dass die Welt sich gerade in eine andere Richtung bewegte. Weg vom Washington-Consensus hin zu einer autoritären Staatsführung, wie man sie in Singapur und China fand.
Dann die Sprachprüfung und die Gruppenübungen. Schließlich hatte der BND, der Bundesnachrichtendienst, noch eine Sicherheitsprüfung durchgeführt. »Machen Sie sich keine Sorgen, so eine Prüfung wird bei jedem gemacht, der Zugang zu als geheim eingestuften Verschlusssachen erhalten soll oder sie sich verschaffen könnte«, hatte der kaugummikauende Mann mit den struppigen Haaren gesagt und dabei fast den genauen Wortlaut des Gesetzes wiederholt. Janine wusste nicht, wie viele ehemalige Vorgesetzte, Chefs und andere ihr nahestehenden Personen vom BND verhört worden waren und ob tatsächlich, wie einige der Teilnehmer im Aufnahmeverfahren tuschelten, auf sie alle ein Detektiv angesetzt worden war, der die letzten Tage und Wochen jeden ihrer Schritte überwacht hatte.
Doch all das waren nur Vorbereitungen, nur die Generalprobe vor der großen Premiere. Ab sofort würde der erste wirkliche Auslandsaufenthalt auf sie warten, und Janine sah schon das Gesicht ihrer Eltern, die endgültig einsehen mussten, dass sie ihr Töchterchen bei weitem nicht mehr so oft sehen würden wie bisher, wenn sie ihren Rollkoffer packen würde, um dahin zu gehen, wo ihr Dienstherr sie haben wollte. Einen Freund oder Partner hingegen musste sie nicht vertrösten. Denn es gab ja keinen. Alles im Auftrag des Volkes.
»Auf Sie warten spannende Eindrücke und neue Herausforderungen, die Sie, davon bin ich überzeugt, mit dem, was Sie mitbringen, und dem, was Sie hier in Ihrer Ausbildung gelernt haben, gut und sicher bewältigen werden«, hatte die stellvertretende Leiterin der Akademie Auswärtiger Dienst erklärt. »Das Auswärtige Amt braucht keine Einzelkämpfer, sondern Teamspieler.« Wenn Janine allerdings an all die einsamen Vorbereitungsstunden dachte, um erfolgreich das harte Auswahlverfahren zu bestehen, kam sie sich eher wie ein Schachspieler vor, der nur gegen einen Gegner kämpft, und zwar allein und nicht im Team. Allein gegen die Müdigkeit, das Bedürfnis, sich zu entspannen und am Ende allein gegen sich selbst. »Es ist wie beim Fußball«, hatte die Leiterin noch hinzugefügt, als hätte sie Janines Gedanken gelesen, und Janine war überrascht gewesen, von einer Frau einen Fußballvergleich zu hören, »es sind einzelne Spieler, die Tore schießen, aber es ist die Mannschaft, die das Spiel gewinnt.« Trotz der Quoten war der diplomatische Dienst eben immer noch eine männerdominierte Welt.
Jetzt lag ihr erster Einsatzort in diesem kleinen, schmucklosen Umschlag verschlossen vor ihr auf dem Tisch. Sie würde endlich ihr kleines Büro am Werderschen Markt gegen die große Welt eintauschen.
Janine betrachtete den Umschlag.
Atmete tief durch.
Sie nahm den Umschlag in die Hand. Zählte bis drei.
Und öffnete ihn.
Kapitel 6
Sonderverwaltungszone Hongkong
Landmark Tower
Das Erste, was Lucia Ming sah, als sie das Büro ihres Chefs betrat, war die gigantische Weltkarte, die sich schon deshalb von anderen unterschied, weil China den Platz in der Mitte einnahm. Links war Europa, und rechts war Amerika. China, das Reich der Mitte, hier war es bereits Wirklichkeit geworden. Zigarrenrauch vernebelte das Büro. An das Rauchverbot hielt sich Huan Yi genauso wenig wie die Festlandchinesen, wenn sie ein Restaurant besuchten.
»Warum heißen wir Zhonghua, Reich der Mitte?«, fragte Huan Yi unvermittelt. Das war eine seiner Marotten, maschinengewehrartige Fragen auf sie abzufeuern.
»Weil, äh …« Lucia stutzte kurz. »Weil wir der Mittelpunkt der Welt sind.«
»Was heißt das konkret?«
»Dass wir wieder Weltmacht werden müssen.«
»Werden müssen? Waren wir das nicht immer?« Er stemmte die Hände in die Hüften.
»Nein, im 18. Jahrhundert sind wir zurückgefallen.«
»Warum?«
»Weil …«, sie dachte nach, »weil die Engländer etwas hatten, was wir nicht hatten.«
»Und was war das?«
»Die industrielle Revolution!«
»Und darum müssen wir jetzt was machen?«
Trotz all ihrer Erfolge während ihrer Ausbildung kam siesich vor wie in der Schule. Oder wie bei einem Drill in der Armee. Oder beidem.
»Schneller sein als je zuvor.«
»Sind wir besser?«
»Ja.«
»Warum?«
Lucia überlegte kurz, was Huan Yi wohl hören wollte.
»Wir haben eine gelenkte Demokratie«, sagte sie.
»Warum ist das besser als die Demokratien des Westens?«
»Weil die Demokratien des Westens allen gefallen wollen. Sie kaufen Wählerstimmen durch Geld. Und weil sie dieses Geld nicht haben, verschulden sie sich maßlos, um Wünsche zu erfüllen, die sie gar nicht erfüllen können. Solche Systeme implodieren über kurz oder lang. Wie man es jetzt an der Eurokrise sieht.«
»Richtig!« Er schien befriedigt. Das war es, was er hören wollte.
Er nahm einen Zug von seiner Zigarre und legte sie zurück in den Aschenbecher aus elfenbeinfarbenem Biskuitporzellan. Huan Yi war ein alter Kader der Kommunistischen Partei, in dessen Büro Mao-Bilder neben den Wolkenkratzern von Hongkong, Shanghai und Peking hingen. Und auch wenn Huan Yi noch immer aus der Mao-Bibel zitierte, hatte er sich schnell an westlichen Luxus gewöhnt, den der Aufschwung Chinas mit sich brachte. Und wieder einmal bemerkte Lucia, dass es sich um die Mao-Bilder der ersten Ära handelte, Bilder mit dem großen Muttermal. Die Zeit des Anfangs, die Zeit, als der große Vorsitzende noch als unantastbar galt, die Zeit vor seiner Rehabilitierung. Und dennoch, lieber im Mercedes weinen als auf dem Fahrrad glücklich sein, hatte ihr Chef einmal gesagt. Seine Zigarren kamen nach wie vor aus Havanna im kommunistischen Kuba, während der Rotwein, den er trank, auch wenn er ihn nicht mochte, aus den besten Anbaugebieten in Bordeaux kam. Anzüge trug er aus Italien, weil sie seine tonnenartige Gestalt gut zu kleiden und unvorteilhafte Formen gut zu verstecken vermochten. Ein höchst widersprüchlicher Mensch.
Huan Yi blickte noch einmal auf die Weltkarte und ließ seine Hand über das Büro und das gesamte Gebäude schweifen.
»Sie wissen, was wir hier machen?«, sagte er dann kurz und knapp, ohne Lucia zu begrüßen oder ihr einen Platz anzubieten.
Das wusste Lucia. Sie arbeitete als Investment-Manager bei SAFE.
»SAFE« stand für »State Administration of Foreign Exchange«, und Lucia Ming war zuständig für Auslandsinvestitionen dieses riesigen, staatseigenen Investment-Vehikels.
SAFE. Die Abkürzung passte gut, denn SAFE war der Verwalter des riesigen Devisenschatzes der chinesischen Großmacht, der Tresor, in dem ein Teil der gigantischen Anlagen schlummerte, die sich auf mehr als dreieinhalb Billionen Dollar beliefen und von denen die sechshundert Milliarden, für die SAFE verantwortlich war, nur sechzehn Prozent ausmachten.
Eine Gesamtsumme, von der sechshundert Milliarden nur sechzehn Prozent sind, dachte sie. Auch das war eigentlich unvorstellbar.
»Wir investieren in Wachstumsbranchen und ausländische Unternehmen«, sagte Lucia wie aus der Pistole geschossen.
»Weniger in Staatsanleihen des Westens?«
Lucia wurde erst mit einigen Sekunden Verzögerung bewusst, dass dies schon wieder eine Frage war.
»Der Großteil der Devisen in China ist in Dollar und Euro angelegt und hierbei besonders in Staatsanleihen.« Sie fuhr sich nervös durchs Haar, während Huans Augen sie wie Pistolen fixierten. »Beide westlichen Großmächte, sowohl die USA als auch Europa, sind allerdings hoch verschuldet, und wenn die Eurokrise einmal gelöst ist, falls sie überhaupt gelöst werden kann, würden sich die Märkte dem gigantischen Schuldenberg der USA widmen.«
»Und was passiert dann?«
»Entweder Inflation oder Schuldenschnitt.«
»Und das heißt?«
»Dann könnte es mit dem Dollar schnell abwärtsgehen.«
Huan Yi erhob sich. »Gut, dass die chinesische Führung schnell erkannt hat, dass sie mit den beiden Währungen Dollar und Euro das hat, was man in Bankenkreisen ein ›Klumpenrisiko‹ nennt. Gleichzeitig«, er wandte sich an die Weltkarte, »muss der Rohstoffhunger unseres Anderthalb-Milliarden-Volkes gestillt werden.«
Er schaute einen Moment weg und Lucia blickte noch einmal auf die Weltkarte. Dort waren auch Krisenländer eingezeichnet, denen SAFE Geld geliehen hat, indem es Staatsanleihen kaufte. Zu günstigen Konditionen für die Schuldner. Im Gegenzug mussten diese Länder China kleine Gefallen tun, zum Beispiel vor der UNO die Meinung vertreten, dass Taiwan kein eigenständiges Land sei, genauso wenig wie Tibet.
Huan sprach weiter. »Und so ist es auch Teil des neuen Fünfjahresplans, den die Partei verabschiedet hatte, einen immer größeren Teil der Devisen in ausländische Unternehmen zu investieren.« Er fixierte sie. »Insbesondere in Unternehmen, die Rohstoffe herstellen oder abbauen. Schon seit 2008 haben wir im Auftrag der chinesischen Zentralbank begonnen, in westliche Rohstofffirmen zu investieren. Rio Tinto, Royal Dutch Shell, BP.« Er schaute kurz auf das Mao-Portrait über seinem Schreibtisch.
»Doch die westlichen Konzerne sind schwer zu überzeugen, sehen uns nach wie vor als Gelbe Gefahr und legen uns so viele Steine wie nur möglich in den Weg. Daher müssen wir dort hingehen, wo man noch günstig einsteigen kann. Insbesondere dort, wo man mit der heimischen Bevölkerung einfacher reden kann als anderswo. Insbesondere in …«
Er schaute sie erwartungsvoll an.
»Afrika?«, sagte sie, halb feststellend, halb fragend.
Er nickte. »Afrika braucht etwas, was wir geben können.«
Er rückte das Mao-Bild über seinem Schreibtisch zurecht.
»Dafür brauchen wir gute Leute. Vor Ort. Leute wie Sie!« Er schaute sie an. Und jetzt lächelte er sogar. »Morgen geht es nach Peking. Und dann Richtung Westen. Wohin genau, das erfahren Sie noch.« Er drückte eine Taste auf seinem Computer. »Die restlichen Informationen sind jetzt gerade in Ihrer Inbox gelandet. Die Reisestelle weiß Bescheid! Packen Sie Ihre Sachen, morgen geht es los!«
Lucia verließ das Büro.
Schwankend und schweißgebadet.
Kapitel 7
Berlin
Verteidigungsministerium, Reichpietschufer
»Ihrem Vaterland können Sie trotzdem dabei dienen«, sagte der Anrufer. Und Schmidt hatte sofort gewusst, wen er da an der Strippe hatte.
Eugen von Stein. Eugen Freiherr von Stein, genau genommen. Schmidt kannte ihn noch aus Afghanistan und sah ihn vor seinem inneren Auge. Von Stein war Leiter der Abteilung EA/Einsatzgebiete, Auslandsbeziehungen im Bundesnachrichtendienst. Von Stein war vormals, als sie sich kennengelernt hatten, Oberleutnant der Reserve gewesen und wurde im Fallschirmjäger-Bataillon 261 im saarländischen Lebach für den Einsatz hinter feindlichen Linien ausgebildet. Und hinter diesen feindlichen Linien war er auch gewesen. In seinem letzten Einsatz 2002. Afghanistan. Dort waren sie sich begegnet. Und dass von Stein seither sein Bein hinter sich herzog, zeugte von dem Scharfschützenprojektil der Taliban, das ihn damals erwischt hatte.
»Sehen Sie den Tatsachen ins Auge, Schmidt«, sagte von Stein. »In der Öffentlichkeit können Sie sich erst einmal nicht sehen lassen. Wo immer Sie auch sind, die Reporter kleben an Ihnen wie die NSA an Google.«
Schmidt fuhr sich durch die Haare. Untertauchen, dachte er. Doch wenn man untertauchen musste, war es meist kein kristallklares Wasser, sondern schmutzige, brackige Brühe.
Von Stein sprach weiter. »Da wäre doch ein internationaler Auftrag gerade richtig. Mit Leuten, die es nicht so genau nehmen, was über bestimmte Menschen in der Zeitung steht.«
Schmidt sah das brackige Wasser bildlich vor sich.
»Was muss ich dabei tun?«
Von Stein atmete aus. »Sie müssen vielleicht einige Ihrer früheren Prinzipien verraten, aber das muss man ja häufig.«
»Ich weiß nicht, ob mir das gefällt.«
»Was soll Ihnen daran nicht gefallen? Deutschland ist erst einmal verbrannte Erde für Sie, in den Medien sind Sie bereits das schwarze Schaf. Zu verlieren haben Sie nichts. Es sei denn, Sie sind ganz begierig darauf, in den nächsten Tagen auf den medialen Scheiterhaufen gestellt zu werden.«
Brackwasser gegen Scheiterhaufen, dachte Schmidt. Beides war nicht verlockend.
»Wissen Sie, was Kostolany gesagt hat?«, fragte von Stein.
»Dieser Börsentyp?« Wie kam von Stein jetzt auf den?
»Genau der! Er sagte: Wer Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig hat, darf nicht spekulieren. Und wer keins hat«, er zog den Satz genüsslich in die Länge, »muss spekulieren.«
»Klingt so, als hätte ich keine Wahl«, antwortete Schmidt resigniert.
»Wer nichts mehr zu verlieren hat, kann nur noch gewinnen«, sagte von Stein. »Näheres erfahren Sie, wenn Sie mich besuchen kommen. Am besten so schnell wie möglich.«
»Wie schnell muss ich mich entscheiden?«
»Bis morgen. Und wenn Sie ganz gut sind, kommen Sie gleich morgen bei mir in Pullach vorbei.«
»Und was bieten Sie mir an?«
»Auch das erfahren Sie, wenn Sie mich treffen.« Von Stein machte eine Pause. »Aber im Vergleich zu allen anderen Angeboten, die Sie vielleicht noch kriegen werden, wird dies das beste sein. Wenn Sie überhaupt noch Angebote kriegen.«
Von Stein hatte aufgelegt. Und Schmidt starrte volle fünf Minuten aus dem Fenster in seinem Büro.
Dann legte er die Füße auf seinen Schreibtisch, so wie es Gerüchten zufolge auch der damalige US-Präsident George W. Bush immer getan hatte.
Jetzt gab es diesen letzten Auftrag, etwas anderes gab es nicht. Entweder er nahm ihn an oder er war draußen. Und zwar richtig.
Er hatte genau zwei Möglichkeiten: Scheiterhaufen oder Brackwasser.
Vielleicht war das Brackwasser weniger schlimm.
Obwohl er bis morgen Zeit hatte, zu entscheiden, wusste er, dass seine Entscheidung bereits gefallen war.
Unentschlossen und mit zitternden Händen rief er seine Assistentin an.
»Buchen Sie mir für morgen einen Flug nach München«, sagte er. »Morgens hin, abends zurück. Und hängen Sie es nicht an die große Glocke.«
Kapitel 8
Berlin
Prenzlauer Berg
»Da hast du ja endlich deine Afrika-Reise«, sagte Bernd, während er und Martin die Kastanienallee entlangliefen. Die Abendsonne tauchte die breite Straße in ein warmes Licht, und Touristen bevölkerten zu beiden Seiten den Bürgersteig. Konnopke’s, Berlins berühmteste Currywurstbude an der Ecke Kastanienallee und Schönhauser Allee, versorgte gerade die letzten Gäste, bevor das Geschäft für heute schließen würde. »Und ich darf dich begleiten und habe auch noch die Arschkarte und soll den ganzen Mist organisieren. Was soll’s. Jedenfalls können wir das Ganze schön in der Kneipe besprechen und nicht in diesem Scheißbüro.« Bernd zuckte die Schultern. »Lass uns mal irgendwo hinsetzen, oder?«
Afrika, dachte Martin.
Coltan. Konflikte. Kriege.
Aber Flori hatte gesagt, es ginge nur um Dian Fossey.
Martin war sich noch immer nicht sicher.
Ging es wirklich nur darum? Und nicht noch um etwas anderes?
Oder wollte Flori nur nicht, dass sich Martin um dieses Thema Gedanken machte? Und wenn ja, warum? Oder warum nicht?
Er beschloss, erst einmal keine Fragen zu stellen, auch nicht an Bernd. Sonst konnte es tatsächlich passieren, dass er für den Rest seiner Global-News-Karriere Schauspielern mit der Kamera am Flughafen auflauern würde.
»Hier okay?«, fragte Bernd noch einmal. »Schläfst du, oder was?«
Martin blickte die Fassade hinauf. »Die Zelle?«, fragte Martin. Bernd zuckte die Schultern. »Warum nicht? Wir können ja draußen sitzen.«
Die Zelle hieß eigentlich anders und hatte ihren wenig schmeichelhaften Namen ihrer Größe und der Luftqualität zu verdanken. Sie war im Inneren allenfalls zehn Quadratmeter groß, wurde aber mit Vorliebe von den stärksten Rauchern Berlins bevölkert – unnötig zu sagen, dass das Rauchverbot dort nicht viel galt. War es zu kalt, um draußen zu sitzen, war drinnen die Luft zum Schneiden, und man rannte, jedenfalls als normal empfindender Mensch, spätestens nach einer halben Stunde japsend und mit roten Augen wieder an die frische Luft hinaus, so dass die Kneipe auch von einigen Gästen den Namen »Gaskammer« erhalten hatte. Die Stammgäste allerdings schien das nicht zu stören, und sie hielten sich Tag und Nacht in der Bar auf, und Martin kam es schon häufiger so vor, als wäre Die Zelle vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet.
»Dann sitzen wir draußen«, sagte Bernd, »so lange es hier Alkohol gibt.« Er ließ sich auf einen Stuhl plumpsen.
»Was kostet der ganze Spaß eigentlich insgesamt?«, fragte Martin.
Bernd schaute auf die Speisekarte. »Du meinst das Bier hier? Ist recht günstig.«
»Nein, ich meine die gottverdammte Afrika-Reise!«
»Hunderttausend, vielleicht auch weniger.«
»Jesus Maria und Halleluja.«
»Fangen wir mal mit dem Auto an«, sagte Bernd. »Das Beste, was wir kriegen können, ist ein Toyota Land Cruiser HZJ 78 oder HDJ 80, auch Buschtaxi genannt. Klasse Dieselmotor, und eine Küche kann man auch einbauen. Superpopulär in Afrika.« Martin blickte sich um, ob schon eine Bedienung auftauchte, und machte sich gleichzeitig ein paar Notizen. »Hat kaum Elektronik, kann man zur Not auch alles selbst reparieren, nicht wie die heutigen Autos, die auf einmal unwiederbringlich stehenbleiben und sich selbst verriegeln, weil irgendein WLAN-Signal falsch ankommt. Also, Toyota, Leichtbauweise.« Bernd zündete sich eine Lucky Strike an, paffte, während Martin eifrig auf seinem Notizblock mitschrieb. »Dafür kriegt man auch in ganz Nordafrika Ersatzteile, ansonsten geht auch Land Rover, da gibt’s aber weniger Ersatzteile, ist halt kein Buschtaxi.«