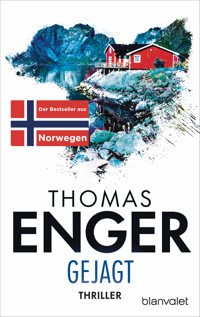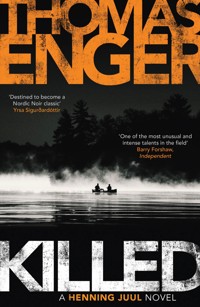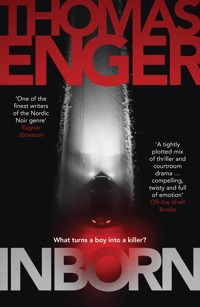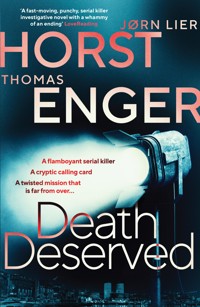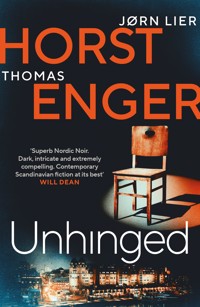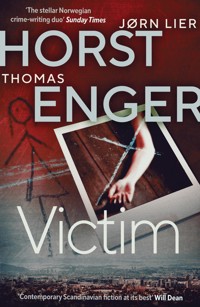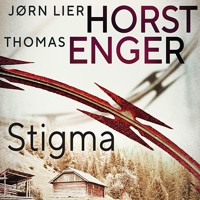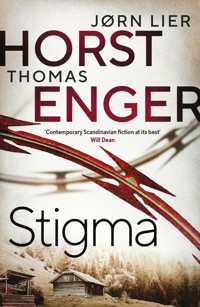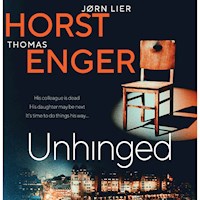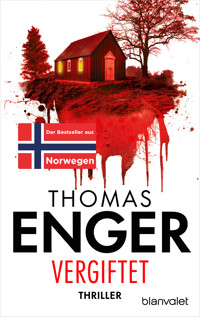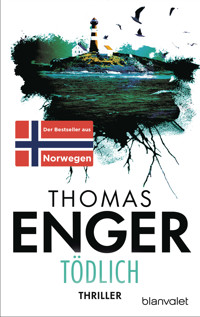
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Henning-Juul-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein tiefer See in Norwegen birgt ein fürchterliches Geheimnis – Henning Juul ermittelt.
Was geschah an dem Tag, als der kleine Jonas bei einem Wohnungsbrand ums Leben kam? Wie ein Fluch verfolgt diese Frage den Reporter Henning Juul – bis er der Antwort so nahe kommt, dass er auf offener Straße von Auftragskillern angeschossen wird. Wer sind die Männer? Welche Verbindung haben sie zu dem lange zurückliegenden Mord an einer alten Frau, bei dem die Ermittlung ins Stocken geriet? Und warum taucht der Name von Henning Juuls Schwester in den Akten von einst auf? Henning Juuls eigenes Leben steht auf Messers Schneide, als er seinen persönlichsten Fall löst …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Was geschah an dem Tag, als der kleine Jonas bei einem Wohnungsbrand ums Leben kam? Wie ein Fluch verfolgt diese Frage den Reporter Henning Juul – bis er der Antwort so nahe kommt, dass er auf offener Straße von Auftragskillern angeschossen wird. Wer sind die Männer? Welche Verbindung haben sie zu dem lange zurückliegenden Mord an einer alten Frau, bei dem die Ermittlung ins Stocken geriet? Und warum taucht der Name von Henning Juuls Schwester in den Akten von einst auf? Henning Juuls eigenes Leben steht auf Messers Schneide, als er seinen persönlichsten Fall löst …
Autor
Thomas Enger, Jahrgang 1973, studierte Publizistik, Sport und Geschichte und arbeitete in einer Online-Redaktion. Nebenbei war er an verschiedenen Musical-Produktionen beteiligt. Sein Thrillerdebüt Sterblich war hierzulande wie auch international ein sensationeller Erfolg, gefolgt von vier weiteren Fällen des Ermittlers Henning Juul. Er lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern in Oslo.
Thomas Enger
Tödlich
Thriller
Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob und Maike Dörries
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Banesår« bei Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. This publication of this translation has been made possible through the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad.
Copyright der Originalausgabe © 2015 by Thomas Enger Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München Redaktion: Leena Flegler Covergestaltung: www.buerosued.deCovermotiv: www.buerosued.deBL · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-19873-2 V004 www.blanvalet-verlag.de
PROLOG
Der Leichnam vor Henning Juuls Füßen steckte in zwei schwarzen Müllsäcken, die von oben und unten über den Körper gestreift und in der Mitte mit silbergrauem Panzerband zusammengeklebt worden waren.
Henning versuchte, nicht an den Menschen zu denken, der darin steckte. Stattdessen hob er den Blick und sah über den See. Langsam und gespenstisch trieb Nebel über das dunkle Wasser auf ihn zu. Er hörte nur das Plätschern – die Tropfen, die aufs Wasser fielen, sobald der Mann die Ruder aus dem Wasser hob und nach vorn führte. Der herbe, moorige Geruch weckte in ihm die Vorstellung von etwas Grobem, Altem, das der See verschluckt, aber nicht richtig verdaut hatte. Henning mochte das Wasser, nicht aber diese kleinen, moorigen Seen. Was unter der dunklen Wasseroberfläche verborgen lag, mochte er sich nicht mal vorstellen. Bald würde auch er selbst für immer in dem Wasser liegen.
Henning versuchte, sich mit dem Gedanken zu versöhnen, mit seinem Schicksal. Vielleicht war dies alles ja gar nicht länger wichtig. Er hatte die Antworten bekommen, nach denen er so lange gesucht hatte, und keine davon hatte ihm Jonas zurückgebracht. Was jetzt für ihn noch von Bedeutung war, lag in der Vergangenheit. Die Jahre als Vater. Die Jahre, in denen er Nora hatte lieben dürfen. Die Jahre, in denen sie ihn geliebt hatte.
Das Boot glitt langsam über das stille Wasser. Henning betrachtete den Mann, der vor ihm saß, dessen kurzes, zerzaustes Haar, das Muskelspiel seiner Arme. Durim Redzepi war lange auf der Jagd nach ihm gewesen und würde endlich seinen Auftrag erfüllen.
Er drehte sich um. Durch den Nebel war der an den Baum gefesselte Mann kaum noch zu erkennen. Was auch geschehen wird, ermahnte sich Henning, tritt anständig ab. Leise. Würdevoll. Zeig diesem Mann nicht deine Angst.
Redzepi machte mit einem Ruder ein paar Züge, während er das andere hochhielt, sodass das Boot sich zu drehen begann. Gleich darauf lag es wieder still auf der Oberfläche. Wasser gluckerte leise an die Bootswand. Dann holte Redzepi die Riemen ein und beugte sich über die Leiche. Hob sie an, als würde sie nichts wiegen, und warf sie über Bord.
Mit einem dicken rostroten Tau hatte er ein schweres Gewicht an dem Toten befestigt. Das Gewicht warf er als Letztes hinaus, und augenblicklich verschwand das schwarze Bündel in der Tiefe.
Redzepi verzog bei alledem keine Miene. Stattdessen nahm er das Seil, das vor seinen Füßen lag, und machte sich daran, eine Schlinge zu knoten. Er lehnte sich nach hinten, griff sich einen grauen Betonklotz, der unter der Persenning gelegen hatte, und setzte ihn vor sich ab. Ein dicker blauer Handgriff war in den Beton eingelassen. Redzepi führte die Schlinge durch den Griff, fädelte das Seil hindurch und befestigte es an Hennings rechtem Knöchel.
Er fragte sich, ob er versuchen sollte, Widerstand zu leisten, aber wie sollte er das anstellen? Seine Schulter schmerzte noch immer, und der Mann vor ihm war mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet.
Redzepi hob den Betonklotz übers Wasser und ließ ihn fallen. Das dumpfe Platschen durchbrach die Stille, die sich über den See gelegt hatte. Als würde es von starken Händen nach unten gezogen, verschwand das Tau in der Tiefe. Dann stellte Redzepi einen Fuß auf das Seil und stand auf.
»Jetzt sind Sie dran«, sagte er.
Henning versuchte aufzustehen, doch seine Beine wollten ihm nicht mehr gehorchen. Er spürte weder seine Füße noch den Hosenstoff an seinen Beinen.
»Los jetzt, so viel Zeit hab ich nicht.«
Redzepi zückte die Pistole und richtete sie auf ihn. Zuckte mit dem Lauf nach oben, damit Henning endlich aufstand. Henning nickte und stemmte sich hoch. Diesmal gelang es ihm, doch unter der plötzlichen Gewichtsverlagerung schwankte das Boot. Er machte einen Schritt zur Seite, um sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, holte noch einmal tief Luft und hob den Blick.
Es war kaum noch etwas zu erkennen. Der Nebel lag jetzt über dem gesamten See. Bis zum Ufer waren es bestimmt dreißig Meter.
Er neigte den Kopf zur Seite, glaubte, etwas gehört zu haben. Aber da war nichts. Kein Motorengeräusch, das sich näherte. Keine knackenden Zweige. Kein Ruf, der einen anderen Ausgang als den unausweichlichen einforderte.
Henning stellte einen Fuß auf den Bootsrand, und das Boot neigte sich leicht zur Seite.
Das Wasser sah ölig aus, zähflüssig, schwarz, kalt. Das Seil verlief wie eine Angelschnur, an der ein dicker Fang hing, straff nach unten.
Dann stieß er sich ab.
Er hielt die Luft an und spürte, wie das Wasser durch seine Kleidung drang. Es war beißend kalt. Er begann, mit den Beinen zu treten und sich gegen den Zug nach unten zu wehren. Er mobilisierte alle Kräfte, trat und strampelte wild um sich, und irgendwie schaffte er es, nicht weiter hinabzusinken und sich mit dem Arm, den er noch bewegen konnte, Zentimeter für Zentimeter wieder nach oben zu kämpfen. Keuchend brach er durch die Wasseroberfläche.
Er blinzelte, prustete, versuchte, sich zu orientieren, während er weiter mit den Beinen und dem gesunden Arm arbeitete. Trotzdem war er überzeugt davon, dass es ihm nicht gelingen würde, dem Gewicht des Betonklotzes, der ihn nach unten zog, irgendetwas entgegenzusetzen.
Henning reckte den Hals, versuchte zu atmen und sah, wie Redzepi die Waffe hob und sich bereitmachte zu schießen. Hier brauchte dieser Mann sich keine Sorgen mehr um Blutflecke zu machen. Henning blieben vielleicht noch ein, zwei Sekunden, ehe er die Mündungsflamme sähe und sein Schädel explodierte.
Er dachte an Noras Lächeln, an ihr hübsches Gesicht, den Glanz ihrer kurz geschnittenen Haare, an die Stimme, bei deren Klang es in seinem ganzen Körper kribbelte, an die Wärme ihrer schlanken Hände.
Er dachte an Iver und an Trine und daran, wie sie am Strand bei der Hütte in Stavern miteinander im Wasser gespielt hatten, wer länger die Luft anhalten konnte. Er hörte auf zu strampeln und spürte, wie das Wasser über ihm zusammenschlug.
Er wusste, dass ihm kein Rekord der Welt helfen würde, dass nichts und niemand ihm mehr Beistand würde leisten können und er nur noch die Wahl hatte, nach seiner eigenen Vorstellung zu sterben.
Er schloss die Augen und ließ sich langsam hinab in das kalte schwarze Wasser sinken.
1
Januar 1996
Ohne den Schnee wäre es überall dunkel gewesen. Die Autos standen dicht an dicht am Straßenrand, dahinter ragten Häuserfronten in die Höhe. Die Straßenlaternen waren ausgestellt worden oder kaputt.
Wäre diese Straße nicht seit mehr als fünfzig Jahren ihr Zuhause gewesen, hätte Bodil Svenkerud es vielleicht mit der Angst zu tun bekommen – nach Einbruch der Dunkelheit geschah so einiges auf Oslos Straßen.
Aber nicht in der Eckersbergs gate.
Hier hatte sie noch nie vor etwas Angst gehabt. Trotzdem wollte sie schleunigst nach Hause, um sich einen warmen Tee zu machen. Es war ein langer Tag gewesen.
Svenkerud bahnte sich einen Weg durch den weichen Schnee. Es war eine Schande, dass die Straße und die Bürgersteige nicht häufiger und schneller geräumt wurden. Sie hatte fast den Eindruck, als kämen sie zu ihnen in die Straße immer erst zuallerletzt.
Sie blieb stehen, sah eine Lücke zwischen zwei geparkten Wagen, blickte kurz nach links und rechts und trat auf die Straße. Aus einiger Entfernung näherte sich ein Auto, war aber noch ein ganzes Stück entfernt. Genug Zeit, dachte sie und stapfte in die Spur der Handvoll Autos, die hier zuvor entlanggefahren waren. Obwohl der Boden eisig war, kam sie in der Fahrspur deutlich besser voran.
Svenkerud schlug den Pelzkragen ihrer Jacke hoch und sah hinauf zu dem Haus, in dem sie jetzt schon so lange wohnte. Dort hatten sie 1957 ihre Hochzeit gefeiert – etwas anderes hatten sie sich gar nicht leisten können. Dort hatte sie ihre Kinder zur Welt gebracht, von der Geburt ihrer Enkel erfahren, während das restliche Leben wie eine Lokomotive in voller Fahrt weitergerast war. Dort hatte sich der Krebs in ihren Olav Sebastian geschlichen und ihn zu einem Schatten seiner selbst werden lassen. Was war er nur für ein fantastischer Mann gewesen – engagiert in der Lokalpolitik, sportlich. Noch mit siebzig war er dreimal in der Woche acht Kilometer gejoggt. Und wie gern er sonntags in den Frognerpark gegangen war – am liebsten mit dem kleinen Sofus vor sich im Kinderwagen. Bis er sich dort in diesem Haus dann an einem schönen Spätsommertag 1992 für immer verabschiedet hatte.
Hinter ein paar Fenstern brannte Licht. Dort schienen die Bauarbeiten schon begonnen zu haben. Trotzdem – sie würde sich nicht erpressen lassen. Sie würden sie nicht aus diesem Haus bekommen – für kein Geld der Welt.
Das hatte sie auch der jungen Sachbearbeiterin im Rathaus gesagt, die erst keine Zeit für sie gehabt hatte, dann aber gegen Ende ihres Arbeitstags doch noch eine Viertelstunde erübrigen konnte. Die hübsche junge Frau mit den dunklen Haaren – wie hatte sie noch mal geheißen? – hatte ihr versprochen, ihren Fall gleich am nächsten Morgen zur Sprache zu bringen. Damit sollte die Sache dann auch erledigt sein. Die Frechheit mancher Menschen kannte wirklich keine Grenzen.
Svenkerud beschleunigte ihre Schritte, holte ein wenig mit den Armen Schwung. Ihr wurde warm, und ihre Brille beschlug. Die Kreuzung vor ihr war keine dreißig Meter mehr entfernt.
Sie drehte sich um. Das Auto war ein gutes Stück näher gekommen. Svenkerud versuchte, schneller zu gehen und sich kräftiger abzustoßen, doch der Schnee war so locker und weich, dass sie kaum Halt fand. Sie rutschte weg, konnte sich dann aber doch wieder auf den Beinen halten.
Sie drehte sich noch einmal um. Das Auto schien schneller geworden zu sein. Der Fahrer musste sie doch gesehen haben – so viele Reflektoren, wie sie sich an die Jacke gehängt hatte?
Sie versuchte, ihm ein Zeichen zu geben, aber der Fahrer bremste nicht, eher im Gegenteil. Im selben Moment begriff Bodil Svenkerud, dass er sie überfahren würde.
Sie unternahm einen letzten Versuch, zur Seite zu springen, doch das Eis lag glatt und verräterisch unter ihren Winterschuhen und hielt sie regelrecht fest – bis der Wagen sie seitlich erfasste und über die Motorhaube schleuderte. Mit dem Rücken zur Windschutzscheibe wurde sie in Richtung Dach hinaufgedrückt, wo sie für einen Moment liegen zu bleiben schien, ehe die Spikes an den Reifen sich ins Eis bohrten, Bodil nach vorn schleuderte, erneut auf der Motorhaube landete und von dort auf die Straße stürzte, wo sie mit dem Gesicht im weichen Schnee liegen blieb.
Sie konnte sich nicht mehr bewegen, hatte seltsamerweise aber keine Schmerzen, als wäre sie am ganzen Körper betäubt. Sie blutete aus einem Cut in der Stirn, und eine Gesichtshälfte fühlte sich ganz plötzlich feucht und warm an. Bei dem Unfall musste auch ihr Hörgerät kaputtgegangen sein. Es pfiff laut und schrill.
Irgendwann gelang es ihr, sich im Schnee hochzustemmen. Sie spürte die eisige Nässe durch Hosenstoff und Strumpfhose. Sie hob den Blick, rückte die Brille zurecht, drehte sich zur Seite und blinzelte in Richtung des Autos. Der Motor lief noch, und im Licht der Scheinwerfer tanzten Schneeflocken.
Warum stieg der Fahrer denn nicht aus, um ihr zu helfen?
Dann setzte der Wagen ein paar Meter zurück, bevor er wieder auf sie zufuhr. Sie war wie gelähmt, wusste, dass sie es nicht schaffen würde, selbst wenn die Spikes auf dem Eis durchdrehten. Es würde ihr auch nichts nützen, um Hilfe zu rufen. Sie wappnete sich gegen den Schmerz, und als er kam, war er gewaltig, überwältigend. Der Wagen schob sie ein Stück vor sich her, bis sie an der Bordsteinkante liegen blieb.
Schnee fiel auf ihre glühend heißen Wangen. Die Brillengläser waren kaputtgegangen, und sie sah so gut wie nichts. Zum Glück hatte das Pfeifen in ihrem Ohr aufgehört, und als die Stille kam, war ihr mit einem Mal alles vollkommen klar.
Endlich verstand sie, worum es hier ging.
Es gab keinen Zweifel mehr.
Sie hoffte nur, dass die nette, hilfsbereite junge Frau im Rathaus – wie hatte sie noch mal geheißen? – es ebenfalls verstand. Dass sie hiervon erfuhr und sie eins und eins zusammenzählte und dann irgendetwas unternahm.
Trine, dachte Svenkerud noch, als der Wagen erneut auf sie zurollte.
Trine hatte die Frau im Rathaus geheißen.
Trine Juul.
2
Oktober 2009
Die weißen Gardinen filterten das Tageslicht. Die Frau neben Charlie Høisæther drehte sich zur Seite und atmete tief durch die Nase ein.
»Schon wach?«, murmelte sie verschlafen und drückte das Gesicht ins Kissen.
»Mhm«, antwortete er.
Das Licht färbte ihre Wangen weiß, als sie die Knie anzog, eine warme Hand unter der dünnen Decke hervorschob und nach Charlies weichem Bauch tastete.
»Du wirst immer so früh wach«, murmelte sie.
»Mhm. Schlaf einfach weiter.«
Die Gardinen vor dem offenen Fenster bauschten sich in der steten Atlantikbrise. Sechzehn Etagen tiefer rauschte der Verkehr vorbei, verströmte ein Gefühl permanenter Betriebsamkeit. Isabel schlug die dunkelbraunen Augen auf. Charlie spürte ihren inzwischen etwas wacheren Blick auf sich.
»Du hast unruhig geschlafen heute Nacht«, sagte sie. »Hast du schlecht geträumt?«
Er schüttelte den Kopf.
»Was war denn dann?«
»Nichts. Schlaf einfach weiter, Isabel.«
In Wahrheit hatte er so gut wie gar nicht geschlafen. Zurzeit passierte einfach viel zu viel. Tores Tod – und dann dieser Journalist, der ständig anrief und irgendwelche Nachrichten hinterließ. Ich würde gern mit Ihnen über Tore Pulli reden. Ich würde gern einen Telefontermin mit Ihnen vereinbaren. Könnten wir vielleicht ein, zwei Worte über Rasmus Bjelland wechseln?
Nein, konnten sie nicht.
Bloß nicht.
Und dann war da auch noch die Halle, die sie bauen wollten, wenn sie nur endlich den passenden Bauplatz fänden.
»Jetzt bin ich aber wach«, sagte Isabel und streckte die Hand weiter aus. »Und ich finde, das solltest du wiedergutmachen.«
Sie drückte ihm die Hand fest auf den Bauch, direkt über dem Nabel, dann glitt sie tiefer, und er wandte sich ab. Isabel zog die Hand wieder zurück, drehte sich auf den Bauch und schob beide Hände unters Kinn.
»Kaputt?«, fragte sie mitfühlend.
»Bloß müde«, erwiderte Charlie und war dankbar, dass sie kein Drama daraus machte. Dann schob sie ihre Hand erneut unter die Decke, diesmal über seine Brust, streifte durch sein Brusthaar hinauf zu Hals und Kinn, zupfte an seinem Bart und strich neugierig an seiner Narbe entlang.
»Nicht«, sagte er und zog den Kopf weg.
»Entschuldige.«
Er schlug die Decke zur Seite und setzte die Füße auf die nackten, kalten Bodenfliesen, stand auf und trat ans Fenster. Er neigte den Kopf zur linken Schulter, dann zur rechten. Es knackste.
»Entschuldige«, wiederholte sie.
»Schon okay. Schlaf weiter.«
Er zündete sich eine Zigarette an und trat hinaus auf die Dachterrasse. Über ihm blauer Himmel. Die Fliesen hatten sich schon in der Sonne aufgeheizt und brannten unter seinen Füßen. Er lehnte sich ans Geländer. Die kurzen nächtlichen Regenschauer waren längt verdunstet. Der Geruch von Teer und Müll wehte aus der engen Gasse zu ihm herauf.
Charlie zog an der Zigarette und blickte hinaus auf das silbrig glitzernde Meer, das glatt wie ein Spiegel vor ihm lag. Bald würden sich die breiten, schönen Strände füllen, auf denen die Jungs aus dem Ort kickten und davon träumten, ein neuer Neymar oder Pelé zu werden. Andere kauften eisgekühlte Kokosnüsse, Schokolade und Zigaretten und dösten in der Sonne, bis die wieder hinter dem Horizont verschwand.
Das war Natal.
Die Sonnenstadt.
Mit einer Durchschnittstemperatur von 28 Grad und 300 Sonnentagen im Jahr. Die Stadt, die ursprünglich Indios und französische Piraten beherbergt und die er selbst in Teilen mit aufgebaut hatte – zumindest in den Teilen, für die sonnenhungrige Norweger bezahlt hatten.
Es war ein Abenteuer gewesen – schön, aber riskant. Sie hatten hoch gepokert, besonders in den letzten Jahren. Einige waren im Knast gelandet. Andere hatten mit ihrem Leben bezahlt, sodass der Rest von ihnen jetzt wieder dort war, wo sie Ende der Neunziger begonnen hatten. Genau wie Tore es gewollt hatte.
Charlie sah hinüber zu der angrenzenden Terrasse. Die Wohnung stand leer. Ein paar Blätter waren bis hinauf in den sechzehnten Stock hochgeweht. Er würde daran denken müssen, vor der nächsten Besichtigung jemanden zum Putzen vorbeizuschicken. Es versetzte ihm immer einen leichten Stich und bescherte ihm ein schlechtes Gewissen, wenn er daran dachte, dass Tore und er Nachbarn hätten sein können, dass sie mit einem kalten Bier in der Hand an der schulterhohen Trennwand stehen und den Blick übers Meer hätten schweifen lassen können, während sie sich an die gute alte Zeit erinnerten, als ihre Konten angefangen hatten, sich zu füllen, und sie so gut wie jeden Tag etwas gefeiert hatten.
Aber es war einfach zu viel Porzellan zerschlagen worden. Sie beide hatten Dinge gesagt und getan, die nicht mehr rückgängig zu machen waren. Trotzdem hätte Tore die Wohnung kriegen sollen. Alles in allem hätte er es verdient gehabt.
Charlie hob die Hand ans Kinn und tastete über die Narbe, die Tore ihm verpasst hatte. Dann schaute er hinab auf die Straße und zog wieder an seiner Zigarette. Ein Mann joggte vorbei. Sein nackter Oberkörper glänzte in der Morgensonne. In die Jahre gekommene Autos, sand- und rostfleckig, rasten vorüber.
Charlies Blick blieb an einem dunklen Audi hängen, der im Schatten einer Palme parkte. Das Auto hatte die letzten Tage immer an exakt derselben Stelle gestanden, Morgen für Morgen. Vom Balkon aus war unmöglich zu erkennen, ob jemand darin saß. Doch jedes Mal, wenn er nach unten gegangen war und seinen Tag in Angriff genommen hatte, war der Wagen wieder weg gewesen. Freddy sollte das mal überprüfen.
Charlie drückte die Kippe an der Wand aus, schnippte sie übers Geländer und sah sie langsam abwärtstrudeln, bis sie von einem Windstoß erfasst und auf eine andere Terrasse geweht wurde. Er kehrte zurück in seine 187 Quadratmeter große Wohnung mit den nackten Wänden – ebenso nackt wie die Frau in seinem Bett, die sich jetzt auf einen Ellenbogen hochstemmte. Ihr Bauch und ihre schlanken Hüften waren unter der Decke verborgen.
»Hi«, sagte sie und schob sich eine schwarze, gelockte Haarsträhne aus der Stirn.
»Hi«, sagte er.
Charlie schlüpfte in Shorts und Flipflops.
»Ist irgendwas passiert?«, fragte sie.
»Nein, nichts.«
»Sicher? Du wirkst so … abwesend, so weit weg.«
»Ich mach Kaffee«, sagte er. »Willst du auch einen?«
Sie schlug die Decke zurück und präsentierte ihm ihren sonnengebräunten Körper. Charlie sah sie nicht mal an, bekam aber auch keine Antwort.
»Ich hätte gern eine Tasse Tee«, rief sie ihm nach, als er schon in der Küche war.
Charlie hatte Isabel in einer Bar an der Praia dos Artistas getroffen. Sie hatte ihm den ganzen Abend verstohlene Blicke zugeworfen, und als sie schließlich auf ihn zugekommen war und ihm in brasilianisch gebrochenem Englisch erzählt hatte, sie sei Tänzerin und würde ihm gern zeigen, was sie draufhabe – »und zwar am liebsten irgendwo anders« –, war er davon ausgegangen, dass sie eine Prostituierte wäre.
Tatsächlich war sie nur auf Jobsuche gewesen, und als sie ihren Namen genannt hatte – Cláudia Isabel Ypiranga –, hatte er sich zu ihr umgedreht und ihren dunklen Teint gemustert, ihre indigenen Züge, den langen, schlanken Körper. Er hatte die Not in ihren Augen gesehen und sich gefragt, in welch ärmlichen Verhältnissen sie ihre knapp fünfundzwanzig Lebensjahre verbracht haben musste. Vor allem aber hatte er die Ähnlichkeit gesehen und mit einem Mal das merkwürdige Bedürfnis verspürt, ihr etwas Gutes zu tun und sie nicht nur als Objekt seiner Lust zu betrachten.
Das war jetzt fünf Monate her.
Inzwischen tanzte sie an sechs Abenden die Woche im Senzuela und kam anschließend zu ihm nach Hause.
Anfangs hatte ihm das gefallen. Er hatte geglaubt, sich in sie verlieben zu können. Bis er sich eines Tages eingestanden hatte, dass sie Mariana niemals würde ersetzen können. Seit einiger Zeit spielte er mit dem Gedanken, das Verhältnis zu beenden, konnte sich aber nicht recht überwinden. Sie gefiel ihm ja. Er fühlte sich wohl in ihrer Nähe, er mochte ihren Körper – solange sie nicht so dumm wäre und schwanger würde. Wahrscheinlich würde sie ihm fehlen, wenn sie nicht mehr da wäre. Außerdem gefiel ihm der Gedanke, dass er sie … wovor auch immer … gerettet hatte. Er hatte nie gefragt, was sie getan hatte, bevor sie sich kennengelernt hatten. Womöglich sollte er das mal tun.
Mit einer Tasse Chai Latte, den sie so gern trank, kehrte er ins Schlafzimmer zurück.
»Danke«, sagte sie mit einem Lächeln. »Du bist süß.«
Wenn du wüsstest, dachte Charlie und zog ein weißes T-Shirt an, das über dem Bauch spannte.
Er spürte ihren Blick über dem Tassenrand.
»Und, was steht heute an?«, fragte sie mit heller, erwartungsvoller Stimme.
Charlie atmete tief ein und stieß die Luft in einem langen Seufzer wieder aus.
»Das Gleiche wie gestern«, antwortete er.
Als er hinaus auf den Bürgersteig trat, war der dunkle Audi weg. Dafür wartete Freddy auf ihn, wie gewohnt in Jeans, T-Shirt und beigefarbenem Leinenblazer. Freddy hieß eigentlich Fred Are, stammte aus Oslo und war lediglich mit seiner schieren Muskelkraft und einer Knarre im Gepäck nach Natal gekommen. Die Leute in der Stadt wussten, dass er auf Charlies Gehaltsliste stand und dass er zu dem Menschenschlag gehörte, mit dem man sich besser nicht anlegte. Was bisher auch nie jemand probiert hatte – nicht zuletzt wegen der Waffe, die er grundsätzlich in einem Schulterholster unter seiner Jacke trug.
»Ich will, dass du einen Mann an der Palme dort drüben postierst«, sagte Charlie. »Auf dem Parkplatz steht jetzt schon drei Nächte in Folge ein schwarzer Audi.«
»Okay, Chef.«
»Finde den Namen des Fahrers heraus und für wen er arbeitet.«
»Okay, Chef.«
Charlie sah sich um. Dann setzte er sich in Freddys Wagen, einen Mercedes CLS Grand Edition, und sie rauschten los. Freddy hielt sich grundsätzlich an kein Tempolimit – das widerstrebte seiner Natur –, was aber auch nicht weiter problematisch war, weil kein Polizist je auf die Idee käme, sie anzuhalten.
»Wohin?«, fragte er.
»Erst in den Club«, sagte Charlie. »Und dreh eine Extrarunde um den Block, wenn wir dort sind.«
Freddy warf ihm einen flüchtigen Blick zu, sagte aber nichts.
Sie fuhren durch die Stadt, die allmählich erwachte, vorbei an Juans Laden, den gerade ein Kunde mit Obst, einem Baguette und etwas zu trinken verließ. Sie überholten Pepe, den Fischhändler, der auf seinem uralten Moped, das dicke schwarze Qualmwolken ausstieß, auf dem Weg zum Hafen war, um dort den Fang der Nacht abzuholen.
Charlie liebte den Morgen, wenn alles noch leicht verschlafen und die Temperaturen noch erträglich waren. Dies war die einzige Zeit, zu der man in Natal noch etwas erledigen konnte.
In den vergangenen Monaten war Charlie damit beschäftigt gewesen, Gelder für den Bau einer Art Vergnügungshalle zu beschaffen, in der man Rollschuh laufen, bowlen und Minigolf würde spielen können – alles unter einem Dach. Es würde Restaurants und Läden geben – anders als alles, was die Leute aus Natal bislang kannten. Eine Art Erholungs- und Freizeitoase. Diverse Investoren hatten bereits zugesagt, das Projekt zu unterstützen, doch Charlie hatte bis jetzt keinen geeigneten Ort gefunden. Er hatte in den letzten Wochen zwar einige gute Grundstücke aufgetan, aber bislang war keiner der Eigentümer bereit gewesen zu verkaufen.
Er würde auch in Zukunft weiter Wohnkomplexe hochziehen – das lukrativste Business in der Gegend –, aber es würde nicht schaden, noch ein anderes Standbein zu haben.
Nach zehn Minuten hielten sie vor dem Fitnessclub. Freddy stieg zuerst aus und sah sich um. Dann nickte er Charlie zu.
Zwei Frauen Mitte dreißig schlenderten an ihm vorbei. Eine von ihnen drehte sich flüchtig zu Charlie um und raunte ihrer Freundin etwas zu. Fast schon automatisch folgte er ihr mit dem Blick, musterte ihre Schuhe, Fesseln, Beine, den Po – und war sich nicht ganz sicher, ob sie ihre Fuckability erkauft hatte oder ob sie angeboren war.
Auf der anderen Straßenseite bewegte sich eine Gardine. Freddy trat hinaus auf die Straße und drückte die Brust raus. Ein Auto, das auf ihn zuraste, bremste ab. Charlie würdigte den Fahrer keines Blickes, ging einfach weiter und betrat das Fitnessstudio, wo er von wummernden Rhythmen, blank geputzten Spiegeln und klirrenden Gewichten empfangen wurde. Er durchquerte den vorderen Bereich, ohne auch nur einen der Trainierenden anzusehen, und steuerte das Büro an – eine acht Quadratmeter kleine Abstellkammer, die dringend renoviert werden musste, worin Charlie aber wenig Sinn sah. Ihm gefiel das Chaos, die herumliegenden Papiere, die Risse in den Wänden – das alles erinnerte ihn an seine erste Zeit in Norwegen, als er ständig Schwierigkeiten gehabt hatte, seine Rechnungen zu bezahlen, bis Høisæther Immobilien endlich auf die Beine gekommen war und er Luft unter die Flügel gekriegt hatte.
Das einzige, das absolute Muss war ein Top-Computer, und mit seiner jüngsten Anschaffung war er wirklich zufrieden – das coolste iMac-Modell, das Apple derzeit auf dem Markt hatte. Charlie gefiel der Kontrast zwischen dem 27-Zoll-Bildschirm und dem abgewrackten Raum.
»Heute Abend um 19.35 Uhr landet ein Flieger aus Amsterdam«, sagte er, als Freddy die Tür hinter sich zugemacht hatte. »Du müsstest einen Passagier für mich abholen.«
Freddy lächelte. Er wusste, dass nicht der Passagier an sich problematisch war oder die Frage, wie man ihn unbemerkt aus dem Flughafen bekäme – sondern das Geld, das an dem Körper klebte.
»Soll ich Hansemann mitnehmen?«
»Nein.«
»Aber er kümmert sich doch sonst immer um die Zollbeamten. Ich …«
Charlie drehte sich zu Freddy um.
»Für Hansemann hab ich einen anderen Job. Das hier erledigst du allein.«
Freddy zögerte, dann nickte er.
»Sonst noch was, Chef?«
Charlie seufzte.
»Der Audi.«
»Okay. Ich mach mich sofort an die Arbeit.«
Charlie blieb allein im Büro zurück. Er sah auf die Uhr. Vier Uhr morgens in Norwegen. Er starrte auf den immer noch schwarzen Bildschirm, sah sein eigenes Spiegelbild, das helle Haar, die blauen Augen, den Kinnbart.
Genauso hatte er dagesessen, als Mariana erstmals hier aufgetaucht war.
»Hi«, hatte sie gesagt. »Ich heiße Mariana de la Rosa. Sie brauchen eine Assistentin.«
»Ach ja?«
Charlie hatte zu dem Zeitpunkt keine Stelle ausgeschrieben, wie eigentlich nie.
»Doch, brauchen Sie«, hatte sie geantwortet. »Ein kurzer Blick in Ihr Büro reicht, um vier Dinge zu sehen, die Sie umgehend ändern sollten.«
»Aha?«
Er setzte sich auf.
»Erstens: Ihre Termine in dem Buch da.«
Sie zeigte auf den aufgeschlagenen Kalender.
»So ein Ding benutzt heute niemand mehr.«
»Ist das wahr?«
»Ich übertrage Ihnen sämtliche Termine in den PC und sorge dafür, dass Ihr Mobiltelefon Sie zehn Minuten vor jedem Termin daran erinnert, wo Sie hinmüssen.«
»Hm.«
»Dann brauchen Sie noch ein Ablagesystem für Quittungen und Rechnungen. Hier fliegt doch alles unsortiert herum. Ich kann das für Sie wieder in Ordnung bringen.«
Zunehmend neugierig betrachtete Charlie die große, schlanke Frau mit den rabenschwarzen Haaren und dem spitzen Kinn – und das nicht nur wegen der braunen Augen und dem verführerischen Charme, sondern vor allem aufgrund ihrer Entschlossenheit und der klaren Meinung, die sie sich auch nicht zu äußern scheute.
»Sie sind einer dieser Männer, die nicht hinter sich aufräumen«, fuhr sie fort.
»Ah ja?«
Sie zeigte auf zwei Kaffeetassen mit schwarzen, angetrockneten Kaffeerändern und einen Teller neben der Computermaus. Zusammengeknüllte Baguetteverpackungen, eine leere Zigarettenschachtel. Ein bis zum Rand mit Kippen vollgestopfter Aschenbecher.
»Und ich kann gut aufräumen.«
Ohne ein weiteres Wort starrte sie ihn an.
»Aber zählen können Sie nicht«, erwiderte er nach einer Weile.
»Bitte?«
»Sie haben von vier Dingen gesprochen, die Sie ändern würden.«
»Oh.«
An der Stelle lächelte sie zum ersten Mal, und dabei war es, als öffnete sich ihr ganzes Gesicht. Die Frau, die er auf den ersten Blick als kühl und kantig eingeschätzt hatte, zeigte mit einem Mal eine verspielte Seite.
»Ich vergaß – das T-Shirt«, sagte sie und zeigte auf Charlies Bauch. »Sie sollten ein paar davon auf Lager haben, für den Fall, dass …«
Sie brach mitten im Satz ab und schlug den Blick nieder.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Das geht mich natürlich überhaupt nichts an …«
»Wie auch immer«, sagte Charlie. »Sie haben recht. Soßenflecken machen sich nicht sonderlich gut bei einem Kundentermin.«
Sie hob den Blick und lächelte verschämt.
Schon am nächsten Tag fing Mariana de la Rosa bei ihm an, und sie blieb gute drei Jahre. Bis sie sich verliebte. Und ermordet wurde. Und obwohl sich Charlie immer wieder einzureden versuchte, dass nicht er den Sprengstoff an dem Wagen angebracht hatte, den sie hatte fahren wollen, hätte er ahnen müssen, dass so etwas passieren könnte.
Und genau das raubte ihm den Schlaf.
3
Henning Juul starrte auf den Bildschirm. Er war sich sicher, dass das, was er vor sich sah, nicht stimmen konnte. Aber als er Datum und Uhrzeit noch einmal überprüfte, gab es keinen Zweifel mehr. Seine eigene Schwester, Trine, war nur zehn Minuten vor Jonas’ Tod direkt vor seinem Haus gewesen.
Sie hatte Durim Redzepi irgendwas überreicht – demselben Mann, der bereits zweimal versucht hatte, Henning umzubringen, und der vermutlich auch den Brand gelegt hatte. Dann war sie wieder weggefahren.
Endlich verstand Henning, warum Veronica Nansen darauf bestanden hatte, dass er sich setzte, ehe er sich durch die 213 Fotos scrollte, die ihr verstorbener Mann, Tore Pulli, in den drei Tagen vor Jonas’ Tod geschossen hatte.
Henning blieb die Luft weg, und ihm wurde heiß.
Er lehnte sich zurück und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen.
Was zum Henker hatte Trine mit einem Mann wie Redzepi zu schaffen? Immerhin wurde der Typ in seinem Heimatland wegen Doppelmordes gesucht. Und was hatte sie ihm übergeben?
»Alles in Ordnung?«, fragte Veronica Nansen vorsichtig. »Dumme Frage«, korrigierte sie sich selbst. »Kann ich irgendetwas tun?«
Henning beugte sich vor und nahm einen Schluck Wasser. Das Glas hatte sie ihm gebracht.
»Nein«, antwortete Henning, »ehrlich gesagt ist hier gar nichts in Ordnung.«
Er warf noch einen Blick auf Trines Bild.
»Und was wollen Sie jetzt machen?«, fragte Veronica und legte ihm die Hand auf die Schulter. Henning wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er. Im selben Moment schoss ihm durch den Kopf, dass Trine zurzeit auf den Bahamas war, wo sie sich nach jenem Skandal erholte, der zu ihrem Rücktritt als Justizministerin geführt hatte.
»Ich habe einen Vorschlag«, sagte Veronica und richtete sich gerade auf. »Gehen wir noch mal alles durch, was Sie wissen oder zu wissen glauben. Und all Ihre Fragen.«
Sie klappte den Laptop zu.
»Sie haben das bestimmt schon hundertmal gemacht. Für sich allein – aber jetzt lassen Sie es uns zusammen versuchen. Manches ist leichter zu verstehen, wenn man es nur laut ausspricht und formuliert.«
Henning hatte sich bisher nur zwei anderen Menschen anvertraut: Bjarne Brogeland und Iver Gundersen. Der eine war Polizist, der andere Noras Lebensgefährte und Hennings Kollege in der Redaktion von 123nyheter. Besonders Iver hatte sich sehr für ihn eingesetzt. In letzter Zeit hatte Henning sogar diverse Nächte auf dessen Sofa zugebracht.
Anfänglich hatte er niemanden in die Angelegenheit mit hineinziehen wollen, aber Veronica hatte in Tores Sachen Hinweise und Spuren gefunden, die Henning weitergeholfen hatten. Und jetzt hatte sie auch noch die Fotos entdeckt, die bewiesen, dass Trine in irgendeiner Weise in das ganze Drama verstrickt war. Überdies hatte sich Veronica als intelligente Gesprächspartnerin erwiesen.
Henning drehte sich ein Stück zur Seite.
»Ich glaube, das Ganze fing mit Rasmus Bjelland an.«
Bjelland hatte jahrelang als Schreiner für Charlie Høisæther gearbeitet – einem von Tores alten Freunden und Geschäftspartnern erst in Norwegen, dann im brasilianischen Natal, wohin Charlie 1996 gezogen war. Gemeinsam hatten sie dort gut von Immobilien gelebt, die sie für sonnenhungrige Norweger gebaut hatten. Viele ihrer Kunden waren bekannte Kriminelle gewesen, die sich auf diese Art einen luxuriösen Unterschlupf beschafft hatten.
Doch 2007 hatte eine koordiniert norwegisch-brasilianische Polizeiaktion zu mehreren Festnahmen wegen Geldwäsche und Betrugs geführt. Danach hatten Gerüchte die Runde gemacht, Bjelland wäre ein Polizeispitzel gewesen und hätte die Festnahmen überhaupt erst möglich gemacht. Auf seinen Kopf war eine Prämie ausgesetzt worden, und Bjelland war geflohen.
Als Kriminalreporter hatte Henning irgendwann von dem Konflikt erfahren, und nach einigem Hin und Her war es ihm tatsächlich gelungen, ein Interview mit Bjelland zu führen. In diesem Gespräch hatte Bjelland beteuert, kein Verräter zu sein. Gleichzeitig hatte er Henning den Tipp gegeben, dass sich auch Tore Pulli, einst einer der berüchtigtsten Geldeintreiber des Landes, mittlerweile in der Immobilienbranche eine goldene Nase verdiente – und noch immer gute Kontakte zur kriminellen Unterwelt unterhielt. Tores Existenz als gesetzestreuer Geschäftsmann sei lediglich Fassade. Bjelland hatte sogar behauptet, dass mehrere Morde auf Pullis Konto gingen. Henning hatte versucht, Bjelland weitere Informationen zu entlocken – allerdings vergebens.
»Darf ich Sie hier schon kurz unterbrechen?«, fragte Veronica.
Henning, der beim Reden die ganze Zeit auf einen unbestimmten Punkt auf der Tischplatte gestarrt hatte, sah zu ihr auf. Ihre Haut hatte einen rosigen Ton angenommen.
»Sie wollen damit also andeuten, dass Tore immer noch kriminell gewesen wäre, nachdem er die Geldeintreiberei an den Nagel gehängt hatte? Und dass er Menschen umgebracht hätte?«
Henning hob die Hände.
»Hat Bjelland zumindest behauptet«, sagte er.
»Ich hab fünf Jahre lang mit ihm zusammengelebt«, wandte Veronica ein. »Das hätte ich doch gewusst oder gespürt – wenn er in der Zeit immer noch in irgendwelche krummen Geschäfte verstrickt gewesen wäre.«
»Vielleicht, aber wenn Sie sich die Leute ansehen, mit denen er verkehrt und trainiert hat, dann sind das nun mal nicht gerade Leute, die als Schwiegermutters Lieblingdurchgehen würden. Und können Sie sich wirklich nicht vorstellen, dass Tore hier und da den Verlockungen erlegen sein könnte, unter der Hand doch noch ein bisschen dazuzuverdienen? Wir wissen doch beide, dass er in den letzten Jahren diverse Probleme hatte – nicht zuletzt wegen seiner Spielsucht.«
Veronica antwortete nicht, sondern lehnte sich bloß mit verschränkten Armen zurück. Henning verstand natürlich, warum sie in den Defensivmodus schaltete. Tore hatte die Schlagringe weggelegt, lange bevor sie ihn kennengelernt hatte, und in den Neunzigern und bis ins neue Jahrtausend hinein hatte er mit seinen Immobiliengeschäften gutes Geld gemacht. Gleichzeitig hatte er ihr gegenüber sein Spielproblem geheim gehalten, und was seine Vergangenheit als Geldeintreiber anging, hatte er ihr auch nicht die Wahrheit erzählt. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe die Polizei bei ihr anklopfte, um Tores Hinterlassenschaften zu durchsuchen, und die Zeitungen würden über Tores Rolle im Mordfall Ellen Hellberg ebenfalls nur zu gern berichten. Auch wenn das Verbrechen in den Neunzigern verübt worden war.
»Ich meine doch nur, dass es Bjellands Tipps waren, denen ich nachgegangen bin – bis es dann eines Tages bei mir brannte.«
Sie sah ihn abwartend an.
»Und Sie glauben, Tore hätte auch was mit dem Brand in Ihrer Wohnung zu tun?«
Sie klang jetzt fast beleidigt. Henning war sich nicht ganz sicher, ob sie auf ihn oder auf ihren verstorbenen Ehemann wütend war.
Er schüttelte den Kopf und zeigte auf den Bildschirm.
»Warum sollte er sonst nur ein paar Meter entfernt in einem Wagen gesessen und Bilder gemacht haben?«, fragte er und fügte dann hinzu: »Vielleicht hatte Tore irgendetwas vor – nur dass ihm dann jemand zuvorgekommen ist.«
»Und wer sollte das gewesen sein?«
Henning atmete ein wenig schneller.
»Vielleicht Charlie Høisæther? Bjelland hat erwähnt, ich müsste zurück in die Neunziger und mir ansehen, was Tore da alles gekauft hätte. Wenn ich nur tief genug graben würde, wäre da eine ganze Menge zu finden. Ich hab aber nicht viel gefunden. Erst im Nachhinein hab ich erfahren, dass Tore damals eine Reihe von Geschäften mit Charlie Høisæther gemacht hat und dass vieles davon an den norwegischen Behörden vorbeigegangen ist. Laut meiner Quelle haben die beiden in dieser Zeit Unsummen verdient, und sie sollen dabei wirklich skrupellos vorgegangen sein.«
Veronicas Blick war wachsam geworden.
»Skrupellos genug, um Leute umzubringen, meinen Sie?«
Henning hob erneut beide Hände.
»Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Tore und Høisæther in den letzten Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. Das könnte erklären, weshalb jeder seinen eigenen Stiefel gefahren hat, um mich zum Schweigen zu bringen. Tore hatte einen Plan – er hat mich überwachen lassen, um herauszufinden, wann er am besten zuschlagen könnte –, während Charlie Durim Redzepi beauftragt hat, damit der die Drecksarbeit für ihn erledigte.«
»Mir schwirrt der Kopf, Henning. Glauben Sie, dass Tore oder Charlie oder vielleicht beide Angst davor hatten, dass Sie etwas Schwerwiegendes ausgraben könnten? Einen unaufgeklärten Mord? Unterschlagung, Geldwäsche?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Henning. »Bis jetzt denke ich nur laut.«
»Aber warum waren und sind Sie für die zwei so gefährlich?«
Diese Frage hatte Henning sich in letzter Zeit mehr als einmal gestellt.
»Jeder weiß doch«, fuhr sie fort, ehe er reagieren konnte, »dass ein Mord an einem Journalisten in der Öffentlichkeit zu einem Aufschrei führen würde. Die Polizei gerät dadurch unter enormen Druck und mobilisiert sämtliche Kräfte. Ich verstehe nicht, warum sie ein derartiges Risiko hätten eingehen sollen – und erst recht nicht, wenn nicht einmal Sie selbst wissen, warum.«
»Noch nicht, nein. Aber ich werde es herausfinden.«
Veronica seufzte.
Das Beste wäre, dachte Henning, noch mal mit Rasmus Bjelland zu sprechen. Aber von dem fehlte seit zwei Jahren jede Spur. Gut möglich, dass das Todesurteil, das im Raum gestanden hatte, als Henning ihn getroffen hatte, in der Zwischenzeit vollstreckt worden war.
»Bjelland hat über Jahre hinweg eng mit Charlie zusammengearbeitet«, sagte er. »Das erklärt, wieso er etwas wusste.«
»Aber das erklärt noch lang nicht, warum er Tore verraten hat.«
»Nein«, sagte Henning und griff erneut nach seinem Wasserglas. »Aber was das angeht, hab ich eine Theorie.«
Er nahm einen Schluck Wasser und rutschte herum, sodass er ihr jetzt frontal gegenübersaß.
»Ich glaube, Bjelland wollte Rache.«
Tiefe Falten gruben sich in Veronicas Stirn.
»Rache?«
Henning nickte.
Er ließ die Behauptung nachklingen, während Veronica nachdachte.
»Warum in aller Welt sollte Bjelland sich an Tore rächen wollen?«
»Das hab ich noch nicht rausgefunden«, sagte Henning. »Aber denken Sie mal nach«, fuhr er fort, »warum sollte er sonst mit so einer Behauptung zu mir kommen? Er hatte keine Veranlassung, mir einen Gefallen zu tun oder mir irgendeinen Scoop rüberzuschieben.«
In Veronicas Blick war keine Antwort zu finden.
»Bjelland und ich hatten nie etwas miteinander zu tun gehabt – es gab also keinen Grund, mir irgendeinen Tipp zu geben, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Außer er hatte dabei irgendeinen Hintergedanken. Außer er wollte Tore das Leben schwer machen. Warum, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Aber können Sie sich irgendein anderes Motiv als Rache vorstellen?« Als sie nicht antwortete, fuhr Henning fort: »Seine Behauptung, nicht der Verräter gewesen zu sein, wird nicht wahrer, indem sie in der Zeitung steht, und dessen war sich Bjelland sicher auch bewusst. Und er wusste auch, was das für Leute waren, die es auf ihn abgesehen hatten. Immerhin war er gut zehn Jahre lang mit ihnen in Brasilien.«
Henning nahm noch einen Schluck.
»Ich glaube daher, dass er einem eigenen Plan folgte. Er wollte mich dazu bringen, Ermittlungen gegen Ihren Mann anzustellen und ihn vielleicht sogar vor Gericht zu bringen, damit Tore im Gefängnis landete.«
Veronica schüttelte den Kopf.
»Für mich hört sich das alles seltsam an«, wandte sie ein. »Soweit ich weiß, kannten die zwei sich kaum.«
»Für mich klingt noch viel unglaubwürdiger, dass sie sich nicht gekannt haben sollen. Bjelland hat über Jahre eng mit einem von Tores besten Freunden zusammengearbeitet. Sogar in derselben Branche.«
Veronica sah ihn skeptisch an, als könnte sie wirklich nicht glauben, was ihr da gerade eröffnet wurde.
Irgendwo in der Wohnung klingelte ein Telefon. Sie ignorierte es und sagte stattdessen: »Dann bleibt uns also nur noch eins …«
Henning sah sie an.
»Wir müssen herausfinden, was nicht ans Tageslicht kommen durfte und wovor Tore und Charlie eine solche Angst hatten. Und warum Bjelland einen Grund gehabt haben könnte, sich an Tore zu rächen.«
Henning nickte.
»Wissen Sie noch irgendetwas, was uns weiterhelfen könnte?«, fragte sie.
Er atmete tief durch.
»Ich weiß, dass Tore tot ist – vermutlich weil er mir erzählen wollte, was er über den Brand …« Henning sah wieder zum Laptop, »… in meiner Wohnung wusste.«
Er schob den Stuhl näher an den Tisch heran und schob den Bildschirm ein Stück höher. Wieder tauchte Trines Bild vor seinen Augen auf.
»Was?«, fragte Veronica.
Henning versuchte, seine widerstreitenden Gedanken zu sortieren. Trine war womöglich irgendwie in die Sache verwickelt. Das würde auch die Warnung erklären, die an seiner Tür gehangen hatte; sie hatte nicht gewollt, dass er – ihr eigener Bruder – ums Leben kam. Andererseits hatte Tore ganz in der Nähe in seinem Auto gesessen und Fotos von ihrer Begegnung mit Durim Redzepi geschossen. Fotos, die nahelegten, dass eine Ministerin mit einem Fall von Brandstiftung mit Todesfolge in Verbindung gebracht werden konnte. Dass sie Kontakt zu Kriminellen gehabt hatte.
Henning teilte seine Gedanken mit Veronica.
»Stellen Sie sich doch die Situation mal vor«, murmelte er konzentriert. »Tore versucht verzweifelt, aus dem Gefängnis zu kommen. Er nimmt Kontakt zu mir auf und erzählt, er könnte mir Informationen über den Brand in meiner Wohnung liefern, wenn ich ihm im Gegenzug helfen würde, aus dem Knast zu kommen. Würde er noch leben, hätte er mir nie was von einem Mord erzählt, in den er und Charlie irgendwie verstrickt waren. Sonst wäre er Gefahr gelaufen, erneut im Knast zu landen. Das wäre wirklich absoluter Blödsinn gewesen …«
Veronica nickte, munterte ihn auf, mit seinen Schlussfolgerungen fortzufahren.
»Aber das hier«, sagte er und zeigte auf den Laptop, »ist etwas anderes. Potenziell kompromittierendes Material über Trine – in meinen Augen sind das überaus relevante Informationen. Genau das ist es, was Tore mit mir teilen wollte.«
Henning frage sich für einen Moment, ob Tore genau deshalb ermordet worden war. Aber die Fotos bewiesen erst mal nichts – nur dass Trine auf offener Straße mit einem Kriminellen gesprochen und ihm irgendetwas … überreicht hatte. Trine würde mit Leichtigkeit eine Erklärung dafür finden, sollte eine Zeitung in den Besitz der Fotos kommen. Und dass sie an einem derart ausgeklügelten Mord wie dem an Tore im Gefängnis beteiligt gewesen sein sollte, war schlichtweg undenkbar.
Andererseits bewiesen die Bilder, dass Trine nur zehn Minuten vor dem Brand am Tatort gewesen war – und es war mehr als verdächtig, dass sie in diesem Zusammenhang mit einer Person wie Durim Redzepi zu tun gehabt hatte. Die Frage war jetzt nur, ob sie auch etwas mit Charlie Høisæther zu tun gehabt hatte.
Henning zog um aufs Sofa.
»Wann kommt sie wieder nach Hause?«, fragte Veronica.
»In drei Tagen«, antwortete Henning leise.
»Dann hab ich eine Idee, was Sie an diesem Tag tun könnten«, sagte sie.
Henning ballte die Hände zu Fäusten.
»Ich auch, das können Sie mir glauben.«
4
Drei Tage später
Es gab nichts, was diesem Gefühl auch nur nahe kam, dachte Iver Gundersen. Die Gewissheit, vor dem Durchbruch zu stehen, der zuvor niemandem gelungen war. Licht ins Dunkel eines überaus bemerkenswerten Falls zu bringen.
Deshalb machte er sich auch auf den Weg, sowie er in Noras Wohnung aufgewacht war. Er freute sich darauf, seine Ergebnisse mit Henning zu besprechen, und erkundigte sich per SMS, ob er direkt zu ihm kommen könne oder ob Henning noch im Bett liege. Iver bot ihm sogar an, ihn abzuholen.
Die Antwort kam postwendend:
Bin auf dem Weg zum Flughafen. Geht es auch später?
Flughafen?, dachte Iver. Was will er denn da?
Er tippte OK, spürte aber im selben Moment, wie enttäuscht er war.
Kurz darauf piepte es wieder.
Worum geht es denn?
Iver fragte sich, was er antworten sollte.
Das kann ich in einer SMS nicht erklären. Lass uns das später besprechen.
Diesmal antwortete Henning mit Okay.
In der Zwischenzeit, dachte Iver, würde er alles noch mal durchgehen und einfach selbst des Teufels Advokaten spielen: eine herausfordernde, aber notwendige Übung für jeden, der jemanden eines Verbrechens überführen wollte. Er musste sich hundertprozentig sicher sein.
Iver scherte hinter einem Bus ein und bemerkte erst jetzt, dass er bald würde tanken müssen. Kein Wunder. Die letzten Tage hatte er förmlich im Auto gewohnt.
Er versuchte, sich ein wenig zu beruhigen und langsamer zu atmen. An Henning und an Nora zu denken.
Die letzten Monate waren schon seltsam gewesen. Er hatte nie vorgehabt, sich in sie zu verlieben, aber Nora war bei all ihrer Verletzlichkeit nach Jonas’ Tod so unglaublich attraktiv gewesen, dass es ihm wie vorherbestimmt vorgekommen war, sie wieder zum Lächeln zu bringen. Und obwohl er wusste, dass Nora Hennings Lebensgefährtin gewesen war und der vielleicht zu 123nyheter zurückkehren würde, hatte er sich nicht gegen die Liebe wehren können.
Insgeheim hatte Iver gehofft, dass Henning nie wieder zu arbeiten beginnen würde, aber im Frühling war er wieder aufgetaucht. Iver wusste wirklich nicht, wem von ihnen beiden die ganze Situation unangenehmer gewesen war. Ihr erster gemeinsamer Auftrag – die Recherche hinsichtlich der Steinigung einer Filmstudentin namens Henriette Hagerup in einem Zelt am Ekeberg – war entsprechend nicht gerade ideal verlaufen. Henning hatte den Täter entlarvt, dann aber Iver seine kompletten Rechercheergebnisse überlassen. Anfangs hatte er gar nicht verstehen können, warum, doch dann war ihm klar geworden, dass Henning nur sich selbst hatte schonen wollen. Er hatte gewusst, dass seine Schlussfolgerungen speziell waren und zu einem enormen Interesse unter ihren Pressekollegen geführt hätten, woran Henning wiederum nicht das geringste Interesse gehabt hatte. Weder damals noch heute.
Anfänglich hatte Iver den Rummel genossen, aber es hatte nicht lang gedauert, bis ihm klar geworden war, dass der Ruhm zwei Seiten hatte. Immer wenn Henriette Hagerups Name gefallen war, hatte er wieder daran denken müssen, wer die Lorbeeren in Wahrheit verdient gehabt hätte. Dass Henning der Einzige war, der darüber Bescheid wusste, machte die Sache nicht leichter. Deshalb hatte Iver versucht, auch etwas für ihn zu tun. Er hatte sich auf die zentrale Frage in Hennings Leben gestürzt, das Rätsel um den Tod seines Sohnes Jonas, und versucht, den entscheidenden Hinweis zu finden, um das Geheimnis zu lüften.
Und jetzt glaubte er, es endlich geschafft zu haben.
Iver parkte ein paar Straßen von seiner Wohnung entfernt und lief eilig nach Hause. Um kurz nach halb zehn schloss er die Tür auf und warf den Schlüsselbund auf die Hutablage.
Und spürte augenblicklich, dass etwas nicht stimmte.
Es dauerte ein paar Sekunden, ehe es ihm dämmerte.
Es war überall dunkel.
Dabei zog er die Vorhänge nie zu. Zumindest nicht ganz.
Außerdem waren aus dem Wohnzimmer Geräusche zu hören. Der Fernseher lief. Er hatte doch nicht vergessen, ihn auszustellen, ehe er am späten Vorabend zu Nora gefahren war?
Iver marschierte in die Küche und spähte ins Wohnzimmer. Der Fernsehschirm warf helles Licht über Decke und Wände. Auch dort waren die Vorhänge zugezogen worden. Was war hier los?
Mit einem Mal hatte er das Gefühl, ein Riesenproblem zu haben.
Im nächsten Augenblick ging im Wohnzimmer das Licht an.
Iver blieb wie angewurzelt stehen.
Auf dem Stressless-Sessel saß jemand.
»Da ist er ja«, sagte ein Mann in gebrochenem Schwedisch.
Iver klappte der Unterkiefer runter. Dann sah er sich rasch um. Auch auf dem Sofa saß jemand. Und dieser zweite Mann hielt eine Waffe in der Hand.
»Wer …«, stieß Iver hervor, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. »Wer sind Sie?«, fragte er schließlich und räusperte sich. »Und was machen Sie hier?«
»Das hat ganz schön gedauert«, sagte der Mann im Sessel. »Wir waren das Warten schon leid, nicht wahr, Jeton?«
Der Mann, der mit Iver sprach, blickte noch einen Moment auf den Fernseher und schaltete ihn dann aus. Die Fernbedienung legte er auf den Tisch. Bei dem harten Geräusch zuckte Iver zusammen. Im selben Moment sah er, dass der Mann Handschuhe trug und dass auf dem Couchtisch ein Strick lag.
Iver schluckte. Fragte sich, ob er sich umdrehen und nach draußen spurten sollte, aber die Art, wie der Mann auf dem Sofa jetzt die Waffe umklammerte, hielt ihn davon ab.
»Was wollen Sie?«
Beide Männer standen gleichzeitig auf. Iver spürte, wie sich sein Bauch verkrampfte.
»Wir wollen wissen, wie viel Sie wissen und mit wem Sie geredet haben.«
Der Mann machte einen Schritt näher. Er war klein, hatte schütteres, ungekämmtes Haar und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Er wirkte gedrungen, aber muskulös. Iver konnte das leichte Zucken seiner Brustmuskeln erahnen. Keiner der beiden machte sich auch nur die Mühe, sein Gesicht zu verbergen. Wie waren sie hereingekommen, und was wollten sie mit dem Strick?
»Wovon reden Sie?«
Iver versuchte, entspannt zu wirken, doch seine Stimme zitterte. Er sah zum Fenster. War eins davon offen? Würde er nach draußen hechten können? Allerdings war es zu weit bis nach unten, und dort wartete nur der Asphalt.
Der zweite Mann nahm den Strick zur Hand, der auf dem Tisch gelegen hatte.
»Sehen Sie, was ich hier drin gemacht habe?«, fragte der Mann, der auch zuvor schon mit ihm geredet hatte, und sah demonstrativ hinauf zur Decke. Iver legte den Kopf in den Nacken. Erst konnte er nichts Ungewöhnliches entdecken.
Doch dann fiel sein Blick auf den Haken.
Der Mann zückte ein Messer.
»Ich hab das mal in einem Film gesehen«, erklärte er. »Ich mag Filme. Mögen Sie Filme, Gundersen?«
Er sah Iver neugierig an, bekam aber keine Antwort.
»Ich hab es noch nie selbst probiert, aber wissen Sie, was passiert, wenn man blutet, zum Beispiel aus dem Hals, und dann verkehrt herum aufgehängt wird?«
Der Mann legte sich mit einem Grinsen im Gesicht die Klinge an den Hals.
Iver schluckte schwer. Überlegte fieberhaft, wie er davonkommen könnte.
»Es hängt vom Schnitt ab, von der Tiefe. Aber wenn man diese Ader hier nur ein klein bisschen anritzt« – er zeigte auf eine Ader an seinem eigenen Hals –, »sodass nur etwas Blut heraussickert« – er machte erneut eine Pause –, »dann dauert es bloß eine halbe Stunde, bis der Betreffende stirbt.«
Erst jetzt sah Iver, dass auch dieser Mann eine Waffe bei sich trug. In der Innentasche seiner Jacke.
Lass dir was einfallen, sagte er zu sich, sonst war’s das.
»Ich hab keine Ahnung, was Sie von mir wollen«, stammelte er. »Ich weiß nichts, ich hab keine …«
»Schh«, unterbrach ihn der Mann. »Nicht.«
Er schüttelte den Kopf und trat dann langsam einen Schritt vor.
»Wir werden schon noch herausfinden, was Sie wissen, ob Sie es nun wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird.« Dann grinste er – ein kurzes, teuflisches Grinsen – und zog eine Uhr aus seiner Tasche. Dann wandte es sich an seinen Kameraden: »Was meinst du, Jeton, wie lange wird es dauern?«
5
Die Flugbegleiterin schob den Getränkewagen vor sich her und fragte die Fluggäste, ob sie Kaffee oder Tsee wollten.
Tsee.
Nicht Tee.
Trine Juul-Osmundsen hatte immer schon geargwöhnt, dass sie diese Überartikulation während der Ausbildung lernten – diese Verhunzung der Sprache. Oder aber sie hörten es sich von anderen ab. Äfften ihre Flugbegleiterkollegen nach.
Unsere Sprache, dachte sie, unser Werkzeug und Instrument, andere Menschen zu verstehen und uns verständlich zu machen, befindet sich in permanenter Veränderung. Leider zum Schlechteren.
Jugendliche sprachen heutzutage unbegreiflicherweise mehr Englisch als Norwegisch, und was sich hinsichtlich der nächsten Generation abzeichnete, machte Trine wenig Hoffnung.
»Kaffee? Tsee?«
Die Flugbegleiterin sah auf sie herab.
Entschuldigen Sie … haben Sie Tsee gesagt?
Trine grinste in sich hinein. Irgendwann würde sie es sagen – nur um die Reaktion der Flugbegleiterin zu sehen. Hätte niemand sie gekannt, hätte sie es sicher längst getan. Aber inzwischen war so was unmöglich – sie wäre wieder einmal auf der Titelseite gelandet, wo die gekränkte und gedemütigte Flugbegleiterin ihre Geschichte erzählte und eine Entschuldigung einforderte.
»Nein danke«, antwortete sie und schüttelte den Kopf, und die Flugbegleiterin schob den Wagen weiter.
Die Luft in der Kabine war trocken und kalt, als wäre die Klimaanlage an Bord der Norwegian-Maschine von Frankfurt nach Oslo auf Frost eingestellt worden. Vielleicht lag es auch daran, dass Trine die vergangenen zwei Wochen auf den Bahamas verbracht hatte, weit weg von der herbstkalten norwegischen Hauptstadt.
Die zwei Wochen waren fantastisch gewesen. Nur sie allein mit sich selbst, einem Haufen digitaler Bücher und einer privaten Sonnenliege, für die sie nicht um fünf Uhr morgens aufstehen musste, um sich den Platz zu sichern. Sie hatte Zeit für sich gebraucht, um nicht in einem fort darüber nachzudenken, was sie zum Rücktritt von ihrem Amt als Justizministerin gezwungen hatte. Die falsche Anschuldigung eines jüngeren männlichen Politikerkollegen wegen vermeintlicher sexueller Belästigung hatte sie alle Kraft gekostet. Auf den Bahamas, wo niemand sie gekannt hatte, hatte sie immer wieder für kurze Momente vergessen können, wie furchtbar und schmerzlich das alles gewesen war – insbesondere das Gespräch mit Pål Fredrik, nachdem sie der TV2-Reporterin Guri Palme gegenüber ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte.
Trine hoffte inständig, dass in Gardermoen nicht wieder irgendwelche Journalisten warteten. Nach zwei Wochen Abwesenheit mussten sie sich doch anderen Themen zugewandt haben. Dass die Medien sie bereits vergessen hätten, glaubte sie allerdings nicht.
Trine sah auf die Armbanduhr, die Pål Fredrik ihr am Morgen ihres ersten Arbeitstags als Ministerin geschenkt hatte. Noch eine halbe Stunde bis zur Landung. Ihr Herz begann, schneller zu schlagen.
Zu welchem Entschluss Pål Fredrik wohl gekommen war, nachdem er jetzt zwei Wochen Zeit gehabt hatte, um zu verdauen, dass sie eine Abtreibung vorgenommen hatte, ohne mit ihm darüber zu sprechen? Und das, obwohl sie zuvor in aller Öffentlichkeit beteuert hatten, wie gern sie Kinder hätten. Würde er mit dem Verrat leben können, den sie an ihm begangen hatte?
Sie hatten einander zwar täglich geschrieben, dabei aber immer nur Belanglosigkeiten ausgetauscht. Sie wusste nicht einmal, ob er sie am Flughafen abholen würde. Wahrscheinlich, dachte Trine, macht er gerade eine lange Fahrradtour. Und wird ihr nie vergeben können.
Es knisterte in der Lautsprecheranlage. Der Pilot verkündete, dass sie den Landeanflug auf Oslos Flughafen einleiten würden. Er bat die Fluggäste, ihre Plätze wieder einzunehmen und sich anzuschnallen. Trine überlegte, was sie machen wollte, wenn sie wieder zu Hause wäre. Vielleicht gäbe es ja die eine oder andere PR-Agentur, die gern eine Frau mit ihrem Netzwerk beschäftigen würde. Andererseits hätte sie auch nichts gegen ein paar Monate ohne Arbeit einzuwenden. Um wieder vollends auf die Beine zu kommen und dann richtig Lust aufs Arbeitsleben zu haben.
Als sie ihr Handy nach der knapp halbstündig verspäteten Landung anschaltete, kam keine SMS