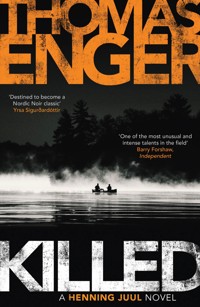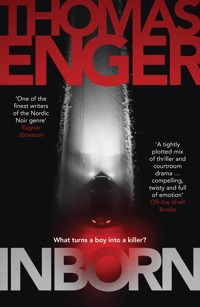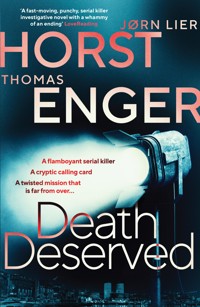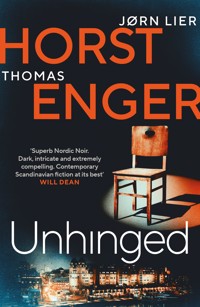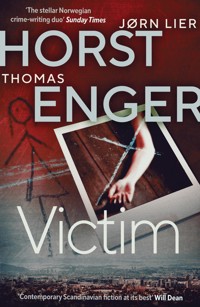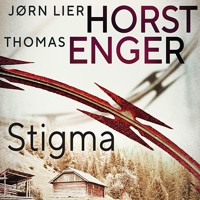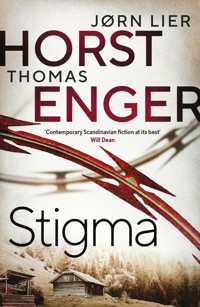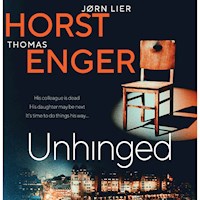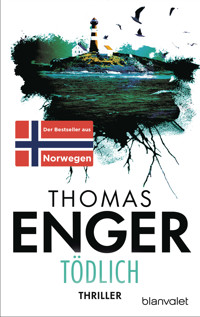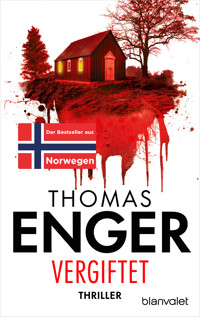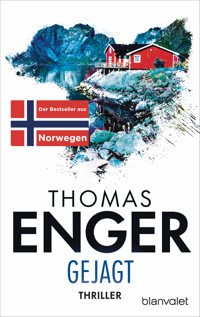
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Henning-Juul-Romane
- Sprache: Deutsch
»Krimi-Autor Thomas Enger wird von seinen norwegischen Landsleuten verehrt wie Jo Nesbø. Zu Recht.« Brigitte
Nach dem Tod ihres Vaters nimmt sich Hedda Hellberg eine Auszeit – und taucht nicht wieder auf. Als Henning Juuls Exfrau Nora von dem Verschwinden ihrer ehemaligen Schulfreundin erfährt, kann sie nicht glauben, dass diese freiwillig ihre Familie verlassen hat. Schnell findet sie heraus, dass Hedda in einen schwedischen Mordfall verwickelt ist. Als Nora bei ihren Nachforschungen nicht weiterkommt, wendet sie sich an Henning – und bald befindet sich das Expaar auf gefährlichem Terrain. Denn irgendjemand ist bereit zu töten, um eines der dunkelsten Geheimnisse der europäischen Geschichte zu bewahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Enger
Gejagt
Ein Henning-Juul-Roman
Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob und Maike Dörries
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Våpenskjold« bei Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert,wofür wir uns herzlich bedanken.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Gyldendal Norsk Forlag AS
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Plainpicture/Anja Weber-Decker
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15808-8
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
www.blanvalet.de
Prolog
August 2011
Daniel Schyman war überzeugt davon, dass die Leute über diesen Tag reden würden.
Es war einer dieser Tage, an denen ihm das Gras und die Büsche vom Straßenrand zublinzelten. Die Luft war frisch und klar und der Himmel über den Bäumen so blau, dass es fast in den Augen wehtat. Er wusste, dass es in den Wäldern in diesem Augenblick nasskalt riechen würde. Die Kreuzottern würden hervorkriechen, verwirrt, welche Jahreszeit gerade war. Die größeren Tiere würden den Schatten suchen und Heidekraut und die Beeren fressen, die allmählich reif wurden. Und wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hätte, würde es warm und trocken duften, und jeder Schritt im Wald, jeder hektische, flatternde Flügelschlag wäre schon von Weitem zu hören. Allein der Gedanke löste ein Prickeln in seinem Körper aus.
In der ersten Zeit nach Gunillas Tod hatte Schyman morgens nicht mehr aufstehen wollen. Sie hatten keine Kinder gehabt und nur einen kleinen Freundeskreis. Die Stille hatte ihn an den Sessel im Wohnzimmer gefesselt, von wo aus er mit leerem Blick auf den Wald und die Wiesen hinausgestarrt und sich gefragt hatte, was das Leben einem wie ihm denn noch bieten sollte.
Nichts. Zu diesem Ergebnis war er fast jedes Mal gekommen, und die Antwort hatte ihn in Erwägung ziehen lassen, Gunilla einfach in die Ewigkeit nachzufolgen. Aber es war nicht seine Art aufzugeben. Darum hatte er sich selbst am Schopf gepackt und Stück für Stück aus seinem Sessel hochgezogen und beschlossen, sich wieder Dingen zu widmen, die ihm etwas bedeuteten. Tage wie dieser überzeugten ihn letztlich davon, dass er richtig entschieden hatte.
Schyman bog von der Straße auf einen Schotterweg ab und wurde langsamer, als wollte er das, was vor ihm lag, hinauszögern, noch nicht sofort erleben. Er passierte den rot gestrichenen Schlagbaum, stutzte kurz, weil er bereits offen stand, wischte den Gedanken dann aber beiseite und parkte auf dem Platz direkt neben der im Winter beleuchteten Langlaufloipe. Dort stand bereits ein anderer Wagen, vermutlich aber noch nicht lange. Die Reifenspuren waren noch deutlich im feuchten Boden zu erkennen. Schyman zog den Autoschlüssel ab, stieg aus und machte die Heckklappe auf, um Lexie herauszulassen.
Wie immer brachten ihn die Lebensfreude seiner Hündin, ihr Schwanzwedeln und das Leuchten in ihren Augen zum Schmunzeln. Neuneinhalbtausend Kronen hatte er für sie bezahlt, aber ihr wahrer Wert war nicht annähernd zu beziffern. Lexie war die beste Bracke, die er je gehabt hatte – immer bereit für einen Ausflug, immer glücklich, ihn wiederzusehen, selbst wenn er nur kurz weg gewesen war.
Schyman schnappte sich den Rucksack und die Schrotflinte, eine Husqvarna, die er zum sechzehnten Geburtstag von seinem Vater bekommen hatte und mit der er seither jeden Herbst auf Jagd gewesen war. Na ja, Vater … Vielleicht war das nicht ganz präzise. Nicht nach allem, was Schyman in den vergangenen Tagen erfahren hatte.
Schon ein merkwürdiger Gedanke, dass er eigentlich Norweger war und dass seine Eltern – seine leiblichen Eltern – so viel durchgemacht und ein so großes Opfer gebracht hatten.
Der Krieg ist Teufelswerk, ein Spiel, in dem man seinem Schicksal ausgeliefert ist und bei dem selten etwas Gutes herauskommt.
Obwohl Schweden im Zweiten Weltkrieg neutral gewesen war, war das Land mitnichten verschont geblieben. Die Menschen, bei denen er aufgewachsen war, hatten ihre Türen geöffnet und Wildfremden Unterschlupf und Hilfe gewährt, und damit hatten sie nicht allein dagestanden. In Schymans Augen war es eine hohe Tugend, sich für andere zu opfern – vielleicht die höchste von allen.
Inzwischen wurde Schyman nicht mehr melancholisch oder traurig, wenn er an die beiden Menschen dachte, bei denen er aufgewachsen war, die er seine Familie genannt hatte, Vater und Mutter. Aber in letzter Zeit hatte er viel darüber nachgedacht, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie nur ein wenig länger gelebt hätten. Schon mit siebzehn war er mit dem Hof und dem Wald allein zurückgeblieben. Der Mann, der ihn vor ein paar Tagen angerufen hatte und ihn später am Tag besuchen wollte, hatte ihm mitgeteilt, dass Schyman eigentlich an seinem achtzehnten Geburtstag über seine wahre Herkunft hätte aufgeklärt werden sollen. Da wäre sicher einiges anders für ihn gelaufen. Es hätte vieles anders kommen können.
Trotzdem war er mit seinem Leben zufrieden, daran änderte auch alles Geld der Welt nichts. Und er würde auch niemals Norweger werden, sondern bis zu seinem Tod in Värmland bleiben.
Er warf einen Blick auf das neben ihm parkende Auto. Norwegisches Kennzeichen, die Buchstaben LJ direkt hinter der rot-weiß-blauen Flagge – Farben, bei denen er immer an Öl und an die Winterolympiade denken musste. Weder das Auto noch das Kennzeichen sagten ihm etwas.
Hatte der Fahrer einen Jagdschein?
Schyman hätte nicht sagen können, ob der Fahrer zum Jagen hier war, aber so früh kam im Grunde sonst niemand hierher. In jüngeren Jahren hätte er mit Sicherheit versucht herauszufinden, wer sich da die Freiheit nahm. Immerhin war dies hier sein Wald. Heute nahm er es damit nicht mehr so genau.
Schyman leinte Lexie an, dann gingen sie los. In der vergangenen Woche waren sie jeden Tag jagen gewesen, und wie üblich zog die Hündin heftig an der Leine. Er mochte es, wenn sie sich ihren Weg in den Wald hinein zu bahnen suchte, während er ihrem Hecheln und der Musik um sich herum lauschte: knackende Zweige, auffliegende Vögel, rauschende Blätter und das Gurgeln des Mooses unter seinen Füßen.
Sie gingen immer erst ein ganzes Stück, ehe er sie von der Leine ließ, und es war jedes Mal wieder gleichermaßen aufregend, wenn er sich mit seiner Waffe einen Ansitz suchte und darauf wartete, dass Lexie einen Hasen zu ihm trieb. In der Regel dauerte es eine Weile, bis sie ein Tier aufstöberte, manchmal passierte es gar nicht, aber genau das machte die Jagd schließlich aus. Aber wusste er, dass Beute in der Nähe war, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Dann kam es darauf an, alles richtig zu machen, genau wie er es eingeübt hatte, so präzise und effektiv wie möglich …
In diesen Momenten fühlte er sich lebendig.
Und dann kam die Stille danach. Die gelöste Spannung.
Es gab einfach nichts Besseres.
Es war vielleicht eine halbe Stunde vergangen, als Lexie plötzlich innehielt und die Ohren spitzte. Ihre Rute erstarrte in der Bewegung. Schyman hörte ein Knacken. Das war kein Hase. Er jagte seit gut sechzig Jahren in den värmländischen Wäldern und kannte die Geräusche.
Sollte er Lexie laufen lassen? Nein, dachte er. Im letzten Herbst hatte ein kleines Wolfsrudel seinen Wald durchquert. Vier Tiere. Wölfe wurden in Schweden immer zahlreicher.
Lexie bohrte die Schnauze in die Erde und zerrte wieder an der Leine. Mit dem Kopf nur wenige Zentimeter über dem Boden, lief sie hin und her, zog und zerrte, schnüffelte, blieb stehen, drehte die Ohren und lief wieder los. Sie führte ihn immer tiefer in den Wald hinein, über Heidekrautbuckel und durch sumpfige Senken. Es schwappte unter seinen Stiefeln.
Wenig später blieb sie erneut abrupt stehen.
Schyman rief laut: »Hallo?«, bekam aber keine Antwort. Er hörte auch nichts mehr. Zumindest nicht sofort. Dann war ganz in seiner Nähe ein Klicken zu vernehmen.
Er drehte den Kopf zur Seite. Sah Kleider, die mit der Umgebung fast zu verschmelzen schienen. Eine grüne Schirmmütze. Einen Gewehrlauf, der aus vielleicht zwanzig Metern Abstand auf ihn zielte.
Es knallte.
Eine ungeheure Kraft schleuderte ihn nach hinten. Der Rucksack federte den Sturz ein wenig ab, genau wie die Preiselbeer- und Heidesträucher, auf denen er landete. Als sein Hinterkopf sich in das weiche Grün drückte, fühlte er ein leichtes Kitzeln an der Wange, aber er konnte sich nicht rühren, lag einfach nur da und lauschte auf den Nachhall des Schusses, der sich im Wald verlor.
Dann kam die Stille.
Es tat ihm nichts weh, aber als Schyman versuchte zu atmen, füllte sich sein Mund mit Blut. Es fühlte sich so an, als hätte eine messerscharfe Klaue seinen Brustkorb aufgerissen. Etwas Warmes, Klebriges lief ihm vom Bauch über die Seite. Es roch streng und metallisch.
Wieder knackten Zweige, jetzt weiter entfernt. Seine Sicht wurde schlechter. Er kämpfte darum, die Augen offen zu halten.
Schyman hörte Lexie wimmern, fühlte gleich darauf ihre Schnauze an seiner Stirn, die feuchte, raue Zunge an der Wange.
Er versuchte, sich aufzurichten, und hob die Hand, um sie der Hündin in den Nacken zu legen, schaffte es aber nicht und sank stattdessen zurück auf die Heidedecke. Lexie schirmte die Sonne ab, die inzwischen richtig schön wärmte.
Diese Wärme brauchte er jetzt.
Daniel Schyman war überzeugt davon, dass die Leute über diesen Tag reden würden. Dann schloss er die Augen und spürte das Licht verschwinden.
Gunilla, dachte er.
Die Ewigkeit wartet.
1
Wo ist er? Wo ist er?
Nora Klemetsen war wütend auf sich selbst. Sie hatte für so einen Mist keine Zeit. Es war gleich Viertel vor acht. Der Bus würde nicht auf sie warten.
Sie wühlte in ihrer Tasche und stellte sicher, dass Handy, Schlüssel, Kreditkarten, all die Dinge, von denen sie abhängig war, an ihrem angestammten Platz waren. Dass sie es aber auch nie lernte, ihre Sachen schon am Vorabend zusammenzupacken!
Nora ging in die Küche, stellte die Tasche auf den Tisch und beugte sich darüber. Der Schal fiel nach vorn und nahm ihr die Sicht. Zornig wickelte sie ihn sich wieder um den Hals und entdeckte dabei die Reste einer Eierschale und einen Stift unter dem Tisch. Brotkrümel und Flusen der schwarzen Wollsocken, die sie zu Hause immer trug.
Sie legte Jacke und Schal wieder ab – für die dicken Sachen war es viel zu warm – und suchte im Wohnzimmer weiter. Vielleicht hatte er auf ihrem Schoß gelegen, als sie ferngesehen hatte, nachdem Iver gegangen war? Oder hatte sie ihn irgendwo abgelegt, als sie ins Bad gegangen war, um zu duschen und sich die Zähne zu putzen?
Sie hob die Sofakissen an und warf einen Blick unter die blau geblümte Decke, die auf der Fernbedienung lag. Dann kniete sie sich hin und sah unter das viel zu teure Sofa, ehe ihr Blick zum Ecktisch wanderte, auf dem die Lampe und das Radio standen. Aber auch dort war er nicht.
Konnte er irgendwie unter die Fernsehkommode gerollt sein?
Nora krabbelte auf allen vieren weiter. Das harte Parkett drückte schonungslos gegen ihre ohnehin schon schmerzenden Knie, doch sie fand nur Staubflocken und Krümel, die sie daran erinnerten, wie lange es schon her war, dass sie zuletzt einen ordentlichen Großputz gemacht hatte.
Nora stand so schnell auf, dass ihr schwindlig wurde. Sie hatte noch nichts Anständiges gegessen – aß immer erst bei der Arbeit ihre drei trockenen Knäckebrote.
Sie versuchte zu rekonstruieren, was sie am vergangenen Tag gemacht hatte. Sie hatte im Bett Zeitung gelesen, vor dem Fernseher gebruncht, einen Spaziergang am Fluss gemacht und mit Iver gegessen. Danach hatte sie versucht, so wenig wie möglich nachzudenken.
Er war gestern auch schon weg gewesen.
Nora ging wieder zum Küchentisch und kippte resolut die Handtasche aus, sodass sich Kleingeld, Quittungen, verstaubte Pastillen und ein einzelner Handschuh, den sie seit dem Frühjahr vermisste, auf der Tischplatte verteilten. Und unter dem löchrigen Fäustling rollte tatsächlich der Ball hervor.
Sie legte ihre Finger darum und setzte sich für einen Moment hin. Dann schüttelte sie ihn leicht und drehte ihn im Kreis, sodass der Flitter im Innern herumzuwirbeln begann.
Als sie ihn wieder still hielt, sah sie das Herz und den Pfeil und die Abdrücke seiner Zähne – als hätte Jonas versucht, den Ball zu zerbeißen. Nur gut, dass er keine Ahnung gehabt hatte, was das für ihn bedeutet hätte. Wasser und Flitter überall: auf den Lippen, dem Pullover, dem Fußboden.
Eigentlich war es gar kein Ball, sondern eine Kugel aus hartem Plastik, aber für Jonas war es immer ein Ball gewesen. Sein Ball.
Es gelang ihr nicht, die Erinnerung festzuhalten. Sie stand auf, legte den Ball in die Tasche zurück, zog sich Jacke und Schal wieder an und trat vor den Spiegel im Flur. Sie zupfte ein paar Haare von ihrem Ärmel, strich sich die Frisur zurecht und die Jacke glatt und hängte sich die Tasche über die Schulter.
Jetzt konnte der Tag beginnen.
Draußen war es Herbst.
Nora mochte es, wenn es so grau und ungemütlich war, dass man sich mit einer Decke aufs Sofa verkrümeln und einfach alles in sich hineinstopfen durfte, was man in die Finger bekam. In diesem Punkt war sie genau wie Henning. Wenn jemand Ausreden fand, um nicht nach draußen gehen zu müssen, dann er – außer, er musste zur Arbeit. Es kam bestimmt irgendein guter Film oder eine Serie im Fernsehen, oder der Kamin musste angeheizt werden, wenn er nicht gerade mitten in einem spannenden Buch steckte oder die Zeitungen der letzten Woche noch nicht gelesen hatte.
Es gab wirklich einiges an Henning, was sie mochte. Seinen Humor ebenso wie seine pointierten Kommentare. Aber es war nicht nur darauf angekommen, was er getan oder gesagt hatte oder was er für ein Mensch gewesen war. Mindestens ebenso wichtig war, was sie in seinen Augen gesehen hatte. Trotz ihrer kurzen Haare und Sommersprossen und ihrem Niesen, mit dem sie jeden regelrecht in Schockstarre versetzen konnte, hatte sein Blick die immer gleiche Liebe und Wärme ausgestrahlt, wenn er sie betrachtet hatte. Sogar wenn sie im angetrunkenen Zustand zu hicksen begann und aussah wie eine Kröte. Sein Blick hatte sich nicht einmal geändert, wenn sie laut schimpfend Türen knallte, weil er wieder einmal die Sofakissen nicht zurückgelegt oder die Wäsche nicht von der Leine genommen hatte. Als hätte er ihr immer wieder sagen wollen: Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ich will dich, wie du bist.
Nora war in ihrer Jugend alle zwei Jahre umgezogen, weil ihr Vater beim Militär angestellt gewesen war. Sie war kaum irgendwo zur Ruhe gekommen. Hatte nirgends dauerhaft Freunde gefunden. Und diese Sehnsucht hatte sie bis weit ins Erwachsenenalter hinein begleitet. Aber nicht einmal wenn sie denn endlich jemanden gefunden hatte, war sie sonderlich gut darin gewesen, Freundschaften zu pflegen. Nur selten war sie es, die sich meldete oder sich mit jemandem verabredete.
Henning hatte all das in sich vereint, was sie sich je gewünscht hatte. Heim, Geliebter, Freund, mit dem sie ihr Leben teilen wollte. Jemand, zu dem sie grundehrlich sein konnte, ohne die Konsequenzen fürchten zu müssen. Es war perfekt gewesen – solange sie zu zweit gewesen waren.
Dann war Jonas gekommen.
Anfangs hatte der kleine Junge ihre Gefühle noch verstärkt. Sie waren eine Familie gewesen, wie sie im Buche stand. Sie hatte es geliebt, nach Hause zu kommen, ihn zu stillen und ihn größer werden zu sehen. Aber Henning war nun mal kein moderner Mann. Er hatte den Kleinen nur gewickelt, wenn es unbedingt nötig gewesen war, und er hatte auch nicht recht begriffen, was wichtig für ein Kind oder eine Familie war. Gerade im ersten Jahr war er fast vollständig in seine Arbeit abgetaucht, hatte nachts in einem anderen Zimmer geschlafen, weil er tagsüber hatte fit sein müssen, und hatte die Wochenenden zum Entspannen, Lesen, für die Nachrichten gebraucht. Und um seine Quellen zu pflegen. Nora hatte ihn in dieser Zeit richtiggehend zwingen müssen, mit Jonas mal für eine Stunde rauszugehen, damit auch sie endlich ein Auge zumachen konnte.
Ihre Liebe und Freundschaft waren verblasst, sie waren morgens im Bad wie Fremde aneinander vorbeigegangen und hatten fast nur noch via SMS kommuniziert. Aber auch dabei war es nur mehr um praktische, alltägliche Dinge gegangen. Der Rahmen, den sie sich für ihr Leben gewünscht hatte, löste sich nach und nach auf, und das Gefühl der Wurzellosigkeit nistete sich wieder ein. Wenn sie einmal versuchte, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, gelobte er betroffen Besserung, aber es verging selten mehr als eine knappe Woche, bis alles wieder so war wie zuvor.
Die Trennung war letztlich ein Hilferuf. Jedenfalls hoffte sie, dass Henning es so interpretierte, aber er war einfach nur traurig und betroffen und argwöhnte sogar, sie hätte einen anderen. Nachdem sie ausgezogen war, sah sie ihn ab und zu mit einer Zigarette in der Hand auf dem Parkplatz vor ihrem neuen Haus auf und ab laufen und zu ihrem Fenster hinaufspähen.
Das Sorgerecht für Jonas teilten sie sich – bis zu jenem Tag, über den keiner von ihnen reden konnte oder wollte. Der Tag, der alles für immer veränderte. Sie wussten beide, dass Jonas heute noch am Leben wäre, wenn sie einen Weg gefunden hätten zusammenzubleiben. Von diesem Moment an konnten sie einander nicht mehr in die Augen sehen. Die Scheidung war die einzige vernünftige Lösung, dabei zementierte sie ihre Trauer und war gleichzeitig eine Niederlage, die sie bis heute nicht vollends akzeptieren konnte.
Trotzdem ging das Leben irgendwie weiter, und schließlich lief ihr Iver über den Weg, in einem Moment, als sie Aufmunterung brauchte, etwas, was sie auf andere Gedanken als Jonas und Henning brachte. Iver hatte dieses Talent. Er stand früh am Sonntagmorgen bei ihr auf der Matte, um sie in einen Jachthafen zu entführen und mit einem gemieteten Boot auf eine Insel zu fahren. Oder um mit ihr bowlen zu gehen, obwohl sie dafür nichts übrig zu haben glaubte. An anderen Tagen las er ihr abends etwas vor, manchmal nackt, wenn nichts Spannendes im Fernsehen kam.
Irgendwie war mit Iver fast alles anders. Und ja, er hatte sie gern, sehr sogar – dessen war sie sich sicher. Nur fehlte diese Glut in seinen Augen. Vielleicht war es ungerecht, Iver mit Henning zu vergleichen oder Henning mit Iver, aber ließ sich das denn vermeiden, wenn man sich die Frage stellte, ob man in seinem Leben die richtigen Entscheidungen getroffen hatte? Diese Frage hatte nach dem Streit, den sie am Vorabend mit Iver gehabt hatte, neues Gewicht bekommen.
Wobei Streit womöglich nicht ganz der richtige Ausdruck war. Schließlich setzte ein Streit voraus, dass zwei Menschen nicht der gleichen Meinung waren und dies auch deutlich machten. Iver hingegen hatte einfach gar nichts gesagt. Nur vor sich hin gebrummelt, bis er wieder zu sich nach Hause gefahren war, ohne sie in den Arm zu nehmen, ihr einen Kuss zu geben oder sonst irgendwie zum Ausdruck zu bringen, was er über das dachte, was sie ihm zuvor eröffnet hatte.
Es war so typisch für ihn, sich einfach wegzuducken, sobald es ernst wurde. Er mochte es am liebsten unkompliziert. Und wenn es ihr ein seltenes Mal gelang, ihn in die Ecke zu drängen, sagte er nur: »Müssen wir wirklich jetzt darüber reden?«
Als würde sich der richtige Moment irgendwann wie von Zauberhand einstellen.
Dass er sich so aufführte, war womöglich Antwort genug, dachte Nora. Und jetzt arbeitete er schon wieder. Nora wusste, was das bedeutete. Lange Arbeitsnachmittage und Besäufnisse mit Informanten, die bis spät in die Nacht dauerten, sodass er allen Gesprächsmöglichkeiten erfolgreich aus dem Weg gehen konnte. Andererseits musste er sich irgendwann äußern. Genau wie sie mit Henning reden musste. Wie sie das schaffen sollte, war ihr allerdings schleierhaft.
Die Straßen waren schwarz vor Feuchtigkeit, und auf dem Asphalt neben dem Rinnstein klebten tote gelbe Blätter wie eine Mahnung an den vergangenen Sommer. Noch war es morgens hell, aber die Luft war unheilverheißend kalt und trug schon so viel Winter in sich, dass Nora die Jacke bis oben zumachte. Vor der Haltestelle an der Uelands gate hielt sie nach dem Bus Ausschau und sah auf die Uhr. Noch fünfunddreißig Minuten bis zur Morgenbesprechung. Höchste Zeit, dass ihr irgendetwas einfiel, worüber sie schreiben konnte.
»Warte, ich helfe dir!«
Als Nora die Redaktion der Aftenposten betrat, hing Birgitte Kråkenes vornübergebeugt über dem Wasserspender und versuchte, einen neuen Wassertank darauf zu platzieren. Birgitte war das Gesicht, das jeder Besucher als Erstes zu sehen bekam, wenn er die Redaktionsräume betrat.
»Oh, danke, lieb von dir«, sagte sie und drehte sich zu Nora um. »Diese Dinger sind echt tonnenschwer.«
Nora war sofort zur Stelle, und gemeinsam hoben sie den beschlagenen, durchsichtigen Plastiktank auf den Wasserspender. Birgitte bedankte sich mit einem Lächeln.
Die Empfangsdame war wie immer tadellos gekleidet und ihr Gesicht von einer faltenlosen Freundlichkeit, die Nora jedes Mal vor Neid erblassen ließ. Ihre Haut hatte einen ganz besonderen Teint, irgendwie sommerlich, pfefferminzfrisch, wovon bei Nora keine Rede sein konnte. Das Schlimmste war aber, dass Birgitte jünger war als sie und schon zwei Kinder zur Welt gebracht hatte, und sie empfing jeden, der sich an die Zeitung wandte, freundlich und zuvorkommend. Nora konnte gar nicht anders, als sie zu mögen.
»Du hast übrigens Besuch«, sagte Birgitte und ließ sich lautlos auf dem Stuhl hinter dem Empfangstresen nieder.
»So früh?«, fragte Nora zurück, griff nach einem Exemplar der Tageszeitung, die sich druckfrisch auf dem Tisch vor ihr stapelte, und warf beiläufig einen Blick auf die Schlagzeilen. Birgitte nickte und rückte die markante kastanienbraune Brille ein Stück höher.
»Er sitzt drüben an deinem Platz.«
Nora streckte sich. Neben ihrem Schreibtisch saß ein Mann mit übereinandergeschlagenen Beinen und sah sich rastlos um. Er war dunkel gekleidet, elegant. Seine halblangen, etwas zerzausten Haare waren schwarz mit einzelnen grauen Strähnen.
»Und? Hat der Typ auch einen Namen?«
Birgitte warf einen Blick auf den Zettel, der vor ihr lag. »Hugo Refsdal«, sagte sie und sah wieder auf.
»Nie gehört«, antwortete Nora. »Hat er gesagt, worum es geht?«
Birgitte schüttelte den Kopf und zuckte gleichzeitig mit den Schultern.
»Okay«, sagte Nora. »Schöne Jacke. Neu?«
»Neu?« Sie sah lächelnd auf ihren grauschwarzen Blazer hinab. »Den habe ich schon ewig!«
»Schön ist er trotzdem«, sagte Nora.
Birgittes Lächeln hielt an, bis das Telefon auf dem Tisch vor ihr zu klingeln begann. Sie nahm den Hörer mit der einen Hand ab und winkte Nora mit der anderen zu.
Nora betrat das charakterlose, langweilig eingerichtete Großraumbüro der Redaktion, das sich in nichts von den anderen Redaktionen unterschied, in denen sie im Lauf der letzten zehn Jahre gearbeitet hatte. Teppichboden, Leichtbauwände, verglaste Sitzungszimmer und ein Sammelsurium aus Kabeln und Bildschirmen. Die jüngste technische Errungenschaft war ein 75-Zoll-Bildschirm, der Mittelpunkt der Redaktion, besonders wenn Sport lief. Und irgendwie lief immer Sport.
Sie nickte ein paar Kollegen zu und sah unter dem unablässigen Klingeln der Telefone zu dem Mann hinüber, der aufstand, als sie näher kam.
»Hallo«, sagte er schon aus einigen Metern Entfernung und kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. »Wir sind uns nie begegnet. Mein Name ist Hugo Refsdal. Ich bin Heddas Mann.«
Nora schlug ein. Seine Hand war klamm.
»Hedda?«, fragte sie und wischte sich die Hand diskret an der Rückseite ihres Hosenbeins ab.
»Hedda Hellberg.«
Nora zuckte zusammen.
Seit dem Studium hatte sie von Hedda nichts mehr gehört. Damals hatten sie sich eine winzige Wohnung am St. Hanshaugen geteilt. Nora glaubte nicht, dass Hedda je Journalistin geworden war. Zumindest hatte sie ihren Namen nie irgendwo gelesen.
»Ja«, sagte sie schließlich. »Hedda.«
Nora hatte viele gute Erinnerungen an ihre Studienzeit. Jeder Tag war ein Fest gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Grenzenlos. Sie hatte nie daran gezweifelt, dass Journalismus für sie genau das Richtige war, egal ob beim Rundfunk, Fernsehen oder den Printmedien. Damals hatte sie davon geträumt, Kriegskorrespondentin zu werden, über Katastrophen zu berichten, sich in Themen einzuarbeiten und kritische Fragen zu stellen. Sie hatte die Wahrheit ans Licht bringen wollen, ständig dazulernen und hoffentlich einen Beitrag leisten, damit andere die wahren Zusammenhänge erkannten. Sie hatte etwas Bedeutendes schaffen wollen.
Die Realität war allerdings anders. Wenn sie mal Kontakt zu ihren Lesern hatte, was selten vorkam, dann nur in Form von Zuschriften, in denen sie mitunter heftig beschimpft wurde, weil sie irgendetwas falsch dargestellt hatte. Die Menschen schienen jegliches Schamgefühl zu verlieren, sobald sie sich vor eine Tastatur setzten.
Nora hatte keine Ahnung, was Heddas Mann zu ihr gebracht hatte, aber sie hatte kein gutes Gefühl.
»Können wir vielleicht irgendwo ungestört reden?«, fragte er. »Ich möchte nicht, dass alle …«
Er brach mitten im Satz ab, als einer ihrer Kollegen aus dem Außenressort vorüberging. Refsdal folgte dem Mann mit dem Blick, bis er sich weit genug entfernt hatte. Irgendwie hatte Nora das Gefühl, dass Heddas Mann jeden Moment in Tränen ausbrechen würde.
»Ja, natürlich«, sagte sie. »Wir können da reingehen.« Sie nickte zum Sitzungsraum der Ressortleiter, legte ihre Jacke ab, nahm ihr Handy und ging voran. »Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee?«, fragte sie über die Schulter.
»Nein danke.«
»Ein Glas Wasser oder irgendetwas anderes?«
»Nein danke, ich bin nicht durstig.«
Nora grüßte im Vorbeigehen ein paar frisch eingetroffene Kollegen und fragte sich im Stillen, worüber Refsdal mit ihr sprechen wollte. Er ging ein paar Meter hinter ihr, während sie zwischen Stühlen und Tischen hindurch in Richtung des Ikea-gelben Raumes mit den Zeitungsbergen auf dem langen Sitzungstisch ging.
Sie setzten sich auf zwei rot bezogene Stühle.
»Also«, sagte Nora, beugte sich vor und faltete die Hände, »wie kann ich Ihnen helfen?«
Refsdal hatte ganz offensichtlich Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Ausweichend ließ er den Blick durch den Raum schweifen, verknotete kurz die Finger, löste sie wieder voneinander und legte dann die Hände vor sich auf den Tisch.
»Wissen Sie, wer Oscar Hellberg ist?«, fragte er schließlich.
Nora dachte einen Augenblick lang nach.
»Ist das nicht Heddas Vater?«
»Er war Heddas Vater«, korrigierte Refsdal sie. »Er ist vor knapp zwei Monaten gestorben. Lungenkrebs – dabei hat er in seinem ganzen Leben nicht eine Zigarette geraucht.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte Nora.
Sie hatte Heddas Vater ein einziges Mal getroffen, als er nach Oslo gekommen war, um seine Tochter zu besuchen. Als Heddas Mitbewohnerin hatte er sie mit zum Essen eingeladen. Nora hatte ihn noch gut in Erinnerung. Ein attraktiver Mann, fit, elegant gekleidet und an anderen Menschen interessiert. Besonders die Bedienung hatte es ihm damals angetan.
»Für Hedda war das ein sehr schwerer Schlag«, fuhr Refsdal fort, griff unwillkürlich nach dem Stift, der vor ihm lag, und zog die Kappe ab. »In den letzten Wochen seines Lebens hat sie Tag und Nacht an seinem Bett gesessen.«
Refsdal rutschte bis vor zur Stuhlkante und legte die Finger um den Stift, als handelte es sich um ein Messer.
»Obwohl sie auf Oscars Tod vorbereitet gewesen war, hat ihr sein Tod ungemein zugesetzt. Sie ist völlig darin versunken. Mit unserem Sohn hat sie kaum noch gesprochen.«
Nora fiel auf, dass er von Hedda in der Vergangenheit sprach.
»Als sie ein paar Wochen später zu mir kam und mir sagte, sie bräuchte eine Auszeit, um wieder zur Ruhe zu kommen, wie sie es nannte, war ich nicht gerade begeistert.«
Refsdal drückte die Plastikkappe wieder auf den Stift zurück und kratzte sich am Bart.
»Als sie mir dann aber mitteilte, dass sie für drei Wochen in eine Rehaklinik nach Italien wollte, habe ich nicht widersprochen. Vielleicht brauchen manche Leute ja die Zeit, um sich wieder zu fangen. Keine Ahnung. Sollte sie sich doch drei Wochen freinehmen, wenn es ihr anschließend nur wieder gut ginge, dachte ich.«
Refsdal machte eine Pause, bevor er weiterreden konnte. Nora sah, wie seine Augen hin und her zuckten, als suchte er die Zimmerwand nach etwas Bestimmtem ab. Er blinzelte erst wieder, als seine Augen feucht wurden.
»Sie wollte vollkommen in Ruhe gelassen werden, sagte sie, und nicht einmal das Handy mitnehmen. Wir durften sie in dieser Klinik auch nicht anrufen, sie wollte ganz für sich sein, um wieder zu sich zu kommen. Sie wollte sogar alleine mit dem Zug zum Flughafen fahren, aber da konnte ich mich durchsetzen und hab sie hingebracht. Als ich sie in Gardermoen abgesetzt habe, meinte sie noch, dass sie mich lieben würde – uns, unsere Familie. Sie lächelte sogar, zum ersten Mal seit Langem. Ich hab mich riesig darüber gefreut – ist ja klar – und war mir sicher, dass alles wieder gut werden würde. Aber …«
Refsdal fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Irgendetwas an dieser Bewegung erinnerte Nora an Iver.
»Drei Wochen später bin ich wieder nach Gardermoen gefahren, um sie abzuholen. Ich hatte Henrik für diesen Tag sogar eine Entschuldigung geschrieben, damit er nicht zur Schule musste, sondern dabei sein konnte, wenn seine Mutter wiederkam.«
Er legte den Stift zurück auf den Tisch und faltete die Hände.
»Aber Hedda kam nicht.«
Es wurde still im Raum.
»Wir haben eine Ewigkeit gewartet, den ganzen Flughafen abgesucht und schließlich mit jemandem gesprochen, der Einblick in die Passagierlisten hatte. Sie durften darüber natürlich keine Auskunft geben. Danach hab ich bei dieser italienischen Rehaklinik angerufen. Und ab da wurde es wirklich merkwürdig.«
Nora beugte sich vor.
»Die Frau, mit der ich geredet habe, hatte noch nie von ihr gehört. Hedda war nie in dieser Klinik gewesen.«
Refsdal verknotete erneut nervös die Finger.
»Sie können sich vielleicht vorstellen, was das in mir ausgelöst hat.«
Nora nickte langsam.
»Ich habe sämtliche Freunde und Bekannte angerufen und gefragt, ob sie etwas von Hedda gehört hätten. Da keiner etwas wusste, blieb mir nichts anderes übrig, als irgendwann die Polizei zu alarmieren.«
»Wann haben Sie das getan?«, fragte Nora.
»Vor elf Tagen.«
»In den Zeitungen stand nichts darüber …«, sagte Nora. Sie ärgerte sich, weil sie ihren Notizblock nicht mitgenommen hatte.
Refsdal sah sie an und lächelte resigniert.
»Heddas Familie war es immer schon wichtig, die Fassade aufrechtzuerhalten«, erklärte er. »Sie wollten nicht, dass es in den Zeitungen landete. Hedda würde schon wieder zur Besinnung kommen, meinten sie. Sie wollten unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen. Aber jetzt sind inzwischen schon elf Tage vergangen, und wir haben immer noch kein Lebenszeichen von ihr.«
»Das heißt, Hedda ist jetzt schon mehr als einen Monat weg?«
Refsdal nickte.
»Und was hat die Polizei unternommen?«
»Ich denke, die hat getan, was in ihrer Macht stand«, sagte er und atmete schwer aus. »Sie haben herausgefunden, dass sie gar nicht in dem Flieger saß, der um 9.50 Uhr nach Mailand geflogen ist. Dass sich in Gardermoen all ihre Spuren verlieren. Niemand hat sie gesehen, seit ich sie damals am Morgen vor der Abflughalle abgesetzt habe.«
Nora sah ihn nachdenklich an.
»Und was ist mit den Überwachungskameras vom Flughafen?«
»Davon gibt es Hunderte, und die nehmen sogar rund um die Uhr auf. Aber nach sieben Tagen werden die Bänder wieder gelöscht.«
»Und da sie schon drei Wochen weg war, gab es …«
»… keine Bilder von ihr«, vervollständigte Refsdal ihren Satz. »Jedenfalls nicht von Gardermoen.«
»Hat die Polizei denn keine Suchmeldung an die Medien gegeben?«
Nora ahnte, was die Antwort auf die Frage sein würde. Die Polizei nahm keinen Kontakt zu den Medien auf, sofern der Verdacht bestand, dass jemand einfach abgehauen sein könnte – derlei Artikel, hieß es, erschwerten es dem Vermissten, wieder nach Hause zurückzukommen. Und bei einem potenziellen Selbstmord halfen sie ohnehin nicht mehr.
»Nein«, sagte Refsdal und schlug den Blick nieder.
Nora dachte nach.
»Geht die Polizei davon aus, dass sie sich umgebracht haben könnte, weil der Tod ihres Vaters ihr so nahegegangen war?«
Refsdal hob den Kopf ein wenig und nickte.
»Ich weiß nicht, ob Hedda Ihnen das jemals erzählt hat«, sagte er und wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. »Aber in den Neunzigern ist Heddas Tante verschwunden. Damals sind alle von Selbstmord ausgegangen.«
Nora erinnerte sich vage daran, dass Hedda einmal von ihrer Tante Ellen erzählt hatte.
»Und deshalb glauben jetzt alle, dass Hedda sich ebenfalls umgebracht hat«, sagte Refsdal. »Dass das irgendwie in der Familie liegt.«
»Aber Sie glauben nicht daran?«
Refsdal nahm den Stift wieder zur Hand.
»Deshalb sind Sie hier, nehme ich an?«, fuhr Nora fort. »Sie wollen, dass ich etwas über sie schreibe?«
Er schlug den Blick nieder und wartete lange.
»Hedda und ich haben vor langer Zeit mal über kluge Menschen gesprochen«, sagte er schließlich und lächelte gedankenversunken. »Ob wir schon mal jemanden um seine Klugheit beneidet hätten.« Er schüttelte leicht den Kopf, lächelte aber weiter. »Hedda meinte damals, dass sie nie einen klügeren Menschen getroffen hätte als Sie.«
Refsdal sah wieder zu ihr auf, und Nora erwiderte seinen Blick, ehe ihr klar wurde, was er da gerade gesagt hatte.
»Mich?«
»Das hat sie gesagt, ja. Und ich habe mir Ihren Namen gemerkt – was ja nicht schwer ist. Immerhin haben Sie beide Ibsen-Namen.«
Nora lächelte verlegen. Unwillkürlich wanderten ihre Gedanken zu einem Abend zurück, als sie sich mit Rotwein betrunken hatten und schließlich irgendwann – wer weiß, warum – auf Ibsen zu sprechen gekommen waren. Sie hatten Noras Ausgaben von Hedda Gabler und Ein Puppenheim hervorgeholt und versucht, ein Gespräch zu führen, das nur aus Zitaten ihrer Namensschwestern bestand.
Eine gute Erinnerung.
»Na ja, ich dachte, Sie könnten sich das Ganze vielleicht ein bisschen genauer anschauen«, fuhr Refsdal fort. »Sie kannten sie ja auch – und Sie sind Journalistin. Sie können anders mit den Menschen reden als ich.«
Nora nickte langsam.
»Was sagt der Rest der Familie dazu? Sind sie Ihrer Meinung, dass das der richtige Weg ist?«
»Sie wissen nicht, dass ich hier bin.«
Nora sah überrascht auf.
»Es spielt keine Rolle, was sie denken. Henrik und ich stehen ihr am nächsten, wir sind ihre Familie, und wir wollen wissen, was mit ihr passiert ist. Wenn Hedda tot sein sollte, will ich ein Grab haben, das ich besuchen kann. Und ich glaube, dieses Bedürfnis haben die anderen Angehörigen insgeheim auch.«
Auf dem Tisch stand ein halb voller Wasserkrug, daneben stapelten sich Plastikbecher. Refsdal stand auf, griff zum Krug, goss sich ein und sah fragend zu Nora herüber.
»Ich glaube, das steht da noch von gestern.«
»Macht nichts«, sagte er und trank den Becher in einem Zug leer.
»Wie sieht es mit Handydaten oder E-Mails aus?«, hakte Nora nach. »Hat sich da seit ihrem Verschwinden etwas getan? Die Polizei wird das doch überprüft haben, oder?«
Refsdal schluckte und setzte sich wieder.
»Keine Aktivität, seit sie weg ist«, sagte er und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.
»Und Geld – hat sie vor ihrem Verschwinden größere Beträge abgehoben?«
Er schüttelte den Kopf.
»Bevor sie abfliegen wollte, hab ich sie noch gefragt, ob sie Euro bräuchte, aber sie meinte, das würde sie vor Ort erledigen. In Italien.«
Was gelogen war, dachte Nora und spürte, dass sie zusehends neugierig wurde. Warum hatte Hedda eine Reise erfunden, die sie nie angetreten hatte, um stattdessen einfach zu verschwinden?
»Dann gibt es also keine elektronischen Spuren, seit Sie Hedda am Flughafen abgesetzt haben?«
Refsdal schüttelte stumm den Kopf.
Nora aktivierte das Display ihres Handys und stellte fest, dass die Morgenbesprechung in vier Minuten anfangen würde. Sie holte tief Luft.
»Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Hugo. Auf den ersten Blick spricht vieles für die Schlussfolgerung der Polizei. Keine E-Mails, keine Kontenbewegungen …«
»Aber der Tod ihres Vaters ist doch kein Grund, sich umzubringen!«
Refsdal stand auf. Hektische rote Flecken zeichneten sich auf seinen Wangen ab.
»Oscar war schon lange krank. Außerdem hat Hedda einen Sohn, den sie nie freiwillig zurücklassen würde. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.«
Nora sah ihn mitfühlend an.
»Ich verstehe, dass Sie sich Hoffnungen machen, Hugo, aber …«
»Es geht nicht um Hoffnungen«, fiel er ihr ins Wort. »Ich fange langsam an, mich damit abzufinden, dass Hedda nie mehr zu mir zurückkommen wird, aber ich muss einfach wissen, was passiert ist.«
»Was ist denn Ihrer Meinung nach passiert, wenn Sie nicht glauben, dass sie freiwillig gegangen ist? Ist sie in Gardermoen von jemandem gekidnappt worden – vor den Augen von Hunderten potenziellen Zeugen?«
Draußen vor den Fenstern kam der erste Ressortleiter zum Vorschein.
»Ich weiß es nicht«, sagte Refsdal leise. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich es Henrik nicht erklären kann, wenn er abends ins Bett geht und mich fragt, wo seine Mama ist.«
Nora sah ihn an. Sie konnte nachvollziehen, wie es ihm ging – und gleichzeitig auch wieder nicht. Über zwei Jahre hatte sie mehr als genug damit zu tun gehabt, endlich zu begreifen, dass Jonas tot war. Obwohl sie genau wusste, dass irgendetwas vorgefallen war, was mit Henning zu tun hatte, war es ihr nicht gelungen, die lähmende Trauer zu überwinden. An Schuld wollte sie gar nicht erst denken – niemand war schuld, alle waren schuld. Aber nichts von alledem brachte ihr Jonas wieder zurück.
»Wir können Folgendes machen«, sagte sie und nahm das Handy vom Tisch. »Ich schreibe einen Artikel über Hedda, ein paar Zeilen werde ich sicher hinbekommen, sowohl in der Papier- als auch in der Onlineausgabe. Ich könnte die Reisenden, die am betreffenden Tag in Gardermoen waren, auffordern, Kontakt zu mir aufzunehmen, falls sie etwas gesehen haben oder wissen sollten. Möglicherweise gehen so ein paar neue Informationen ein.«
Refsdal nickte energisch.
»Aber bevor ich das tue«, sagte Nora und sah ihn direkt an, »muss ich mir zu hundert Prozent sicher sein, dass Sie das wirklich wollen. Der Artikel wird eine Belastung für alle darstellen, die Sie kennen – auch für Ihren Sohn. Vermutlich werden auch andere Medien zu Ihnen Kontakt aufnehmen. Sind Sie sich darüber im Klaren?«
Refsdal sah sie unverwandt an und ballte die Fäuste, bis seine Knöchel weiß wurden.
»Ja, ich bin mir darüber im Klaren. Und ich bin bereit, mich all dem zu stellen, wenn es mir nur eine Antwort gibt, mit der ich dann versuchen kann weiterzuleben.«
»Gut«, sagte Nora und machte einen Schritt in Richtung Tür. »Haben Sie ein Auto?«
»Bitte?«
»Sind Sie mit dem Auto hergekommen?«, fragte sie über die Schulter.
»Ja, ich …«
»Gut«, sagte sie und legte die Hand auf die Klinke. »Fahren wir, ich muss nur erst meine Kamera holen.«
2
Der glänzende Škoda glitt lautlos über die Autobahn. Draußen vor den Fenstern zogen Felder vorbei, platt und gelbbraun. Die Bäume entlang der Straße über den Gjelleråsen in Richtung Nittedal waren trist dunkelgrün. Über ihnen hing eine eintönig graue Wolkendecke. Es sah aus, als könnte es jeden Augenblick anfangen zu regnen. Trotzdem wäre Nora jetzt lieber an der frischen Luft gewesen als in der Enge dieses Wagens. Der Duft von Rasierwasser und der Anblick eines liegen gebliebenen Kinderpullovers bedrückten sie.
An Hedda zu denken half ein wenig.
»Erzählen Sie mir von Heddas Familie«, forderte sie Refsdal auf, als links von ihnen ein großes Einkaufszentrum auftauchte, vor dem sich eingeschweißte Warenpaletten türmten.
Refsdal fuhr mit dem Daumen über ein Rädchen am Lenkrad und regulierte die Lautstärke des Radios ein wenig nach unten.
»Wie viel wissen Sie noch von früher?«, fragte er.
»Eigentlich nicht sehr viel. Hedda hat nicht oft über ihre Familie gesprochen. Ich weiß aber noch, dass sie verhältnismäßig reich waren. War es nicht so? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie sogar ein eigenes Wappen.«
Refsdal nickte und legte die Hand auf den Schaltknüppel, sodass der Ehering daraufklackte.
»Obwohl sie nicht adelig sind. Heddas Urgroßvater hat das Wappen kurz nach dem Krieg käuflich erworben.«
Er verdrehte die Augen.
»Ach, so was kann man kaufen?«, fragte Nora.
»Ja, das geht. Der alte Anwalt Hellberg hat großen Wert auf solche Dinge gelegt.«
Nora nickte nachdenklich.
»Sie sagten, Heddas Vater sei gestorben. Lebt die Mutter noch?«
»Oh ja«, sagte Refsdal, »Unni lebt noch, zweifellos.«
Der Wagen beschleunigte.
»Oscar und Unni haben nicht gerade die beste Ehe geführt«, fuhr er fort. »Sie hatten getrennte Schlafzimmer und sind nie zusammen in Urlaub gefahren. Sie ist am Ende nicht einmal mehr allzu häufig im Krankenhaus gewesen. Das wäre ihr alles einfach zu viel, hat sie gesagt. Als wäre sie diejenige, mit der man Mitleid haben musste.«
Sie überholten mit nur wenigen Zentimetern Abstand einen Sattelschlepper, und für einen Moment hatte Nora das Gefühl, er würde gleich auf sie kippen.
»Was macht sie?«
»Unni oder Hedda? Wen meinen Sie?«
»Beide eigentlich«, antwortete Nora und kratzte über eine unebene Stelle auf ihrem Fingernagel.
»Hedda versucht sich seit ein paar Jahren als Weinimporteurin«, sagte Refsdal, »allerdings eher im privaten Rahmen, im ganz kleinen Umfang. Und Unni hat eine Zeit lang im Familienbetrieb gearbeitet – sie hat sich dort um die Finanzen gekümmert. Inzwischen ist sie Vollzeitwitwe – mit allem, was dazugehört.«
Wieder verdrehte er die Augen.
»Und der Familienbetrieb ist …«
»Hellberg Immobilien – im Bezirk Vestfold eine echte Größe im Immobiliengeschäft. Sie sind Projektentwickler und Makler. William, Heddas ältester Bruder, ist Chef beider Firmenzweige.«
Das Auto glitt an einem protzigen Mercedes vorbei, der einen Anhänger mit einem eierschalenfarbenen Kabinencruiser hinter sich herzog. Geld auf Rädern, schoss es Nora durch den Kopf.
»Und Hedda hatte nie Interesse, in die Firma einzusteigen?«
»Möglicherweise hatte sie das, aber wie sie eben so ist – sie wollte selber Chefin sein, wenn Sie verstehen, was ich meine, wollte eigenständig Sachen entwickeln und auf die Beine stellen.«
Nora erinnerte sich noch gut daran, dass Hedda bereits während des Studiums den Empfehlungen ihrer Dozenten getrotzt und versucht hatte, ihren eigenen Kopf durchzusetzen.
»Wie lief der Weinimport?«
Refsdal zögerte mit der Antwort.
»Der Weinimport ist ein knallhartes Geschäft«, sagte er dann. »Nach einem Italienurlaub hatte sie kurzerhand beschlossen, es trotzdem zu versuchen. Wir hatten dort einen Wein getrunken, von dem sie völlig hingerissen gewesen war, den es bei uns aber nirgends zu kaufen gab. Sie hat es sich damals fast schon zur Lebensaufgabe gemacht, ihn im Vinmonopol ins Basissortiment einzuführen, was ihr irgendwann sogar gelungen ist. Aber ein paar schlechte Rezensionen in der Tagespresse führten dazu, dass ihr Wein ein halbes Jahr später wieder aus dem Sortiment genommen wurde. Man konnte ihn zwar immer noch bestellen, aber Hedda blieb trotzdem auf einem Haufen Flaschen sitzen, die sie mühsam anderweitig verkaufen musste. Sie stehen teilweise immer noch in einem Lager in Tønsberg.«
»Oh.«
»Sie hat versucht, sich bei diversen Messen in der Gegend einzukaufen, sie hat alle möglichen Hotels und Restaurantketten abgeklappert. Aber um dort einen Fuß in die Tür zu kriegen, muss man zahlen. Und das konnte Hedda sich nicht leisten.«
»Dann hat sie keine finanzielle Starthilfe von der Familie bekommen?«
Refsdal schüttelte den Kopf.
»Wie gesagt, sie wollte die Dinge aus eigener Kraft in die Tat umsetzen.«
Der breite gelbe Streifen am linken Autobahnrand zog Nora in seinen Bann. Nach ein paar hundert Metern musste sie sich zwingen, den Blick abzuwenden.
»Aber nach dem Tod des Vaters hat sie doch vermutlich ein paar Kronen geerbt?«
Refsdal sah sie von der Seite an.
»Ich frage nur, weil Geld oder eben kein Geld oft ein Motiv bei Menschen ist, die sich das Leben nehmen oder es zumindest versuchen.«
Refsdal richtete den Blick wieder nach vorne.
»Doch, ja«, sagte er. »Das hat sie wohl.«
»Aber Sie wissen es nicht?«
Er zögerte mit der Antwort.
»Hedda wollte sich nicht detailliert dazu äußern, und ich hielt es für unpassend, in so einer Situation über Geld zu sprechen. Aber nach dem Tod meines Schwiegervaters haben wir tatsächlich mal darüber gesprochen, das Haus zu verkaufen und wegzuziehen.«
»Sie wollte aber nicht sagen, wie viel sie geerbt hatte? Wie viel Ihnen zur Verfügung stand?«
Refsdal schüttelte den Kopf.
Nora nickte nachdenklich, wartete eine Weile, ehe sie die nächste Frage stellte.
»Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen beiden?«
»Zwischen Hedda und mir?«
Nora nickte aufmunternd. Erneut kam Refsdals Antwort zögerlich.
»Na ja, was soll ich … Sicher, wir hatten unsere Probleme. Wer hat das nicht. Aber wir haben nie in Betracht gezogen, uns zu trennen.«
Noras Gedanken verweilten einen Augenblick bei ihrer Beziehung mit Iver. Mit ihm zusammen zu sein hatte ihr nie das große Glücksgefühl beschert, sie war sich inzwischen aber auch nicht mehr ganz so sicher, was das Wort Glück überhaupt bedeutete. Natürlich hatte sie Gefühle für ihn – aber wie tief reichten sie? Wie wichtig waren sie ihr?
»Hedda hat noch einen zweiten Bruder, nicht wahr?«
»Ja, da ist noch Patrik«, sagt Refsdal. »Er arbeitet für eine Arzneimittelfirma in Oslo. Ich glaube, er ist häufiger auf Geschäftsreise als der Ministerpräsident.«
Nora lachte.
»Wie haben die Brüder den Tod des Vaters aufgenommen?«
Refsdal neigte den Kopf erst nach links, dann nach rechts.
»Mit Fassung, würde ich sagen. Oder – ich weiß es nicht genau, weil ich so damit beschäftigt war, mich um Hedda zu kümmern. Aber sie haben geholfen, den Sarg zu tragen, und wie alle anderen geweint.«
Er fuhr wieder auf die rechte Spur zurück. Nora sah hinaus über die Felder und Bäume, die Reihenhäuser in der Senke zwischen Olavsgaard und der Abfahrt nach Skedsmo. Dort draußen sah es überall gleich aus, als hätte ein Kind mit nur einer Sorte Legosteinen ein Dorf gebaut.
ENDE DER LESEPROBE