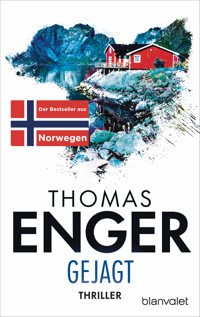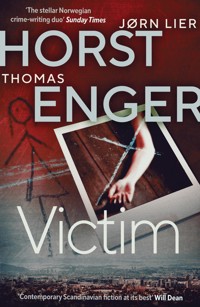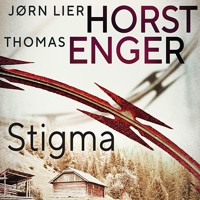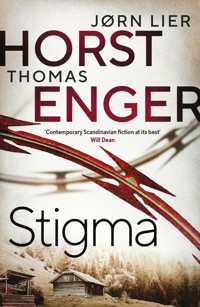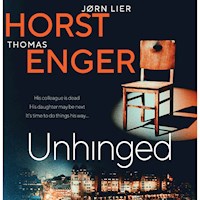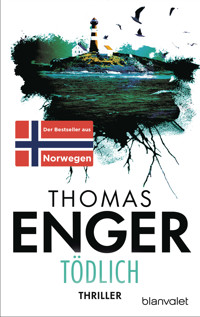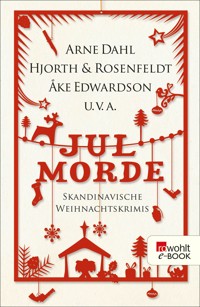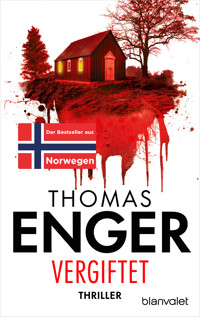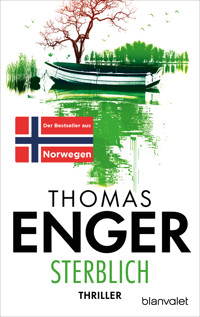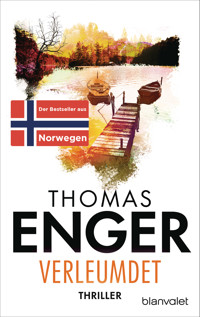6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Deine Freundin ist tot und du stehst unter Mordverdacht ...
Der 18-jährige Even wird über Nacht vom Schulschwarm zum Verdächtigen. Seine Freundin und ein Bandkollege werden nach dem Schulfest tot aufgefunden. Sie hat gerade mit ihm Schluss gemacht, er sich mit Even gestritten. Als ein belastendes Video auftaucht und Evens Alibi infrage stellt, hält jeder in seinem Heimatort ihn für den Täter. Um seine Welt vor dem endgültigen Einsturz zu bewahren, sucht Even nach dem wahren Täter. Doch dann geschieht ein weiterer Mord ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
DER AUTOR
Thomas Enger, Jahrgang 1973, studierte Publizistik, Sport und Geschichte und arbeitete in einer Online-Redaktion. Nebenbei war er an verschiedenen Musical-Produktionen beteiligt. Sein Thrillerdebüt »Sterblich« war hierzulande wie auch international ein sensationeller Erfolg, gefolgt von vier weiteren Fällen des Ermittlers Henning Juul. »Wer heute lügt, ist morgen tot« ist sein erster Jugendroman. Er lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern in Oslo.
Mehr über cbt/cbj auf Instagram unter @hey_reader
THOMAS ENGER
WER HEUTE LÜGT, IST MORGEN TOT
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Oktober 2019 © 2017 Thomas Enger Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Killerinstinkt« bei Kagge Forlag AS, Oslo Veröffentlichung durch Vermittlung von NORTHERN STORIES © 2019 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Übersetzung: Gabriele Haefs Umschlaggestaltung: Grafiker: Geviert, Grafik & Typografie, Andrea Hollerieth unter Verwendung eines Fotos von © Shutterstock (Malivan_luliia) MP · Herstellung: UK Satz und E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23337-2V002www.cbj-verlag.de
1
»Nervös?«
Die Gerichtsdienerin im Gerichtshaus von Nedre Romerike blickte mich mit einem vorsichtigen Lächeln an. Ich hörte auf, meine feuchten Finger ineinander zu verschränken.
»Ist das so deutlich zu sehen?«, fragte ich. Die Gerichtsdienerin lächelte ein bisschen breiter. Sie hatte seit mindestens einer Viertelstunde neben mir gesessen, aber erst jetzt sah ich, dass ihre Zähne gelb waren.
»Sagst du das erste Mal vor Gericht aus?«
»Ja.«
»Ein ganz besonderer Fall«, sagte sie.
»Ja«, erwiderte ich.
Ich hatte nicht viel über das erzählt, was geschehen war. Die Polizei hatte mich natürlich noch einmal vernommen, aber Bitten um Interviews mochte ich nicht nachgeben. Ich hatte keine Lust, im Fernsehen oder Radio aufzutreten oder etwas zu Leuten zu sagen, die ich gar nicht kannte.
Jetzt allerdings blieb mir keine Wahl mehr.
Ich hatte versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten, aber alles, was ich über Gerichtsverhandlungen wusste, stammte von Netflix, und ich hatte so das Gefühl, dass die Wirklichkeit doch ein bisschen anders aussah, jedenfalls in Norwegen. Die Unsicherheit war einer der Gründe, warum ich in den letzten Nächten nicht sehr viel geschlafen hatte, und die vielen Erinnerungen, die ich jetzt noch einmal würde durchleben müssen.
Die Tür vor mir öffnete sich. Ein Mann in Uniform bedeutete mir mit einem Kopfnicken, dass ich ihm folgen sollte. Ich holte tief Luft und stand auf. Sah die Gerichtsdienerin an.
»Und jetzt zu dir«, sagte sie und lächelte mich aufmunternd an. Ich zupfte meine Hosenaufschläge gerade, knöpfte mein Sakko zu und zog ein wenig an den etwas zu kurzen Manschetten meines Hemdes.
»Und jetzt zu mir«, sagte ich.
Ich fragte mich, ob ich es schaffen würde, alles zu erzählen, und wie ehrlich ich wohl sein könnte. Aber ich hoffte, dass dann alle zu Hause in Fredheim und auch im Rest des Landes besser verstehen würden, was an den kalten, nassen Oktobertagen im vergangenen Herbst bei uns im Dorf geschehen war.
Der Uniformierte führte mich durch eine breite Tür und in einen großen Saal. Und dann war es wirklich wie im Fernsehen; Gesichter, die sich zu mir umdrehten, eine plötzliche erwartungsvolle Stille, die bald einem Murmeln wich. Ich fand einen Punkt vor mir und fixierte ihn, war froh darüber, dass ich bis zum Zeugenstand einige Meter gehen musste. Das Geräusch meiner Schritte gab mir noch etwas, worauf ich mich konzentrieren konnte.
Ich hob den Blick und sah Mama, sah, wie schrecklich das alles für sie war, dass sie versuchte, sich von den bösen Wörtern, die sie heute früh auf dem Weg zum Gericht gehört hatte, nicht zermürben zu lassen.
Ich nahm im Zeugenstand Platz und drehte mich zum Saal um. Erst jetzt ging mir auf, wie viele Menschen gekommen waren, um mir zuzuhören. Der Saal war vielleicht halb so groß wie ein Handballplatz, aber er war gesteckt voll mit Leuten, alle Reihen waren besetzt. Einige standen sogar ganz hinten. Zuerst konnte ich niemanden erkennen, ich sah nur ihre Köpfe, aber das wurde besser, nachdem ich mich gesetzt hatte. Und Atem holte. Dann konnte ich die Presseleute ausmachen, auch den Kommissar, Yngve Mork, neben ihm Rektor Brakstad, Kaiss und Fredrik saßen ebenfalls da, zusammen mit anderen, die ich aus der Schule kannte. Nun drang eine Stimme durch das Gemurmel und Getuschel zu mir durch, und ich begriff, dass ich nun dem Gericht meinen Namen nennen sollte. Ich wandte mich dem Richter und den beiden Schöffen zu.
»Even Tollefsen«, sagte ich und räusperte mich ganz kurz – ich musste mich zum Mikrofon vorbeugen, damit mich alle hören könnten.
»Wie alt sind Sie, Even?«
»Achtzehn.«
Ich registrierte zwar die Richtung, aus der die Fragen kamen, aber nicht, wer sie stellte. Ich dachte nur daran, dass ich so gut antworten musste, wie ich nur konnte, auf eine Frage nach der anderen. Dann würde es bald vorüber sein.
Oder vielleicht doch nicht?
Ich hatte irgendwo gelesen, wenn man sich nur dafür entschied, weiterzuleben, würde das Leben auch wieder seinen Gang aufnehmen. Ich begriff nur nicht, wie ich es je schaffen sollte, zu dieser Entscheidung zu gelangen.
Ich wurde aufgefordert, dem Gericht zu erzählen, wo ich wohnte und was ich von Beruf sei. Ich sagte, ich wohnte im Granholdvei in Fredheim und ginge noch zur Schule.
»Gesamtschule Fredheim?«
»Richtig.«
»Und Sie leben bei Ihrer Mutter Susanne Tollefsen.«
»Ja. Mit Tobias, meinem jüngeren Bruder. Mein Vater, Jimmy, ist gestorben, als ich noch klein war.«
Ich wusste nicht viel über die Staatsanwältin, die diese Fragen stellte, außer dass sie mit Nachnamen Håkonsen hieß. Sie war klein und schlank, sah fast aus wie ein Mann in ihrem schwarzen eng sitzenden Anzug. Sie trank einen Schluck Wasser aus dem Glas, das vor ihr stand. Ich hätte das auch gern getan, aus meinem Mund kamen Schmatzgeräusche, wenn ich etwas sagte. Dann musste ich schwören, die Wahrheit zu sagen. Das tat ich und schluckte danach hart.
»Mari Lindgren«, sagte die Staatsanwältin. »Können Sie dem Gericht sagen, in welcher Beziehung Sie zu ihr gestanden haben?«
Ich holte Luft und versuchte, daran zu denken, wie mir zumute gewesen war, als ich an jenem Morgen aufwachte. Schon damals hatte ein Teil von mir gewusst, dass etwas Schreckliches passieren würde. Ich hatte es am ganzen Körper gespürt.
»Sie war meine Freundin«, sagte ich. »Wir waren seit einer Weile zusammen.«
»Aber am 17. Oktober vorigen Jahres waren Sie kein Paar mehr, oder?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Für die Gerichtsstenografen die Frage bitte hörbar beantworten«, sagte die Staatsanwältin.
»Äh, nein«, sagte ich.
Die Wahrheit war, dass Mari zwei Tage zuvor mit mir Schluss gemacht hatte. Sie hatte mir mitten in der zweiten Halbzeit des Spiels Chelsea–Leicester eine SMS geschickt:
Even, du bist wunderbar, aber wir können nicht mehr zusammen sein. Sorry.
Das war alles.
Ich hatte natürlich eine Erklärung verlangt, aber sie hatte mir nie geantwortet – weder als ich anrief noch als ich eine weitere SMS schickte.
Jedes Mal, wenn ich es bei ihr zu Hause versuchte, war sie immer gerade nicht da.
An jenem Montag, dem 17. Oktober, konnte ich sie auch in der Schule nicht ausfindig machen. Ich versuchte, mit ihrer Mutter zu sprechen, aber die sagte nur, sie wisse nicht so recht, wo Mari stecke oder was passiert sei.
Erst später ging mir auf, dass Cecilie Lindgren mich belogen hatte. Und dass mehrere von Maris Freundinnen mich anlogen, weil wirklich keine von ihnen mir helfen wollte, sie zu finden. Dass Mari sich ganz einfach vor mir versteckte.
»An dem Abend gab es eine Schulaufführung?«
Die Staatsanwältin ließ es wie eine Frage klingen. Ich wollte schon nicken, riss mich aber zusammen und sagte »Ja«.
»Aber Sie waren nicht dabei?«
Ich beugte mich wieder ein wenig zu dem Mikrofon vor.
»Nein.«
Ich hätte an dem Abend in der Schulband spielen sollen, aber ich brachte es einfach nicht über mich, auf der Bühne zu sitzen und in den Saal zu blicken, um dann vielleicht Mari zu entdecken. Ich wusste, dass sie für die Schülerzeitung berichten würde, wusste, dass ich es nicht schaffen würde, mich auf die Musik zu konzentrieren, wenn ich sie erst gesehen hatte. Ich wollte auch den anderen den Abend nicht verderben, deshalb sprang Imo, mein Onkel, für mich ein. Er war der musikalisch Verantwortliche für die Aufführung, das war also kein Problem. Imo entschuldigte mich damit, dass ich krank sei, was von der Wahrheit auch nicht so weit entfernt war. Ich fühlte mich wie gerädert. Lag nur in meinem Zimmer und starrte die Wand an, während ich auf einen Anruf von Mari wartete.
Aber sie rief nicht an.
Das alles versuchte ich dem Gericht zu erklären.
»Sie haben an dem Abend das Haus also nicht verlassen?«, fragte Staatsanwältin Håkonsen.
»Nein, ich war zu Hause in meinem Zimmer.«
Die Richterin schaute kurz in ihre Unterlagen, ehe sie den Blick wieder zu mir hob, ihre Brille gerade rückte und sagte: »Erzählen Sie dem Gericht, was am nächsten Tag passiert ist, so wie Sie es erlebt haben.«
Und das tat ich.
Ich hatte es nicht ausgehalten, im Bett zu liegen zu bleiben und mich von einer Seite auf die andere zu wälzen, deshalb war ich aufgestanden, obwohl es noch so früh war. Ich hatte eine Unruhe im Leib wie noch nie. Es war, als ob irgendetwas in mir versuchte, mir eine Sache zu erzählen, die ich gar nicht wissen wollte.
Dieses scheußliche Gefühl ließ mich auch nicht los, als ich geduscht und gefrühstückt hatte, aber ich versuchte mir einzureden, es liege sicher an zu wenig Schlaf oder ich sei trotzdem unterzuckert.
Ich ging hinaus auf den Flur und zog meine Jacke an. Betrachtete mich einige Sekunden im Spiegel und fragte mich dabei, ob ich Mari etwas getan hatte. Ob ich etwas Falsches gesagt hatte. Ob sie mich nicht mehr leiden konnte. Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, ich hatte genug Gel darin, nun lagen sie ungefähr so, wie ich das wollte – glatt nach hinten und in den Nacken gekämmt. Ich wusste, dass ich ziemlich gut aussah. Ich war eins fünfundachtzig, hatte fast kein Gramm Fett am Leib, war gar nicht blöd und absolut überdurchschnittlich umgänglich. Glaube ich. Ich sagte mir, dass es mir nicht schwerfallen würde, eine neue Freundin zu finden.
Aber ich wollte keine neue Freundin.
Ich wollte Mari.
»Gehst du zur Schule?«
Ich drehte mich um. Tobias kam die Treppe aus dem ersten Stock heruntergeschlurft. Als ich ihn dort oben an der Treppe sah, dachte ich, wie sehr er sich im vergangenen halben Jahr verändert hatte. Er hatte sich ebenfalls die Haare wachsen lassen, und ab und zu – wenn er kein Basecap trug – band er sie oben auf dem Kopf mit einem Gummi zusammen. Er hatte ständig eine Trainingshose an, die ihm dann fast von seinem knochigen Leib rutschte, und immer verbarg er den Kopf unter der Kapuze seines Shirts. Selbst wenn er die Schirmmütze trug.
»Du nicht?«, fragte ich.
Langsam kam er herunter und stand dann vor mir. Er hatte die Hände in den Hosentaschen.
»Do-hoch.«
Er sah mich an, während ich eine Regenhose anzog. Draußen schüttete es – ein harter, prasselnder Regenguss. Ich hob wieder den Blick zur Wanduhr.
»Dann musst du dich beeilen«, sagte ich. »In fünfunddreißig Minuten klingelt es ja schon.«
Tobias gab keine Antwort. Schlurfte nur langsam in die Küche.
»Wir haben übrigens keine Milch mehr«, rief ich hinter ihm her. »Und Cornflakes auch nicht, glaub ich.«
Tobias zog nur wortlos die Tür hinter sich zu. Ich fragte mich, ob er wirklich zur Schule wollte, ob ich vielleicht ein bisschen warten und dafür sorgen sollte, dass er sich auf den Weg machte. Mama war bei Knut, deshalb waren wir uns selbst überlassen. Wie so oft. Aber dann dachte ich wieder an Mari, und deshalb zog ich die Regenjacke über und lief hinaus in den strömenden Regen.
Die Gesamtschule Fredheim liegt drei Kilometer von unserem Haus entfernt, und ich fahre immer mit dem Rad, egal, wie das Wetter ist.
Ich hatte mir die Kapuze eng um den Kopf gezogen, und das sperrte die Geräusche teilweise aus. Licht und Farben aber hatten es leicht, an dem dunklen Oktobermorgen Aufmerksamkeit zu erregen.
Deshalb hielt ich schon an, als ich noch einige Hundert Meter von der Schule entfernt war. Aus der Ferne sah es ein bisschen aus, als ob jemand die Wolken über dem großen, flachen Gebäude buntgemalt hätte. Das blinkende blaue Licht drängte sich durch die Bäume zwischen Schule und Parkplatz, und irgendwo in der Ferne hörte ich ein gehetztes Heulen, das immer näher kam.
Ich fuhr den Hang zur Schule hoch und stieg vom Rad, als ich sah, dass es unmöglich wäre, an den vielen Menschen vorbeizufahren. Überall um mich herum standen Schüler, Lehrer, uniformierte Polizisten, Männer und Frauen in Sanitäterkleidung. Die Schule war mit rotweißem Band abgesperrt.
Viele von den Schülerinnen und Schülern umarmten einander. Einige weinten. Ich hatte das Gefühl, dass sich etwas Schweres und Hartes auf meine Brust legte.
Ich sah Tic-Tac, den Hausmeister der Schule, der in der offenen Hecktür eines Kombiwagens saß und mit einem Polizisten redete. Beide machten düstere Gesichter. Ich hielt Ausschau nach Oskar, Kaiss oder Fredrik. Konnte sie nicht sehen.
Ich entdeckte Rektor Brakstad, der alle anderen um einige Zentimeter überragte, und lief zu ihm.
»Bitte«, sagte ich. »Was ist denn los?«
Der harte Regenguss hatte dem Rektor die Haare an die Kopfhaut geklatscht. Seine großen, dicken Brillengläser waren von innen beschlagen, aber ich konnte seine Augen trotzdem sehen. Wie dunkel sie waren.
»Hallo, Even«, sagte er und schaute sich um. Als er nicht weitersprach, wiederholte ich meine Frage und fügte hinzu: »Ist ein Unglück passiert, oder was?«
»Ich weiß nicht so genau«, sagte Brakstad – seine Stimme zitterte ein bisschen. »Die Polizei hat mich aus der Schule gejagt, als ich gekommen bin.«
»Aber …«, begann ich, verstummte dann aber. Ich lauschte einfach dem Regen, der auf meine Jacke und meine Kapuze prasselte. Ich streifte die Kapuze ab, um besser hören zu können, aber ich verstand nur Bruchstücke von dem, was um mich herum gesagt wurde.
»… Tic-Tac die Polizei angerufen …«
»… überall Blut …«
Ich drehte mich um und sah einen Polizisten, der das Absperrband anhob. Er ließ zwei Männer und eine Frau darunter durchgehen, die von Kopf bis Fuß in weiße Schutzkleidung aus Kunststoff gehüllt waren. Es sah aus wie eine Filmszene. Einer der Männer trug einen kleinen schwarzen Koffer.
Eine Stimme drang zu mir durch.
»… lag im Musiksaal …«
Ich drehte mich wieder zu Brakstad um, aber der starrte nur zurück. Ich konnte seinen Blick nicht so richtig deuten, die tief liegenden, traurigen Augen bohrten sich in meine.
»Wer?«, fragte ich und versuchte zu schlucken. »Wer ist umgebracht worden?«
Gleich darauf fiel mein Blick auf Ida Hammer. Maris beste Freundin. Die Blicke aller fielen auf sie, weil sie schrie. Sie ließ sich zu Boden fallen und schrie, und für einen Moment hörte ich nur noch das. Ida krümmte sich auf dem regennassen Asphalt und heulte. Einige ihrer Freundinnen standen neben ihr und versuchten, sie auf die Füße zu ziehen. Ich merkte nicht, dass ich mein Fahrrad losließ, ich hörte nur den Knall, als es auf den Boden schlug.
Ich wandte mich noch einmal Brakstad zu und erkannte in seinen Augen das, was ich nicht sofort verstanden hatte, nun aber mit voller Wucht über mich hereinbrach.
Mari – meine Mari –war tot.
2
»Sie wussten, dass es Mari war?«, fragte die Staatsanwältin. »Wie konnten Sie das wissen?«
»Das konnte ich eigentlich nicht«, antwortete ich. »Aber ich habe es gespürt.«
Håkonsen schien zu erwarten, dass ich meine Antwort präzisierte, sie schaute auch zum Richter hoch, aber als der sich nicht räusperte und auch nicht auf andere Weise zu verstehen gab, dass ich mehr sagen sollte, fragte Håkonsen: »Was haben Sie dann gemacht?«
Ich hatte mich vorgebeugt, um mich zu erbrechen, aber aus meinem Mund war nichts herausgekommen.
Verzweifelt versuchte ich, auf eine Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte: »Du irrst dich, Mari ist gar nicht tot, das ist jemand anderes.« Und für einen Moment trug dieser Gedanke den Sieg über die anderen davon – ich konnte mich aufrichten und denken: Ganz ruhig, sie taucht gleich auf, scheißegal, ob sie nicht erklären will, warum sie mit dir Schluss gemacht hat – das ist nicht so wichtig. Bald wird sie durch den Regen den steilen Hang hochkommen und dann wird sie zu ihren Freundinnen gehen und sie alle werden um irgendeine andere weinen.
Aber ich konnte Ida und ihre an den graublauen, nassen Himmel gerichteten Schreie nicht verdrängen. Und auch nicht ihre Schläge auf den Asphalt.
Oskar kam zur mir herüber, ich registrierte ihn jetzt zum ersten Mal.
»He«, sagte er und zog seine weißen Ohrstöpsel heraus. »Was für ein Dreck.«
Rektor Brakstad trat ein wenig zurück und stellte sich neben einen Lehrer. Ich merkte, dass die beiden mich ansahen.
»Hast du etwas gehört?«, fragte ich.
Oskar seufzte und sagte: »Bisher nur Gerüchte.«
»Ist es … ist es Mari …?«
Ich drehte mich halbwegs um und zeigte auf den Eingang. Oskar ließ meinen Blick nicht los, schüttelte aber den Kopf und sagte, er wisse nichts. Noch immer gab es etwas in mir, das mich davon zu überzeugen versuchte, dass ich träumte, dass nichts hier wirklich sei. Aber ich musste eine Antwort haben. Jemand musste es mir einfach sagen.
Ich entdeckte Tic-Tac, der noch immer neben einem Einsatzwagen stand, nun aber allein. Er rauchte hektisch. Ich ließ mein Fahrrad liegen und lief zu ihm hinüber.
»Tic-Tac«, sagte ich. »Was zum Teufel ist da drinnen passiert?«
Tic-Tac war eigentlich ein großer, bulliger Mann. Doch jetzt sah er aus, als wäre er ein Luftballon, in den jemand reingepikst hatte. Er hing vornüber. Hatte Mühe, sich aufrecht zu halten.
Der Hausmeister hob den Kopf, sah mich an und erklärte: »Ich darf nichts sagen«, und dabei wies er mit dem Daumen auf die Polizisten.
»Aber verdammt noch mal, Tic-Tac.«
Der Hausmeister zog wieder an seiner Zigarette und ließ sie auf den Boden fallen, trampelte wütend darauf herum, obwohl sie in einer Pfütze gelandet war. Er schaute zu mir hoch. Und ich begriff, was immer er dort drinnen gesehen hatte, hatte ihn fertiggemacht. Tic-Tac war erschüttert. Seine Hände zitterten. Dass er ein wenig bebte, war an sich nicht ungewöhnlich – deshalb wurde er schließlich Tic-Tac genannt. Doch nun zuckten seine Gesichtsmuskeln ab und zu, wie im Krampf.
Ich versuchte, mit einer etwas wärmeren Stimme zu sprechen.
»Alle wollen das wissen, Tic-Tac. Wer liegt dort drinnen?«
Er tastete unbeholfen nach der Zigarettenpackung in seiner Innentasche. Fing an, sich eine zu drehen, aber seine Finger wollten nicht aufhören zu zittern.
»Ich hab nur Johannes gesehen«, sagte er leise.
»Johannes?«
Tic-Tac machte »Pst« und sah mich strafend an. Ich begriff gar nichts mehr. War Mari also doch nicht tot?
Johannes Eklund war der Sänger der Band. Der unbestrittene Star der Schulaufführung. Ich trat noch einen Schritt näher an Tic-Tac heran und wartete darauf, dass er erzählte.
»Er lag auf der Treppe zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock.«
Tic-Tac versuchte, immer neue Zuckungen in seinem Gesicht unter Kontrolle zu bringen.
»Da war … verdammt viel Blut. Wo sie dieses Mädchen gefunden haben, weiß ich nicht.«
Dieses Mädchen.
Ich glotzte.
In der Schule lagen zwei Tote.
Johannes.
Und ein Mädchen.
Ich drehte mich um und schaute in die Runde. Ich hatte das Gefühl, dass alle mich anstarrten.
Ich hielt es dort nicht mehr aus, deshalb ging ich einfach los, schnell, und bald rannte ich hinab zum Parkplatz und hinaus auf die Straße; ich nahm die Beine in die Hand – ich konnte nur den Regen und meinen gehetzten Atem hören, das Geräusch der Tropfen, die mein Gesicht peitschten, schließlich hatte ich ein solches Tempo erreicht, dass ich plötzlich vornüberkippte; ich konnte mich gerade noch mit den Händen abstützen. Ich rutschte über den Asphalt. Schrammte mir die Haut auf. Blieb liegen und rang um Atem, und dann fing auch ich an zu schreien.
Ich schrie in den Asphalt hinein, es war mir egal, dass sich Steinchen in meine Lippen bohrten und dass meine Hände bluteten. Ich lag einfach nur da und weinte.
Dann hielt neben mir ein Wagen. Ich drehte mich ein wenig um und sah das Gesicht einer Frau, die den Kopf aus dem Auto streckte und fragte, ob ich Hilfe brauchte. Ich konnte mich mit Mühe auf die Ellbogen stützen und den Kopf schütteln.
»Bist du sicher?«, fragte die Frau.
Ich musterte meine blutigen, aufgescheuerten Hände. Konnte nur kurz nicken, während ich an Mari dachte, mich fragte, ob auch sie geblutet hatte. Zum Glück fuhr die Frau dann weiter und ich setzte mich auf. Hob mein Gesicht in den Regen und spürte, wie das Wasser in meine Augen platschte.
Als ich endlich aufstand, schien an meinem Körper ein schweres Bleigewicht zu hängen. Ich musste die Hände zu Hilfe nehmen, um mich aufzurichten. Dann machte ich mich auf den Heimweg. Drei Kilometer sind lang, wenn nichts mehr geht, wenn du nicht einmal deine Beine unter dir spürst oder weißt, was du tust.
Ich lief einfach nur weiter.
Als ich zu Hause die Tür aufschloss, streifte ich die Regensachen ab, stolperte in mein Zimmer und ließ mich aufs Bett fallen. Dort blieb ich ganz still liegen.
Bis es an der Tür klopfte.
3
Das Klopfen verriet mir, dass es Imo war. Mein Onkel klopfte immer dreimal, mit gleichkurzen Zwischenräumen, und das letzte Klopfen war immer ein wenig härter als die beiden ersten. Er öffnete die Tür, ehe ich »herein« rufen konnte. Ich brachte es nicht über mich, mich umzudrehen, starrte nur die Wand an, die sich zwei Zentimeter vor meiner Nase befand.
»He, Champ«, sagte Imo seufzend.
Ich holte Luft und ließ sie langsam durch meine Nasenlöcher entweichen. Der Bruder meines Vaters hieß Ivar Morten, aber alle nannten ihn schon Imo, so lange ich mich zurückerinnern konnte. Er kam langsam herein, zog die Tür aber nicht hinter sich zu. Blieb nur mitten im Zimmer stehen.
»Ich bin sofort zur Schule gefahren, als ich davon gehört hatte«, sagte er. »Aber ich habe dich nicht gesehen, und da bin ich davon ausgegangen, dass du hier bist.«
Ich drehte mich nun doch um und sah ihn an, versuchte, nicht wieder loszuweinen. Wie immer trug er nur eine kurze Hose, dunkelgraue Wollsocken und eine offene marineblaue Regenjacke. Unter der Jacke spannte sich ein ungebügeltes weißes T-Shirt über seinem Bauch. Imo war einer von denen, die behaupteten, niemals zu frieren. Solange das Thermometer über null blieb, weigerte er sich, etwas anderes anzuziehen als Shorts.
Imo kam einige Schritte näher und setzte sich auf das Bett. Legte mir eine Hand auf die Schulter und drückte leicht zu. Einige Tropfen fielen von seinem üppigen dunkelbraunen Schopf und landeten auf meiner Bettdecke.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
Ich gab keine Antwort, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte.
»Kann ich dir irgendwas holen?«, fragte er. »Cola oder … irgendwas?«
Ich schüttelte den Kopf.
Imo zog die Hand zurück, stand auf und öffnete das Kellerfenster. Die kühle Luft füllte den Raum.
»Ist dein Bruder zu Hause?«, fragte Imo.
»Weiß nicht«, antwortete ich. »Sicher. Vielleicht. Ich weiß es nicht.«
Mein Onkel zog das Fenster wieder zu, setzte sich in den Sessel in der Ecke und griff zu der danebenstehenden Gitarre. Sein Daumen berührte die E-Saite, und die ließ einen tiefen Ton durch das Zimmer schweben. Dann liefen seine Finger lautlos über die Saiten, ohne dass er versucht hätte, das Griffbrett anzusehen. Obwohl ich wusste, dass er improvisierte, klang es doch wie eine komplette Melodie.
»Ist das … weißt du, ob wirklich Mari tot ist?«
Imo dämpfte die Lautstärke, indem er die Handfläche über die Saiten legte.
»Das habe ich in der Schule gehört«, sagte er. »Ich habe mit einer Polizistin gesprochen, die auf dem Schulhof stand. Sie wollte es nicht zu hundert Prozent bestätigen, aber … alles weist darauf hin, dass es Mari ist.«
»Haben sie etwas darüber gesagt, wie sie getötet worden ist?«
Imo stellte die Gitarre weg und stand auf.
»Nein«, sagte er. »Darüber weiß ich nichts. Aber es ist offenbar gestern Abend nach der Aufführung passiert. Apropos … die Polizei will mit dir sprechen. Ich habe mich mit Kommissar Mork verabredet; der kann jetzt jeden Moment hier sein. Du kennst doch Yngve Mork, oder nicht?«
Daran, dass die Polizei sicher mit allen Kräften versuchte, herauszufinden, wer Mari und Johannes umgebracht hatte, hatte ich noch gar nicht gedacht.
»Sie haben zuerst deine Mutter angerufen, da sie dich ohne ihre Einwilligung nicht vernehmen dürfen. Sie wollte wissen, ob ich mit dir reden könnte, eventuell bei der Vernehmung dabei sein, wenn du das möchtest.«
Ich setzte mich auf.
»Soll ich das also?«
Ich dachte einige Sekunden darüber nach, dann schüttelte ich den Kopf.
»Alle werden glauben, dass ich es war«, sagte ich.
»Warum sollten sie?«
»Deshalb.«
Ich griff nach meinem Telefon, das auf dem Bett gelegen hatte, und zeigte Imo, was ich Mari am Vorabend geschrieben hatte.
Früher oder später finde ich dich, Mari. Und dann wirst du meine Fragen beantworten, ob du nun willst oder nicht.
»Bestimmt hat die ganze Schule mitbekommen, dass ich gestern versucht habe, sie zu finden. Dass ich überall nach ihr gesucht habe.«
»Sie war also nicht in der Schule?«
Ich schüttelte den Kopf.
Mir ging auf, dass die Polizei diese SMS vermutlich schon kannte. Dass sie wussten, dass Mari mit mir Schluss gemacht hatte. Ich stand wahrscheinlich ganz oben auf ihrer Liste der Verdächtigen. Deshalb wollten sie mit mir sprechen.
Das war auch nicht schwer zu verstehen. Ich hätte für beide Morde ein Motiv haben können. Johannes hatte einen wahnsinnigen Erfolg bei Mädchen. Mari konnte sich in ihn verliebt und deshalb mit mir Schluss gemacht haben. Ich wäre nicht der erste eifersüchtige Ex, der zum Mörder wurde.
Ich konnte mein Herz gegen meinen Brustkasten hämmern hören. »Du warst doch gestern den ganzen Abend hier«, widersprach mein Onkel. »Stimmt das nicht?«
Und ehe ich antworten konnte: »Es liegt doch auf der Hand, dass du es nicht gewesen sein kannst.«
Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, schob meine Füße über den Fußboden.
»Du brauchst einfach nur die Wahrheit zu sagen«, sagte Imo. »So wie es war, dann geht sicher alles gut. Komm jetzt, steh auf. Die Polizei kann jeden Augenblick hier sein.«
4
»Und dann kam die Polizei zu Ihnen. In Ihr Haus im Granholtvei.«
Staatsanwältin Håkonsen schaute zu mir hoch.
»Ja.«
»Wie lange wohnen Sie schon dort?«
Ich war nicht sicher, ob ich die Frage verstanden hatte. Oder – verstanden hatte ich sie schon, ich begriff nur nicht, warum das wichtig sein sollte. Ich beschloss, trotzdem zu antworten. Eine Frage nach der anderen, wie gesagt.
»Zu diesem Zeitpunkt war es etwas über ein Jahr.«
Håkonsen nickte, als ob gerade das eine Auskunft sei, über die sie erst einmal genauer nachdenken müsste.
»Sie hatten auch früher schon einmal in Fredheim gewohnt, stimmt das nicht?«
»Doch. Als ich klein war. Gleich nach dem Tod meines Vaters sind wir dann nach Solstad gezogen.«
»Wann war das?«
»Da war ich wohl etwa sieben.«
Håkonsen dachte noch eine Weile nach.
»Wir werden später noch darüber reden, warum Sie zurückgezogen sind, Even, aber jedenfalls kam dann Kommissar Yngve Mork am Dienstag, dem 18. Oktober, am Vormittag zu Ihnen nach Hause. Am Tag nach der Schulaufführung. War Ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt von der Arbeit gekommen?«
»Nein.«
Ich wusste nicht viel über Yngve Mork, als er bei uns zu Hause anklopfte, aber ich hatte schon gehört, dass er nicht lange zuvor seine Frau verloren und gerade erst wieder angefangen hatte zu arbeiten. Ich ging zwar davon aus, dass ihm die Trauer noch arg zu schaffen machte, aber an jenem Morgen war ihm das nicht anzusehen.
Er kam allein, dieser hochgewachsene, kräftige Mann. In Uniform sah er ziemlich beängstigend aus. Er gab mir die Hand. Seine war kalt und nass, der Händedruck hart und fest. Seine Finger pressten sich auf meine frischen Schrammen. Ich hatte sie nicht gereinigt, nachdem ich mich vom Asphalt aufgerappelt hatte. Hatte mich nicht einmal gewaschen.
Wir setzten uns in die Küche. Mork starrte mich lange an, dann wollte er wissen, wo ich am Vorabend gewesen sei und ob jemand bestätigen könne, dass ich zu Hause geblieben war.
»Tobias vielleicht«, sagte ich und räusperte mich. »Mein Bruder. Er ist eigentlich immer hier, aber … ich weiß nicht, ob er wusste, dass ich auch hier war. Sein Zimmer liegt im ersten Stock. Meins im Keller.«
»War deine Mutter nicht zu Hause?«
»Nein, ich glaube, sie war bei Knut. Ihrem Typen. Ich habe heute noch nicht mit ihr gesprochen.«
»Nicht?«
Mork schüttelte seine Armbanduhr unter dem Hemdsärmel hervor.
»Nein, also … nein.«
Einem Polizisten meine Beziehung zu meiner Mutter zu erklären, war nicht leicht. Seit ich gelernt hatte, Rührei zu machen, und vor allem, seit wir wieder nach Fredheim gezogen waren, war ich mehr oder weniger allein zurechtgekommen. Also sagte ich einfach nur Nein. Sollte Mork doch seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Doch es gefiel mir nicht, wie er mich anstarrte. Als ob er mir kein Wort glaubte.
»Aber bestimmt gibt es zweihundert Zeugen dafür, dass ich gestern Abend nicht in der Schule war«, fügte ich eilig hinzu.
Mork gab keine Antwort, sondern fragte, warum Mari mit mir Schluss gemacht hatte. Ich erklärte, wie wenig ich wusste, zeigte ihm sogar die SMS, die Mari mir geschickt hatte. Wie weit das meine Aussage stärkte oder nicht, ließ Mork sich nicht ansehen, er sah mich weiterhin einfach nur an, schien mich zu bewerten.
»Wie war dein Verhältnis zu Johannes Eklund?«, fragte er dann.
»Das war schon in Ordnung«, sagte ich und schluckte. »Wir sind gut miteinander ausgekommen.«
»Weißt du, ob er eine Beziehung zu Mari hatte?«
Dieser Verdacht war mir an dem Tag auch schon gekommen.
»Das … glaube ich nicht«, sagte ich. Mari hatte mir nie den Eindruck vermittelt, dass sie andere außer mir wahrnahm. Ich glaubte auch, dass Johannes ein bisschen mit Elise zusammen war, aber Mork machte sich nicht einmal die Mühe, ihren Namen zu notieren. Ich fragte mich, ob er einer von denen war, die sich alles merken können.
Wir sprachen ein bisschen darüber, warum ich an dem Abend nicht mit der Band gespielt hatte. Ich erklärte das, so gut ich konnte.
»Hast du dich verletzt?«, fragte Mork plötzlich. Ich sah die Schrammen an meinen Händen an und mir wurde glühend heiß.
»Ja, ich …«
Zu sagen, dass ich auf die Fresse gefallen war, weil ich zu schnell für meine Beine rannte, kam mir komisch vor, aber es war die Wahrheit, und Imo hatte gesagt, an die sollte ich mich halten. Deshalb erzählte ich, was passiert war, selbst wenn es als Erklärung seltsam klang. Wie wenn Erwachsene sich geprügelt haben und behaupten, ihnen sei leider das Rasiermesser ausgerutscht.
Mork ließ sich ein wenig zurücksinken, während er mich weiterhin musterte. Er hatte Schweißringe unter den Armen. Ich glaubte, dass auch ich welche hatte, und hoffte, dass sie nicht zu sehen wären.
»Kannst du mir irgendetwas erzählen, das uns vielleicht weiterhilft?«, fragte Mork dann. »Etwas, das vielleicht zu der Klärung beiträgt, warum Mari und Johannes gestern Abend ermordet worden sind?«
»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas sagen«, erwiderte ich. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, was passiert ist.«
»Du weißt nicht, ob sie irgendwelche Probleme hatte?«
»Mari?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Mari war das liebste Mädchen auf der Welt.«
Ich konnte seinen Blick nicht erwidern, deshalb starrte ich die Tischplatte an.
»Du weißt nicht, ob sie sich an den vergangenen Tagen mit irgendwem gestritten hatte?«
Ich hätte fast gefragt: »Außer mit mir?«, aber das konnte ich mir zum Glück verkneifen. Ich zuckte nur mit den Schultern.
Wir sahen einander einen Moment lang an.
»Wie ist sie gestorben?«, fragte ich.
»Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen«, sagte Mork. »Sie muss zudem obduziert werden, und erst danach werden wir eine eindeutige Antwort haben.«
»Obduziert«, sagte ich. »Dann wird sie also … aufgeschnitten?«
»Ja.«
Ich sah Mari vor mir, nackt, kalt, unter einem sterilen weißen Laken. Mit bleicher Haut, blauen Lippen. Eine Person in weißem Schutzanzug stand vor ihr, das Skalpell erhoben. Mir stülpte sich der Magen um.
»Sie haben also keine Verdächtigen«, fragte ich.
Mork sah mich lange an, ehe er sagte: »Vorläufig nicht.«
Ich glaubte ihm nicht.
»Aber hat denn niemand etwas gesehen?«, fragte ich und hörte die Verzweiflung in meiner Stimme. »Ich meine – da müssen gestern Abend doch mindestens zweihundert Personen gewesen sein?«
Mork sah mich wieder lange an. Er gab keine Antwort.
5
»Auf die Aufführung kommen wir noch zu sprechen«, sagte Staatsanwältin Håkonsen. »Nicht zuletzt darüber, wer wann was gesehen hat, aber Sie hatten also das Gefühl, dass Ihre Lage gar nicht so gut war. Haben Sie deshalb diese Eintragung auf Facebook vorgenommen, sobald Herr Mork gegangen war?«
Die Staatsanwältin hob das Kinn und suchte meinen Blick. Ich nickte, ehe ich Ja sagte, und dachte daran, wie seltsam und leer ich mich nach der Vernehmung gefühlt hatte.
Ich war wieder in den Keller gegangen und hatte mich auf mein Bett gelegt, unsicher, was ich jetzt tun sollte. Es kam mir so unwirklich vor, dass Mari tot war. Ich fragte mich, ob ich deshalb nicht die ganze Zeit verzweifelt schluchzte.
Ich blieb liegen und spielte an meinem Telefon herum. Meine Kumpels hatten mir Mitteilungen geschickt, sie wollten wissen, wie es mir ging und ob ich Besuch wollte. Ich gab keine Antwort, sondern ging auf Facebook und stellte fest, dass irgendeine Freundin eine Erinnerungsseite für Mari und Johannes eingerichtet hatte und dass bereits eine Menge Bilder und Erinnerungen gepostet worden waren. Zum Glück hatte niemand etwas über mich geschrieben. Noch nicht jedenfalls.
Ich scrollte mich durch die Bilder. Sah Mari, die sich vor Lachen krümmte. Die nachdenklich in die Kamera blickte. Sich irgendetwas am Horizont ansah. Das typische Klassenfoto war auch gepostet worden. Mari als kleines Mädchen. Mari, die Ida Hammer umarmte. Alle hatten geschrieben, wie sehr sie sie gemocht hatten, wie sehr sie ihnen fehlte. Einige versprachen sogar, Mari und Johannes zu rächen. Diese Kommentare hatten haufenweise Likes bekommen.
Die Bilder von Johannes waren ziemlich ähnlich: Auf der Bühne, mit dem Mikro vor dem Gesicht, mit Bühnennebel im Hintergrund, die rechte Hand zum Rock-on-Zeichen erhoben. Viele Hunderte hatten auch diese Fotos gelikt.
Ich hatte keine Lust, irgendetwas zu liken. Ich hatte auch keine Lust, meine Gedanken oder Erinnerungen mit irgendwem zu teilen. Mich beschäftigte Yngve Morks Blick und die Vorstellung, dass mich schon ganz Fredheim in Verdacht hatte oder bald haben würde – wenn die Polizei die Sache nicht schnell aufklären konnte.
Deshalb schrieb ich:
Viele von euch wissen vermutlich, dass Mari und ich bis vor wenigen Tagen zusammen waren. Viele von euch glauben sicher auch, dass ich sauer und traurig war, weil sie Schluss mit mir gemacht hatte. Ich will ganz ehrlich zugeben, dass ich es war. Aber ich hätte ihr niemals, NIEMALS, etwas antun können. Ich habe Mari sehr lieb gehabt. Und Johannes war ein Mensch, den ich mochte und in vielerlei Hinsicht bewunderte. Die Welt ist ohne die beiden ärmer, und ich werde sie nie vergessen.
Das war ein bisschen pompös, aber das war mir egal. Ich wusste, dass viele lesen würden, was ich geschrieben hatte, und ich blieb noch eine Weile auf der Seite und sah, dass immer mehr Likes kamen. Das half ein bisschen.
»Aber nachdem Sie sich auf Facebook verteidigt haben, waren Sie dann auch noch bereit, sich von Ole Hoff von der Fredheimpost interviewen zu lassen.«
Die Stimme von Staatsanwältin Håkonsen ließ mich zusammenzucken. Die Art, wie sie das sagte, ließ mein Verhalten ziemlich seltsam klingen.
»Das stimmt«, sagte ich und räusperte mich. »Ich hatte das Bedürfnis, über Mari zu sprechen, glaube ich. Um ein bisschen Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Mich zu verteidigen. Und ich kannte Ole ja; er ist der Vater von Oskar, meinem besten Freund.«
»Aber er wollte mit Ihnen nicht nur über Mari sprechen?«
Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, merkte, dass sie jetzt feucht waren.
»Nein.«