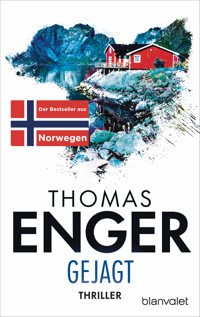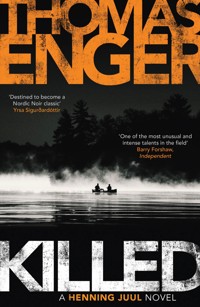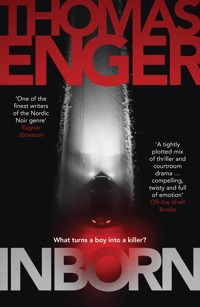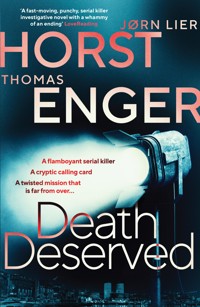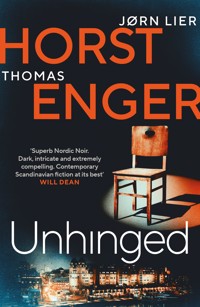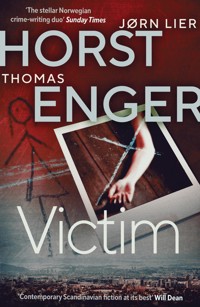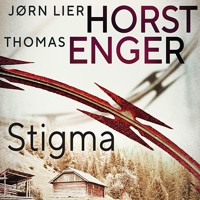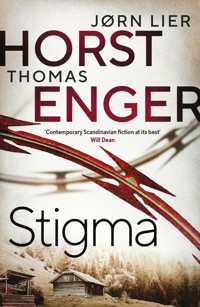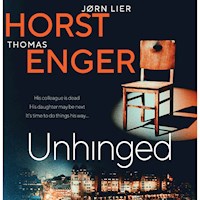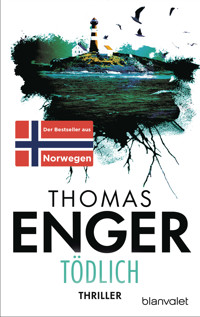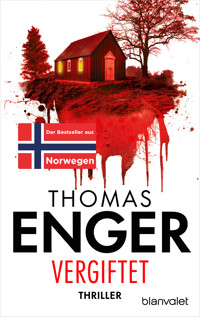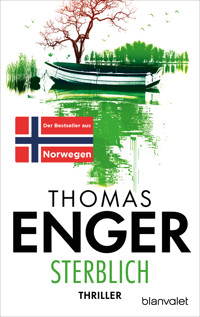10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alexander Blix und Emma Ramm
- Sprache: Deutsch
Ein Polizist, der nicht mehr ermitteln darf, ist kein guter Polizist, sondern ein wütender! Band 5 der SPIEGEL-Bestseller-Reihe aus Norwegen.
Zwei Monate sind vergangen, seit Alexander Blix vom Vorwurf des vorsätzlichen Mordes freigesprochen wurde. Doch sein Leben liegt in Trümmern: Er kann nie wieder als Polizist arbeiten und fühlt sich, als würde ihn jemand auf Schritt und Tritt verfolgen. Dann verschwindet auch noch Blix' dementer Vater aus dem Pflegeheim. Aber Blix, der keinen Kontakt zu seinem Vater haben will, weigert sich, die Ermittlung aufzunehmen, zumal die Polizei Oslo ihn immer noch für einen Mörder hält. Zum Glück steht Emma Ramm fest an seiner Seite – und zusammen schließen die beiden einen Cold Case, der nicht nur Blix' Familie betrifft, sondern die dunkelsten Seiten eines Verbrechers hervorbringt.
Lesen Sie auch die anderen Fälle der norwegischen Platz-1-Bestseller-Reihe wie »Bluttat und »Blutnacht«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Zwei Monate sind vergangen, seit Alexander Blix vom Vorwurf des vorsätzlichen Mordes freigesprochen wurde. Doch sein Leben liegt in Trümmern: Er kann nie wieder als Polizist arbeiten und fühlt sich, als würde ihn jemand auf Schritt und Tritt verfolgen. Dann wendet sich Blix’ dementer Vater an ihn, weil dieser glaubt, jemand versuche, ihn zu vergiften. Aber Blix, der keinen Kontakt zu seinem Vater haben will, weigert sich, die Ermittlung aufzunehmen, zumal die Polizei Oslo ihn immer noch für einen Mörder hält. Zum Glück steht Emma Ramm fest an seiner Seite – und zusammen schließen die beiden einen Cold Case, der nicht nur Blix’ Familie betrifft, sondern die dunkelsten Seiten eines Verbrechers hervorbringt.
Autoren
Thomas Enger, Jahrgang 1973, studierte Publizistik, Sport und Geschichte und arbeitete in einer Onlineredaktion. Nebenbei war er an verschiedenen Musical-Produktionen beteiligt. Sein Thrillerdebüt »Sterblich« war im deutschsprachigen Raum wie auch international ein sensationeller Erfolg, gefolgt von vier weiteren Fällen des Ermittlers Henning Juul. Er lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern in Oslo.
Jørn Lier Horst, geboren 1970, arbeitete lange in leitender Stellung bei der norwegischen Kriminalpolizei, bevor er Schriftsteller wurde. 2004 erschien sein Debüt; seither belegt er mit seiner Reihe um Kommissar William Wisting regelmäßig Platz 1 der norwegischen Bestsellerliste. Für seine Werke erhielt er zahlreiche renommierte Preise, zuletzt 2019 den Petrona Award für den besten skandinavischen Spannungsroman.
Die beiden Bestsellerautoren belegen mit ihrer Thrillerreihe über die Ermittler Alexander Blix und Emma Ramm regelmäßig die Spitze der norwegischen Bestsellerliste.
Alle Bände der Blix- und Ramm-Serie
Blutzahl
Blutnebel
Bluttat
Blutnacht
Blutstunde
Thomas EngerJørn Lier Horst
Blutstunde
Thriller
Deutsch von Maike Dörries und Günther Frauenlob
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Offer« bei Capitana, Oslo.
This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © Jørn Lier Horst & Thomas Enger 2023
Published by agreement with Salomonsson Agency.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ricarda Essrich
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: stock.adobe.com / Reinholds
BL · Herstellung: sam · lor
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29569-1V003
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Epilog
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
»All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother.«
(Abraham Lincoln)
Prolog
Der Mond warf sein mattes Licht auf den Parkplatz.
Es war vier Minuten nach halb zwölf.
Seit er sie begraben hatte, war er schon mehrere Male hier gewesen, bis zu ihrem Grab war er aber noch nie gegangen. Trotz der Dunkelheit war er sich sicher, dass er den Weg finden würde. Er kannte diesen Wald.
Am Abend zuvor hatte es geregnet.
Das Profil der Wanderschuhe würde tiefe Abdrücke hinterlassen, weshalb er eine in Norwegen weitverbreitete Marke gekauft hatte. In seiner grünen Regenjacke verschmolz er mit der Umgebung.
Das A und O ist ein guter Plan, dachte er.
Er nahm den Rucksack aus dem Kofferraum. Verriegelte das Auto und trat auf den Pfad. Die Luft war kühl und feucht. Am Himmel zogen schwarze Wolken vorbei. Der Boden roch nach kalter Verwesung. Ein paar Vögel flatterten auf, als er vorbeiging.
Er begann, unter der Mütze zu schwitzen. Seine Brille beschlug.
Es war riskant gewesen, sie so weit in den Wald hineinzutragen. Halb Norwegen hatte damals nach ihr gesucht. Außerdem war sie viel schwerer gewesen als vermutet. Deshalb hatte er es, wie jetzt auch, nachts gemacht und alles vorher detailliert geplant.
Drei Nächte vorher hatte er sich mit einem Klappspaten auf den Weg gemacht. Am ersten potenziellen Versteck war der Untergrund zu felsig gewesen, zu viele Steine. Am zweiten konnte er nicht tief genug graben, um zu verhindern, dass sie von irgendwelchen Raubtieren ausgebuddelt wurde. Erst beim dritten Versuch hatte er im Schutz von Bäumen, Büschen und Farnkraut den perfekten Platz gefunden. Bevor er zurückgegangen war, hatte er einen der Bäume markiert.
Die Fichte war inzwischen gewachsen. Die Zweige waren breiter, vielleicht auch dicker. Er stellte den Rucksack ab und nahm den Spaten heraus, froh, dass der Boden noch nicht gefroren war.
Die ersten Spatenstiche durch die dicke Schicht aus Heide, Moos und Wurzeln waren die schwersten.
Als er nach einer Stunde endlich tief genug war, legte er den Spaten beiseite und grub mit den Händen weiter, um die Folie, in die sie eingeschlagen war, nicht zu beschädigen. Die Handschuhe gruben sich in den feuchten Boden. Immer mehr Plastik kam zum Vorschein.
Er öffnete die Jackentasche und nahm vorsichtig ein zusammengefaltetes Blatt heraus. Dann schlug er sorgsam die Folie beiseite, Schicht um Schicht, bis sie exponiert vor ihm lag.
Ein jegliches hat seine Zeit, dachte er.
Und jetzt war die Zeit hierfür.
Tagsüber waren viele Wanderer im Wald. Die Spaziergänger ließen ihre Hunde frei laufen. Verstrich zu viel Zeit, bis sie gefunden wurde, müsste er ihnen einen Tipp geben.
Für den letzten Handgriff brauchte er eine knappe Minute. Als er fertig war, stand er auf und sah sich zufrieden um. Über den Baumwipfeln rissen die Wolken auf und das Mondlicht fiel auf das Grab.
Es war Dienstagmorgen. Viertel nach vier.
Er lächelte.
Es würde ein schöner Tag werden.
1
Der graubraune Boden vor ihm war mit hellen Kaugummiflecken übersät. Alexander Blix hatte den Blick einen Meter vor sich gerichtet und versuchte, Müll und alte Hundescheiße zu umschiffen.
Eine heftige Böe ließ ihn den Kragen seines Mantels hochschlagen. Der Himmel hatte sich zugezogen, sicher würde es bald anfangen zu regnen. Als er zu Hause losgegangen war, hatte noch die Sonne geschienen.
Oslo, dachte er.
In einer Sekunde Sommer, in der nächsten schon Herbst.
Als links von ihm das Haus Grønlandsleiret 44 auftauchte, hob er den Blick und blieb stehen. Vor dem Gebäude mit den großen Fenstern stand eine Frau und rauchte. In der Nähe rief jemand etwas in einer fremden Sprache. Auf der Rasenfläche im Park unterhalb des Gebäudes lagen gelbe und rote Blätter. Ein Hund hastete auf kurzen Beinen zurück zu seinem Herrchen, in der Schnauze einen Stock.
Die Morgenbesprechung dürfte jetzt rum sein, dachte Blix. Vermutlich stand Nicolai Wibe in diesem Augenblick an der Kaffeemaschine und erzählte stolz von seiner morgendlichen Trainingseinheit. Tine Abelvik verdrehte vielleicht die Augen, während Gard Fosse, ganz der Chef, zur Arbeit mahnte.
Blix’ Blick fiel auf ein Auto, das aus der Tiefgarage fuhr. Auf der Straße schaltete es die Sirenen ein. Das Blaulicht flackerte über die Hauswände, während die anderen Autos Platz machten. Die Beamtin auf dem Beifahrersitz drehte den Kopf und sah Blix an, als sie vorbeifuhren. Er konnte sich nicht daran erinnern, sie schon einmal gesehen zu haben.
Was das wohl für ein Einsatz war? Ein Einbruch, Unfall, Mord? Heulend raste der Wagen in Richtung Zentrum, ein Instrument im städtischen Kakofonieorchester, das langsam verklang.
Blix drehte sich wieder zum Präsidium um. Ein Regentropfen fiel auf seine Wange und bekam schnell Gesellschaft von anderen. Er warf einen Blick auf die Uhr und sah, dass er spät dran war.
Im Umdrehen fiel sein Blick auf eine Person, die ebenfalls kehrtmachte und hastig über die Straße lief, ohne nach links und rechts zu schauen. Ein Autofahrer hupte. Der Mann schob sich zwischen die Passanten auf dem anderen Bürgersteig und verschwand mit schnellen Schritten.
Das war derselbe Typ, dachte Blix.
Die gleiche dunkelgrüne Regenjacke, und auch der schwarze Rucksack kam ihm bekannt vor. Blix hatte ihn schon mehrfach vor seiner Wohnung unten auf der Straße gesehen, manchmal spät am Abend, andere Male frühmorgens. Auch im Laden war er ihm aufgefallen und einmal – da war er sich aber nicht ganz sicher – im Hinterhof des Hauses, in dem er wohnte.
Blix beschleunigte seine Schritte, realisierte aber schnell, dass er ihn nicht mehr einholen konnte, als der Mann in der U-Bahn-Station Grønland Torg verschwand.
Deshalb ging er weiter Richtung Zentrum. Dieses Mal schneller, nicht mehr darauf achtend, wohin er die Füße setzte. Immer wieder drehte er sich um, und jedes Mal hatte er das Gefühl, dass alle ihn anstarrten. Der Mann mit der grünen Regenjacke war aber nicht unter ihnen.
2
Elf Minuten später blieb Blix vor einem Haus stehen. Leirfallsgate 11. Ein Elektroroller lehnte an der Hauswand.
Es regnete leicht.
Zögernd richtete Blix seinen Zeigefinger auf die Klingelschilder an der Tür, trat aber gleich wieder einen Schritt zurück.
Du musst das nicht tun, sagte er zu sich selbst. Noch kannst du einfach weggehen. Doch dann presste er den Finger auf Krissander Dokkens hellgrünen Klingelknopf. Eine Sekunde später summte der Türöffner.
Am Ende des Flurs im zweiten Stock war eine Tür einen Spaltbreit geöffnet. Vorsichtig schob Blix sie auf. Krissander Dokken stand im Flur und streckte ihm mit einem etwas distanzierten Lächeln die Hand entgegen. Mit der anderen umklammerte er den Stock, auf den er sich stützte.
»Kommen Sie rein.«
Blix zog die Schuhe aus und hängte seine nasse Jacke an die Garderobe. Ohne ein weiteres Wort führte Dokken ihn in einen Raum, in dem zwei Stühle an einem runden Tisch standen. Eine gut gefüllte Wasserkaraffe und zwei Gläser standen bereit. Aus einer viereckigen Box ragten dünne weiße Papiertaschentücher.
Blix setzte sich auf den hinteren Stuhl und schlug die Beine übereinander. Der tiefe Atemzug verursachte einen stechenden Schmerz in der Brust. Vergeblich versuchte er, sich zu entspannen.
Krissander Dokken setzte sich auf seinen üblichen Stuhl, lehnte den Stock neben sich und platzierte einen Notizblock auf seinem Schoß. An der Wand hinter ihm hing der bekannte Druck eines van Goghs. Neben dem weiß gestrichenen Bücherregal stand ein Terrakottatopf mit einer leuchtend grünen Glückskastanie.
»Also«, sagte Dokken und rückte seine kleine, runde Brille zurecht. »Wie geht es Ihnen? Wie waren die letzten Tage?«
Dokken sprach langsam mit heller, spröder Stimme. Blix wusste nicht, was er antworten sollte. Er könnte sagen, dass er noch immer das Gefühl hatte, jeden Morgen von einer unsichtbaren Kraft aufs Laken gedrückt zu werden. Dass kein einziger Tag und nicht eine Minute verstrich, in der er nicht an Iselin und ihren Mörder dachte. Und an das, was danach geschehen war. Die Zeit im Gefängnis. Die Zeit nach seiner Entlassung.
Stattdessen sagte er: »Gut.« Er schluckte. »Ich denke, es geht mir … ganz gut.«
»Was heißt das?«
Dokken sah ihn eindringlich an.
»Tja«, sagte Blix zögernd. »Ich weiß auch nicht so recht.«
»Was bedeutet gut gehen für Sie?«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Blix antwortete.
»Das ist eine gute Frage«, sagte er. »Wahrscheinlich weiß ich das gar nicht mehr richtig.«
Dokken nickte langsam.
»Was, glauben Sie, muss geschehen, damit es Ihnen besser geht?«
Blix dachte nach. Lange.
»Ich weiß es nicht«, sagte er. »Ich habe wirklich keine Ahnung.«
»Haben Sie es noch mal mit Meditation versucht?«
Blix schüttelte den Kopf.
»Ich … bin noch nicht dazu gekommen.«
Stille.
»Was haben Sie in den letzten Wochen gemacht?«
»Nicht viel, eigentlich. Ich … habe ein bisschen gelesen. Zeitungen, Bücher. Und ich … binde Fliegen.«
»Sie meinen … zum Fliegenfischen?«
»Ja, ein früheres Hobby von mir, das ich wieder aufleben lasse.«
»Gut. Das freut mich zu hören. Gehen Sie oft fischen?«
»Nicht mehr. Früher schon. Aber das ist lange her.«
»Vielleicht sollten Sie Ihre neuen Fliegen mal ausprobieren?«
Blix zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht.«
Dokken wartete kurz, bis er seine nächste Frage stellte.
»Essen Sie genug?«
»Ja, ich denke schon.«
»Auch … etwas Gesundes?«
Blix dachte nach.
»Bestimmt nicht so oft, wie ich sollte.«
»Du bist, was du isst, das wissen Sie, oder?«
Dokken versuchte sich an einem Lächeln. Blix antwortete nicht.
»Wie sieht es mit Ihrem Schlaf aus?«
»Ich werde ziemlich oft wach. Aber das war immer so, auch als ich noch gearbeitet habe.«
Dokken befeuchtete seine Lippen.
»Machen Sie morgens noch immer Ihre Touren?«
»Meistens ja.«
»Die gleiche Route?«
»Ja, da gibt es kaum Veränderungen. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Aber da bin ich ja wohl nicht der Einzige.«
Dokken legte die Finger zu einem Dreieck zusammen.
»Fühlen Sie sich noch immer überwacht? Oder anders ausgedrückt, glauben Sie noch immer, dass Ihnen jemand folgt?«
Blix hatte vergessen, dass er Dokken beim letzten Mal davon erzählt hatte.
»Nein«, antwortete er und spürte, wie eine Flamme in seinem Gesicht aufloderte. »Viele Leute wissen, wer ich bin«, fügte er hinzu. »Nach … nach allem, was passiert ist. Es gibt immer mal wieder jemanden, der mich erkennt, wenn ich auf der Straße oder beim Einkaufen bin.«
»Der Preis des Ruhms«, sagte Dokken mit einem dünnen Lächeln. »Ich bin froh, nicht prominent zu sein.«
Blix sagte nichts.
»Bekommen Sie noch immer so viel Post?«
Blix zögerte.
»Vielleicht ein bisschen weniger.«
»Und was für Briefe sind das?«
»Ich weiß es nicht, so genau sehe ich mir sie nicht an.«
»Warum nicht?«
Blix dachte nach. Eigentlich hatte er keine gute Antwort auf diese Frage.
»Haben Sie mit jemandem Kontakt?«, fragte Dokken.
»Mit Emma«, sagte Blix. »Emma Ramm. Ab und zu.«
»Und Ihre alten Kollegen schicken Ihnen nicht manchmal Nachrichten oder laden Sie auf ein Bier ein?«
Blix schüttelte den Kopf.
»Melden Sie sich bei jemandem?«
»Nein. Höchstens bei Merete, meiner Ex-Frau. Aber nicht sehr oft.«
Dokken starrte einen Moment wie tief in Gedanken versunken vor sich hin.
»Was ist mit Ihren Eltern?«
Blix hob überrascht den Kopf.
»Was soll mit denen sein?«
»Leben sie noch?«
»Wie meinen Sie das? Ob sie noch leben?«
»Hm?«
»Mein Vater … er lebt«, sagte Blix seufzend. »Meine Mutter ist schon vor vielen Jahren gestorben.«
»Wie alt waren Sie da?«
Blix schob sich im Stuhl etwas hoch und kratzte sich mit einem ungewöhnlich scharfen Fingernagel an der Wange.
»Sechzehn.«
»Haben Sie Kontakt zu Ihrem Vater?«
Blix legte die Hand auf den Schenkel und drückte die Muskulatur unter dem Stoff etwas zusammen.
»Nicht wirklich.«
»Warum nicht?«
»Er ist … in einem Pflegeheim.«
»Ist das ein Grund, keinen Kontakt zu haben?«
Blix senkte den Blick und schob die Finger ineinander. Er blieb die Antwort schuldig.
»Warum ist er in einem Pflegeheim?«, fuhr Dokken fort. »Wenn ich das fragen darf?«
»Weil … er allein nicht mehr zurechtkommt.«
Dokken nickte langsam.
»Und wo ist dieses Heim?«
»Außerhalb von Gjøvik.«
»Kommen Sie von da?«
»Nicht ganz, ich bin aus Skreia.«
»Skreia«, wiederholte Dokken, als wäre der Ort als solcher wichtig.
»Wann haben Sie ihn zuletzt besucht?«
»Das … weiß ich nicht.«
»War das vor oder nach der Zeit im Gefängnis?«
»Davor«, antwortete Blix schnell.
»Und wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Das …«, Blix stockte, »ist eine Weile her.«
Blix sah die tiefe Falte zwischen den Augenbrauen des Psychologen.
»Vielleicht sollten Sie mal wieder hinfahren«, sagte er. »Allein um …«
»Nein«, erwiderte Blix.
Dokken betrachtete ihn eine ganze Weile.
»Warum nicht?«
»Weil ich keine Lust habe.«
Es wurde still am Tisch.
»Wie war die Beziehung zu Ihrer Mutter?«
Blix seufzte. »Gut«, antwortete er. »Lassen Sie uns über etwas anderes reden.«
Dokken musterte ihn, dann lehnte er sich zurück und schlug die Beine übereinander.
»Kommen wir noch mal auf das zurück, worüber wir zu Beginn der Stunde gesprochen haben«, sagte er. »Was brauchen Sie, damit es Ihnen besser geht? Im Grunde ist es ja das, wonach wir alle streben. Jeden Tag, das ganze Leben.«
Er trommelte mit den Fingern auf sein Notizbuch und schien seine nächsten Worte genau abzuwägen.
»Sie waren im Gefängnis, Alexander. Fast acht Monate. Dann wurden Sie freigesprochen. Sie sind jetzt seit mehr als zwei Monaten ein freier Mann.«
»Das kommt darauf an, wie man frei definiert«, wandte Blix ein. »Von dem, was geschehen ist oder was ich getan habe, werde ich nie ganz freikommen. Das wird niemals wieder verschwinden.«
»Ja, aber so ist es für alle Menschen«, sagte Dokken. »Wir tragen mit uns herum, was uns im Laufe unseres Lebens widerfahren ist, egal wie kurz oder lang es war. Es ist ein Teil von uns, wir können nicht zurückgehen und irgendetwas davon ändern. Beeinflussen können wir nur unsere Zukunft.«
»Dann muss ich das einfach nur hinter mir lassen? Ist es das, was Sie sagen wollen?«
»Ganz und gar nicht«, sagte Dokken, unbeeindruckt davon, dass Blix laut geworden war. »Was Sie erlebt haben, wird Sie für immer prägen. Wir versuchen hier nicht, ein Pflaster auf Ihre Wunden zu kleben, damit sie nicht mehr bluten. Eher im Gegenteil: Wir bohren darin und lassen das Blut so lange fließen wie nötig. Bis auf Weiteres ist unser Streben, Ihrem Körper und Geist irgendwie klarzumachen, dass es okay ist, das Blut fließen zu lassen, ohne zu viel darüber nachzudenken oder zu intensiv auf den Schmerz zu achten.«
»Das hört sich ja gar nicht abstrakt an«, sagte Blix ironisch.
»Das ist nicht die Spur abstrakt«, sagte Dokken. »Es gibt ein paar Techniken, die sich bei Menschen mit schweren Traumata oder in tiefer Trauer als sehr effektiv erwiesen haben.«
Er wartete, bis Blix ihn ansah, und sagte:
»Haben Sie schon mal etwas von EMDR gehört?«
Blix schüttelte den Kopf.
»Die Abkürzung steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Das ist eine Methode der Gehirnstimulierung, die es einem erleichtert, nach schlimmen Erlebnissen weiterzuleben.«
Blix zog die Augenbrauen hoch.
»Ein traumatisches Erlebnis«, fuhr Dokken fort und strich eine Falte in seinem himmelblauen Hemd glatt, »kann unsere Fähigkeit, Gefühle und Erinnerungen zu bearbeiten, völlig außer Kraft setzen. Man ist dieser Aufgabe dann einfach nicht mehr gewachsen. Das Geschehene überwältigt einen und ist viel zu schmerzhaft. Mit der EMDR kann man das Hirn umprogrammieren, damit Stress und Traumata bearbeitet werden, ohne allzu starke Gefühle zu aktivieren.«
Während Dokken weiter ins Detail ging, wanderten Blix’ Gedanken zurück zu dem Mann in der grünen Regenjacke.
»Andernfalls könnten wir auch eine Methode namens EFT probieren«, sagte Dokken nach einer Weile. »Tapping wäre noch eine andere Technik. Das können Sie auch selber zu Hause machen.«
Blix strich sich über das Kinn, ohne etwas zu sagen.
»Sie meinten irgendwann einmal«, fuhr Dokken nach einem Räuspern fort, »es würde Ihrem persönlichen Gerechtigkeitssinn widersprechen, dass Sie nicht mehr im Gefängnis sitzen. Weil Sie einen Mann erschossen haben.«
»Weil ich es aus Rache getan hab«, sagte er leise.
»Sie haben ihn daran gehindert, auch noch Emma Ramm zu töten.«
»Ja, aber meine eigentliche Intention war es, ihn zu bestrafen, nicht Emma zu retten. Ich denke, das ist die Wahrheit.«
Dokken sah ihn an.
»Ich sollte nicht hier sein«, sagte Blix. »Ich meine damit nicht, dass ich jetzt nicht hier bei Ihnen sein sollte. Ich meine draußen. Ich hätte ehrlich sein und meine Strafe annehmen müssen, wie alle anderen Verbrecher auch.«
»Und deshalb haben Sie ein schlechtes Gewissen?«
Blix hob den Blick und sah ihn an.
»Ja.«
Dokken klopfte mit dem Stift auf den Notizblock.
»Was ist so schlimm daran, wenn tatsächlich Hass, Rache und Bestrafung Teil Ihrer Motivation waren?«, fragte er. »Der Mann hat Ihre Tochter getötet, ist das nicht eine zutiefst menschliche Reaktion?«
Blix senkte den Blick. Sagte nichts.
»Das macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen.«
»Vielleicht nicht«, sagte Blix. »Aber zu einem schlechten Polizisten.«
»Definiert das, wer Sie sind?«, fragte Dokken. »Was für ein Polizist Sie mal waren?«
Blix wusste nicht, was er darauf antworten sollte.
»Und noch ein anderer Aspekt – wäre Ihr Leben besser, wenn Sie ihn entkommen lassen hätten? Und er auch noch Emma Ramm getötet hätte?«
Blix starrte weiter zu Boden.
»Sie haben in gewisser Weise eine neue Chance bekommen.«
»Nicht wirklich«, sagte Blix. »Ich werde nie wieder als Polizist arbeiten können.«
»Nein, aber vielleicht können Sie ja anerkennen, dass Ihnen die Freiheit geschenkt wurde. Das ist in der Geschichte schon öfter vorgekommen, und sicher bei Menschen, die deutlich Schlimmeres getan haben als Sie. Machen Sie etwas aus dieser Freiheit. Nehmen Sie dieses Geschenk an.«
Blix sah ihn an.
»Und wie?«
»Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Das müssen Sie selbst herausfinden.«
Wieder wurde es still.
»Darf ich Ihnen sagen, was mir aufgefallen ist?«, fragte Dokken nach einer Weile.
Blix sah ihn abwartend an.
»Es macht auf mich den Eindruck, als würden Sie sich selbst kasteien«, sagte Dokken. »In erster Linie, weil es Ihnen nicht gelungen ist, Ihre Tochter zu retten, aber auch, weil Sie einen Menschen getötet haben und jetzt trotzdem frei sind. Sie gehen regelmäßig an Ihrem alten Arbeitsplatz vorbei – nahezu jeden Tag. Auf diese Weise erinnern Sie sich täglich an das, was Sie getan haben, und an das, was Sie nicht mehr haben. Was Sie da machen, ist sehr brutal gegen Sie selbst.«
Blix antwortete nicht.
»Im Moment«, sagte Dokken und räusperte sich erneut, »ist Ihr Kopf Ihr größter Feind, weil Ihre Gedanken sich im Kreis drehen. Sie kommen nicht weiter. Sie sind wie ein Hund, der sich selbst in den Schwanz zu beißen versucht.«
Blix hörte zu, wusste aber nicht, was er sagen sollte.
»Dennoch«, fuhr Dokken fort, »kommen Sie weiter hierher, allen früheren Erfahrungen mit Menschen meines Berufsfeldes zum Trotz, und Sie tun das freiwillig. Das verrät mir, dass Sie tief in Ihrem Inneren Hilfe suchen. Sie wollen, dass es Ihnen besser geht. Das ist ein Zeichen von Charakterstärke. Und ich helfe Ihnen gerne, Alexander. Aber dann müssen Sie mich auch lassen.«
Blix sah zu der Uhr an der Wand. Dokken folgte seinem Blick.
Es wurde wieder still.
»In der Psychologie gibt es den Begriff Self Compassion«, sagte Dokken. »Immer diese Fremdwörter, ich weiß. Es geht dabei darum, freundlich zu sich selbst zu sein. Zu akzeptieren, dass es einem schlecht geht, aber eben auch, dass es vollkommen in Ordnung ist, Schmerz zu empfinden. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten. Und es nicht noch schlimmer zu machen, als es ohnehin schon ist.«
»Ich sollte mir also eine andere Route aussuchen?«
»Das wäre auf jeden Fall schon einmal ein guter Anfang«, sagte Dokken. »Und wie ich schon früher gesagt habe: Schaffen Sie sich einen Hund an, wenn Sie keine Allergie haben. Hunde sind fantastisch.«
Dokken nutzte die folgenden Minuten für Anekdoten über die eigenen Vierbeiner, die er im Laufe seines Lebens gehabt hatte, und wie sehr sie ihm in schweren Stunden geholfen hatten. Kurz vor Viertel vor zwölf machte er Anstalten, die Sitzung zu beenden.
Blix stand auf, froh darüber, dass die Stunde vorüber war. Dokken begleitete ihn auf den Flur. Als Blix die noch immer nasse Jacke angezogen hatte, sagte er:
»Fahren Sie mal zu Ihrem Vater. Auch wenn Sie keine Lust dazu haben. Vielleicht freut er sich über Besuch. Und wer weiß, vielleicht tut es auch Ihnen gut, ihn zu besuchen.«
Blix bückte sich, um die Schnürsenkel neu zu binden, obwohl er die Schuhe gerade erst angezogen hatte. Er richtete sich wieder auf, ohne darauf zu antworten.
»Besuchen Sie ihn«, sagte Dokken. »Es kann ganz schnell zu spät sein.«
Blix knöpfte sich die Jacke zu und legte die Hand auf die Klinke.
»Danke«, sagte Blix, ohne den Psychologen anzusehen. »Noch einen schönen Tag.«
3
Nach nur wenigen Minuten sah Emma ihren Fehler ein. Er bestand nicht darin, dass sie in den Botanischen Garten gegangen war, obwohl sie nichts mit Pflanzen am Hut hatte. Sie hatte immer schon ein Faible für ästhetische Objekte und Umgebungen gehabt. Aber wenn der Begleiter vier Beine hatte und überdurchschnittlich neugierig auf alles reagierte, was um sie herum vor sich ging, war nicht mehr daran zu denken, die schöne Umgebung zu genießen.
Terry war ein Tibet-Terrier, dem nachgesagt wurde, ein »ausgeglichener, aber lebhafter und freundlicher Hund mit vielen charmanten Zügen« zu sein. Offen und clever, nicht besonders aggressiv und unkompliziert im Umgang. Aber – und das war in diesem Fall ein sehr großes Aber – er konnte »bei Fremden ziemlich bockig« sein. Und eine Fremde war Emma nach wie vor für ihn.
Sei bestimmt, wiederholte sie wie ein Mantra. Trotzdem zerrte Terry sie abwechselnd nach rechts und nach links. Im Botanischen Garten gab es offensichtlich noch mehr spannende Gerüche und Spuren als an jedem andern Ort in Oslo.
Als es ihr endlich gelang, Terry zu einer kurzen Verschnaufpause zu überreden, und sie sich auf einer Bank niedergelassen hatte, von der aus sie über den oberen Teil von Oslo-Grønland schauen konnte, fragte sie sich, wie die vorigen Besitzer Terry wohl behandelt hatten. Sie wusste nicht mehr über ihn, als dass er aus einem Tierheim kam.
Emma schaute auf die Uhr.
Blix war verspätet.
Sie vertrieb sich die Wartezeit, indem sie die Onlinenachrichten überflog. Es war ein gutes Gefühl, das ohne den ständigen Druck tun zu können, dass einem die Konkurrenz eine Story vor der Nase wegschnappte, ohne immer gleich neue Blickwinkel bei allem auszuloten, was die nächsten Tage vermutlich die Schlagzeilen beherrschen würde.
Es hatte sie viel Zeit gekostet, alte Gewohnheiten und Denkweisen abzulegen. Sich von alten Routinen zu lösen wie das frühe Aufstehen, um vor der Arbeit noch zu trainieren. Jetzt schlief sie gerne mal bis halb acht und entschied sich je nach Laune fürs Rad oder einen Wettlauf mit den hellblauen Straßenbahnen quer durch die Stadt.
Das Telefon in Emmas Hand vibrierte.
Eine unbekannte Nummer. Normalerweise wies sie diese Anrufe ab, sie hasste es, mit Telefonverkäufern zu reden oder Leuten, die sie zu irgendwelchen langweiligen Marktforschungsbefragungen überreden wollten. Dieses Mal nahm sie das Gespräch an, weil Blix sich noch immer nicht gemeldet hatte.
»Hallo … spreche ich mit Emma Ramm?«
Die Stimme am anderen Ende war die einer jungen Frau.
»Ja?«
»Hallo. Ich …«
Es wurde still. »Ich … heiße Carmen«, sagte das Mädchen. »Tut mir leid, dass ich …«
Emma richtete sich auf und stellte beide Füße auf die Erde.
»Ich würde gerne mit Ihnen reden.«
Emma zog die Stirn in Falten. Vielleicht ging es um ein Referat, dachte sie, und die Schülerin hatte ihren Namen in irgendeinem Artikel zu dem Thema gefunden. Das wäre nicht das erste Mal.
»Ja … klar können wir reden«, antwortete Emma. »Worum geht’s?«
»Das möchte ich ungern am Telefon besprechen. Ich …«
Wieder stockte sie.
»Sorry«, sagte sie. »Ich bin keine große Telefoniererin.«
Die junge Frau wurde Emma immer sympathischer.
»Sie wollen sich also mit mir treffen?«
»Ähm, ja. Wenn das geht. Und Sie Zeit haben?«
Emma warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, obwohl sie wusste, dass die Zeit an sich kein Problem war.
»Darf ich Sie fragen, wieso Sie ausgerechnet mit mir sprechen wollen, Carmen?«
»Weil …«
Es wurde still. Emma hörte ein Schluchzen am anderen Ende. Und noch ein Schluchzer.
»Vergessen Sie’s«, kam es knapp. »Und entschuldigen Sie die Störung.«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
Emma schaute aufs Display. Eine kurze Suche im Internet ergab, dass die Nummer, von der das Mädchen gerade angerufen hatte, auf Victoria Prytz registriert war.
»Oh«, sagte Emma laut.
Im nächsten Augenblick erwachte Terry zum Leben. Und Emma sah auch gleich den Grund dafür. Blix kam den Hügel hochgelaufen. Terry stürmte auf ihn zu und riss Emma von der Bank, die ihn mit aller Kraft zurückhalten musste, um nicht über den Asphalt gezogen zu werden.
Blix beugte sich zu Terry runter, als der mit wedelndem Schwanz an ihm hochsprang. Hoch ins Gesicht, wieder auf die Erde, einmal um die eigene Achse, ehe es wieder hoch ins Gesicht ging. Blix ließ die überschäumende Sehnsucht, Liebe und Freude mit verhaltenem Lächeln über sich ergehen.
»Hallo«, sagte er, als Terry sein Willkommensritual schließlich abgeschlossen hatte.
»Hallo.«
Emma atmete hörbar durch den offenen Mund aus. Die Schatten um Blix’ Augen waren noch dunkler als am Morgen. Die Haut unter seinem Kinn wirkte schlaff.
»Wie war es?«, fragte sie.
Blix sah sich um.
»Du weißt schon, dass solche Sitzungen vertraulich sind?«
»Ach was«, sagte Emma. »Nur die Psychologen müssen die Klappe halten. Du kannst so viel schwätzen, wie du willst. Besonders mit Menschen, die auf deinen Köter aufpassen.«
Sie blinzelte ihn lächelnd an. Blix übernahm die Leine. Terry hatte sich ein bisschen beruhigt, im Augenblick beschäftigte ihn eine unsichtbare Duftspur am Wegrand.
»Alles gut gegangen?«, fragte er mit einem Nicken zum Hund.
»Ja klar«, log Emma. »Wir hatten viel Spaß.«
Sie strengte sich an, nicht die Augen zu verdrehen.
Gemeinsam gingen sie nach unten zum Ausgang an der Jens Bjelkes gate.
»Und was machst du jetzt?«, fragte sie.
Er schaute hoch zu den Wolken. Der nächste Regenschauer würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
»Nach Hause gehen, denke ich.«
Wieder scannte er die Umgebung. Folgte mit dem Blick einem Pkw auf dem Weg Richtung Sofienberg.
»Ich begleite dich.«
Sie gingen Richtung Tøyengata.
Emma dachte an die junge Frau, die sie angerufen hatte. Carmen, ihrer Recherche nach Victoria Prytz’ Tochter und damit die Stieftochter von Oliver Krogh. Emma wollte Blix gerade von dem Anruf erzählen, aber er war mit den Gedanken ganz woanders.
»Du hast nicht vor, irgendwas zu sagen?«, fragte sie.
»Was meinst du?«
»Hallo«, sagte Emma. »Du warst eine Dreiviertelstunde bei ihm.«
»Ja, aber …«
Er drehte den Kopf zur Seite.
»Hast du schon mal was … von EMDR gehört?«, fragte er schließlich.
»Was soll das sein – ein neues Land in Osteuropa?«
Da, ein winziges Zucken im Augenwinkel. Emma war kurz davor, sich selbst auf die Schulter zu klopfen.
»Nein, keine Ahnung, was das ist«, schob sie hinterher. »Schieß los.«
»Halt so ’n Kram«, sagte Blix kopfschüttelnd.
»Was für ’n Kram?«
»Na ja … so Psychoscheiße halt. Nichts, was ich ausprobieren werde.«
Und trotzdem erwähnst du es, dachte Emma.
In der Tøyengata kam ihnen ein roter Bus entgegen. Ein paar Minuten später erreichten sie die Nummer 19, wo Blix wohnte.
»Danke, dass du auf Terry aufgepasst hast«, sagte er mit einem tiefen Seufzer und blickte die Straße hoch. »Er … ist nicht gern allein zu Hause.«
»Es war mir ein Vergnügen.«
Sie sah ihn an.
Und fing an zu lachen.
»Was ist los?«
»Ach, irgendwie ist das schon verrückt«, sagte sie. »Du bist wahrscheinlich der letzte Mensch, von dem ich gedacht hätte, dass er sich einen Hund anschafft.«
»Wie kommst du jetzt darauf?«
Sie schaute Terry an, der mit hängender Zunge neben Blix auf dem Boden saß und aussah, als wäre sein Puls auf 350.
»Ich wusste nicht mal, dass du Hunde magst.«
Blix warf einen raschen Blick über ihre Schulter, als hielte er nach etwas Ausschau. Emma drehte sich nach hinten um, konnte aber nichts Spezielles sehen.
»Und jetzt hast du plötzlich so einen Racker in der Wohnung, nach dem du deinen Tagesablauf einrichten musst. Der komplett von dir abhängig ist, um zu überleben.«
Blix schwieg.
Und Emma dachte, dass es sich wahrscheinlich genau umgekehrt verhielt.
»Du bist echt ein anregender Gesprächspartner, Blix, das muss man dir lassen. Informativ und mitteilsam.«
»Tut mir leid«, sagte er mit mattem Lächeln und einem erneuten Blick über ihre Schulter. »Ich bin einfach ein bisschen kaputt.«
»Erwartest du jemanden?«
»Nein, nein«, sagte er. »Ich hab nur …«
Er senkte den Blick. Emma musterte ihn.
»Du weißt schon, dass ich dich inzwischen ziemlich gut kenne, oder?«
Blix seufzte, sagte aber noch immer nichts.
»Ist irgendwas los?«, hakte sie nach.
»Nein, Quatsch. Es ist nichts«, antwortete er.
»Sicher?«
»Ja.«
Er sah sie an und schüttelte den Kopf. Emma glaubte ihm kein Wort.
»Okay«, sagte sie trotzdem. »Ich werde dich nicht weiter nerven. Du wirst es mir vielleicht irgendwann erzählen.«
Blix wirkte bedrückt, als sie sich vorbeugte.
»Danke für die Gesellschaft, Terry«, sagte sie und streckte eine Hand zum Kopf des Hundes aus. »Es war mir ein Vergnügen.«
Terry antwortete mit einem Kläffen.
4
An den Briefkästen im Treppenaufgang traf Blix auf Holger Evensen, ein paar Jahre jünger als er, der im Frühsommer ins Haus eingezogen war. Trotz der Kälte trug Evensen nur ein T-Shirt und eine löchrige Jogginghose. Er sah Blix vorwurfsvoll an, als Terry ihn begrüßen wollte.
»Sie wissen schon, dass Sie die Miteigentümer um Erlaubnis fragen müssen, wenn Sie einen Hund halten wollen, oder?«, belehrte er ihn und nahm energisch seine Post aus dem Kasten.
»Der Hund ist aus dem Tierheim«, sagte Blix versuchsweise.
Holger Evensen schnaubte und blätterte auf dem Weg nach oben die Post durch. Seine Hausschuhe schlurften über die dreckigen Stufen.
Blix’ Briefkasten war halb voll mit Werbung und Rechnungen. Dazwischen hatten sich ein paar wenige Umschläge privateren Charakters gemogelt. Auf zweien stand ein Absender auf der Rückseite – R. Nakstad aus Honningsvåg und Alma Söderqvist aus Uddevalla.
Sogar aus Schweden schreiben sie jetzt schon, dachte Blix. Für alles gab es ein erstes Mal.
Er ging weiter in den Innenhof, behielt zwei Rechnungen und warf den Rest in den Papiercontainer.
Eine Etage über ihm ging eine Tür auf, als Blix seine Wohnung betrat. Terry blieb auf der Fußmatte im Flur stehen. Er legte die Ohren an und zuckte mit der Schnauze, als witterte er einen fremden Geruch. Blix schob ihn mit dem Fuß weiter, damit er die Tür schließen konnte.
»Was ist los?«, fragte er, als er die Leine löste.
Terry tapste unbekümmert in die Wohnung. Seine Krallen klackerten auf dem Holzboden.
Blix hängte seine Jacke auf und folgte Terry in die Küche.
Er legte die Post ab und füllte den Wassernapf des Hundes. Dann wärmte er den Rest vom gestrigen Labskaus auf und aß dazu zwei trockene Scheiben Brot. Die Wanduhr tickte rhythmisch, als wollte sie ihn hartnäckig daran erinnern, dass das Leben weiterging.
Terry legte sich vor seine Füße. Blix überlegte kurz, sich auch hinzulegen, war aber eigentlich zu unruhig zum Schlafen. Stattdessen ging er in sein kleines Arbeitszimmer und nahm sich die angefangene Fliege vor. Das Antron-Garn für das Schwänzchen hatte sich um den Hakenschaft gewickelt.
Er atmete tief ein, entwirrte den Knoten und fing von vorne an. Zufrieden stellte er fest, dass der neue Anlauf besser war.
Er hatte gerade zwei Pfauenfibern eingebunden, als das Telefon in der Küche klingelte. Blix ignorierte es und konzentrierte sich auf seine Arbeit, wurde aber mit jedem Klingeln gereizter. Irgendwann verstummte es.
Als er die Fibern am Hakenschaft befestigt hatte, begann das Handy erneut zu klingeln.
»Verdammt noch mal«, murmelte er und stand etwas zu hastig auf, sodass es ihm ins Kreuz schoss. Mit gekrümmtem Rücken schlurfte er in die Küche. Auf dem Display stand keine Nummer, nur »Unbekannt«. Er meldete sich mit einem mürrischen Hallo.
»Das hat ja gedauert«, sagte eine heisere Stimme am anderen Ende. Sie klang gedämpft, als läge ein Stück Stoff über dem Mikrofon.
»Wer ist da?«, fragte Blix. »Mit wem spreche ich?«
Die Antwort blieb aus. Stattdessen:
»Ich möchte ein Geständnis ablegen.«
Blix legte das Handy ans andere Ohr. Der Anrufer schien seine Stimme eine Oktave tiefer zu machen, als sie war.
»Was heißt das?«, fragte er.
»Ich möchte ein Geständnis ablegen«, wiederholte der Mann.
Terry wachte auf. Er verließ seinen Platz und legte sich unter den Tisch.
Blix war sich nicht sicher, ob die Person am anderen Ende ein harmloses Geständnis oder etwas Ernsteres meinte.
»Wenn Sie einen Gesetzesverstoß melden wollen«, sagte Blix und setzte sich, »müssen Sie sich an jemand anders wenden. Ich bin nicht mehr bei der Polizei.«
»Ich habe es in Ihren Briefkasten gesteckt.«
»Was?«
»Das Geständnis. Ich habe es in Ihren Briefkasten gesteckt. Aber dort …«, er machte eine Pause, »… dort liegt es nicht mehr.«
Blix’ Blick wanderte zu den Rechnungen, die er mitgenommen hatte. Sein Puls schoss in die Höhe.
»Sie sollten nicht einfach wegwerfen, was andere Leute Ihnen anvertrauen, Blix«, redete der Mann weiter. »Das ist unhöflich.«
Der Kühlschrankmotor sprang an und summte dumpf im Hintergrund. Blix schluckte, unsicher, wie er das Gespräch weiterführen sollte. Im nächsten Augenblick war die Verbindung unterbrochen.
Blix blieb mit dem Telefon in der Hand sitzen. Dann stemmte er sich hoch und ging in den Flur. Terry folgte ihm, aber Blix bedachte ihn mit einem strengen Blick und hielt ihn mit einer erhobenen Hand auf.
»Bleib!«
Terry legte sich gehorsam hin. Blix hastete aus der Wohnung, ohne die Tür zu schließen, und lief die Treppe runter. In die Eingangstür im Erdgeschoss schob er den dort deponierten Holzkeil.
Um ihn herum waren mehrere Fenster erleuchtet. Eine Gardine im ersten Stock bewegte sich, ansonsten war es ruhig.
Er klappte den Containerdeckel auf, dankbar, dass die Müllabfuhr heute nicht kam, und fischte die Umschläge aus dem Stapel weggeworfener Werbung heraus. Als Erstes öffnete er den Brief von R. Nakstad.
Ein Foto und ein handgeschriebener Brief. Das R stand für Regine. Blix war schnell klar, dass es sich um eine einsame Frau handelte. Er knüllte das Blatt zusammen und sah sich um. Zwei Jungen mit Sporttaschen gingen auf der Straße vorbei, beachteten ihn aber nicht.
Er riss den zweiten Umschlag auf. Alma Söderqvist lud ihn nach Uppsala ein. Auch dieser Brief wanderte direkt zurück in den Abfall.
Der dritte Umschlag hatte weder eine Anschrift noch einen Absender und war leicht mit Postwerbung zu verwechseln.
Er versuchte, den Inhalt zu ertasten. Möglicherweise ein Foto.
Behutsam schob er einen Finger unter die Klebefalz.
»Verflucht«, murmelte er leise, als er das Polaroidfoto einer Frau aus dem Kuvert zog.
Elisabeth Eie.
Seit bald zweieinhalb Jahren vermisst und vermutlich nicht mehr am Leben.
Und Mutter eines kleinen Kindes.
5
Emma saß auf einer Bank, deren Holz an manchen Stellen noch nass war. Von der Kuppe des St. Hanshaugen, 83 Meter über dem Meeresspiegel, hatte sie einen weiten Blick über den Oslofjord. Ein Kreuzfahrtschiff schob sich durch den Sund in Richtung Skagerrak. Die Wolkendecke war geschlossen und die Luft kühl.
Es war bereits nach halb sechs, aber Carmen Prytz war weit und breit nicht zu sehen. Emma öffnete die Nachrichten-App und scrollte sich durch die kurze Kommunikation, die sie geführt hatten. Die Neugier hatte gesiegt, deshalb hatte Emma noch einmal Kontakt aufgenommen und ihr geschrieben, dass sie sich natürlich treffen könnten. Sagen Sie einfach, wann und wo es Ihnen am besten passt, dann komme ich dorthin. Eigentlich hatte sie gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Aber eine gute Stunde später waren ihr eine Uhrzeit – 17.30 Uhr – und ein Treffpunkt geschickt worden, mehr nicht. Mittlerweile war es 17.40 Uhr und noch immer keine Spur von Carmen. Emma schrieb ihr, dass sie am vereinbarten Ort war, und fügte ein Smiley an. Keine Reaktion.
Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte Emma als Journalistin aufgehört und sich vorgenommen, die neu gewonnene Freizeit dafür zu nutzen, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen und etwas Neues anzufangen. Bis jetzt hatte sie aber noch keine Idee, wie es weitergehen sollte. Anfangs hatte sie es noch genossen, mal keine Verpflichtungen zu haben. Alles war offen, alles war möglich. Sie hatte sogar überlegt, noch mal die Schulbank zu drücken, aber welche Richtung? Was interessierte sie?
Emma hatte sich vorgestellt, dass sich der passende Karriereweg eines Tages schon offenbaren würde, nach dem Motto, dass es irgendwo im Universum einen Platz speziell für sie gab. Vielleicht war das eine übertrieben romantische und kindische Vorstellung, aber trotzdem hatte sie sich angewöhnt, jeden Tag so zu nehmen, wie er kam, ohne sich allzu viele Gedanken zu machen. Das erleichterte einerseits ihren Alltag, machte ihn andererseits aber auch komplizierter. Langweiliger. Leerer. Trainieren, essen, schlafen, ein bisschen lesen, Sachen in der Wohnung reparieren, zu IKEA fahren. Zeit mit ihrer Schwester Irene und ihrer Nichte Martine verbringen, sich mit Freunden verabreden. Einen fremden Menschen nach Hause begleiten, aber niemals übernachten.
Besonders lebenstüchtig war das nicht gerade. Und irgendwann müsste sie auch mal wieder Geld verdienen. Das Buch, das sie geschrieben hatte, hatte sich gut verkauft, war aber trotzdem weit entfernt von einem Bestseller.
17.45 Uhr.
Carmen hatte offenbar kalte Füße bekommen.
Emma erhob sich seufzend und schüttelte das Hosenbein herunter. Als sie losging, sah sie eine junge Frau zögernd auf sich zukommen. Sie trug einen zu großen Kapuzenpulli und schaute nervös in Emmas Richtung.
Emma erkannte Carmen von dem kleinen Profilbild ihres Instagram-Kontos wieder. Mehr öffentliche Infos hatte sie über die junge Frau, die sie treffen wollte, nicht gefunden.
Emma winkte.
Carmen kam langsam auf sie zu. Emma lächelte sie an und streckte die Hand aus, die ihr Gegenüber vorsichtig mit dünnen, warmen Fingern ergriff.
»Entschuldigen Sie die Verspätung«, sagte sie. »Mama, sie …«
Carmen stockte.
Das Mädchen vor Emma hatte blonde, lange Haare und ein rundes, fülliges Gesicht mit ausgeprägten Hautirritationen. Um den Mund eine Art Ausschlag, im übrigen Gesicht aufgekratzte Pickel mit frischen, dunkelroten Schorfhauben. Der Fluch der Pubertät. Eine grauenvolle, unbarmherzige Zeit – in vielerlei Hinsicht.
»Kein Problem«, sagte Emma besänftigend. »Wollen wir uns setzen?«
Emma zeigte zu der Bank, von der sie sich gerade erhoben hatte. Carmen setzte sich und legte die Hände in den Schoß. Verschränkte die Finger, schob einen in den Mund, kaute auf dem Nagel herum. Zog ihn heraus und musterte ihn.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie, ohne Emma anzusehen. »Ich … war mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffe.«
Carmen wirkte verlegen, unsicher. Emma hatte in ihrer Jugend viele Mädchen wie sie erlebt, nicht zuletzt bei jedem Blick in den eigenen Spiegel.
»Wie kann ich dir helfen?«, fragte sie.
Die junge Frau wartete kurz.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragte sie schließlich und vergrub die Hände in den Taschen des Hoodies.
Emma nickte. »Ungefähr.«
»Dann wissen Sie auch, was mit meinem Stiefvater passiert ist? Oliver Krogh?«
»Das war kaum zu umgehen«, sagte Emma.
Oliver Krogh saß in Untersuchungshaft, weil er verdächtigt wurde, eine Freundin aus der Kindheit umgebracht zu haben. Ende Juli war das Bull’s Eye, Kroghs Jagd- und Fischereigeschäft, bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Anfangs war man davon ausgegangen, dass Maria Normann, die für ihn gearbeitet hatte, im Laden gewesen war und dass Krogh das Feuer selbst gelegt hatte.
Maria Normann war bis heute nicht aufgetaucht, aber wenige Tage nach dem Brand war Krogh trotzdem festgenommen worden.
Die Medien hatte noch keine Anhaltspunkte für das Motiv der Tat. Vorläufig war noch keine Anklage erhoben worden, es wies aber alles darauf hin, dass das bald passieren würde.
»Er ist unschuldig.«
Carmen nahm ein rundes dunkelblaues Döschen aus der einen Tasche und schraubte den Deckel ab. Sie tippte den kleinen Finger hinein und verrieb die feuchtigkeitsspendende Substanz auf den trockenen Lippen.
»Mein Stiefvater könnte niemals jemanden umbringen«, sagte sie und steckte das Döschen zurück in die Tasche.
»Woher willst du das wissen?«
»So ist er nicht.«
Carmen schüttelte den Kopf. Emma sah, dass sie die Tränen nicht mehr lange würde zurückhalten können.
»Was sagt er selbst zu dem Vorfall?«, fragte Emma.
»Er leugnet natürlich.«
»Hat er irgendeine Idee, wer der Täter sein könnte?«
Sie zögerte einen Moment, dann schüttelte sie den Kopf.
»Wir … haben mit dem Anwalt zusammen überlegt, einen Privatdetektiv zu engagieren, aber Mama … wollte das nicht.«
»Warum nicht?«
»Sie meinte … das würde zu teuer werden. Aber der Hauptgrund war wohl …«
Carmen senkte den Kopf und begann, leise zu weinen.
»Tut mir leid«, entschuldigte sie sich, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte.
»Nicht doch«, sagte Emma und legte eine Hand auf Carmens Arm. »Du musst dich für nichts entschuldigen.«
Carmen wischte die Tränen weg.
»Sie waren dabei, sich zu trennen, glaube ich, schon vor der ganzen Sache. Und nachdem er festgenommen wurde …« Sie schüttelte den Kopf. »Kurz darauf hat sie die Scheidung eingereicht. Ich glaube, sie war froh, einen Grund zu haben. Das hat es wohl leichter gemacht.«
»Leichter, sich von ihm zu trennen, meinst du?«
»Ja.«
»Das heißt, deine Mutter glaubt ihm nicht?«
Carmen seufzte. »Sieht nicht so aus.«
Sie saßen schweigend nebeneinander.
»Dann … weiß deine Mutter nicht, dass du hier bist?«, fragte Emma. »Dass du mich kontaktiert hast?«
Carmen sah Emma von der Seite an und schüttelte den Kopf.
»Sind Ihre Eltern noch zusammen?«, fragte sie nach einer Weile.
Emma überlegte, was sie darauf antworten sollte. Dass ihr Vater ihre Mutter erschossen hatte, gehörte nicht zu den Dingen, die sie an die große Glocke hängte. Sie begnügte sich mit einem Kopfschütteln.
»Carmen, bevor wir weiterreden: Du weißt schon, dass ich nicht mehr als Journalistin arbeite, oder?«
»Ja, das ist mir klar.«
»Und trotzdem willst du mit mir reden?«
Auf einem Rasenstück ein Stück entfernt stritten ein paar Möwen um etwas Essbares. Es war nicht zu erkennen, wer als Sieger hervorging.
»Niemand will ihm helfen«, sagte Carmen. »Die Polizei scheint davon überzeugt zu sein, dass er der Täter ist. Er steht ganz allein da.«
Emma ging davon aus, dass die junge Frau vor ihr schon andere, profiliertere Journalisten kontaktiert hatte.
»Ich habe im Internet etwas über Sie gelesen«, fuhr Carmen fort. »Da stand, dass Sie einen Recherchepreis bekommen und keine Angst vor schwierigen, unbeliebten Fällen haben.«
Emma fühlte sich nicht ganz wohl in der Situation, musste aber zugeben, dass Carmens Anruf und Oliver Kroghs Fall ihre Neugier geweckt hatten. Als Journalistin hatte sie überbordender und einseitiger medialer Berichterstattung immer kritisch gegenübergestanden.
»Ich weiß, dass ich um sehr viel bitte«, sagte Carmen. »Und ich kann Sie noch nicht mal bezahlen. Aber mir fällt sonst keiner ein, an den ich mich wenden könnte.«
Emma wusste nicht, was sie sagen sollte. Nachdem sie in ein Treffen mit ihr eingewilligt hatte, war es schwer, sie jetzt abzuweisen.
»Die Polizei hat noch keine Spur von Maria Normann«, sagte sie. »Trotzdem sitzt dein Stiefvater noch immer in Untersuchungshaft. Das kann eigentlich nur heißen, dass die Polizei Beweise oder Indizien hat, die ihn als Schuldigen ausweisen.« Emma hatte keine Details dazu finden können. »Wurden die nächsten Angehörigen, also du und deine Mutter, informiert?«
Carmen starrte vor sich hin.
»Wir bekommen kaum Informationen«, sagte sie.
Emma wartete, bis sie weitersprach.
»Sie … haben Blutspuren gefunden«, sagte Carmen mit brüchiger Stimme.
»Blut?«, fragte Emma.
»Marias Blut«, sagte Carmen. »In der Ruine von Olivers Geschäft.«
6
Unten an der Tür grüßte ihn eine Nachbarin, aber Blix ging wortlos an ihr vorbei und direkt hoch in den zweiten Stock.
In der Wohnung kam Terry ihm entgegen. Blix ignorierte ihn, ging zielstrebig weiter in die Küche und nahm sein Handy.
Ein weiterer verpasster Anruf von einer unbekannten Nummer, die er also nicht zurückrufen konnte. Fluchend setzte er sich auf einen Küchenstuhl und legte Bild und Umschlag vor sich auf den Tisch. In der Mitte des Fotos war ein kleines Loch, als hätte es an einer Pinnwand gehangen. Die Stecknadel hatte Elisabeth Eies Kopf durchbohrt.
Er stand auf, ging zum Waschbecken und suchte im Schrank darunter nach Gummihandschuhen. Als er keine fand, nahm er zwei Gefrierbeutel und schob den Umschlag in den einen und das Foto in den anderen, ohne sie weiter zu kontaminieren.
Er war damals der leitende Ermittler in der Eie-Sache gewesen.
Von Anfang an ein merkwürdiger Fall. Zwei Beamte hatten auf dem Weg aus dem Parlamentsgebäude unter dem Scheibenwischer ihres Fahrzeugs einen großen Umschlag gefunden. Blix’ Name und Dienstgrad hatten darauf gestanden, darunter ein Vermerk, dass der Inhalt persönlich sei und eile.
Eine Stunde später lag der Umschlag auf Blix’ Schreibtisch. Auf einem großen, weißen Blatt Papier hatte gestanden: Irgendwas stimmt nicht mit Elisabeth Eie. Daneben waren ihre Adresse und ihr Geburtsdatum notiert, damit keine Zweifel aufkamen, wer gemeint war.
Blix hatte eine Streife zu ihrer Adresse geschickt, die die Wohnung leer vorgefunden hatte. Sieben Stunden zuvor hatte Elisabeth Eie ihre Tochter in den Kindergarten gebracht und danach einen Sachbearbeiter des Jugendamts getroffen. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hatte.
Blix stützte sich auf der Tischplatte ab und starrte auf das Foto. Die Haare lagen wirr in alle Richtungen. Die Augen waren weit geöffnet, und die Gesichtshaut schimmerte bläulich. Es war offensichtlich, dass sie tot war, aber nicht, wie sie zu Tode gekommen war.
Der Untergrund, auf dem sie lag, war dunkel, vielleicht braun. Möglicherweise ein Kellerboden, dachte Blix, oder eine Decke. Weitere Details, denen er entnehmen konnte, wo das Bild aufgenommen war, gab es nicht.
Er drehte das Foto um und sah auf die Rückseite. Über das Loch in der Mitte war ein dickes schwarzes Kreuz gemalt. Rundherum waren drei kleinere Kreuze verteilt. Das sagte ihm nichts.
Elisabeth Eie stammte aus Lillestrøm, hatte aber an verschiedenen Orten gewohnt. Sie hatte als Vertretungslehrerin an einer Vorschule gearbeitet. Ihre Tochter Julie stand unter der Aufsicht des Jugendamts. Der Vater war ein vierzigjähriger Sozialhilfeempfänger, den das Amt für nicht geeignet gehalten hatte, sich um das Kind zu kümmern. Sein Name war Skage Kleiven.
Zu Beginn richteten sich die routinemäßigen Ermittlungen gegen ihn, aber Kleivens kranker Vater war zwei Tage vor Eies Verschwinden gestorben, und Kleiven war mit der Beerdigung und allem anderen, was anstand, beschäftigt gewesen. Er hatte diverse Termine mit dem Bestatter als Alibi vorweisen können.
Blix hielt das Foto ins Licht, das durch das Fenster fiel, und sah es sich genauer an. Elisabeth Eie hatte hellblaue Augen und lange, gebogene Wimpern, dünne Augenbrauen und eine markante, kräftige Nase. Ihr Mund stand halb offen, als schnappte sie nach Luft.
Er zuckte zusammen, als das Telefon klingelte.
Wieder die unbekannte Nummer.
Blix meldete sich mit vollem Namen.
»Sie haben es also gefunden«, konstatierte eine raue Stimme.
Blix ging ans Fenster und sah nach draußen.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das einfach so sage?«
»Sie haben gesagt, dass Sie ein Geständnis ablegen wollen.«
»Das ist richtig«, sagte der Mann. »Das habe ich gesagt.«
»Ich arbeite nicht mehr bei der Polizei«, sagte Blix.
»Ich weiß.«
»Sie müssen sich bei denen melden.«
Der Mann blockte ab.
»Das ist eine Sache zwischen uns«, sagte er.
Blix dachte nach.
»War der Brief damals von Ihnen?«, fragte er. »Der Umschlag mit meinem Namen?«
Es kam keine Antwort.
»Ist das Foto echt?«, fragte Blix weiter.
Der Mann am anderen Ende wirkte überrascht.
»Finden Sie etwa nicht, dass es echt aussieht?«
Blix blieb ihm die Antwort schuldig.
»Ich habe es an dem Morgen aufgenommen, an dem ich sie getötet habe«, fuhr der Mann fort.
Blix atmete tief ein.
»Warum haben Sie das getan?«, fragte er. »Warum haben Sie sie getötet?«
Die Antwort kam schnell: »Weil sie es verdient hat.«
»Warum?«, wiederholte Blix. »Was hat sie getan?«
Am anderen Ende blieb es still.
»Wer sind Sie?«, versuchte Blix es mit mehr Druck. »Wie heißen Sie?«
Hinter dem Schweigen hörte er ein Geräusch, das er aber nicht identifizieren konnte.
»Was hatten Sie für eine Beziehung zu Elisabeth Eie?«
Der Mann antwortete auch dieses Mal nicht.
»Wie haben Sie sie überwältigt?«
Keine Antwort.
»Wo …«
Blix räusperte sich.
»Sie haben gesagt, dass Sie gestehen wollen«, sagte er. »Aber Sie sagen nichts.«
»Och, ich finde, dass ich schon eine ganze Menge gesagt habe«, antwortete der Mann schließlich.
Blix drehte das Foto um.
»Was bedeuten die Kreuze?«, fragte er.
»Das erzähle ich Ihnen ein andermal«, antwortete der Mann. »Falls notwendig.«
»Wie meinen Sie das?«
Wieder keine Antwort.
»Warum melden Sie sich jetzt?«, fuhr Blix fort. »Und warum ist es Ihnen so wichtig, das Geständnis gerade mir zu machen?«
Der Mann schwieg weiter.
»Sind Sie es, der mich verfolgt?«
Stille.
Beim Gedanken an den Mann in der grünen Regenjacke wurde Blix heiß und kalt.
»Ich habe Sie heute Morgen gesehen«, sagte er. »Und Sie mich auch. Deshalb sind Sie in die U-Bahn verschwunden.«
Es kam kein Widerspruch.
»Okay«, sagte Blix, wohl wissend, dass er so nicht weiterkam. »Was soll ich mit den Informationen von Ihnen machen?«
»Das müssen Sie selbst herausfinden.«
Blix holte tief Luft. Das hätte auch Krissander Dokken gesagt haben können.
»Ein Foto reicht nicht«, sagte er. »Ich muss wissen, wo sie ist.«
»Sie sollten nicht einfach wegwerfen, was man Ihnen mit der Post schickt, Alexander.«
»Das sagten Sie bereits.«
»So hätten Sie nämlich auch die anderen Fotos gesehen, die ich Ihnen anvertraut habe.«
Es lief Blix kalt den Rücken herunter.
»Wie meinen Sie das … andere Fotos? Andere Fotos von Elisabeth, oder …?«
Blix schluckte.
»Oder haben Sie mir auch Fotos von anderen Frauen geschickt, die Sie …?«
Es kam keine Antwort.
Die Leitung war tot.
Blix brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln und alles, was er gehört hatte, noch einmal durchzugehen. Sein Puls war noch immer hoch, als er Nicolai Wibes Nummer wählte, aber der Kommissar ging nicht ans Telefon. Auch Tine Abelvik war nicht zu erreichen.
»Jetzt komm schon«, rief er gereizt und schickte beiden eine SMS, in der er sie um Rückruf bat. Es geht um Elisabeth Eie, fügte er hinzu. Ich habe neue Informationen.
Er machte Fotos von der Vorder- und Rückseite der Fotografie und schickte sie ihnen. Tine Abelvik rief nur Sekunden später zurück.
»Blix«, sagte sie. »Hallo.«
Sie klang müde. Erschöpft.
»Hallo«, erwiderte er.
»Wie … geht es dir?«
»Hast du die Fotos bekommen?«
»Äh, ja.«
Blix gab ihr in der nächsten halben Minute eine kurze Zusammenfassung, was geschehen war. Er sprach schnell und vergaß fast zu atmen.
»Du erinnerst dich an den Fall?«, fragte er, als er fertig war. »Eine Zeit lang haben wir uns mit nichts anderem befassen können.«
»Natürlich erinnere ich mich daran«, antwortete Abelvik merkwürdig distanziert, als hätte sie den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen.
»Ich glaube, es ist derselbe Mann«, sagte Blix. »Der den Brief geschrieben hat, durch den die Ermittlungen nach ihrem Verschwinden überhaupt erst ins Rollen gekommen sind.«
»Du hast ihn nicht wiedererkannt?«, fragte Abelvik. »Ich meine, die Stimme kam dir nicht bekannt vor?«
Blix verneinte. Er hatte es versucht, sie aber nicht zuordnen können.
»Er hat sie irgendwie verstellt«, erklärte er.
Abelvik zögerte.
»Okay«, sagte sie schließlich. »Wir lassen das Foto analysieren, um zu sehen, ob es echt ist.«
»Auf mich wirkt es echt«, sagte Blix. »Warum sollte jemand so etwas erfinden?«
»Der anonyme Brief war in den Medien damals eine große Sache«, antwortete Abelvik. »Das war dein Fall, bevor all das andere geschah … Inzwischen hast du Promistatus. Und Promis ziehen nicht selten unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich, häufig von Menschen, die ein verdrehtes Bild von der Wirklichkeit haben.«
Blix war sich nicht sicher, ob er richtig hörte.
»Ihr müsst das ernst nehmen«, protestierte er.
»Das werden wir«, versicherte ihm Abelvik. »Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mörder sich plötzlich meldet, um seine Tat zu gestehen? Wäre eine verwirrte Person nicht die realistischere Erklärung?«
Das eine schließt das andere nicht aus, dachte Blix.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte er. »Nichts? Sollen wir einfach abwarten?«
»Ich schicke eine Streife zu dir nach Hause«, antwortete Abelvik. »Um das Foto zu holen.«
Eine Streife, dachte Blix. Sie kommt also nicht mal selbst.