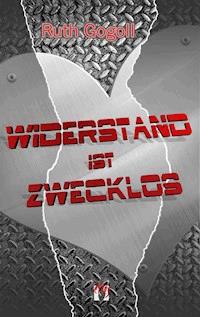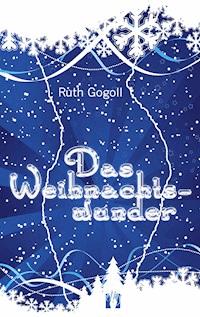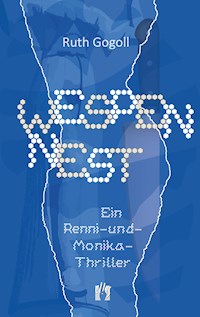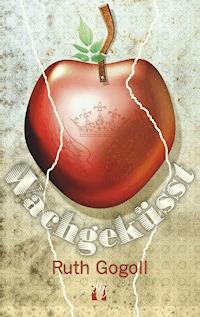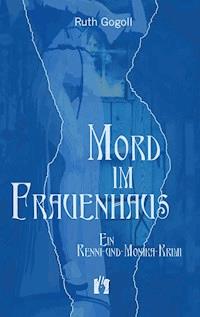Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Renni-und-Monika-Krimis
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Renni hat wieder einen neuen Fall zu lösen: Wer ist die tote Frau auf dem Parkplatz? Die Ermittlungen erweisen sich als schwieriger als zunächst angenommen, und darüber hinaus geht es auch in ihrem Privatleben drunter und drüber: Obwohl immer noch verliebt in Nora, beginnt sie eine Affäre mit der Pathologin, mit der zusammen sie an der Aufklärung des Mordes arbeitet. Probleme über Probleme für Renni - schafft sie es diesmal, alle zu meistern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Gogoll
TÖDLICHE LIEBESSPIELE
Fortsetzung des Romans»Computerspiele«
© 1999 3. Auflage 2022édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Was bisher geschah
Kommissarin Renni Schneyder ist schon seit ihrer Kindheit hoffnungslos in ihre ehemalige Mitschülerin Nora verliebt. Nora wusste von diesen Gefühlen nichts, für sie war Renni immer nur die gute Freundin, die ihr bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stand – eine äußerst undankbare Rolle für die Kommissarin. Renni ist daher gar nicht erfreut, als Nora ihr eines Tages ihre neue Freundin Ellen vorstellt. Als Ellen des Mordes an ihrer Ex-Freundin verdächtigt wird, schaltet sich Renni trotzdem auf Noras Bitte hin in die Ermittlungen des Falles ein. Bei ihren Nachforschungen stellt sich letztendlich heraus, dass der Verdacht der Polizei gar nicht so unbegründet war. Ellen kann jedoch fliehen und lässt eine völlig verzweifelte Nora mit einem gebrochenen Herzen zurück. Endlich findet Renni den Mut, Nora ihre Liebe zu gestehen. Diese reagiert ganz anders als erwartet . . .
Wohin sollte das führen?
Noras Lippen kamen immer näher, und ich konnte ihr in meiner Erstarrung nicht ausweichen. Jahrelang hatte ich darauf gewartet, seit meiner Kindheit – oder spätestens seit der Pubertät – hatte ich mir gewünscht, dass sie mich endlich als Frau, als mögliche Geliebte wahrnehmen würde.
Es war immer ein unerfüllbarer Wunsch gewesen. Etwas, wovon man träumt, das aber nie passiert. Und nun auf einmal geschah es. Eben noch hatten wir uns über ihre Ex-Geliebte Ellen unterhalten, und ich war nur die Seelentrösterin gewesen. Vielleicht war ich das immer noch – nur. Aber die Art des Trostes, die Nora von mir verlangte, hatte sich in den letzten Minuten extrem gewandelt und in eine Richtung entwickelt, mit der ich einfach nicht gerechnet hatte, mit der ich nicht rechnen konnte.
Was sollte ich nur tun? Ich wusste, dass ich mir etwas erträumte, was nie in Erfüllung gehen würde. Ich hatte es über Jahre gelernt. Seit meinem zwölften Lebensjahr hatte ich diese Überzeugung genährt. Bislang hatte Nora sich auch nie bemüht, etwas daran zu ändern. Sie hatte mich kaum wahrgenommen – jedenfalls nicht so, wie ich es mir wünschte. Ich war eine von mehreren Freundinnen, mit denen sie etwas unternahm, sich ab und zu traf oder etwas trinken ging. So war es gewesen, fast mein ganzes Leben lang, und so sollte es auch bleiben, verlangte das Gewohnheitsrecht in mir. Wo kommen wir denn da hin, wenn sich plötzlich alles ändert? Wenn sich das, worunter wir leiden, plötzlich in Freude verwandelt? Nein, so ging das nicht!
Ich hob meine Hände und hielt Nora auf. »Nicht«, sagte ich leise.
Nora sah mich fragend an. »Warum nicht? Was ist los? Habe ich mich geirrt?«
Sie hatte gerade erst geglaubt, in meinen Augen zu entdecken, was ihr jahrzehntelang verborgen geblieben war: meine Liebe zu ihr. Es würde leicht sein, sie jetzt davon zu überzeugen, dass sie sich geirrt hatte. Wollte ich das?
Ein Teil von mir wollte es sicher. Ein Teil von mir wollte, dass alles so blieb, wie es war. Aber ein anderer Teil hatte sich schon zu sehr darauf gefreut, nun endlich der Erfüllung nah zu sein. Der Erfüllung aller Träume und Sehnsüchte der letzten Jahre. Dieser Teil in mir würde sich nicht so leicht enttäuschen lassen wollen. Er würde kämpfen. Und da ich eine geübte Kämpferin war, würde es ein harter Kampf mit mir selbst werden. Aber vielleicht war das ja auch gar nicht nötig.
»Nein, du hast dich nicht geirrt. Ich liebe dich – schon ewig. Schon seit wir zusammen zur Schule gegangen sind.« Ich suchte Noras Blick und wartete auf ihre Reaktion.
»So lange schon?«, fragte sie ungläubig. »Und ich habe es nie bemerkt.«
»Ja, hast du nicht. Du warst mit anderen Frauen beschäftigt. Wie solltest du es da merken? Ich war ja einfach immer nur so da.« Ich hatte mich ihretwegen sogar in eine andere Stadt versetzen lassen, in die Stadt, in der sie wohnte. Das hatte sie natürlich für Zufall gehalten.
»Meine Güte!« Nora schüttelte erstaunt den Kopf. »Warum hast du nie etwas gesagt? So viele Jahre –« Sie konnte es sich anscheinend überhaupt nicht vorstellen.
»Ja.« Ich drehte mich um und ging zum Tisch, um mich zu setzen. »Und ich hätte es dir auch jetzt nicht gesagt, wenn du es nicht selbst bemerkt hättest.«
Nora kam auf mich zu und blieb vor mir stehen. Ich sah von dem Küchenstuhl hoch, auf dem ich saß. »Nora, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und glaub mir, es gibt niemand, die das mehr bedauert als ich. Aber du trauerst immer noch um Ellen. Es ist schließlich erst ein paar Tage her, seit sie weg ist. Und der Schock, dass sie eine Mörderin ist, dass sie dir diesen Mord sogar gestanden hat, sitzt immer noch tief in dir drin. Das verläuft sich nicht in ein paar Tagen. Bitte lass dir Zeit, bevor du etwas Neues anfängst. Ich habe so lange gewartet, ich kann auch noch länger warten. Und wenn du dann in ein paar Wochen oder Monaten feststellst, dass es nur deine momentane Verfassung war, die dich dazu gebracht hat, mich küssen zu wollen, dann ist eben wieder alles wie vorher. Es wird sich nichts ändern zwischen uns.« Das war eine lange Rede für meine Verhältnisse. Sie entstand wahrscheinlich aus dem Gefühl heraus, dass ich nicht wusste, wovor ich mehr Angst hatte: dass Nora feststellen würde, dass sie sich geirrt hatte, oder dass sie feststellen würde, dass sie sich nicht geirrt hatte.
»Es hat sich schon alles geändert zwischen uns, Renni. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Das weißt du genauso gut wie ich.« Sie stand vor mir und sah immer noch wie eine verhinderte Boxerin aus: Ihr Gesicht war verschwollen von tagelangem Heulen, seit Ellen sich verflüchtigt hatte. Aber der Ausdruck ihrer Augen war nicht mehr der eines verwundeten Rehs, wie noch vor wenigen Minuten. Sie hatte sich gefangen und konzentrierte sich jetzt mehr auf mich als auf ihre tiefsitzende Enttäuschung und den Schock, den Ellen ihr durch ihr Mordgeständnis verpasst hatte. Gut oder schlecht für mich? Das würde sich weisen.
»Das weiß ich. Davor hatte ich Angst. Jetzt, wo du Bescheid weißt, wirst du mich vielleicht bald nicht mehr sehen wollen. Wir werden vielleicht nicht mehr unverkrampft zusammen sein können.« Das hoffte und fürchtete ich. Wenn sie meine Zuneigung zurückweisen würde, wäre eine Freundschaft wie bisher sicher nicht mehr möglich. Jede von uns würde wissen, dass die andere es wusste. Wenn aber nicht? Wenn sie meine Zuneigung annahm – was sollte ich dann machen? Das war ja fast noch schlimmer! Dann musste ich zu meinen Gefühlen stehen, die ich so lange versteckt hatte. Ich wusste nicht, ob ich das konnte.
Nora strich mit ihrer Hand über mein Gesicht. »Ich fühle mich eigentlich gar nicht verkrampft. Du etwa?« Sie grinste ein wenig. Ihre Berührung ließ meinen ganzen Körper erschaudern, obwohl sie nichts weiter als meine Wangen gestreichelt hatte. »Aber wenn du so viele Einwände hast . . .« Sie drehte sich um und setzte sich mir gegenüber an den Küchentisch.
Einwände? Ja, ich hatte Einwände, aber immerhin war es Nora gewesen, die es fertiggebracht hatte, mehr als ihr halbes Leben lang über die Liebe einer Frau hinwegzusehen, die fast immer in ihrer Nähe war. Sollte das jetzt alles auf einmal nicht mehr wahr sein? War meine Liebe stark genug für uns beide, und Nora brauchte sich um ihre gar keine Gedanken mehr zu machen? Das erschien mir dann doch zu einfach.
»Nora, ich möchte die Sache einfach nicht so übers Knie brechen. Lass uns noch ein bisschen warten, ja? Du bist jetzt verwirrt, du hast einen Schock erlitten, du bist müde und erschöpft. In einem solchen Zustand kann man die Dinge manchmal nicht richtig beurteilen.«
»Zu Befehl, Frau Kommissarin«, erwiderte Nora lächelnd. »Du hast ja recht. Aber Renni –« Sie brach ab und sah mich eine Minute lang nachdenklich an. Eine Minute kann schrecklich lang sein! »Ich kenne dich schon fast mein ganzes Leben, und trotzdem kenne ich dich anscheinend überhaupt nicht. Als Ellen –« Sie stockte. Die Erinnerung an Ellen würde ihr noch eine geraume Weile furchtbar wehtun, doch Nora gab sich einen Ruck und sprach weiter. »Als Ellen in Köln des Mordes verdächtigt wurde, fiel mir nur ein Name ein: deiner. Ich war sofort überzeugt, dass du helfen könntest. Nicht nur, weil du Polizistin bist, sondern auch, weil ich wohl tief in meinem Innern gespürt habe, dass du mich nie im Stich lassen würdest, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe deine Liebe zwar vielleicht nicht bewusst wahrgenommen, aber unbewusst wusste ich genau: Wenn ich ein Problem habe, kann ich immer Renni fragen.« Sie lachte ein wenig. »Das war übrigens schon in unserer Schulzeit so.« Sie sah mich lächelnd an. »Und da hast du etwas nicht mitbekommen. Ich hatte oft das Bedürfnis, dich etwas zu fragen, dich häufiger zu sehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich deshalb anzusprechen. Nachdem du die Jungs verprügelt und mich rausgehauen hattest –«
»Du hast dich selbst rausgehauen«, widersprach ich. Für einen Moment erinnerte ich mich an die Situation damals. Wir waren beide nicht älter als zwölf gewesen, Nora und ich, gingen in dieselbe Klasse und kannten uns trotzdem kaum. Aber eines Tages war sie von mehreren Jungs auf dem Schulweg überfallen worden, und als ich das sah, hatte ich mich auf die Übeltäter gestürzt, und wir hatten sie gemeinsam vertrieben. Erst danach waren wir in gewisser Weise Freundinnen geworden.
Nora schüttelte den Kopf. »Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Die waren zu dritt, und ich war allein. Obwohl ich sehr wütend war. Ich habe dir nie erzählt, was in dem Schuhkarton war, oder?«
Die Jungs hatten Nora einen Schuhkarton vor die Nase gehalten, bevor die Keilerei losgegangen war. Ich hatte später dann nie mehr daran gedacht zu fragen. Deshalb schüttelte ich nun den Kopf.
»In dem Schuhkarton war ein junger Vogel. Und als sie ihn mir gezeigt hatten und ich ihn streicheln wollte, hat ihn der Anführer einfach herausgenommen und ihm den Hals umgedreht. Vor meinen Augen. Da habe ich rot gesehen und zugeschlagen. Aber ich hatte keine Chance gegen die drei. Wenn du nicht gekommen wärst, hätte das übel ausgehen können.« Sie sah mich dankbar an. »Danach jedenfalls habe ich dich sehr bewundert, weil du so stark warst. Ich wäre gern genauso gewesen, aber ich war es nicht. Und gerade weil du so stark warst, habe ich immer gedacht, dir würde nichts an einer näheren Bekanntschaft mit mir liegen. Ich gehörte ja immer zu den schwachen, albernen Mädchen, die du nicht mochtest.«
»Du warst nicht wie sie – und sie mochten mich nicht«, wiederholte ich. Das hatte ich ihr schon mal gesagt – in unserer Kindheit.
Nora lachte wieder ein wenig. »Das stimmt nicht ganz. Sie hatten hauptsächlich Angst vor dir, und sie wussten nichts mit dir anzufangen. Du warst die einsame Heldin auf dem Schulhof, die niemand brauchte, um sich zu verteidigen, die alles allein bewältigen konnte. Du hast sie verunsichert. Und mich auch.«
»Dich auch?« Der Gedanke war mir nie gekommen. Sie hatte immer so zufrieden gewirkt.
»Ja, mich besonders. Weil du mir geholfen hattest und trotzdem hinterher immer noch distanziert warst. Ich kam nicht an dich heran.«
Sie kam nicht an mich heran? Wieso hatte ich ihre Versuche nie registriert? Ich war völlig überfordert von Noras Geständnissen. »Hättest du das denn gewollt?« Ich hatte doch nur meine Liebe zu ihr versteckt! Ich hatte befürchtet, dass sie mich auslachen würde, dass sie meine Zuneigung nicht wollte, deshalb hatte ich mich zurückgehalten.
»Ja, eigentlich schon. Ich hätte dich sehr gern näher kennengelernt. Aber du warst immer so abweisend. Du kamst nie von selbst. Immer musste ich dich einladen. Und dann hast du oft in der Ecke gesessen und deutlich gezeigt, wie sehr dich dieser ›Mädchenkram‹ langweilt.« Sie lächelte ein bisschen unsicher. »Ich bin zu schüchtern, um ständig auf jemand zuzugehen, das solltest du eigentlich wissen, so lange, wie wir uns schon kennen.«
Ich war schuld? Ich war schuld, dass Nora und ich nie ein Paar oder zumindest enge Freundinnen geworden waren? Das versetzte mir einen ziemlichen Schlag. »Ich dachte, du warst lieber mit den anderen zusammen als mit mir. Ich wollte mich nicht aufdrängen«, murmelte ich leise. »Ulrike zum Beispiel –« Ulrike war ihre ›beste Freundin‹ in der Schule gewesen.
»Ulrike war ein nettes Mädchen, aber nicht halb so interessant wie du. Sie hat sich nicht vor mir versteckt, deshalb war es für mich wesentlich einfacher, mit ihr befreundet zu sein als mit dir. Du wolltest ja anscheinend nicht.« Sie provozierte mich ein wenig mit ihrem Blick.
Ich hatte natürlich gewollt! Aber ich hatte angenommen, Nora wollte nicht. »Ich dachte, du willst lieber mit ihr befreundet sein, weil ihr so viele gemeinsame Interessen hattet«, versuchte ich, mich herauszureden.
»Die Geschichte unserer Freundschaft ist eine Geschichte von Missverständnissen!«, lachte Nora, die bekannte Tampon-Werbung persiflierend, doch mitten im Lachen fasste sie sich mit einer Hand an die Stirn. »Ich glaube, ich sollte nicht lachen. Ich habe wohl doch etwas zu viel getrunken in letzter Zeit.« Sie verzog das Gesicht. »Dafür habe ich seit Montag so gut wie nicht geschlafen, das gleicht es wieder aus, nicht wahr?« Sie sah mich etwas zerknittert an.
»Das solltest du jetzt aber schleunigst nachholen«, verlangte ich und stand auf. »Reden können wir immer noch.« Wenn sie dann überhaupt noch reden wollte! Ich würde die Entscheidung ihr überlassen.
Sie konnte die Augen kaum mehr offen halten. Einerseits, weil sie so zugequollen waren vom früheren Weinen und andererseits, weil die Müdigkeit jetzt wirklich das Kommando in ihrem Körper übernommen hatte, nach all dem Alkohol und Schlafentzug seit Montag, immerhin war nun schon Freitag. Langsam erhob sie sich von ihrem Stuhl. »Ich danke dir, Renni. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist.« Sie ging ebenso langsam, wie sie sprach, an mir vorbei und legte mir kurz die Hand auf die Schulter. »Und über das andere reden wir bestimmt noch. Jetzt kommst du mir nicht mehr so leicht davon!« Sie versuchte zu grinsen, aber sie schaffte es nicht mehr. Sie war einer Ohnmacht nahe.
Ich stützte sie ein wenig. »Ja, sicher. Komm, ich bringe dich noch ins Bett, und dann schläfst du erst mal.«
Sie nickte nur ganz angedeutet, und ich legte ihren Arm über meine Schulter und brachte sie ins Schlafzimmer. Die Tür stand auf, so musste ich nicht fragen, wo es ist, denn solange wir uns auch kannten, ich hatte es noch nie gesehen. Wir gingen hinein, sie legte sich hin, und ich zog ihr die Schuhe aus. Sie schlief schon, als ich sie wieder ansah. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen: Ich mit Nora in ihrem Schlafzimmer und dann so was! Tja, wie das Leben so spielt! Ich drehte mich um und verließ ihre Wohnung. Alles andere konnte warten.
Am nächsten Tag war Samstag, und ich hörte nichts von Nora. Ich nahm an, dass sie den ganzen Tag durchschlief, und ich wollte sie nicht anrufen, um sie nicht eventuell zu wecken, aber ich machte mir schon Gedanken über unser Gespräch. Warum hatte ich nicht den Mund halten können? Sie war doch gar nicht in der Verfassung gewesen, darauf zu beharren. Wenn ich ihr nicht gesagt hätte, dass ich sie liebte, hätte sie es nie erfahren. Ich Dummkopf! Jetzt würde ich sie sogar noch als Freundin verlieren, wenn ich Pech hatte. Und warum sollte ausgerechnet ich einmal Glück haben? Das war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen.
Der Samstag ging mit den üblichen Nicht-Tätigkeiten dahin. Ein Blick in den Kühlschrank, ach was, ich muss nicht einkaufen, ich kann mir ja eine Pizza auftauen, und damit war die Entscheidung, das Haus nicht zu verlassen, auch schon gefällt. Es fiel mir schwer, darüber nachzudenken, warum ich meine Wochenenden häufig so verbrachte. Irgendwie hatte ich keinerlei Antrieb, wenn ich nicht zum Dienst musste, Verbrecher jagen oder Akten wälzen. Oft fiel es mir sogar schwer zuzusagen, wenn ich eingeladen wurde, zu einem Essen, einer Fete oder einem Spaziergang. Manchmal nahm ich nicht einmal das Telefon ab, wenn es klingelte. Eigentlich war es meine Pflicht als Polizistin, das auch in meiner dienstfreien Zeit zu tun, aber ich ignorierte es einfach. Bislang war in diesem ruhigen Eck des Landes noch nie ein so dringender Mordfall vorgekommen, dass es aufgefallen wäre, wenn eine Kommissarin der Mordkommission einmal nicht erreichbar war.
Vielleicht war das mein Problem: Ich fühlte mich oft unterfordert, und privat war ich allein, jedenfalls, was eine Beziehung anging. Nur die Pseudobeziehung zu Nora, die lediglich in meinem Kopf existierte, schaffte dazu einen Ausgleich.
Ich hätte kaum sagen können, wie der Tag verlaufen war, als er zu Ende ging, so ereignislos war er gewesen. Wenn nicht die Aktivität meiner Gedanken ein wenig Aufmerksamkeit gefordert hätte, hätte ich genauso gut den ganzen Tag durchschlafen können.
Am Sonntag wachte ich auf und merkte, dass sich etwas veränderte. Die ganze Schwere des vergangenen Samstags schien wie fortgeblasen. Ich erinnerte mich an den Sonntag, an dem ich Ellen und Nora zum ersten Mal zusammen gesehen hatte, es schien eine Ewigkeit her zu sein, und doch waren es erst gut zwei Monate. Was war in diesen beiden Monaten nur alles passiert . . . Und wie hatte sich in den letzten Tagen alles verwandelt . . .
Ich erinnerte mich daran, wie grau mir der Tag damals erschienen war, als ich Nora und Ellen beim Sonntagsfrühstück zufällig im Café traf. Die Sonne hatte geschienen, aber ich hätte schwören können, dass mich kein einziger Strahl traf. Ich nahm die Wärme und das Licht noch nicht einmal wahr. Dann ging einen kleinen Moment für mich wirklich die Sonne auf, als ich Nora entdeckte, und gleich darauf schob sich eine schwarze Wolke dazwischen, als Ellen dazukam, die ich damals noch nicht einmal kannte. Es war so deutlich zu erkennen gewesen, dass Nora unsterblich in Ellen verliebt war, dass ich meine Eifersucht kaum bezähmen konnte. Und nun war Ellen fort, eine Mörderin auf der Flucht, und meine Sonntage schienen auf einmal nicht mehr so grau zu sein. Dieser hier zumindest nicht – der erste Sonntag nach dem Tag, an dem ich Nora meine Liebe gestanden hatte . . .
Fast mein ganzes Leben lang – zumindest mein erwachsenes Leben – war die Erkenntnis, dass ich zwar Nora liebte, sie aber nicht mich, ein Grundstein meines Seins gewesen. Ich hatte es akzeptiert wie meine schwarze Haarfarbe oder den Wechsel der Jahreszeiten, Sommer und Winter, Frühling und Herbst. Ein Naturgesetz. Ebenso hatte ich vorausgesetzt, dass ich ihr nicht sagen dürfte, dass ich sie liebte, weil sie mich dann ganz sicher aus ihrer Umgebung verbannen würde, denn diese Liebe konnte für sie allerhöchstens lächerlich sein – etwas, worüber sie mit einer ihrer Freundinnen lachte, wenn sie morgens zusammen im Bett lagen.
Und nun? Ich hatte es ihr gesagt, und sie lachte nicht. Sie erzählte mir sogar, dass sie ebenfalls Interesse an mir gehabt hätte, wenn ich nicht so verbohrt gewesen wäre. Sie versuchte, mich zu küssen . . .
Gut, das war nicht dasselbe wie ›Ich liebe dich‹, aber es war sehr viel mehr, als ich mir all die Jahre erhofft hatte. Dieser Sonntag war der erste in meinem Leben, an dem tatsächlich die Sonne schien. Es war mir auch völlig egal, ob das mit der aktuellen Wetterlage übereinstimmte: Für mich schien definitiv die Sonne, auch wenn es draußen stürmen und schneien sollte – was zugegebenermaßen im Sommer unwahrscheinlich war.
Ich sprang aus dem Bett und ging in meine kleine Küche, die genau meine Lebensweise widerspiegelte: Ich kochte nicht, ich aß kaum etwas zu Hause, und der Kühlschrank war so winzig, dass er eher einer Minibar in einem Hotel glich. Er erschien immer noch genauso gähnend leer wie gestern, als ich nun hineinsah, bis auf ein paar Fertiggerichte im Gefrierfach. Ich war eben eine typische berufstätige Junggesellin: Zum Einkaufen kam ich nie, und ehrlich gesagt wusste ich auch kaum, was ich hätte einkaufen sollen. Im Büro ernährten wir uns vom Schnellimbiss gegenüber, oder wir gingen in die Kantine. Kein sehr gesundes Leben vermutlich, aber es hatte mich bislang nie gestört.
Heute überlegte ich, was ich tun sollte. Mit meiner neu erwachten positiven Lebenseinstellung hatte ich keine Lust, allein zu bleiben. Am liebsten hätte ich sie selbstverständlich mit Nora geteilt, denn sie war ja auch der Grund dafür, dass ich mich wohlfühlte, aber da bestand natürlich die Gefahr, dass sie sich – nachdem sie sich erholt und einen Tag lang geschlafen hatte – heute anders verhalten würde als am Freitag. Am Freitag hatte ich sie getröstet, und sie war dankbar gewesen. Heute, in etwas ausgeschlafenerem Zustand, konnte es durchaus sein, dass sie unser Gespräch vom Freitag als einen Ausrutscher betrachtete.
Aber das Risiko musste ich eingehen. Bei der Polizei, in meinem Beruf, im täglichen Leben, war ich oftmals mit viel größeren Gefahren konfrontiert, aber nun, als ich den Telefonhörer in die Hand nahm, um Nora anzurufen, schlotterten mir beinahe die Knie. Ich hätte fast wieder aufgelegt, aber dann schalt ich mich selbst feige, und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also wählte ich Noras Nummer. Der Anrufbeantworter ging dran. Vermutlich wollte sie nicht gestört werden, denn ich nahm an, dass sie zu Hause war. Ich hinterließ eine kurze Nachricht und fiel wieder etwas in meinen üblichen deprimierten Sonntagszustand zurück. Das war erneut die bekannte Situation: ich wollte Nora, aber sie wollte mich nicht.
Dennoch hatte sich etwas verändert: Die Hoffnung hatte von mir Besitz ergriffen. Die Hoffnung, dass es noch anders werden könnte zwischen Nora und mir. Dass die Signale, die sie am Freitag ausgesandt hatte, nicht einfach verpuffen würden. Dass sie es ernst gemeint hatte mit dem, was sie sagte. Ebenso ernst wie ich.
Ich setzte den Teekessel auf. Das war das Einzige, was ich mir für die Küche angeschafft hatte. Eine kleine Stärkung am Morgen brauchte ich nun mal, und entgegen der Meinung, die manche Leute von mir hatten, war ein Glas Whisky morgens nicht das Richtige für mich. Das Wasser kochte, und ich goss es in einem dampfenden Schwall in meinen Teebecher hinein. Meine Gedanken ließen nicht los von den Veränderungen, die ein einziger Tag bringen konnte. Mir fiel ein, dass ich Ellen – auf die ich bislang nur eifersüchtig gewesen war – eigentlich noch dankbar sein musste. Ohne sie hätte ein klärendes Gespräch zwischen Nora und mir vielleicht nie stattgefunden. Ich musste in meinen Teebecher hinein lächeln. Mein Gesicht spiegelte sich ein wenig auf der Oberfläche der Flüssigkeit, und ich kam mir ganz fremd vor. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt ins Bad ginge und mich vor den Spiegel stellte, würde ich mich nicht erkennen. Eine lächelnde, entspannte Renni – das war nicht das Bild, das ich von mir selbst hatte.
Montag
Das Telefon auf meinem Schreibtisch im Büro klingelte kurz nach Dienstbeginn, aber ich ignorierte es für einen Moment. Deshalb griff mein Kollege danach, der genau gegenüber von mir an seinem Schreibtisch saß. Er legte schon kurz darauf wieder auf. »Arbeit, Renni«, sagte er ruhig. So harmlos das klang, diese Bemerkung konnte in unserer Abteilung nur eins bedeuten: Es war ein Mord geschehen.
Ich griff nach meiner Waffe, um sie umzuschnallen. »Wo?«, fragte ich.
Er stand schon auf. »Direkt vor dem Zoll, keine fünfzig Meter von der Grenze«, antwortete er knapp.
Mehr war nicht nötig. Den Rest würden wir am Tatort sehen. Wir verließen das Büro der Mordkommission und begaben uns an die Arbeit.
Die Leiche war kein schöner Anblick. Jemand hatte ihr den Schädel eingeschlagen, und zwar von vorn. Ihr Gesicht war nur noch Matsch. Es war eine Frau, aber sehr viel mehr war nicht zu erkennen. Der Kleidung nach konnte sie eine der Frauen sein, die in den Appartements über der PussyCat-Bar wohnten; eine irreführende Bezeichnung, denn tatsächlich handelte es sich um ein Bordell. Ebenso erschien der Begriff ›Appartements‹ als ausgesprochen beschönigend für die kleinen Zimmer mit einem großen Bett, die nur einem Zweck dienten: Einen Ort für das Zusammensein zwischen Hure und Freier zu schaffen. An den Klingelschildern standen nur die Vornamen der Frauen, die häufig wechselten. Die Freier kamen hauptsächlich aus der Schweiz über die Grenze. In Deutschland war es billiger.
Wie immer überließen wir das meiste der Spurensicherung. Ein Kollege kam uns schon entgegen und nannte uns die Daten der Toten. Es war, wie ich vermutet hatte: In ihrem Ausweis stand als Adresse das Haus der PussyCat-Bar. Sie war neunundzwanzig Jahre alt gewesen – fast ein bisschen zu alt für den Beruf, jedenfalls in diesem Haus, soweit ich gehört hatte – und hatte dort offensichtlich schon eine Weile gewohnt. Ich kannte sie nicht. Hier in dieser Stadt hatte ich nie bei der Sitte gearbeitet, wie das zu Anfang meiner Polizeikarriere in Köln der Fall gewesen war, und dadurch auch nie viel mit den Frauen aus dem ›Gewerbe‹, wie es so schön hieß, zu tun gehabt.
»Wenn Sie mich nicht in Ruhe arbeiten lassen, werden Sie Ihre Ergebnisse überhaupt nicht bekommen!«
Die neue Pathologin, die die Leiche der Toten aus der PussyCat-Bar untersuchen sollte, war nicht besonders freundlich. Es war der erste Fall, in dem ich mit ihr zu tun hatte. Ihr Vorgänger war gerade in Pension geschickt worden. Er war ein gemütlicher Mann gewesen, der stundenlang über Leichenteile und deren Besonderheiten erzählen konnte. Am liebsten hätte er beim Essen im Restaurant einen abgeschnittenen Arm oder ähnliches hervorgeholt und das Ganze gleich am toten Objekt erklärt. Die Berührungsängste anderer mit dieser Materie konnte er nie so richtig verstehen. Er hatte sein ganzes Leben in den Katakomben der Pathologie verbracht und sah das als die normale Welt an.
Die neue Pathologin war da schon etwas anders. Zuerst einmal war sie mindestens dreißig Jahre jünger als er – was ganz sicher keinen Nachteil darstellte, wie ich feststellen konnte, als ich sie das erste Mal sah –, aber sie war auch bei Weitem nicht so gemütlich und freundlich wie er, und das konnte eine zukünftige Zusammenarbeit erheblich erschweren. Pathologinnen oder Pathologen waren einer der Grundpfeiler der Kriminalistik bei einer Morduntersuchung, ohne sie konnten wir meistens keine Beweise erbringen. Deshalb war eine gute und unkomplizierte Zusammenarbeit wichtig. Mit dieser Dame hier konnte das ein Problem werden.
Ich fragte mich immer wieder, wieso eine Medizinerin oder ein Mediziner in die Pathologie ging, sich lieber mit toten als mit lebenden Patienten beschäftigte. Ich hätte eher gedacht, dass die Medizin am lebendigen Objekt interessanter sei. Ich zum Beispiel hätte weitaus lieber Verbrechen verhindert als hinterher die Toten aufzusammeln. Aber ich hatte da selten die Wahl. Sie – die Pathologin – hatte sich dagegen freiwillig für die Pathologie und die Toten entschieden.
Was mich allerdings sofort an ihr interessierte, war meine Vermutung, sie sei eventuell nicht hetero. Wie schon des Öfteren verließ ich mich dabei sehr auf meine Instinkte, und ich hatte mich in meinem Leben in dieser Beziehung selten getäuscht. Allerdings irritierte sie mich schon. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mich diesmal auf mein Gefühl verlassen konnte.
»Es tut mir leid, Frau Dr. Kowalski, aber Sie wissen doch auch, dass die ersten Tage die wichtigsten sind bei einem Mordfall. Nach einer Woche kann der Mörder schon über alle Berge sein.« Ich versuchte es mit Vernunft, das war immer noch das Beste, auch wenn ich es nicht vertragen konnte, wenn mich jemand anblaffte. Und diesmal konnte ich noch nicht einmal zurückblaffen. Aber was tut man nicht alles für eine gute Zusammenarbeit!
»Ja, ja, schon gut.« Sie brummelte ein wenig in ihren nicht vorhandenen Bart, doch sie stritt sich wenigstens nicht mehr mit mir herum. »Es nützt aber der Aufklärung des Falles auch nichts, wenn Sie mir immer hier zwischen den Beinen herumspringen.«
Zwischen den Beinen? An diese Möglichkeit hatte ich bislang noch gar nicht gedacht. Ich musste grinsen. Wenn sie wüsste, was mir jetzt durch den Kopf ging! Ihr tadelnder Blick wurde noch unfreundlicher, als sie meinen Gesichtsausdruck bemerkte, und ich versuchte meine Mundwinkel wieder in eine einigermaßen gerade Stellung zu bringen.
»Wenn Sie glauben, dass Sie sich hier über mich lustig machen können –«, begann sie giftig.
Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen. »Aber nein, das liegt mir fern, Frau Doktor. So etwas würde ich nie tun. Ich bin nur an den Ergebnissen Ihrer Untersuchungen interessiert, und das möglichst schnell.«
»Dann verschwinden Sie hier, und lassen Sie mich in Ruhe!«, zischte sie.
Ich ging zur Tür. »Heute Nachmittag?«, fragte ich harmlos.
Ihre Stirn zog sich zusammen wie die Vorboten eines Hurrikans. »Sie bekommen die Ergebnisse, wenn ich fertig bin!«, knirschte sie.
Ich verließ den Raum und musste wieder grinsen. Ich würde meine Ergebnisse heute Nachmittag bekommen, davon war ich überzeugt. Möglicherweise war sie eine Hündin, die auch biss, aber im Moment bellte sie nur, so viel Menschenkenntnis hatte ich in meiner jahrelangen Arbeit gewonnen. Sie versteckte sich hinter einer abweisenden Mauer, aber in Wirklichkeit war sie wahrscheinlich einfach nur sehr verletzlich und wollte sich schützen. Vielleicht hatte sie schlechte Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall würde sie gute Arbeit leisten, das sah ich ihr an. Und das war schließlich das Wichtigste.
Am späten Nachmittag kam die Akte zu mir hoch. Gleichzeitig erhielt ich den Bericht der Spurensicherung. Er besagte unter anderem, dass die Frau nicht an dem Ort ermordet worden war, an dem wir sie gefunden hatten. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Die Leiche war von oben bis unten voller Blut gewesen, und auf dem Boden um sie herum war kaum ein Spritzer, das deutete zweifellos auf einen anderen Tatort hin. Auch die Mordwaffe war verschwunden. Zumindest war nichts, was dazu hätte dienen können, in der Nähe der Toten gefunden worden. Das hieß, die Tote war vermutlich nicht zufällig bei der Arbeit ihrem Mörder in die Hände gefallen und getötet worden, wie es bei Prostituierten heutzutage des Öfteren der Fall war, sondern der Mord hatte entweder gezielt stattgefunden, geplant und dementsprechend ausgeführt, oder der letzte Freier hatte die nun Tote zu Lebzeiten noch mit sich in die Wohnung oder sonst wohin genommen und dort umgebracht. Leider wurde der Fundort normalerweise als Parkplatz benutzt, und somit waren die Reifenspuren, die haufenweise um die Tote herum abgebildet waren, kaum von Wert. Es gab zwar ein paar Vermutungen, dass der Wagen, mit dem die Tote dorthin gebracht worden war, ein Jeep oder etwas ähnliches gewesen sein musste, aber ganz genau konnte man das nicht sagen. Und Jeeps fuhren mittlerweile so viele herum – gerade die Schweizer fuhren sie zuhauf. Sie kamen zu Dutzenden jeden Tag über die Grenze.
Falls es ein Schweizer gewesen sein sollte, würden die Ermittlungen ohnehin sehr schwierig werden, denn so nahe die Grenze auch war und so sehr wir uns daran gewöhnt hatten, einfach mal schnell drüben in der Schweiz einkaufen zu gehen – das war vor allem praktisch, wenn die Geschäfte in Deutschland schon geschlossen hatten – es war doch ein anderes Land. Eines, das noch nicht einmal zur EU gehörte. Das erschwerte die polizeiliche Zusammenarbeit enorm. Ich konnte nicht einfach die fünfzig Meter über die Grenze gehen und meine KollegInnen auf der anderen Seite um Hilfe bitten, da musste ich erst ein Gesuch einreichen und den ganzen bürokratischen Kram erledigen, um Unterstützung aus dem europäischen Ausland zu beantragen. Das konnte dauern.
Ich hoffte, dass sich der Mord in Deutschland zugetragen hatte, dann würde mir dieser ganze Aufwand erspart bleiben.
Ich wandte mich dem Bericht aus der Pathologie zu und sah mir alles genau an. Einen Vorteil hatte der Wechsel zu Frau Doktor Kowalski auf jeden Fall: Sie schrieb sauber und leserlich. Der größte Teil des Berichtes war getippt, und die handschriftlichen Ergänzungen, die sie offensichtlich im Nachhinein noch gemacht hatte, waren in sehr geraden Druckbuchstaben geschrieben. Ihr Vorgänger war in dieser Beziehung eine völlige Katastrophe gewesen. Er schrieb alles mit der Hand und in einer kaum zu entziffernden Sauklaue. »Also, Frau Doktor, was haben wir denn da?«, murmelte ich vor mich hin, während ich die Seiten umblätterte. Der Todeszeitpunkt war ziemlich genau bestimmt, gestern am späten Abend. Ich las weiter und stutzte bei der nächsten Seite. Da musste ich aber noch einmal nachfragen!
»Was glauben Sie, wer Sie sind, dass Sie jederzeit einfach so hier hereinspazieren und mich bei der Arbeit stören können?« Frau Dr. Kowalski war schon wieder in ihrem Element. Wenn sie schimpfen konnte, ging es ihr anscheinend am besten.
Ich versuchte, ihren beleidigenden Tonfall zu ignorieren. »Ich bin diejenige, die die Untersuchung leitet, und ich brauche Fakten, auf denen ich meine Ermittlungen aufbauen kann, das ist alles. Sie wissen doch, wie wichtig Ihre Ergebnisse dafür sind. Sie sind überhaupt die wichtigste Mitarbeiterin in diesem Fall.« Die Frau wollte ich sehen, die für solche Schmeicheleien nicht empfänglich war!
Frau Dr. Kowalski war es jedenfalls. Sie wurde ruhiger, nicht unbedingt freundlicher, das lag ihr wohl nicht im Blut. Zumindest fauchte sie mich nicht mehr an wie eine Tigerin im Käfig. Vielleicht fühlte sie sich ja so – eingesperrt hier unten, wie sie war –, aber dann sollte sie sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. Dafür war ich schließlich nicht verantwortlich, ebenso wenig wie all die anderen, die sie jeden Tag vor den Kopf stieß, seit sie hier arbeitete. Aber nun fragte sie mich wenigstens, »Also, was wollen Sie?«
»In Ihrem Bericht steht, dass die Frau, die gestern gefunden wurde, mindestens fünfzig Jahre alt war.«
»Ja, und?« Sie blickte schon wieder feindselig. Offenbar vermutete sie, ich wolle die Qualität ihrer Arbeit infrage stellen.
Das war jedoch keineswegs meine Absicht, ich brauchte nur eine Bestätigung. Aber sie würde das garantiert zuerst einmal falsch verstehen. »Wir haben Papiere bei der Toten gefunden, in denen steht, dass sie neunundzwanzig war. Das ist ein ziemlich großer Unterschied«, versuchte ich es vorsichtig.
Sie explodierte fast. »Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte mich bei der Bestimmung des Alters geirrt?« Wenn sie jetzt nach einem Stilett griff, um es mir entgegenzuschleudern, hätte ich mich nicht gewundert.
»Nein, im Gegenteil«, wehrte ich ab. »Ich denke, dass die Papiere nicht stimmen. Ich wollte mich nur noch einmal vergewissern.« Vielleicht würde sie das beruhigen.
Tat es nicht. »Sie haben meinen Bericht – da steht alles drin. Wieso fragen Sie dann noch?«, wütete sie. Dann drehte sie sich um und ging zu der Tür, die nach nebenan in das kleine Büro führte, das die PathologInnen benutzten, wenn sie ihre Berichte schrieben oder gerade keine Leichen aufschnitten.
Ich wollte so nicht gehen und folgte ihr. Es musste doch eine Möglichkeit geben, mit ihr auszukommen! Ich hatte keine Lust, mich jedes Mal wegen irgendwelcher Kleinigkeiten stundenlang herumzustreiten in Zukunft und bis in alle Ewigkeit.
Sie stand an dem kleinen metallenen Schreibtisch – irgendwie war in der Pathologie alles aus Metall – und hielt ein Diktiergerät in der Hand. Ich sprach sie freundlich an. »Frau Dr. Kowalski – bitte – ich möchte mich mit Ihnen vertragen. Warum schließen wir nicht einen Waffenstillstand? Wir arbeiten schließlich auf das gleiche Ziel hin.«
Sie sah mich nicht an, sondern fixierte ihr Diktiergerät. »Ach, tatsächlich?«, fragte sie schnippisch, aber sie wirkte ein wenig verunsichert.
Die meisten ließen sich von ihrer rauen Schale wahrscheinlich abschrecken und versuchten nicht weiter, ihr näherzukommen. Aber ich war ja selbst so wie sie. Ich kannte das Dilemma, meine Gefühle zu verstecken und dadurch umso verletzlicher zu sein, aus eigener Erfahrung. Da musste es doch möglich sein, sich zu verständigen! »Ja, tatsächlich. Oder suchen Sie nicht nach der Wahrheit?«
Sie lehnte sich gegen den Schreibtisch und sah schräg von unten zu mir hoch. »Die Wahrheit? Gibt es so etwas überhaupt? Und glauben Sie wirklich, Sie können sie finden?« Sie versuchte, das Bröckeln ihrer Mauer zu verhindern, aber ich hatte anscheinend doch ihr Interesse geweckt. Sonst hätte sie nicht gefragt.
»Zumindest suche ich danach. Ich möchte herausfinden, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist. Und ich glaube, Sie auch. Oder warum sonst machen Sie diese Arbeit?«
»Ich mache diese Arbeit, weil ich Geld dafür bekomme. Aus keinem anderen Grund. Sie sollten nicht so leicht von sich selbst auf andere schließen.« Obwohl sie es bestritt, glaubte ich ihr nicht. Ihr Tonfall erinnerte mich an die Dementis aus dem Buckingham-Palast: ›Nein, der Prinz und die Prinzessin von Wales denken gar nicht daran, sich scheiden zu lassen . . .‹ Auch diese Lüge hatte nicht lange gehalten. Und die von Frau Dr. Kowalski würde es ebenso wenig tun.
Ich ging einen Schritt näher auf sie zu. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Wir nennen es nicht die Wahrheit, sondern die Lösung eines Rätsels. Wir suchen beide danach, und wir müssen zusammenarbeiten. Deshalb fände ich es viel angenehmer, wenn wir uns nicht dauernd ankläffen würden wie zwei Straßenköter. Das bringt doch nichts.« Ich streckte ihr meine Hand hin. »Ich heiße Renni. Wie wär’s?«
Sie sah erst auf meine Hand, dann auf mich. »Was wollen Sie damit erreichen?«
Mein Gott, war sie misstrauisch! Was hatte sie bloß erlebt, dass sie sich so verschloss? Oder war sie so geboren? »Ich will gar nichts damit erreichen – außer einem etwas entspannteren Verhältnis.« Ich ließ meine Hand, wo sie war. Es wurde zwar langsam peinlich, weil sie nicht reagierte, aber ich wollte unbedingt durchhalten. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt aufgab, müsste ich sehr lange warten, bis ich einen neuen Versuch starten konnte. »Bitte –« Noch einmal streckte ich ihr meine Hand entgegen, jetzt berührte sie schon fast ihre, die immer noch ein wenig verkrampft das Diktiergerät hielt.
Sie drehte sich von mir weg und ging jetzt hinter den Schreibtisch an einen Metallschrank mit Hängeordnern. Mit einem quietschenden Geräusch zog sie einen davon heraus, als ob sie etwas nachsehen müsse. Das sah mir stark nach einem Fluchtversuch aus dieser für sie unangenehmen Situation aus.
Meine Hand hatte sie berührt, als sie sich umdrehte. Ich konnte die Wärme immer noch spüren. Möglicherweise lag das nur an dem extremen Kontrast zur Raumtemperatur – in einem Leichenschauhaus ist es nun einmal kalt –, aber ich fürchtete, es war auch noch etwas anderes. Schon die Vermutung, sie könnte eventuell nicht hetero sein, hatte ein gewisses Interesse bei mir ausgelöst, aber nun, nach dieser – wenn auch nur zufälligen – Berührung, stieg ein warmes Kribbeln in mir hoch, mit dem ich nicht im Entferntesten gerechnet hatte. Ich war selbst irritiert. Einen Moment zögerte ich, dann ging ich ihr nach und blieb direkt hinter ihr stehen. »Ich kenne eine nette Geschichte über ein Leichenschauhaus.«
Sie drehte sich langsam um und blickte mich ungläubig an. »Bitte, was?«
»Mir fiel gerade ein, dass mir eine Bekannte mal etwas erzählt hat, was mit einem Leichenschauhaus zu tun hatte. Hätten Sie Interesse, die Geschichte zu hören?«
»Sie sind verrückt. Was soll das?« Sie schüttelte den Kopf, aber gleichzeitig verzogen sich ihre Mundwinkel. Obwohl sie versuchte, sich zu beherrschen, kroch offensichtlich dennoch ein Lächeln in ihr hoch, das sie kaum unterdrücken konnte. Ich hatte sie noch nie lächeln sehen; ich war gespannt, wie es wohl aussehen würde.
»Wollen Sie die Geschichte nun hören oder nicht?«, fragte ich. Ich hatte offenbar einen Punkt bei ihr erwischt, der Erfolg versprach.
Sie schüttelte wieder den Kopf. Es sah fast wie Gewohnheit aus. Immer erst mal ›Nein‹ sagen. Dann zuckten ihre Mundwinkel wieder. »Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber wenn Sie unbedingt wollen . . . Ich würde ganz gern weiterarbeiten, und dazu muss ich Sie erst mal loswerden. Also erzählen Sie Ihre Geschichte. Damit endlich Schluss ist.«
»Ja, damit endlich Schluss ist . . .« Ich meinte mit diesen Worten etwas anderes als sie, und das merkte sie auch, aber sie sagte nichts. Ich fuhr fort. »Also dann – Meine Bekannte erzählte: Ihre Großmutter fröstelte ständig, solange sie lebte. Sie trug immer eine Strickjacke oder so. Als sie älter wurde und krank, sagte sie einmal zu ihrer Tochter, der Mutter meiner Bekannten: ›Im Leichenschauhaus ist es doch so kalt. Hoffentlich friere ich da nicht.‹ Die Tochter wehrte natürlich ab. ›Sprich doch nicht vom Tod!‹ Aber wie viele ältere Menschen, für die der Tod keine Bedrohung mehr darstellt, lachte die Großmutter nur darüber. Drei Wochen später starb sie dann wirklich, wie erwartet. Als sie nun die erste Nacht im Leichenschauhaus lag, schlug dort im Kühlsystem der Blitz ein. Meine Bekannte, ihre Enkelin, sagte als Kommentar dazu: ›Da wusste ich, dass sie wirklich angekommen ist.‹ Nun, was halten Sie davon? Wie gefällt Ihnen die Geschichte?«
Auch wenn ich ihr Lächeln heute nicht mehr sehen würde, so war ich doch fest davon überzeugt, dass ich dem ein großes Stück nähergekommen war. Sie hatte wirklich schwer mit ihren zuckenden Mundwinkeln zu kämpfen, um es zu verbergen. »War das alles?«, fragte sie. »Kann ich jetzt weitermachen?«
»Es freut mich wirklich, dass ich Ihnen Ihren Tag versüßen konnte«, antwortete ich grinsend. Ich ging in Richtung Tür, dann drehte ich mich noch einmal um. »Rufen Sie mich an?«
»Weshalb?«
»Nun, wenn die Tote fünfzig ist und nicht neunundzwanzig, sind die Papiere, die wir bei ihr gefunden haben, keinen Pfifferling mehr wert, dann müssen wir herausfinden, wer sie wirklich ist. Das wird wohl einige zusätzliche Untersuchungen erforderlich machen, oder sehe ich das falsch?«
Sie schürzte die Lippen. Sie musste sich überwinden zuzugeben, dass ich recht hatte. Es fiel ihr sichtlich schwer. »Nein«, sagte sie. »Wohl nicht.«
»Also rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen?«, wiederholte ich meine Frage.
Sie nickte.
Ich verließ nun endgültig das kalte Gemäuer und sah mich nicht mehr um. Wenn sie jetzt lächelte, hatte ich es verpasst.
Der Fall beschäftigte mich so sehr, dass ich eine Weile nicht an Nora gedacht hatte, aber als ich in mein Büro zurückkam, fiel sie mir wieder ein. Wenn Frau Dr. Kowalski keine Nachtschicht einlegte, würde ich vor morgen Abend nichts Neues über die Tote erfahren, also war es wohl besser, nach Hause zu gehen. Wenn ich einen neuen Fall hatte, war ich normalerweise froh, allein zu sein und in Ruhe darüber nachdenken zu können, aber heute hätte ich mir Gesellschaft gewünscht.
Eigentlich interessierte mich der Fall erstaunlich wenig. Zu viele andere Dinge schwirrten mir im Kopf herum. Ich dachte an Nora und daran, wann wir uns vielleicht wiedersehen würden – und ich dachte an Frau Dr. Kowalski . . . Das erstaunte mich am meisten. Was hatte sie denn mit meinem Privatleben zu tun?
Ich schüttelte den Kopf, um meine Gedanken in dieser Richtung loszuwerden. Aber eins tat ich dennoch: Ich sah in den Computer und startete das Personalinformationssystem. Ihr Vorname war Monika, und sie wohnte mitten in der Stadt. Sie hatte es nicht weit zur Arbeit, stellte ich fest.
Ich schaltete den Computer mit einem plötzlichen Widerwillen aus. Was tat ich denn da? Ging mich das irgendetwas an? War ich schon so verdorben durch die Polizeiarbeit, dass ich niemand seine kleinen Geheimnisse lassen konnte? Ich hatte ihr meinen Vornamen gesagt, und sie hatte mir ihren verweigert. Aber statt das zu akzeptieren, überging ich ihren eindeutigen Willen und besorgte mir die Information auf andere Art. Das war nicht fair. Sicher – sie konnte den Computer genauso benutzen wie ich, aber sie würde es nicht tun, denn das würde sie kaum interessieren. Also verschaffte ich mir einen einseitigen Vorteil. Das war Verbrechern gegenüber legitim, aber gegenüber einer Kollegin? Was für ein Recht hatte ich dazu – und was ging sie mich überhaupt an?
Verwirrt und durcheinander verließ ich das Büro. So ein Gefühlschaos erlebte ich sonst nicht oft!
Zu Hause wurde es auch nicht sehr viel besser. Ich rief Nora an und erwischte wieder nur ihren Anrufbeantworter. Noras Stimme auf dem Anrufbeantworter klang so echt, dass ich im ersten Moment dachte, sie wäre dran. Die Freude schoss in mir hoch, um dann eine Sekunde später der Enttäuschung zu weichen, als ich merkte, dass sie nicht antwortete, sondern nur der Text auf dem Band lief. Diese verdammten Maschinen! Ich bat Nora, mich zurückzurufen, und legte wieder auf.
Dann nahm ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte mich in den Sessel vor den Fernseher, schaltete ihn aber nicht ein. Selbst Inspektor Columbo konnte mir heute nicht helfen.
Was war das für eine merkwürdige Situation? Ich hatte mich nie viel um Frauen gekümmert, außer wenn mich das akute Bedürfnis überkam, mit einer Frau zusammen sein zu wollen. Aber selbst dann . . . Meistens war es am nächsten Morgen vorbei gewesen, und ich hatte die Frau nie mehr wiedergesehen. Die wenigen Ausnahmen, die es zu einem längeren Aufenthalt gebracht hatten, konnte ich an einer Hand abzählen, aber keine von ihnen war lange genug dageblieben, um eine Kuhle in meine Matratze zu liegen. Immer hatte Nora in meinem Kopf herumgespukt, und keine der Frauen, mit denen ich etwas gehabt hatte, konnte ihr meiner Meinung nach auch nur entfernt das Wasser reichen.
Im Grunde war es immer die gleiche Geschichte: Die Voraussetzung war immer die gleiche gewesen: Nora konnte ich nicht haben, also nahm ich eine andere, aber da sie nicht Nora war, hatte sie von Anfang an keine echte Chance. Jetzt plötzlich war Nora frei, und es machte mir fast Angst. Ihr Versuch, mir näherzukommen, mich zu küssen, ihr Geständnis, dass sie mir mehr Interesse entgegenbrachte, als ich je zu hoffen gewagt hatte, ließen mich nicht auf dem Tisch tanzen und die Welt umarmen, obwohl das immer so ungefähr meine Vorstellung von diesem heiß ersehnten und glücklichsten Moment meines Lebens gewesen war. Nein, im Gegenteil, zum ersten Mal in meinem Leben war Nora frei und möglicherweise sogar an mir interessiert, und ich saß zu Hause und blies Trübsal. Ich dachte sogar mit Interesse an eine andere Frau . . .
Das Telefon gab einen hustenden Laut von sich. Ich hatte es so leise gestellt, dass ich es kaum hörte. Ich stand auf und ging in die Diele, um abzunehmen. Es war Nora.
»Renni, ich habe gerade deine Nachrichten auf dem AB gehört«, sagte sie leise. »Ich dachte, ich rufe mal zurück.«
Das klang mehr als zurückhaltend. Wahrscheinlich hatte sie sich immer noch nicht ganz erholt. »Das ist nett von dir«, erwiderte ich. Ich unterdrückte meine Freude etwas, da sie so wenig zu ihrer Stimmung zu passen schien. Ich war nur froh, endlich mit ihr sprechen zu können. »Ich wollte mich nur mal erkundigen, wie es dir geht und ob ich irgendwas für dich tun kann.«
Nora lachte leise. »Die liebe Renni«, sagte sie.
Lieb? Lieb? Sie fand mich lieb? Das empfand ich fast als Beleidigung. Unter ›lieb‹ stellte ich mir immer eine dumme, naive Frau vor, die alles für andere tat, ohne etwas zurückzubekommen. Das wollte ich nun wirklich nicht sein. So sah ich mich auch ganz und gar nicht. Ich war eine ziemlich harte Polizistin, das war mein Image. Lieb konnten andere sein, nicht ich!
»Wie geht es dir?«, fragte ich deshalb etwas steif, weil ich mich so falsch eingeschätzt fühlte. »Hast du dich einigermaßen ausschlafen können?« Ich wollte von mir ablenken, und das tat ich am besten, indem ich mich nach ihrem Befinden erkundigte.
»Doch, ziemlich. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Fast zwei Tage lang.«
»Und? Geht es dir jetzt besser?« Schließlich konnte ich sie ja nicht direkt fragen, ob sie nun über Ellen hinweg war, das wäre zu auffällig gewesen, obwohl es so ziemlich das Einzige war, was mich wirklich interessierte. Aus meiner eigenen Erfahrung konnte ich bestätigen, dass nichts eine Beziehung so sehr vergiften konnte wie eine abwesende, unerreichbare Geliebte, an der eine der beiden Partnerinnen immer noch hing. Meine eigene Beziehung zu Gisela war unter anderem daran gescheitert. Wir hatten zwar sowieso nicht besonders viel gemeinsam außer unserem Beruf, aber Noras ständige Anwesenheit in meinem Kopf und meinen Gefühlen hatte wenig Raum für liebevolle Empfindungen gegenüber anderen gelassen. Und da Nora immer unerreichbar für mich gewesen war, hatte sich dieser Zustand auch nie geändert. Ich erinnerte mich an einige Auseinandersetzungen mit Gisela, in denen sie mir vorwarf, sie ständig in Gedanken mit Nora zu betrügen. Das hatte ich damals natürlich vehement abgestritten, aber heute musste ich zugeben, dass Gisela absolut recht gehabt hatte.
»Ja, es geht mir ganz gut«, sagte Nora, aber es klang unsicher. So, als ob sie sich nicht auf etwas festlegen wollte.
»Brauchst du irgendetwas?« Ich wusste nicht, was es war, aber irgendwie klang Nora komisch. Vielleicht, wenn ich sie sehen würde –
»Eigentlich schon«, antwortete sie jetzt. »Ich werde demnächst mal einkaufen gehen. Ein bisschen frische Luft wird mir guttun.«
Komisch, komisch, komisch! Sie klang so, als ob sie sich gar nicht mit mir unterhalten wollte. »Ich kann auch für dich einkaufen gehen«, bot ich an. »Wenn du noch zu schwach bist . . .«