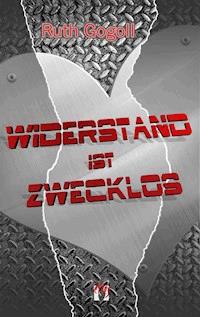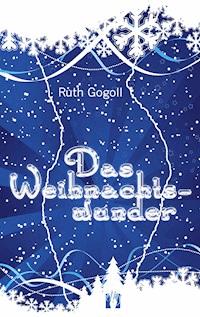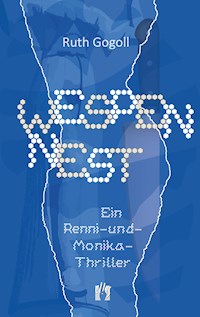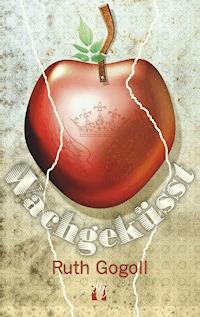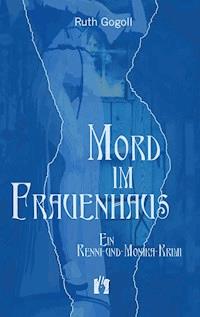Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die arme Irin Emma O'Leary ist als Kind mit ihrer Familie vor der Hungersnot in Irland nach Amerika geflohen. Kaum erwachsen muss sie schon hart als Näherin in der Schneiderwerkstatt eines Modesalons arbeiten. Dort gehen arrogante, reiche New Yorkerinnen ein und aus, für die Emma Kleider näht, die sie sich selbst niemals leisten könnte. Jedoch hat sie den Traum, mehr aus ihrem Nähtalent zu machen und dem Joch der Armut zu entfliehen. Eine besonders arrogante Kundin ist die junge Lady Francie Cunningham, die Emma zu sich nach Hause bestellt. Die Anproben im Herrschaftshaus werden bald sinnlicher und erotischer, denn Francie hat nicht nur Interesse an den Kleidern, sondern an Emma selbst. Auch Emma wird überflutet von völlig unbekannten Gefühlen. Für kurze Zeit sind Francie und Emma heimlich glücklich, doch da bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus und schleudert ihre Schicksale in eine ungewisse Zukunft ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Gogoll
WIE HONIG SO SÜSS
Roman
© 2017édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-232-9
Coverillustrationen: © jozefklopacka, darkbird – Fotolia.com
»Sie haben gerufen, Mademoiselle?« Die fragend blickende Zofe sprach Englisch, jedoch mit sehr starkem französischem Akzent.
»Ja«, antwortete eine amerikanische Stimme. »Ich brauche dich, Jeanne. Komm her.«
Jeanne, dunkelhaarig, kräftig und mit dem dunklen Teint des sonnenreichen Südens Frankreichs ausgestattet, trat in das Zimmer, schloss die Tür hinter sich und ging zu der jungen blonden Frau hinüber, die halbnackt vor dem Spiegel stand. »Oui, Mademoiselle?« Sie wechselte nun ins Französische.
»Du musst mir helfen«, verlangte die junge Lady, auch auf Französisch, aber mit amerikanischem Akzent, und wies auf ihr Korsett.
»Das sehe ich«, bemerkte die Zofe mit einem Zucken ihrer Mundwinkel, während sie auf die steif hervorstehenden Brustwarzen oberhalb des Korsetts starrte.
»So habe ich das nicht gemeint.« Die junge blonde Lady sprach wieder Englisch, vielleicht, weil das abweisender klang als die anschmiegsame Melodie der französischen Sprache. »Ich muss auf den Ball –«
»Aber natürlich, Mademoiselle.« Jeanne blieb bei Französisch. »Sie gehen auf den Ball . . . und Sie werden wunderschön aussehen.« Sie beugte sich vor und hauchte einen Kuss auf die unbedeckten Schultern. »So wie jetzt.«
Die junge Amerikanerin erzitterte. »Nicht hier, Jeanne«, flüsterte sie. »Wir sind nicht zu Hause.«
»Aber du willst es«, flüsterte Jeanne zurück. »Das sehe ich.«
»Du weißt, dass das nicht gut ist.« Im Gesicht der jungen Lady bildeten sich erregte rötliche Flecken. »Es sind viel zu viele Leute im Haus.«
»Dann musst du eben leise sein.« Geschickt begann Jeanne das Korsett zu öffnen. »Das kannst du doch, oder?«
»Jeanne, ich befehle dir –!« Der Satz brach mittendrin ab, als Jeanne mit beiden Händen über die Brustwarzen fuhr, die zuvor schon ihre Aufmerksamkeit erregt hatten. Die junge Lady stöhnte auf und biss sich dann schnell auf die Lippen.
»Wenn du mir befiehlst zu gehen, werde ich gehen«, hauchte Jeanne der jungen Frau ins Ohr. »Willst du das?«
Die Lady antwortete nicht. Ihr Atem ging schnell.
»Wusste ich’s doch.« Jeanne lachte leise. »Deshalb hast du mich gerufen. Nur deshalb.«
»Nein«, widersprach der schön geschwungene Mund. »Ich wollte wirklich, dass du mir beim Anziehen hilfst.« Die Augen der jungen Frau, die die Zwanzig noch lange nicht erreicht hatte, wanderten kurz zu dem ausladenden Ballkleid hinüber, das sie heute Abend tragen wollte. Wie üblich würde sie mit der Krinoline, über die der Stoff fiel, kaum durch eine Tür kommen, aber das war sie gewöhnt. Ob Alltag oder Ball – jedes Kleid verlangte so viel Platz.
»Ich glaube, du hast dich versprochen«, bemerkte Jeanne neckend. »Du meintest wohl: beim Ausziehen.«
Ein leises Seufzen kam von den jugendlichen Lippen ihrer Herrin, als Jeanne nun das Korsett endgültig entfernte und ihr auch noch das Unterkleid über den Kopf zog. »Du bist verrückt, Jeanne«, flüsterte sie wehrlos.
Unter dem hohen Fenster hörte man Pferdehufe trappeln. Eine Kutsche hielt, dann drangen Stimmen von der Straße herauf.
»Die De La Fontaines!« Die blonde Frau sprang fast in die Luft. »François wird mich sehen wollen!« Sie atmete heftig mit weit aufgerissenen Augen.
»Oh ja, das wird er.« Süffisant ließ Jeanne ihren Blick über die nackte Gestalt schweifen, die vor ihr stand. »Und wie begeistert wäre er wohl, dich so zu sehen?« Ihre Lippen verzogen sich zu einem breiten Grinsen, und ihre Hand legte sich auf die feste kleine Brust und begann die Brustwarze sanft hin und her zu bewegen.
Ein tiefes Stöhnen war die Antwort, und die grünen Augen schlossen sich. »Du musst ihnen sagen«, hart biss sie sich auf die Lippen, als Jeanne die Brustwarze nun zwischen ihre sog, »dass ich . . . noch nicht . . .«, nur abgerissen flatterten die Silben zwischen den zitternden Lippen hervor, »fertig bin.«
»Das wirst du aber bald sein«, hauchte Jeanne an ihrer Brust, bevor sie langsam an ihr hinabglitt. »Du brauchst doch nie lange.«
Es schien, als ob die Knie der jungen Lady einknickten, und sie sank, nackt, wie sie war, auf einen Stuhl.
»Ich werde dich gut für den Ball vorbereiten«, murmelte Jeanne, während ihr Blick sich in den feucht glitzernden blonden Haaren zwischen den leicht geöffneten Schenkeln verfing.
Dann sank sie zwischen die zitternden Knie, spreizte sie weit und bedeckte mit ihrem Mund den erwartungsvoll pochenden Eingang zum Paradies.
Kurz darauf war nur noch leises Seufzen und Stöhnen zu hören.
1
Emma blickte die staubige, schmutzige Hauptstraße entlang. Ein Pferdefuhrwerk drängte sich am anderen vorbei, fluchende Kutscher versuchten die Straße ganz für sich zu beanspruchen, ungeheurer Lärm erfüllte die Luft.
Wie ruhig und friedlich war es doch in Irland gewesen, in ihrer Heimat. Niemals hatte sie dort solche Szenen gesehen. So viele Menschen, so viele Pferde, so viel Schmutz.
Und der Schmutz befand sich nicht nur auf der Straße, er kam auch aus den Mündern. Sie hatte hier in kurzer Zeit viele Wörter gelernt, für die ihr ihre Mutter in Irland den Mund mit Seife ausgewaschen hätte, hätte Emma sie benutzt. Nun war ihre Mutter zu schwach dazu, sie konnte sich selbst kaum auf den Beinen halten.
Der Gedanke an ihre Mutter und ihre Schwester Katie brachte sie zu dem Problem zurück, weshalb sie hier war. Hunger. Wegen des Hungers waren sie aus Irland geflohen, und nun war der Hunger noch schlimmer geworden statt dass sie ihm entkamen.
Wenn Ian nicht erschossen worden wäre . . .
Aber Ian war erschossen worden, gleich in der zweiten Woche, von betrunkenen Soldaten. Sie waren nicht besser als die Engländer, diese Menschen hier in Amerika.
Emma spuckte aus, wie sie es immer bei ihrem Bruder gesehen hatte. Ian war ihr großes Vorbild gewesen, schon so erwachsen, achtzehn Jahre alt. Emma hätte die acht Jahre, die sie trennten, am liebsten übersprungen, um mehr mit ihrem Bruder unternehmen zu können.
Ian hatte oft über sie gelacht, weil sie ihm hinterherlief wie ein kleiner Hund; er sagte, sie wäre doch ein Mädchen, kein Junge, und er hätte immer Jungssachen zu tun, die sie nichts angingen. Dennoch liebte er sie heiß und innig, seine kleine Schwester. Er warf sie in die Luft und fing sie auf, lachte, wenn sie schrie, weil er so tat, als ob er sie beim Herumschleudern loslassen würde. Wenn er sie dann sicher wieder auf den Boden stellte, während ihr vom Drehen der Kopf brummte, lachte sie auch und fühlte sich in seiner Gegenwart einfach nur geborgen. Solange er dagewesen war, hatte ihr nichts passieren können.
Doch nun war sie allein. Allein mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, die, wie es ihr schien, schon fast nicht mehr da waren, so grau und müde und abgezehrt sahen sie aus. Ian hatte für sie gesorgt. Ian hatte immer gewusst, was zu tun war. Nun musste Emma diese Aufgabe übernehmen.
Sie schaute sich schnell um. Auch wenn sie wusste, dass ihre Mutter das niemals geduldet hätte, aber sie musste Essen besorgen, obwohl sie kein Geld hatte. Und da gab es nur eine Möglichkeit.
Schon in den letzten Tagen hatte sie die Jungs beobachtet, die sich zu einer Bande zusammengeschlossen hatten und sich so alles besorgten, was sie brauchten. Ein paar lenkten die Händler ab, die anderen stopften sich unter ihre Hemden, was sie greifen konnten, und dann preschten alle davon wie eine Herde junger Fohlen. Lachend und johlend. Sie hielten das wohl für einen großen Spaß.
Die Grundherren in Irland hätten sie dafür gehängt, die Engländer, die meinten, Irland gehörte ihnen. Sie machten auch vor Kindern nicht halt, und wenn sie verhungerten und nur deshalb stahlen.
Aber hier in Amerika war es anders. Wenn man flink und geschickt war, konnte man entkommen.
Die Jungs würden sie allerdings nicht unterstützen. Sie würden niemals ein Mädchen in ihre Bande aufnehmen. Also musste sie es allein versuchen, denn Mädchenbanden hatte sie noch keine gesehen. Das war selbst in Amerika nicht üblich.
Sie schlich ein wenig um den Obststand herum. Nun war es wieder von Vorteil, dass sie ein Mädchen war. Die Händler achteten nicht auf sie, weil sie ihr Augenmerk auf die Banden der Jungs richteten. Von ihnen erwarteten sie Unheil, von einem kleinen Mädchen wie Emma nicht. Sie lächelten ihr sogar zu, wenn auch ein wenig zurückhaltend.
Sie sah abgerissen aus, wie alle Iren, die mit dem Schiff gekommen waren und für die Passage ihr letztes Hemd gegeben hatten. Dabei hatten sie schon vorher nichts gehabt. Aber wenn man sah, wie alle um einen wie die Fliegen starben, wenn sie schwächer und schwächer wurden, weil es nichts zu essen gab, fand man einen Weg.
Ian hatte es irgendwie fertiggebracht, für sie alle eine Passage zu ergattern. Wenn Emma das richtig verstanden hatte, hatte er das Geld beim Spielen gewonnen. Aber er hatte Emma darauf eingeschworen, es niemals ihrer Mutter zu sagen. Ihre Mutter wäre lieber verhungert als von einem Spielgewinn zu leben. Sie hätte das Geld vielleicht sogar der Kirche gespendet, weil sie sich so sehr dafür schämte.
Emma sah die Frömmigkeit ihrer Mutter mittlerweile als eine Art zweischneidiges Schwert an. Natürlich glaubte sie an den lieben Gott und natürlich betete sie zu ihm, bat ihn um Hilfe. Aber noch nie war Manna vom Himmel gefallen nach so einem Gebet, was auch immer darüber in der Bibel stand. Also verließ sie sich lieber auf sich selbst.
Sie beobachtete den Bäcker, der seinen dicken Bauch genüsslich in die Sonne streckte, nachdem er die Backstube verlassen hatte und alles Brot in den Körben vor dem Laden lag.
Dicke Bäuche hatten in Irland nur die Engländer. Die Iren hatten nichts, was sie in einen Bauch hätten stecken können. Also war ihr der Mann schon grundsätzlich unsympathisch.
Nun drehte er sich um und ging wieder in den Laden hinein.
Schnell wie der Wind setzten sich Emmas lange, schlaksige Beine in Bewegung, und schon war sie mit einem Laib Brot um die Ecke verschwunden.
»Wir danken dir, Herr, dass du uns in deiner Güte auch heute wieder mit Brot versorgt hast.«
Emma hörte mit gesenktem Kopf zu, während ihre Mutter auf Irisch das Dankgebet sprach. Sie hatte in ihrem Leben nie Englisch gesprochen und verstand auch nur ein paar Brocken. Wie vielen der armen Leute im Westen Irlands war ihr die englische Sprache immer fremd geblieben. Die britischen Eroberer hatten sie genauso mitgebracht wie den Hunger.
Innerlich hätte Emma am liebsten protestiert. Es war nicht Gott, der sie und ihre Familie heute mit dem Nötigsten an Essen versorgt hatte, sondern die Jüngste der Familie, die sich jeden Tag dafür in Gefahr begab. Ihre Schwester Katie, obwohl drei Jahre älter, war dazu nicht in der Lage. Sie ähnelte ihrer Mutter sehr und betete lieber, statt etwas zu unternehmen.
Ihre Mutter hatte noch mehr Kinder gehabt, in Irland bekam jede Frau fast jedes Jahr ein Kind, aber sie waren alle gestorben, manche schon bei der Geburt, manche etwas später. Von den vielen Geburten und der schweren Arbeit ausgezehrt hätte ihre Mutter eigentlich gutes Essen gebraucht, aber alles, was es gab, waren Kartoffeln. Der Reichtum des Landes, Butter, Milch, Rindfleisch und Getreide, wurde nach England verschifft. Die Iren sahen davon nichts.
Und dann waren die Kartoffeln von der Pest befallen worden. Sie waren in der Erde verfault, und als der Herbst kam und die armen Pächter sie ausgruben, gab es nichts zu essen. Zuerst starben die kleinen Kinder und die Alten, dann wurden es immer mehr.
Britische Soldaten schossen auf jeden, der sich den Lebensmitteltransporten nach England näherte, die die ganze irische Insel hätten am Leben erhalten können.
Ihr Vater, der sich mit einigen anderen Männern zusammengetan hatte, um seine Familie zu retten, nur ein wenig Getreide für Brot zu besorgen, überlebte diesen Versuch nicht.
Und nun gab es von der großen Familie niemanden mehr außer ihnen dreien.
In Irland mussten Kinder schon früh mitarbeiten, um die Familie zu versorgen. Die protestantischen englischen Herren hatten Bildung für die Katholiken verboten, das hieß für alle Iren, denn alle waren katholisch. Katholiken konnten weder Land kaufen noch Land besitzen, sie hatten kein Recht auf eine Ausbildung, auf eine Chance im Leben. Eigentlich hatten sie überhaupt keine Rechte.
Von dem, was sie anbauten, blieb nichts übrig. Die Engländer ließen ihnen gerade die paar Kartoffeln, an denen sie nicht weiter interessiert waren.
Emma hatte ein wenig Lesen und Schreiben von ihrem Vater gelernt, und Rechnen konnte sie im Kopf. Besser als mancher »Mittelsmann«. Eine Schule hatte sie wie die meisten Iren nie von innen gesehen.
Die Mittelsmänner waren der Untergang des Landes. Sie hatten das Land von den Grundherren gepachtet und in so kleine Parzellen aufgeteilt, dass niemand mehr davon leben konnte. Dennoch mussten die Pächter – wie Emmas Vater es getan hatte – hohe Mieten für die winzigen Landstücke zahlen. Es war kaum zu schaffen, wenn nicht alle rund um die Uhr wie die Sklaven arbeiteten.
Und Sklaven, das waren sie ja auch. Erst in Amerika hatte Emma davon gehört, dass Sklaven im allgemeinen schwarz waren. In Amerika traf das zu, in Irland hatte die Hautfarbe keine Rolle gespielt, nur die Religion und der Grundbesitz.
Besitz war überhaupt das A und O. Das hatte selbst Emma mit ihren zehn Jahren schon begriffen. Wenn man kein Land besaß, war man ein Niemand.
Deshalb reifte der Wunsch in ihr, welches zu besitzen. Auch wenn sie nicht im entferntesten wusste, wie sie das anstellen sollte. Genauso gut hätte sie sich wünschen können, auf den Mond zu fliegen.
Es war so dunkel in dem verrotteten Zimmer, in dem sie alle lebten, im untersten Stock eines Mietshauses, das so aussah, als würde es gleich zusammenbrechen, dass man normalerweise kaum mitbekam, ob draußen die Sonne schien oder tiefste Nacht war. Nicht ein einziger Sonnenstrahl fand seinen Weg durch die kaputten Fenster. Es war kalt, und Schimmel wucherte an den Wänden. Die Feuchtigkeit führte zu Tuberkulose und Tod. Im ganzen Haus hörte man ständig irgendjemanden husten.
Sie hatten keinen Tisch und keine Stühle, sie schliefen auf dem Boden, auf alten, mottenzerfressenen Decken, die weder Schutz noch Wärme boten. Es war wirklich nicht viel anders als in Irland, und Emma fragte sich manchmal, warum sie überhaupt hierhergekommen waren. In Irland hatten sie zumindest einen Tisch gehabt und wenn auch harte Holzbetten, einen Topf, in dem über dem offenen Feuer die Kartoffeln kochten. Hier konnten sie sich noch nicht einmal das leisten.
Sie versuchte langsam zu essen, obwohl sie am liebsten das ganze Brot in sich hineingestopft hätte. Sie hatte ständig Hunger. Aber sie wusste aus Erfahrung, dass es ein wenig länger dauerte, bis sie wieder richtigen Hunger bekam, wenn sie langsam aß. Sattessen konnte sie sich ja ohnehin nie.
Im Augenwinkel nahm sie eine Bewegung vor dem Fenster wahr. Sie stand vom Boden auf und schaute hinaus. Neben diesem Haus türmte sich ein großer Steinhaufen auf, das einst nächstgelegene Mietshaus, das tatsächlich zusammengestürzt war, wie viele andere.
Eine laute Stimme hob sich darüber hinweg.
Ein Polizist mit einem hohen, halbrunden Helm hielt mit weitausholender Geste eine Rede, und um ihn herum standen ein paar Gestalten, die hier gar nicht herzupassen schienen.
Sie waren gut angezogen, die langen Kleider der Ladys schleiften im Dreck, und die Krinolinen erhoben sich über dem unteren Rücken – ihre Mutter hätte nie erlaubt, »Hintern« zu sagen – der Damen, als ob sie sich mit Grausen von dem Schmutz abwandten.
Es war nicht das erste Mal, dass Emma hier solche Besucher sah. Es wurden richtige Führungen durch das Armenviertel Five Points in New York veranstaltet, in dem die meisten eingewanderten Iren lebten. Die Reichen ergötzten sich an Hunger und Elend.
Emma, die das Viertel liebend gern verlassen hätte, verstand diese Menschen nicht, die freiwillig hierherkamen, obwohl sie es gar nicht mussten. In Irland hatten sich englische Ladys, die genauso gekleidet waren wie diese hier, sehr rar gemacht. Sie hatte nur einmal eine Kutsche von weitem gesehen, als sie zum Landsitz des Lords fuhr, und kurz einen Blick auf eine solche Lady erhascht.
Die sah aber nicht so aus, als ob sie wirklich freiwillig dort wäre. Die englischen Lords waren bekannt als die »abwesenden Grundherren«. Sie fanden das Leben auf dem Land so abstoßend, dass sie ihre Güter kaum je besuchten.
Diese Ladys hier wirkten anders. Bestürzt irgendwie. Bis auf eine. Ein junges Mädchen, die hinter einer älteren Frau stand, wahrscheinlich ihrer Mutter. Sie schaute sich mit einem arroganten Blick um, als ob sie eine der englischen Grundherrinnen wäre.
Emma selbst besaß ein typisch irisches Äußeres: schwarze Haare und strahlend blaue Augen, diese junge Lady war blond, eine Engländerin eben. Die Farbe ihrer Augen konnte Emma nicht erkennen, aber sie hatte noch nie einen Engländer mit dunklen Augen gesehen. Englische Augen waren immer blass, wie ihre Haut.
Während die anderen Damen und Herren dem Polizisten zu lauschen schienen, interessierte diese junge Frau sich anscheinend überhaupt nicht dafür. Sie wirkte gelangweilt. Vielleicht war sie wirklich Engländerin, keine Amerikanerin, dachte Emma. Nur hier bei Verwandten zu Besuch.
Als Emma sie länger betrachtete, fiel ihr auf, dass diese junge Lady wohl kaum älter sein konnte als Katie, auch wenn sie wegen der eleganten Kleider reifer wirkte. So abgerissen, wie die Iren gezwungen waren herumzulaufen, sahen selbst Erwachsene manchmal noch wie schmuddelige Kinder aus.
Ein solches Kleid zu tragen musste der Himmel auf Erden sein, dachte Emma.
Jung, wie Emma war, stieg doch ein leichter Abscheu in ihr auf. Was bildeten sich diese Leute eigentlich ein? Sie wurden ihr Leben lang versorgt, brauchten keinen Finger zu rühren. Womit hatten sie das verdient?
In Irland hatten nur die Iren auf den Feldern gearbeitet, die Grundherren nicht. So war die Welt beschaffen, das wusste Emma auch, aber auf einmal erschien es ihr ungerecht. Warum stand dieses junge Mädchen jetzt nicht hier am Fenster, in abgerissenen Kleidern, und Emma war dort draußen, mit sorgfältig gelegten Locken im Haar und einem Schleier vor dem Gesicht, mit Handschuhen so weiß, dass man kaum glauben konnte, dass es so etwas gab?
»Was ist denn da draußen?« Ihre Schwester Katie war nun doch aufmerksam geworden.
»Nichts.« Emma sagte es, aber sie drehte sich nicht um. Sie konnte sich einfach nicht vom Anblick dieser jungen Lady lösen.
Katie stand auf und kam zu ihr. »Die Engländer«, sagte sie. Ihrer Stimme war keine Gefühlsregung anzuhören.
»Ich glaube nicht«, sagte Emma. »Amerikaner.«
»Sie tragen wunderschöne Kleider.« Immer noch wirkte Katies Stimme so starr wie ihr Blick.
»Ja.« Ein leichtes Lächeln hob Emmas Mundwinkel. Sie liebte schöne Kleider. Und sie bewunderte Frauen, die darin aussahen wie dahingleitende Engel. In der Kirche gab es Engel mit langen Kleidern. Die hatte Emma immer besonders geliebt.
»So etwas werden wir nie haben«, sagte Katie. Sie wandte sich ab.
»Warum nicht?« In Emma regte sich Protest. Das hatte ihre Mutter ihr schon als kleines Kind vorgeworfen. Aber Emma konnte nicht anders.
Ihre Mutter sagte, die Welt wäre von Gott so geschaffen, wie sie nun einmal war. Daran könnte man nichts ändern.
Und schon früh war in Emma die Frage »Warum?« aufgestiegen.
Diese Frage stellte man nicht, sagte ihre Mutter.
Darauf hätte Emma am liebsten gleich noch einmal »Warum?« gefragt, aber sie verbiss es sich.
Katie fragte nie nach dem Warum. Sie nahm alles hin. Als Emma noch kleiner war, hatte sie sie immer nur strafend angesehen, wenn sie »Warum?« fragte. Ein wenig herablassend auch, wie man eben ein kleines Kind ansah, wenn es etwas Dummes fragte, das zu dumm war, um es überhaupt einer Antwort zu würdigen.
Seit Emma größer geworden war, machte Katie sich nicht mehr die Mühe, sie so anzuschauen, sie ignorierte sie einfach. Vielleicht war sie auch nur zu müde, um sich um irgendetwas anderes zu kümmern als sich selbst.
»Warum nicht?« Katie wiederholte Emmas letzte Frage, als ob sie in einer fremden Sprache gesprochen hätte.
»Ja, warum nicht?«, bestätigte Emma. Sie setzte einen trotzigen Gesichtsausdruck auf. Dadurch wirkte sie nun tatsächlich eher wie ein kleines Kind, während sie ansonsten meistens den Eindruck machte, als ob sie älter wäre.
»Nur kleine Kinder fragen so dumm«, antwortete Katie denn auch prompt mit dem überheblichen Gesichtsausdruck, den Emma schon lange nicht mehr an ihr gesehen hatte.
»Wer hat das Brot besorgt?«, fragte Emma angriffslustig. »Du oder ich? Wer ist also hier das Kind?«
»Ich bin jedenfalls schon so alt, dass ich kein Brot mehr geschenkt bekomme«, erwiderte Katie leicht gelangweilt, als ob sich eine feine Dame herabließe, sich mit den profanen Dingen des Lebens zu beschäftigen, die sie sonst nicht interessierten. Wenn man genau hinhörte, klang jedoch eine Spur von Neid in ihren Worten mit.
Dachte Katie das wirklich? überlegte Emma. Dass sie das Brot geschenkt bekam? Sie musterte ihre Schwester mit einem forschenden Blick. Tatsächlich. Sie sah so aus. Als ob einem hier in Amerika irgendjemand irgendetwas schenken würde. Als ob sich irgendetwas geändert hätte seit Irland. So wie sie alle es sich erhofft hatten.
Insbesondere für Ian war Amerika das Land seiner Träume gewesen, das Land, in dem Milch und Honig für sie fließen würden. Wie er sich doch geirrt hatte. Es gab weder Milch noch Honig hier, seit ihrer Ankunft hatte Emma so etwas nie bekommen. Früher, in Irland, hatten sie zumindest eine Kuh gehabt. Und Honig versteckten die Bienen im Sommer in ihren Waben, in Bäumen, die Emma genau kannte. Sie war schon mehr als einmal gestochen worden, wenn sie ihnen die süße Versuchung stahl.
Sie lächelte, als sie an den Geschmack dachte. Dann jedoch verdüsterte sich ihr Gesichtsausdruck. Hier in der Stadt gab es keine Bienen. Also würde sie dieses Jahr wohl auch keinen Honig bekommen. Noch nicht einmal gestohlenen.
Sie beschloss, Katie genauso zu behandeln, wie sie Emma meistens behandelte, und sie zu ignorieren. Ihr Blick wanderte wieder nach draußen.
Der Polizist war nun mit den »Besuchern« weitergezogen. Sie sah die Gestalten nur noch von hinten. Sie würden sich nicht mehr lange hier aufhalten. Meistens ertrugen sie den Gestank nicht. Schon jetzt hatten praktisch alle sich weiße, seidene Taschentücher vor die Gesichter gepresst, um den Geruch nicht an ihre wertvollen gepuderten Näschen herankommen zu lassen.
Was für ein Leben musste das sein. Emma versank in einen Tagtraum. Sie sah sich selbst in so einem langen, auf dem Boden schleifenden Kleid, ein Taschentuch im Ärmel, das sie elegant herauszog. Nicht um sich mit brüllendem Getöse die Nase zu putzen, wie es die armen Leute taten, sondern nur, um sie leicht zu betupfen, als wäre ein Taschentuch nichts weiter ein überflüssiges Accessoire. Eine modische Torheit ohne Funktion.
»Mutter.« Emma drehte sich um. »Wenn ich solchen Stoff bekäme, könntest du mir dann so ein Kleid nähen?«
Ihre Mutter schaute sie verständnislos an. Vor Auszehrung lagen ihre Augen tief in den Höhlen. »Was für ein Kleid?«
»Wie die feinen Damen es tragen.«
Wenn sie noch die Kraft dazu gehabt hätte, hätte ihre Mutter wohl nachsichtig gelächelt. Aber da ihr die Kraft fehlte, sagte sie nur müde: »Solchen Stoff gibt es nicht für arme Leute. Den könnten wir gar nicht bezahlen.«
»Du immer mit deinem Geträume.« Katies Stimme klang ärgerlich, als sie ihre Schwester abschätzig ansah. »Schon zu Hause hast du immer nur geträumt. Vater und du –«
»Katie!« Bei aller Kraftlosigkeit schaffte es ihre Mutter, den Namen recht scharf auszusprechen, aber dann fiel sie wieder in sich zusammen.
»Und Ian«, fuhr Katie dennoch aufmüpfig fort. »Ihr alle. Und was habt ihr davon? Vater und Ian sind tot –«
»Katie . . .« Diesmal flüsterte die Stimme ihrer Mutter nur.
»Hör auf! Hör verdammt noch mal auf!« Emma sprang ihrer Schwester an die Gurgel. »Siehst du nicht, wie du Mutter quälst?«
Katie versuchte sich zu wehren, aber auch sie war recht schwach. Deshalb behielt Emma die Oberhand und konnte sie zu Boden reißen. »Vater hat immer gesagt, ohne Träume ist ein Ire nichts wert. Es ist unser gutes Recht zu träumen. Die kleinen Menschen konnten alles erreichen, weil sie davon geträumt haben.«
»An Feen zu glauben ist heidnisch, unchristlich«, sagte ihre Mutter leise. »Auch wenn dein Vater –« Sie brach erschöpft ab.
»Und wo sind die kleinen Menschen jetzt?«, fragte Katie spitz. Immer noch lag Emma auf ihr und ließ sich nicht wegschieben, auch wenn Katie das versuchte. »Helfen sie uns? Haben sie Vater beschützt? Haben sie Ian beschützt?«
Emma hatte für einen Moment das Gefühl, als würde alle Kraft aus ihren Armen gesaugt, als bestände sie nur noch aus einer weichen, biegsamen Masse. Die Erinnerung an ihren Vater und ihren Bruder, die nicht mehr bei ihnen waren, überfiel sie wie ein schwarzes Loch.
Katie warf sie ab und stand auf. Geringschätzig schaute sie auf Emma hinunter. »Niemand ist da«, setzte sie hart fort. »Wir sind ganz allein. Niemand hilft uns.«
Die Schwäche, die Emma für einen kurzen Augenblick überwältigt hatte, verließ sie wieder. Sie sprang auf die Beine und starrte ihre Schwester mit wie blaue Diamanten glitzernden Augen an. »Sie sind da«, behauptete sie. »Sie sind bei uns. Aber helfen müssen wir uns selbst.«
Mit einem hohlen Laut wandte Katie sich ab. »Wir müssen Arbeit finden. Mutter läuft den ganzen Tag herum, aber es gibt keine Arbeit. Ich habe es auch schon versucht, aber sie wollen mich nicht. Ich sehe zu dünn aus. Sie denken, ich bin zu schwach. Und du . . .«, sie warf einen vernichtenden Blick auf ihre kleine Schwester, »träumst.«
Und ich bringe das Essen nach Hause, dachte Emma, aber sie sagte es nicht laut. Es hatte ja keinen Sinn. Wenn ihre Mutter erfuhr, dass das Brot und die Äpfel gestohlen waren, würde sie keinen Bissen anrühren und Emma dazu auffordern, in die Kirche zu gehen und Abbitte zu leisten, alle Heiligen um Verzeihung zu bitten und tausend Rosenkränze zu beten. Dafür hatte Emma keine Zeit.
»Einmal werde ich reich sein«, sagte sie und warf den Kopf zurück, dass ihre langen, schwarzen Haare wie eine Aura aus dunklem Licht um ihr Gesicht flogen. »Einmal werde ich alles haben, was ich mir wünsche. Du wirst schon sehen.«
»Träume, nichts weiter.« Katie verzog die Mundwinkel. »Wir werden nie ein Goldstück zu sehen bekommen. Wie es immer schon war.«
2
»Emma? Hast du die Änderungen für Mrs. Lexington-Smith fertig?« Eine kleine, aber durchaus streng aussehende Frau kam zur Tür herein, die in die Schneiderwerkstatt führte.
Sie trug ein exquisit geschneidertes Kleid, das aber trotzdem einen Hauch von Bescheidenheit vermittelte. Sie wollte ihre Kundinnen nicht übertrumpfen, die zu ihr kamen, um so auszusehen, dass ihnen ihre Geschlechtsgenossinnen am liebsten die Augen ausgekratzt hätten.
»Gleich«, sagte Emma, während sie von dem Stoff in ihrer Hand aufschaute. »Ich habe noch etwas mehr geändert.«
Die kleine Frau hob die Augenbrauen und seufzte. »Lernst du es denn nie? Die Kundin will es genauso haben, wie sie es bestellt hat. Das gibt wieder nur Ärger. Mach es so, wie sie es wollte.«
»Aber . . .«
»Kein Aber!« Nun klang die Stimme wirklich streng. »Du hast zu tun, was man dir sagt. Du bist Näherin, nicht die Besitzerin!« Wütend rauschte Harriet Mitchell ab.
Emmas Wut war an ihren zusammengezogenen Augenbrauen zu erkennen. Heftig riss sie den Saum wieder auf, den sie gerade erst genäht hatte. Diese Idioten!
Harriet Mitchell war die beste Schneiderin der Stadt, aber Emma dachte, dass sie selbst noch besser sein könnte, wenn man sie nur ließe. Sie wusste, dass sie eigentlich froh sein sollte, dass sie diese Arbeit überhaupt bekommen hatte. Seit sie sechzehn geworden war, arbeitete sie hier. Nun aber war sie achtzehn, und langsam hätte Mrs. Mitchell ihr ruhig etwas Freiheit lassen können. Sie fühlte, wie ihr irisches Temperament überzuschäumen drohte.
Aber sie hatte gelernt, sich zu beherrschen, zumindest nach außen hin. Also nahm sie Nadel und Faden und begann erneut zu nähen.
»Ich bringe das Kleid für –«
»Lieferanteneingang!« Der hochnäsige Butler knallte Emma die Tür vor der Nase zu.
Eines Tages werde ich durch den Vordereingang kommen, und du wirst dich vor mir verneigen. Emmas Backenzähne mahlten. Dieser Kerl war nicht besser als sie, aber er hielt sich dafür. Alle hielten sie sich dafür. Sie würden schon noch sehen . . .
Da sie keine andere Wahl hatte, ging sie am Haus vorbei nach hinten zum Dienstboteneingang. Obwohl sie als Näherin auch nicht gerade einen angesehenen Berufsstand repräsentierte, war sie froh, dass sie es geschafft hatte, es zu vermeiden, als Dienstmädchen arbeiten zu müssen.
Katie war in einem solch großen Haus angestellt, und sie gab ständig vor Emma damit an, die noch immer im Slum wohnte, wie Katie es abschätzig nannte, die sich nun für etwas Besseres hielt. Genau wie dieser Butler. Aber sie waren eben alle nur Dienstboten. Katie wurde den ganzen Tag herumgescheucht, von morgens fünf bis Mitternacht oder später, wenn die Herrschaft etwas wünschte.
Emma wurde auch herumgescheucht, aber anders. Ihre Fähigkeiten als Näherin wurden zumindest teilweise anerkannt. Schon damals als Kind hatte sie angefangen, sich bei ihrer Mutter, die eine hervorragende Näherin war, einiges abzuschauen.
Sie hatte Stoff »besorgt« (ihre Mutter durfte nur nicht wissen, wie) und sich von ihrer Mutter alle Feinheiten des Handwerks zeigen lassen. Aufgrund ihres Könnens hatte ihre Mutter dann zuerst diese Arbeit hier bei Harriet Mitchell bekommen, aber dann kam die Lungenentzündung, es gab kein Mittel dagegen, und wenn, hätten sie es nicht bezahlen können. So war ihre Mutter vor zwei Jahren gestorben.
Daraufhin war Emma ihr in die Arbeitsstelle gefolgt, nachdem sie Harriet Mitchell mühsam davon überzeugt hatte, dass sie trotz ihrer Jugend genauso gut wie ihre Mutter war.
Am Hintereingang musste sie nicht klopfen, sie schob einfach die Tür auf. Vor ihr öffnete sich ein Gang, von dem mehrere Türen abzweigten, die Zimmer der Dienstboten. Den Gang herunter zu ihr hin fädelte sich ein verführerischer Duft. In der großen Küche, die seitlich am Ende des Ganges lag, wurde wahrscheinlich das Mittagessen gekocht.
Anscheinend waren alle damit beschäftigt, denn Emma sah niemanden, den sie hätte fragen können, wo sie hinmusste. Also näherte sie sich der Küche und schaute hinein.
Die Köpfe zweier Küchenmädchen, die dazu abgeordnet waren, Gemüse zu putzen und Brot zu kneten, wandten sich ihr zu.
»Ich bringe das Kleid für Mrs. Lexington-Smith.« Diesmal konnte Emma ihren Satz zu Ende führen.
Die Küchenmädchen schienen mit dieser Mitteilung überfordert, aber eine ältere Frau, deren Leibesumfang man deutlich ihren Beruf als Köchin ansah, wischte sich die Hände an der Schürze ab und rief: »Mrs. Gallagher! Können Sie mal kommen?«
Kurz darauf erschien eine ehrfurchtgebietende Dame in einem dunklen Kleid. Sie hob fragend die Augenbrauen in Richtung der Köchin.
»Das Kind bringt das Kleid für die gnädige Frau«, erklärte die, wandte sich ab, da sie den Stab nun an die Hausdame weitergegeben hatte, und öffnete einen riesigen Ofen, der Emmas ganzes Zimmer ausgefüllt hätte, hätte sie denn einen solchen besessen.
»So?« Mrs. Gallagher blickte Emma an, als hätte sie eine Gans gestohlen.
»Mrs. Mitchell schickt mich.« Emma versuchte sowohl zu ignorieren, dass sie als Kind bezeichnet als auch, dass sie offensichtlich als Eindringling betrachtet wurde, der nicht in dieses Haus gehörte und es baldmöglichst wieder verlassen sollte, wenn sie nicht vom einheimischen Rudel weggebissen werden wollte. »Ich habe die Änderungen gemacht, die Mrs. Lexington-Smith verlangt hat.«
»Du?« Offenbar konnte die Hausdame kaum glauben, dass ein junges Mädchen wie Emma bereits eine solche Verantwortung zugewiesen bekam.
»Ja«, sagte Emma, die diese Reaktion schon kannte. »Wenn Mrs. Lexington-Smith das Kleid freundlicherweise anprobieren könnte, könnte ich überprüfen, ob alles in Ordnung ist.«
Erneut wanderten die Augenbrauen nach oben. »Da muss ich erst einmal fragen, ob die gnädige Frau sich dafür jetzt Zeit nehmen kann.«
»Selbstverständlich«, sagte Emma. »Aber Mrs. Mitchell meinte, die gnädige Frau wartet dringend auf das Kleid.«
»Komm mit«, forderte Mrs. Gallagher sie auf, drehte sich um und ging an der Küche vorbei auf eine Tür zu.
Emma stolperte leicht, als sie ihr folgte, da der Boden nicht ganz eben war. Als Mrs. Gallagher durch die Tür ging, wäre die Emma beinah ins Gesicht geschlagen, denn sie hielt sie ihr nicht auf, obwohl Emma das große Paket mit dem Kleid trug und eigentlich keine Hand mehr frei hatte.
»Bleib hier stehen«, wies Mrs. Gallagher sie an, als sie auf der anderen Seite waren. »Und fass nichts an!«
Emma biss die Zähne zusammen. Obwohl diese Art der Behandlung ihr tägliches Los war, hatte sie sich ihr Leben lang nicht daran gewöhnen können. Und das würde sie auch niemals. Sie wollte es gar nicht. Nur weil es Menschen gab, die Geld hatten, und andere, die nicht so viel hatten, meinten die Reichen, sie könnten die Armen wie Dreck behandeln.
Aber sie würde sich das nicht gefallen lassen. Einmal würde sie selbst reich sein, und dann würde niemand sie mehr so behandeln.
Sie schaute sich in der Halle, die sich vor ihr öffnete, um. Wie in allen großen Häusern schwang sich in der Mitte eine weitausladende Treppe nach oben, auf der ein ganzes Regiment hätte marschieren können. Sie hatte von Einladungen gehört, bei denen auf solchen Treppen so viele Menschen gleichzeitig hinauf und hinab gingen, dass tatsächlich ein Stau entstand.
Neugierig schaute sie um die Ecke. Sie wusste, dass es hier einen Ballsaal gab. Die ganze Stadt sprach davon. Mrs. Lexington-Smith war für ihre Bälle berühmt.
Da sich außer ihr offenbar niemand hier unten befand, wagte sie es, ihre Nase noch weiter hinauszustrecken und sogar ein paar Schritte in die Halle hineinzugehen. Sie hatte den Eindruck, die Halle war so hoch wie das ganze Haus, in dem sie wohnte. Bewundernd legte sie den Kopf in den Nacken. Das hier war Freiheit, nicht die beschränkende Enge eines Zimmers, in dem gerade einmal ein Bett Platz hatte.
Immer noch war sie allein und unbeobachtet, also tastete sie sich weiter vor und wurde mutiger, je mehr sie sich einer hohen, halbrunden Öffnung auf der anderen Seite der Treppe näherte.
Tatsächlich, das war der Ballsaal. Emma konnte sich kaum sattsehen an den glänzenden Lüstern aus teuerstem, aus Europa importierten Kristall, das wie Diamanten glitzerte. Sicherlich ein Dutzend dieser vielarmigen Luxuskerzenhalter zierte die Decke. Es musste wunderbar sein, wenn die Kerzen brannten, wenn es Abend war und man hier tanzte . . .
»Was machst du da? Wer hat dich hier hereingelassen?« Eine scharfe Stimme, hell und doch gebieterisch, ließ sie herumfahren.
Eine junge Frau stand vor ihr, in einem Nachmittagskleid, das hinter ihr auf dem Boden schleifte und dessen Stoff sich über dem Reifrock oberhalb ihres »unteren Rückens« bauschte, um damit ihre schmale Taille noch mehr zu betonen. Sie war älter als Emma, aber höchstens wenige Jahre. Ihr blondes Haar ringelte sich von der Brennschere gelockt über die eher schmalen Schultern, und ihr Gesichtsausdruck war nicht sehr freundlich.
Emma schluckte. »Ich bringe . . .«, sie hob den Karton an, »das Kleid –«
»Komm herauf!«, befahl da von oben die Stimme von Mrs. Gallagher. »Nun mach schon! Lass die gnädige Frau nicht warten!«
Emmas Kopf ruckte nach oben. Mrs. Gallagher stand auf dem mittleren Absatz der Treppe, von wo sie in die Halle hinunterschauen konnte.
Schnell lief Emma auf die Treppe zu. Allein diese Treppe hinaufzusteigen war der Höhepunkt des Tages, an den sie sich lange erinnern würde. Sie war Mrs. Gallagher trotz ihrer Unfreundlichkeit fast dankbar, denn sie hätte sie auch über die Dienstbotentreppe heraufrufen können.
Als sie ein paar Stufen genommen hatte, schaute sie hinunter. Die blonde junge Frau stand immer noch da, sie hatte sich nicht gerührt. Anscheinend wollte sie sicherstellen, dass Emma genau das tat, was man ihr befahl, und nicht etwa noch einmal allein im Haus herumlungerte.
Sie passt in dieses Haus, als wäre es für sie gemacht, dachte Emma. Wenn sie in dem großen Ballsaal tanzt, leuchten die Kerzen nur für sie.
Sie konnte sich sehr gut vorstellen, wie diese junge Dame in einem Ballkleid aussah, und sie wünschte sich, ihr beim Tanzen zuschauen zu können.
»Was hast du denn da zu glotzen?«, fuhr Mrs. Gallagher sie ungeduldig an. »Die gnädige Frau hat nicht ewig Zeit für dich.«
»Verzeihung«, murmelte Emma und nahm schnell die weiteren Stufen.
Sie konnte sich auch nicht erklären, warum sie sich von dem Anblick der jungen Frau in der Halle nicht hatte lösen können. Irgendetwas faszinierte sie daran.
In Mrs. Mitchells Salon hatte sie schon viele junge Damen aus den besten Kreisen gesehen, aber diese nicht. Und obwohl sie keine der Besucherinnen des Salons interessierte – oft schaute sie ihnen nicht einmal ins Gesicht, wenn sie Säume und Taillen absteckte –, übte diese junge Frau hier eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus.
Während sie den Sitz des Kleides an Mrs. Lexington-Smith’ üppiger Büste überprüfte, ging ihr das Gesicht des blonden Mädchens nicht aus dem Kopf. Sie hatte sie noch nie gesehen, davon war sie überzeugt, und doch kam sie ihr bekannt vor.
Eine weitere Begegnung war ihr jedoch nicht vergönnt, denn nachdem Mrs. Lexington-Smith das Kleid gnädig abgesegnet hatte, wurde Emma von einem Hausmädchen über die Dienstbotentreppe direkt nach unten in den Küchentrakt und zur Hintertür hinaus geführt.
3
»Du sollst zu Mrs. Mitchell kommen.« Eine Kollegin von Emma, eine andere Näherin, brachte Emma die Nachricht und blickte besorgt, was aber nichts Besonderes war, da sie immer so blickte. Sie war nicht die beste Näherin und hatte ständig Angst, entlassen zu werden. Wahrscheinlich vermutete sie dasselbe Schicksal nun auch für Emma.
»Ich bin gerade –« Emma hielt das Korsett fest, in das sie seit einer Stunde Fischbeine einnähte. Sie hasste es, mitten in der Arbeit unterbrochen zu werden, aber wenn Mrs. Mitchell sie rief, konnte sie schlecht sagen: »Warten Sie bitte, bis ich fertig bin.« Also legte sie das Korsett seufzend zur Seite und stand auf.
»Ah, Emma.« Mrs. Mitchell begrüßte sie in ihrem Büro ausgesprochen freundlich, was vermutlich darauf zurückzuführen war, dass sich mit ihr zusammen zwei Kundinnen im Raum befanden. Emma sah beide nur von hinten, da sie vor Mrs. Mitchell standen und sich ihr zugewandt hatten.
Eine davon war Mrs. Lexington-Smith, das erkannte Emma schon an der Figur, ohne in ihr Gesicht geblickt zu haben.
»Du hast doch letztens dieses Frühlingskleid aus dem Pariser Katalog nachgenäht«, fuhr Mrs. Mitchell fort. »Könntest du es bitte einmal anziehen?«
Ein Kleid aus der Pariser Kollektion anziehen? Emma war mehr als erstaunt. Sie nähte diese Kleider, aber sie trug sie nicht. Sie waren ausschließlich für Kundinnen bestimmt. Emma hätte sich so etwas nie leisten können. Ihr Gesicht drückte eine große Frage aus.
»Du hast eine ähnliche Figur wie Miss Cunningham«, sprach Mrs. Mitchell weiter, nun schon eindeutig mit unterdrückter Ungeduld. »Sie möchte das Kleid sehen.«
Miss Cunningham war anscheinend die Dame neben Mrs. Lexington-Smith. Auch von ihr sah Emma nur den Rücken. »Ich soll das Kleid vorführen?«, fragte sie, sogar noch überraschter als zuvor.
»Natürlich, Kind. Davon rede ich doch die ganze Zeit!« Mrs. Mitchell konnte ihre Ungeduld kaum noch bezähmen. Ihre Kundinnen sollten nicht den Eindruck erhalten, dass sie ihre Untergebenen nicht im Griff hatte. »Nun spute dich!« Sie klatschte in die Hände, um Emma anzutreiben. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Wenn du fertig bist, komm in den Vorführsaal.«
Emma wandte sich automatisch um und verließ das Büro, aber in ihrem Kopf drehte sich alles. Es gab etliche junge Mädchen, die ab und zu Kleider vorführten, aber Emma war diese Ehre noch nie zuteil geworden.
Dennoch war sie hin und wieder bei einer Vorführung zugegen gewesen, wenn es darum ging, dass sie die Änderungen gleich an einem Kleid abstecken sollte. Das war aber auch alles. Man beachtete sie nicht. Die Kundinnen behandelten sie, als wäre sie gar nicht da und unterhielten sich ausschließlich mit Mrs. Mitchell, schauten Emma nicht einmal an.
Wenn sie in diesem Kleid steckte, würden sie sie jedoch anschauen. Sie würde nur so etwas wie eine lebende Schneiderpuppe sein, aber wenn sie das Kleid betrachteten, würden sie kaum an ihr vorbeischauen können.
Nicht dass sie sich davor fürchtete, aber es war doch eine ungewohnte Situation, so im Mittelpunkt zu stehen. Näherinnen waren die unsichtbaren Geister im Hintergrund, sie nähten in der Abgeschiedenheit der Schneiderwerkstatt, und auch wenn sie die ganze Arbeit taten, benahmen die Kundinnen sich oft, als wäre eine Näherin ein unnützes Accessoire.
Sie war mittlerweile in den Teil der Werkstatt zurückgekehrt, in dem die fertigen Kleider hingen. Nachdem sie kurz danach gesucht hatte, zog sie das geblümte Kleid heraus. Das Muster gefiel ihr nicht, sie fand es zu überladen, französisch eben, aber wenn Mrs. Mitchell dieses Kleid wollte, dann war es dieses Kleid.
Sie konnte es jedoch nicht allein anziehen. Üblicherweise trug sie kein Korsett, die Kleidung der ärmeren Schichten der Bevölkerung erforderte keins, bei der Arbeit störten Korsetts und Reifröcke nur, aber für dieses Kleid musste sie eins tragen. Die Taille war viel zu eng für jede normale Frau, selbst für ein so junges Mädchen wie sie.
»Maggie? Kannst du mir bitte mal helfen?«, rief sie rückwärts in den Raum hinein.
Kurz darauf erschien ein Mädchen mit einem Tuch um den Kopf und einem Putzlappen in der Hand.
»Leg das weg«, sagte Emma. »Du musst mir das Korsett schnüren.«
Maggie starrte sie nur an. Sie war nicht unbedingt die Hellste, aber sie hielt die Werkstatt peinlich sauber, was alle an ihr schätzten.
»Das Korsett«, wiederholte Emma, zog eines aus einem Regal an der Wand und zeigte es Maggie. »Komm mit.« Sie huschte hinter ein paar Schneiderpuppen, griff an ihr Mieder und öffnete es, ließ ihr Kleid fallen, stieg in das Korsett und schlüpfte hinein. Rasch blickte sie sich um. »Ich halte mich hier an der Stange fest«, erklärte sie Maggie, »und du musst ziehen.« Sie drehte sich wieder zurück, griff mit einem Arm an das Gestänge und streckte den anderen mit den Strippen, die bislang noch lose am Korsett herunterhingen, nach hinten.
Maggie zögerte, und Emma musste sie extra noch einmal auffordern, aber dann griff sie an die Bänder und zog fest daran.
»Mehr«, verlangte Emma schon ein wenig gepresst. »So passe ich nie in das Kleid.«
Maggie zerrte, so sehr sie konnte, sie war ein kräftiges Mädchen, und unter den Fischbeinkorsettstäben wurde Emmas Taille immer schmaler, während sie ächzte und fühlte, wie ihr die Luft abgedrückt wurde. Sie liebte schöne Kleider, aber wenn sie darüber nachdachte, jeden Tag in so einen Käfig gesteckt zu werden, in dem man kaum atmen konnte, geschweige denn schnell laufen oder springen, bekam sie so ihre Zweifel an der Mode.
Endlich – als sie schon fast in Ohnmacht fiel – war es vollbracht, und sie befestigte den Reifrock an ihrer Taille, dann warf Maggie das Kleid darüber. Der Stoff fühlte sich schwer an, es war viel mehr, als Emma je zuvor getragen hatte, mehrere Schichten übereinander. Sie wusste, wie viele, denn sie hatte es ja genäht.
Mit Maggies Hilfe schloss sie den Stoff über dem Korsett. Theoretisch hatte sie schon gewusst, dass es für eine Dame unmöglich war, sich allein anzuziehen, aber heute probierte sie es zum ersten Mal praktisch aus, mit Maggie als ihrer Zofe.
Sie musste lachen, als sie sich vorstellte, wie es wäre, jeden Tag von einer Zofe bedient zu werden, fing aber sofort an zu husten, weil sie nicht genug Luft für ein Lachen bekam. Das war wohl der Grund, warum feine Damen immer nur zurückhaltend lächelten.
»Meine Haare«, fiel ihr plötzlich ein, und sie griff sich in die lange, schwarze Mähne. Da war nicht viel zu machen. Für eine damenhafte Frisur war nun keine Zeit mehr.
Sie suchte nach einem Sonnenschirm in der Farbe des Kleides – er musste immer die Farbe des Kleides haben, weshalb feine Damen Unmengen davon besaßen, sogar mehr als Schuhe – und streifte sich schnell noch weiße Handschuhe über, von denen viele in verschiedenen Größen im Regal lagen.
Schnell – das heißt, so schnell sie konnte in dem beengenden und mit seiner über zwei Meter breiten Reifrock-Krinoline äußerst schwer durch die Werkstatt zu manövrierenden Kleid – trat sie hinter den Schneiderpuppen hervor, lief zu einem Spiegel und schaute hinein.
»Du lieber Himmel, Emma!« Das war ihre Kollegin Siobhan, die einzige andere Irin, die hier arbeitete. »Du siehst unglaublich aus!«
Zwar war Emma von ihrer Mutter zur Bescheidenheit erzogen worden, aber sie hatte das nie so ganz verinnerlichen können, wenn es gewisse Dinge betraf. Solange sie lebte, hatte sie diese in den Augen ihrer Mutter gotteslästerliche Eigenschaft jedoch in deren Gegenwart nie durchblicken lassen, höchstens in Katies. »Finde ich auch«, sagte sie lächelnd. Ihr eigener Anblick gefiel ihr ausgesprochen gut. Sie erkannte sich selbst kaum wieder.
»Wie eine feine Dame«, staunte Maggie. Sie bekam den Mund erst nach einer Weile zu.
»Emma! Emma!« Ein Junge in abgerissenen Hosen und einem Hemd voller Löcher, das um seine magere Figur flatterte, schoss in die Werkstatt herein. »Mrs. Mitchell –« Er erstarrte. Sein Mund blieb tatsächlich offenstehen. Er schaffte es nicht einmal nach mehreren Sekunden, ihn zu schließen. Emmas Anblick hatte ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen.
»Ich komme schon«, erwiderte Emma, und in diesem Moment hätte man sie tatsächlich kaum von einer feinen Dame unterscheiden können. Sie unterdrückte ihren irischen Akzent und versuchte die Kundinnen zu imitieren, denen sie zuhörte, wenn sie zu Mrs. Mitchell ins Geschäft kamen.
Mit einer fließenden Bewegung wandte sie sich vom Spiegel ab, der Reifrock schwang um sie wie ein Ballon, sie zupfte an den Handschuhen und öffnete den Sonnenschirm, um ihn locker auf ihrer Schulter liegenzulassen. Im Hinausgehen drehte sie ihn hin und her, dass die Farben wie in einem Kaleidoskop wechselten.
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, in diesem Kleid durch den Gang zum Vorführsaal zu schreiten. Schreiten musste man auf jeden Fall, an Laufen war gar nicht zu denken, auch wenn sie wusste, dass Mrs. Mitchell jetzt schon nah an einer Explosion war, weil sie so lange warten musste. Aber eine Dame brauchte Stunden, um sich anzuziehen, bei Emma war es sicherlich nur ein Bruchteil dieser Zeit gewesen. Sie konnte es nicht ändern.
Als sie sich der Tür zum Vorführsaal näherte, schlug ihr Herz auf einmal lauter. Wenn sie diese Tür öffnete, würden alle Gesichter sich ihr zuwenden, dann war sie nicht mehr die unsichtbare Näherin.
Ihre Mundwinkel zuckten und verzogen sich endlich zu einem breiten Lächeln. »Hier kommt Miss Emma O’Leary«, murmelte sie. »Die Tochter einer der angesehensten Familien der Stadt.« Und mit diesem Lächeln auf den Lippen öffnete sie die Tür und betrat den Vorführsaal.
Leider konnte sie dort nicht umhin, Mrs. Mitchells säuerliche Miene zu bemerken, die sich ihr sofort zuwandte, als die Modesalonbesitzerin ihrer ansichtig wurde.
»Da bist du ja endlich!«
So sehr sie sich auch beeilt hatte, das war zu erwarten gewesen. Emma seufzte innerlich genervt auf, aber nach außen neigte sie nur den Kopf. Mrs. Mitchell konnte es als Entschuldigung nehmen oder auch als die großherzige Geste einer hochgestellten Dame, die Emma ihrem Gefühl nach im Moment war.
»Wir sind der einzige Salon, der diese Schnitte bereits hat«, stellte Mrs. Mitchell stolz fest. »Sie sind gerade erst aus Paris eingetroffen, und sie werden kein zweites Kleid wie dieses in New York finden, geschweige denn im Rest unseres großen Landes.«
Ihre Oberlippe zuckte, als wollte sie gleich die Zähne fletschen. Es war ein Tick, der bei ihr bei großer Anspannung auftrat. Die einflussreichen Kundinnen und die Wartezeit hatten diese Anspannung wahrscheinlich auf den Höhepunkt getrieben.
Emma dachte immer, dass Mrs. Mitchell wölfische Vorfahren haben musste. Ihr Gesicht lud zu einer solchen Vermutung ein, und auch ihr geschäftlicher Erfolg deutete darauf hin, dass sie sich durchbeißen konnte.
»Dreh dich«, befahl Mrs. Mitchell jetzt, ohne Emma direkt anzusehen. »Sehen Sie nur diesen Schwung, diese Linien . . .«, wandte sie sich stattdessen an ihre Kundinnen. »Und das Material . . .« Sie geriet nahezu ins Schwärmen.
Und wie sich die Näherin beim Nähen die Finger zerstochen hat, fügte Emma in Gedanken hinzu. So etwas wurde natürlich nie erwähnt.
Sie drehte sich mit dem Sonnenschirm auf der Schulter und lächelte in die Luft hinein. Es war ein echtes Lächeln, denn sie genoss den Schwung des Kleides ebenfalls, auch wenn der Reifrock an ihrer Taille zerrte. Die war jedoch durch das Korsett so versteift, dass sie dem Gewicht des Stoffes durchaus standhalten konnte.
»Es könnte dir gut stehen, Liebes.« Das war die Stimme von Mrs. Lexington-Smith. »Es würde zu der Original-Garderobe passen, die du aus Paris mitgebracht hast.«
»Paris ist Paris«, erwiderte eine jugendliche Stimme, die ausgesprochen gelangweilt klang. »Solche Kleider wie dort werde ich hier niemals finden.«
In Emma schäumte die Wut hoch. Wie bitte? Sie wusste ganz genau, dass dieses Kleid genauso gut in jedem Pariser Salon hätte vorgeführt werden können. Eventuell trug eine Mademoiselle (sie hatte sich das Wort erklären lassen, nachdem eine Kundin es benutzt hatte) in Paris es gerade jetzt und flanierte damit über die Straßen.
Diese eingebildete – Jählings erstarrte sie, als sie den Blick in Richtung der jungen Dame wandte, die sie bislang nur von hinten hatte betrachten können. Sie erkannte sie sofort. Es war dieselbe hochmütige junge Frau, die sie in der Halle des Hauses angefahren hatte, als sie auf Mrs. Lexington-Smith wartete, um ihr das Kleid zu bringen.
Blasse, leicht grün schimmernde Augen blickten gezielt an ihr vorbei. So wie Emma jetzt aussah, erkannte diese . . . Pute sie wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn, hätte sie es nicht zugegeben. Ob Näherin oder Kleidervorführerin – es war für sie alles in gleichem Maße unter ihrer Würde, sich mit solchen Menschen überhaupt zu beschäftigen.
Emma wäre ihr am liebsten ins Gesicht gesprungen.
Aber das konnte sie natürlich nicht tun. Ihr Lächeln gefror, es wirkte nun nicht mehr echt, während sie sich zurückdrehte, um die junge Frau nicht mehr anschauen zu müssen.
Glücklicherweise konnte ihr deshalb niemand Vorwürfe machen, denn schließlich war es ihre Aufgabe, das Kleid möglichst gut zur Geltung zu bringen, damit die Kundinnen es kauften.
Sie konnte sich kaum mehr vorstellen, was diesen Anflug von Bewunderung in ihr ausgelöst hatte, kürzlich im Hause von Mrs. Lexington-Smith. Wahrscheinlich war es die Umgebung gewesen, nicht diese unverschämte junge Dame. Und damals hatte Emma kein solches Kleid getragen.
In diesem Kleid fühlte sie sich jeder Frau in der Stadt ebenbürtig. Wäre sie nun damit auf die Straße gegangen, hätten die jungen Herren den Hut vor ihr gezogen und ihr bewundernd hinterhergeschaut, wie sie es bei den wohlgeborenen jungen Damen taten. Äußerlichkeiten waren alles.
Und Geld. Geld war das Allerwichtigste überhaupt. Hatte man kein Geld, war man ein Nichts. Hatte man es, konnte man sich benehmen, wie man wollte, und alle mussten es akzeptieren. Man konnte sich alles leisten, in einer eleganten Kutsche umherfahren, mit eleganten Pferden davor, die gestriegelt glänzten und die Schwänze hochtrugen, weil sie sich ihrer Bedeutung, ihrer Zugehörigkeit zu einem reichen Haushalt, bewusst waren.