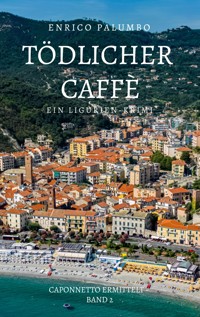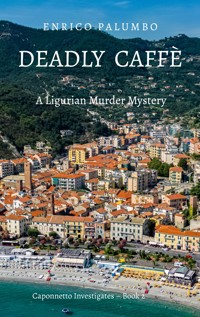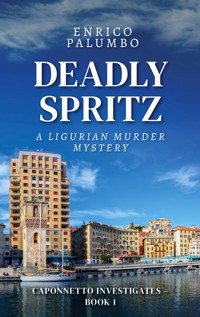Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Caponnetto ermittelt
- Sprache: Deutsch
In den Hügeln und an der Küste Liguriens liegt der Winter in den letzten Zügen. Eben erst hat Giuseppe Caponnetto seinen Dienstausweis für immer abgelegt, da wird er durch seinen Freund Commissario Bonfatti schon wieder in einen Mordfall involviert. Eigentlich hat Caponnetto genug damit zu tun, sein Leben neu zu organisieren. Die Osteria Il Golfo, deren Verpächter er geworden ist, erfordert seine Aufmerksamkeit ebenso wie Giulia, die attraktive Pächterin der Osteria. Der brutale Mord an einem alten Mann aber lässt ihn nicht los, zumal der Hauptverdächtige ein "wasserdichtes" Alibi hat. Zwischen Antipasti und Primi Piatti lernt Caponnetto, wie ihm die gesammelte Erfahrung seiner Karriere neue Wege öffnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Enrico Palumbo, 1972 in Karlsruhe geboren, hat in München und Venedig studiert. Vor seinem Wechsel in die Wirtschaft war er als Journalist für deutsche und italienische Nachrichtenagenturen und Medien tätig. Nach beruflichen Stationen u. a. in Prag, Mailand und Zürich lebt er seit 2019 mit seiner Familie in Karlsruhe. »Tödlicher Spritz« ist der erste Band der Krimireihe um den pensionierten Carabiniere Giuseppe Caponnetto.
Il talento senza disciplina
è come una macchina senza benzina.
Talent ohne Disziplin
ist wie ein Auto ohne Benzin.
Italienisches Sprichwort
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
EPILOG
I
Caponnetto war spät dran. ›Ausgerechnet heute‹, dachte er und schaute hinaus aufs Ligurische Meer. Ein großes Schiff fuhr von Osten auf den Hafen von Savona zu.
Um die Silhouette zu erkennen, kniff er die Augen zusammen und entschied, auf die Nassrasur zu verzichten. Dadurch würde er mindestens fünf Minuten gewinnen.
Sechs Monate waren vergangen, seit die Entscheidung gefallen war. Nein, seit er die Entscheidung getroffen hatte. Er bereute sie nicht, und doch war der heutige Tag viel zu schnell gekommen.
Beim Gang ins Badezimmer schaute er auf seine Uhr, aber nicht auf die Zeiger. Sein Blick galt der Datumsanzeige. Gerade so, als hege er die Hoffnung, sich doch im Tag geirrt zu haben. Vielleicht bliebe ihm doch noch etwas Zeit: Zeit, sich zu verabschieden, Zeit, zu planen, Zeit, sich vorzubereiten.
Caponnetto betrachtete kritisch sein Spiegelbild. Während er den Elektrorasierer über das Gesicht schob, dachte er unwillkürlich an die Textzeilen aus dem Lied Genua per noi von Paolo Conte.
»Con quella faccia un po’ così.
Quell’espressione un po’ così
Che abbiamo noi prima d’andare a Genova«
Tatsächlich hatte das Gesicht, welches er im Spiegel sah, einen besonderen Ausdruck. Und ja, das hatte natürlich mit der bevorstehenden Fahrt nach Genua zu tun.
›Jetzt nur nicht wehmütig werden, alter Freund‹, dachte er.
›Das Ganze hat ja auch gute Seiten. In ein paar Wochen sieht die Welt schon ganz anders aus. Also: Capitano Caponnetto, mi raccomando! Etwas mehr Haltung, wenn ich bitten darf!‹
Zufrieden mit dem Ergebnis seiner Rasur entschied er auch auf den Espresso zu verzichten. Das brachte noch einmal fünf Minuten.
Im Schlafzimmer erlaubte sich Caponnetto einen Moment der Rührung und schaute auf das Meer, das sich in der Schranktür spiegelte.
Er gab sich einen Ruck und dann zog Giuseppe Caponnetto, Capitano der Carabinieri, zum letzten Mal seine Uniform an.
*
Am Abend zuvor, etwa zu der Zeit, als der Capitano seine Vorbereitungen für den nächsten Tag begonnen hatte, tat es rund 20 Kilometer nordwestlich von Savona einen dumpfen Schlag. Und dann noch einen und noch einen und noch einen.
Bald sickerten dicke Blutstropfen auf die Lehne des Ohrensessels. Der Kopf von Umberto Serra war schlaff auf seine rechte Schulter gesunken.
Schon der erste Schlag hatte genügt, den Schädel zu zertrümmern. Die restlichen Schläge waren lediglich Ausdruck einer Woge von Wut gewesen, die nur langsam abgeebbt war. Dann endlich war es vorbei.
Die Gestalt hinter dem Sessel, ganz außer Atem vor Anstrengung, legte den Hammer auf den Boden, riss schnell einige Schubladen im salotto, dem Schlafzimmer und der Küche auf und leerte den Inhalt auf den Boden.
Dann lief der dunkle Schatten zurück zum Sessel, nahm den Hammer an sich, ging durch die noch offenstehende Wohnungstür, stieg die Treppe hinunter, trat aus dem Haus Nummer 13 und verschwand in der Abenddämmerung von San Giuseppe.
Der Obduktionsbericht wird später vermerken, dass der Tod gegen 20 Uhr eingetreten war, also etwa zu der Zeit als auf RAI Uno die Hauptnachrichtensendung begann. Als Todesursache im Fall Umberto Serra wird die Gerichtsmedizinerin »Schädelbasisbruch nach stumpfer Gewalteinwirkung auf das Hinterhaupt« festhalten.
Die Wucht und Anzahl der Schläge deuteten auf einen impulsiven Mörder hin. Andererseits hatten Täterin oder Täter vermutlich die Waffe in die Wohnung mitgebracht und wieder mitgenommen. Das wiederum sprach für ein planvolles Vorgehen.
Es waren solche Widersprüche, die Commissario Bonfatti, der als leitender Ermittler eingesetzt werden würde, besonders reizten.
*
Bei der Verabschiedung von Capitano Caponnetto in den Ruhestand war die Aula des Taucherausbildungszentrums der Carabinieri in Genua bis auf den letzten Platz belegt.
Die Gäste ließen sich grob in vier Gruppen unterteilen, die jeweils eine der wichtigsten Etappen von Caponnettos Laufbahn repräsentierten.
Es gab einige junge Carabinieri, bei denen Caponnetto als strenger wie fachkundiger Lehrer der Ausbildungseinheit in Rom in Erinnerung geblieben war.
Die zweite Gruppe bestand aus denjenigen, die ungefähr in Caponnettos Alter waren. Allesamt trugen sie die elegante Uniform, die Giorgio Armani in den 1980er Jahren für die Carabinieri neu entworfen hatte.
Einige unter ihnen hatten mit Caponnetto die Ausbildung absolviert, sich dann aber, weil es ihnen an Disziplin, Talent – oder an beidem – gefehlt hatte, nicht für die höhere Laufbahn empfohlen.
Der größere Teil dieses Grüppchen bestand aus Kollegen, die mit Caponnetto die Offiziersschule besucht oder später gemeinsam mit ihm in Palermo oder Rom im Raggruppamento Operativo Speciale, kurz ROS genannt, gedient hatten.
Die dritte Gruppe bildete eine Mischung aus Vertretern anderer uniformierter Einheiten und Zivilisten.
Stefania Barone war ebenfalls unter den Gästen. Caponnetto hatte sie seit jenem Abschied in Palermo nicht mehr gesehen. Ihr Profil jedoch war ihm in der Menge sofort aufgefallen.
Unter den Männern und Frauen in Uniform waren Vertreter der Feuerwehr, ebenso wie der Finanzpolizei. Auch einige »Blaue« waren da, Beamte der Polizia di Stato. Zwischen den Carabinieri und den Angehörigen der Polizia gab es eine lange Historie, geprägt von viel Konkurrenz und wenig Kooperation. Doch Caponnetto war weithin bekannt als ein Diener des Staates, dem der Erfolg in der Sache wichtiger war als Partikularinteresse. Das hatte ihm Kritik von einigen ehrgeizigen Brigadegenerälen eingebracht, die ihre Fahndungserfolge nicht teilen wollten. Aber auch den Respekt und das Vertrauen vieler Kollegen aus den unterschiedlichsten Reihen.
Caponnetto freute sich besonders, als er Bonfatti unter den Gästen in der ersten Reihe sah. Er hatte angeordnet, den Platz links neben seinem eigenen für den Kollegen zu reservieren und war nun sichtlich zufrieden, dass sein Wunsch erfüllt worden war.
In dem Commissario hatte er nicht nur einen zuverlässigen Kollegen gefunden, sondern auch einen Freund. Ihre Laufbahnen hatten sich in den vergangenen Jahren mehrfach gekreuzt, zunächst auf Sizilien, dann auf dem Festland. Sie hatten gemeinsam Ermittlungen koordiniert und Fahndungserfolge gefeiert. Beide waren Anfeindungen aus den eigenen Reihen ausgesetzt gewesen, ebenso wie seitens der Lokalpresse. In Rom hatten sie sich für ein paar Monate eine Wohnung in der Via Tuscolana geteilt.
Nachdem seine Tante Antonella verstorben war, hatte Caponnetto keine Angehörigen mehr, die der Veranstaltung hätten beiwohnen können. So bestand die Gruppe der Zivilisten aus einigen Repräsentanten der Provinz, lokalen Pressevertretern und Angehörigen ausländischer Dienste.
Sein Mentor, Generale Carlo Marini, hatte sich eine besondere Überraschung ausgedacht. Er hatte eine handverlesene Gruppe internationaler Beamte zu einer Tagung nach Genua geladen, absichtlich auf den Tag nach Caponnettos Verabschiedung. Und ganz bewusst hatte er als Tagungsort das Taucherzentrum, etwas außerhalb von Genua, gewählt.
Das schmucklose Dienstgebäude lag direkt an der Strada Statale 1 und war damit leicht zu erreichen – ganz gleich, ob die Gäste am Flughafen Genua landeten oder mit dem Zug kamen. Auch das Thema der Tagung war nicht zufällig gewählt worden. »Die Rolle des organisierten Verbrechens bei der Produktfälschung von Nahrungsmitteln.«
Die Agromafia war eines der Schwerpunkte von Caponnettos Arbeit in den vergangenen Jahren gewesen.
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet verdienen kriminelle Organisationen ein Vermögen mit Subventionsbetrug, Schwarzarbeit und der Fälschung von Lebensmitteln. Allein das Panschen und Umetikettieren von Olivenöl bringt der Mafia jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag ein.
Caponnetto freute sich im Publikum Kollegen aus seiner Zeit in der Verbindungsstelle in Tirana zu sehen und auch einige bekannte Gesichter aus London und Berlin. Den Kollegen Hering aus Bayern konnte er in der Menge nicht ausmachen. Entweder war er noch auf dem Weg von München nach Genua oder er hatte ein contratempo.
›Sicher ist ihm ein Fall dazwischengekommen, oder eine wichtige private Sache‹, dachte Caponnetto.
Unter all den Männern und Frauen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, war Hering derjenige gewesen, der Caponnetto am meisten beeindruckt hatte. Der Mann vom Landeskriminalamt Bayern war ebenso kreativ in der Entwicklung neuer Fahndungsansätze wie zielstrebig im Aufbau einer internationalen Kooperation zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.
Caponnetto hörte die Ansprachen, die gemäß Protokoll und Rangordnung der Laudatoren vorgetragen wurden. Noch während der ersten Rede drehte sich Caponnetto zur Seite und flüsterte Bonfatti zu
»Bitte zwick mich, damit ich spüre, ob ich noch lebe.«
»Ja«, schmunzelte sein Nachbar, »schon gut, Peppino. Du lebst noch. Jetzt sei still und hör‹ zu.«
Antonio Bonfatti war einer der wenigen, die Giuseppe Caponnetto mit »Peppino« anreden durften. Ansonsten war dieser Kosename den Angehörigen der Familie vorbehalten gewesen.
Caponnetto hatte Bonfatti vor einigen Jahren mitgenommen zu einem Besuch bei seiner Tante Antonella. Die Tante hatte ihn »Peppino« genannt, Bonfatti hatte diese Anrede übernommen und Caponnetto hatte es ihm gestattet als ein Zeichen der Freundschaft, die sie verband.
Ein Brummen war zu hören. Nach einigen Sekunden wieder ›Brumm, Brumm‹. Bonfatti griff in seine Tasche, las die Nachricht und wandte sich zu Caponnetto.
»Merda, gewaltsamer Tod, ausgerechnet heute. Ich muss los.«
Caponnetto flüsterte »Das muss Dir nicht leidtun, Antò. Das hier ist ja noch nicht meine Beerdigung. Kommst Du später wieder – an den Strand?«
»Sobald ich kann. Versprochen!« Bonfatti stand auf und ging zu seinem Wagen. Das schlechte Gewissen darüber, dass er seinen Freund mit den anderen Gästen alleine ließ, würde ihn die ganze Fahrt nach San Giuseppe begleiten.
*
Caponnetto hatte einen Tisch für die engsten Freunde in einer trattoria am Strand Piazza Nicolo da Voltri reserviert. Der nach dem genuesischen Maler benannte Strand war gewiss nicht der schönste an der Ligurischen Küste, aber er lag in Fußnähe der Tauchschule.
In dieser trattoria hatte Caponnetto schon so manchen Teller Pasta genossen: spaghetti allo scoglio oder pasta alla genovese. Sein Lieblingsgericht aber waren die pennette mit beschwipstem Tintenfisch – polpo ubriaco.
Caponnetto hatte sich für gutes Essen begeistern können, soweit seine Erinnerung zurückreichte. Rezepte jedoch interessierten ihn erst seit einigen Monaten.
Pennette con polpo ubriaco war eines der ersten Kochrezepte, mit denen er sich überhaupt beschäftigt hatte. Der Oktopus musste weichgeklopft und in kleine Stücke geschnitten werden. Dann gab man eine halbe Zwiebel und etwas pepperoncino, beides sehr fein gehackt, zusammen mit einer Knoblauchzehe und einem Lorbeerblatt in einen Topf mit erhitztem Olivenöl. Sobald die Zwiebeln goldbraun waren, kam der polpo hinzu und dann musste man ihn etwas im eigenen Saft köcheln lassen. Den lustigen Namen verdankte das Rezept den zwei Gläsern Rotwein, die nach und nach in den Sud gegossen wurden. Etwa eine Stunde dauerte es dann, bis der Rotwein fast vollständig reduziert und der polpo schön weich und zart war.
Meistens wurde der »beschwipste Tintenfisch« mit Spaghetti serviert. Caponnetto aber bevorzugte die Variante mit pennette und hatte für den heutigen Abend beim Wirt der trattoria einige Portionen vorbestellt.
*
Bonfatti war, nachdem er die Aula verlassen hatte, eilig zu seinem Dienstwagen gelaufen und startete nun den Motor. Ihm war klar, dass er bis zum Tatort mehr als eine Stunde brauchen würde. Zu dieser Zeit war die Aurelia stark befahren. Auch die Straße entlang der Küste würde ihn nicht schneller ans Ziel bringen.
›Also die Europastraße 80 bis Savona, dann zunächst die E717 bis Altare und dann weiter auf die Landstraße SP29 bis San Giuseppe.‹ Bonfatti drückte die Kurzwahltaste auf dem cellulare.
»Ciao Cristina, was hast Du für mich?«
Cristina Donati, die zuständige Pathologin, hatte schon auf den Anruf des Commissario gewartet.
»Ciao Antonio. Der Tote ist männlich, vermutlich zwischen 70 und 80 Jahre alt. Ihm wurde gestern Abend …«
Bonfatti fuhr in einen der zahlreichen Tunnel, die die Küstenabschnitte miteinander verbanden. Er würde sich gedulden müssen.
Cristina Donati, die nicht bemerkt hatte, dass Bonfatti sie nicht mehr hören konnte, setzte unterdessen ihren Bericht fort.
»…, ich würde meinen zwischen 19 und 21 Uhr der Schädel eingeschlagen. Genaueres kann ich erst nach der Obduktion sagen.«
Dann hörte sie das ›tut, tut‹ in der Leitung und merkte, dass die Verbindung unterbrochen war.
*
In Genua hatte der Capitano unterdessen den offiziellen Teil der Verabschiedungsfeier hinter sich gebracht.
Im Vorraum der Aula war ein kleines Buffet aufgebaut worden, und er hatte sich so im Raum postiert, dass er das Buffet im Blick behalten konnte.
Als er auf die Bühne gerufen worden war, hatte er Stefania aus den Augen verloren. Zuerst war er von den Scheinwerfern geblendet worden. Dann am Ende, während die Gäste schon aufgebrochen waren in Richtung Buffet, war er dem Präfekten in die Arme gelaufen.
Der gute Mann hatte die gleiche trockene Rede, die er zuvor gehalten hatte, noch ein zweites Mal vorgetragen – fast wortgleich. Caponnetto, dem die gute Absicht dahinter bewusst gewesen war, hatte die Laudatio geduldig über sich ergehen lassen. Er hatte sich bedankt und den Präfekten gebeten, sich am Buffet zu bedienen.
Als der Capitano schließlich wieder von der Bühne gestiegen war, hatte Stefania ihren Platz bereits verlassen.
Er hoffte, sie jetzt am Buffet zu sehen und überlegte zugleich, ob sie vielleicht schon gegangen war.
›Ohne mit mir zu sprechen. Das kann ich mir kaum vorstellen‹, beruhigte sich Caponnetto und schaute weiterhin Richtung Buffet.
»Suchst Du jemanden?«
Noch vor ihrer Stimme hatte er das Parfum erkannt und sich sofort umgedreht. Seine und Stefanias Nasenspitzen hatten sich dabei fast berührt.
›Wunderbar‹, schoss es Caponnetto durch den Kopf› noch immer der gleiche Duft!‹
»Stimmt, was ich gehört habe, Giuseppe … Du bist jetzt Gastronom geworden? Siehst Du deswegen andauernd Richtung Buffet?«
Es sollte wie ein Scherz klingen, aber Caponnetto konnte nicht darüber lachen. Nicht heute.
»Komm, lass uns nach draußen gehen, Steff, etwas frische Luft schnappen.«
Im Freien angekommen, erzählte er Stefania in knappen Worten, was in den vergangenen Monaten sein Leben verändert hatte.
»Momento, Giuseppe, piano! Das ging mir zu schnell.« Stefania schaute ihn fragend an.
Die scheinbare Gleichgültigkeit, mit der Caponnetto von seinem Unfall während einer Ermittlung sprach, von den Monaten im Krankenhaus und der Entscheidung, den Dienst zu quittieren, machte sie betroffen.
»Das klingt fast so, als ginge es nicht um Dein Leben, sondern um einen Film, den Du gestern bei Netflix gesehen hast.«
»Was soll ich sagen? Nach dem Unfall war meine Einsatztauglichkeit eingeschränkt. Und daran würde sich auch nichts ändern: ein … ge … schränkt.«
Der Capitano zerteilte die Silben des Wortes, als ob es sonst unverständlich, nicht begreifbar wäre.
»Ich hatte die Wahl, ein Schreibtischhengst zu werden, einer von den Robinson Crusoes, oder neu anzufangen.«
Stefania musste schmunzeln. Als »Robinson Crusoes« hatte Caponnetto stets die Kollegen bezeichnet, die ihren Dienst lustlos verrichteten. Diejenigen, die nicht aus Überzeugung zu den Carabinieri gegangen waren. Diejenigen, die sich einen posto sicuro mit Pensionsanspruch sichern wollten. Diejenigen, die ihre Jahre bis zur Pensionierung damit verbrachten, schon montags auf Freitag zu warten – Robinson Crusoes eben.
»Ja, das verstehe ich. Es muss schwierig gewesen sein für dich. Und es tut mir so leid. Ich hätte mich melden müssen.«
Caponnetto umschloss ihre linke Hand mit seinen Händen. »Stefania, es muss Dir nicht leidtun. Du warst beschäftigt, Deine Ermittlungen damals waren sehr wichtig.«
Dann fuhr Caponnetto mit seinem Bericht fort. Wieder sprach er in einem Ton, als ob er eine Ermittlungsakte zusammenfasste: »Im Juni ist Tante Antonella überraschend gestorben. Sie erlitt einen Herzinfarkt auf dem Weg zur Infiorata. Als die ambulanza eintraf, war sie bereits tot.«
Die Infiorata in Pietra Ligure ist ein Blumenfest mit großer Tradition. Die Straßen und Plätze des Küstenortes verwandeln sich Jahr für Jahr in ein Blütenmeer aus bunten und kunstvoll gestalteten Bildern und Ornamenten. Unzählige Blumen säumen dann in phantasievollster Weise die Fußwege und lassen Bewohner wie Besucher eintauchen in eine Welt aus Farben und Düften.
Caponnettos Tante hatte dieses Fest geliebt. Ohnehin war sie eine Liebhaberin von Blumen und Blüten gewesen. Den Garten ihres Hauses hatte sie mit Bedacht gestaltet: neben dem Tisch auf der Terrasse standen Oliven- und Zitrusbäume in hellen Terrakottatöpfen. Rote, rosa, weiße, gelbe, lachsfarbene und aprikotfarbene Oleanderpflanzen dienten als Sichtschutz zur Straße und dem Nachbargrundstück. Drillingsblumen rankten an der Hauswand neben und über der Tür.
Lavendel und natürlich Thymian, Rosmarin, Majoran und Oregano hatten den Liegestuhl so eingerahmt, dass Tante Antonella an manchen Tagen allein am Geruch erkennen konnte, aus welcher Richtung der Wind wehte. Roch es nach Lavendel oder Rosmarin – diese Pflanzen standen am Kopfende der Liege – kam der Wind aus dem Norden oder Nordwesten. An solchen Tagen konnte der Himmel wolkenfrei sein, während im nächsten Moment frische Böen aufkamen, die die Luft deutlich kälter erscheinen ließen. Diese Windströmung wurde Tramontana genannt und war typisch für Ligurien, besonders in den Wintermonaten.
Nach dem Tod seiner Tante hatte Caponnetto diesen prächtigen Garten geerbt, zusammen mit ihrem Haus, das ihm seit seiner Kindheit gut vertraut war. Antonella hatte ihn als Alleinerben im Testament bedacht.
Einerseits war das keine große Überraschung. Schließlich war er der einzige lebende Verwandte. Andererseits kam es doch unerwartet für ihn, denn, der lokale Tierschutzverein und die katholische Kirche hatten regelmäßig großzügige Spenden von der Tante erhalten und daher vermutlich ebenfalls auf einen Erbanteil gehofft.
Zum Nachlass der Tante gehörten noch zwei weitere Häuser in Pietra Ligure, die Antonella im Bauboom der 1980er Jahre gekauft hatte. Eines davon beherbergte ein Restaurant, das seit Jahrzehnten an eine Familie verpachtet war. Auf diese Immobilie hatte Stefania angespielt mit ihrer Bemerkung, Caponnetto sei nun Gastronom geworden.
Das Erbe von Tante Antonella hatte Caponnetto die Entscheidung erleichtert, den Dienst zu quittieren. Den Entschluss hierzu hatte er aber schon im Krankenhaus gefasst. Der Nachlass machte ihn finanziell unabhängig und erlaubte ihm seinen Abschied aus dem Staatsdienst zu nehmen, ohne einen konkreten Plan für sein Leben danach zu haben.
»Ich hatte ja keine Ahnung, Giuseppe«, sagte Stefania traurig.
»Von deinem Unfall hatte ich gehört und dass Du Dich daraufhin für die Versetzung in den Ruhestand entschieden hast, aber ich hatte keine Ahnung, was es mit dem Restaurant auf sich hatte.«
Sie war davon ausgegangen, Caponnetto habe sich in ein Restaurant eingekauft, um der Langeweile vorzubeugen, die ihn als Frühpensionär erdrücken würde. Jetzt erst begriff sie, dass das Restaurant zum Nachlass der Tante gehörte und wusste daher auch, um welches Restaurant es sich handelte. Caponnetto hatte seine Tante Antonella dort regelmäßig zum Essen ausgeführt, wenn er in Pietra Ligure zu Besuch gewesen war. Einmal, an ihrem Geburtstag, war Stefania auch dabei gewesen.
Antonella hatte das Restaurant 1985 an das Ehepaar Pavese/ Meloni verpachtet. Als Signor Pavese nur wenige Monate später überraschend gestorben war, hatte Tante Antonella der Witwe die Miete für sechs Monate erlassen, und ihr damit ermöglicht, die Osteria Il Golfo fortzuführen.
Caponnettos Tante und Signora Meloni hatte keine Freundschaft verbunden. Sie hatten stets nur das Nötigste miteinander gesprochen. Ihre Charaktere waren einfach zu unterschiedlich gewesen, aber Antonellas noble Geste nach dem Tod des Mannes hatte ein enges Band zwischen den beiden Damen geschaffen.
Vor zwei Jahren dann war Signora Meloni bei Tante Antonella vorstellig geworden, weil sie ihr den Plan mitteilen wollte, Il Golfo an ihre Nichte Giulia Lenti weiterzugeben.
»Meine Beine tragen mich nicht mehr wie früher. Und was noch schlimmer ist: Der Geschmackssinn lässt im Alter nach. Ich will nicht, dass die Leute aus Mitleid bei mir essen, auch wenn die minestra versalzen ist.« Sie hatte dabei gelacht, aber ihre Augen hatten traurig ausgesehen.
»Giulia möchte nach Italien zurückkommen, nach Ligurien. Sie hat das nötige Talent und die erforderliche Disziplin.«
Signora Meloni hatte sich feierlich an Tante Antonella gewandt und gesagt »Bitte erlauben Sie meiner Nichte, die osteria in Ihrem Haus weiterzuführen.«
Tante Antonella hatte nicht geantwortet, sondern nur die Hand von Signora Meloni fest gedrückt. Dann, nach kurzem Zögern, hatten sich die beiden Damen umarmt.
Damit war die Verbindung neu geknüpft worden. Ab diesem Zeitpunkt war Tante Antonella auch mit Melonis Nichte Giulia verbunden gewesen. Und dieses Band war nun als Teil der Erbschaft von seiner Tante auf Caponnetto übergegangen, ob er wollte oder nicht.
*
Der Verkehr war noch zähflüssiger, als Bonfatti befürchtet hatte und so brauchte er fast 90 Minuten bis nach San Giuseppe.
Dort angekommen, fielen ihm als Erstes die missmutigen Gesichter der Bestatter auf. Er hatte Cristina Donati per SMS gebeten, die Leiche bis zu seinem Eintreffen am Tatort zu behalten, auch wenn aus ihrer Sicht die Spurensicherung abgeschlossen und der Tatort dokumentiert war.
Für die Bestatter, die nach Fallpauschale bezahlt werden, bedeutete dies einen Mehraufwand, für den niemand aufkommen würde. Bonfatti konnte sich lebhaft vorstellen, wie die Herren später beim Transport der Leiche im Bestattungswagen ihrem Unmut über den Zeitverlust Luft machen würden.
›Nicht wirklich einer Totenfahrt würdig‹, dachte er, ›ein bisschen Respekt sollte einem alten Herrn bei seiner letzten Fahrt doch gebühren‹. Bonfatti zuckte mit den Achseln.
Der Commissario legte großen Wert darauf, jeden Tatort selbst in Augenschein zu nehmen. Daran würden die grimmigen Gesichter der Bestatter auch nichts ändern. Dieses Mal jedoch hatte es den Anschein, als sei der Aufwand vergebens gewesen.
Die Umstände schienen klar: Der Tote war Umberto Serra: 68 Jahre alt, verwitwet. Er hatte seit vielen Jahren allein gelebt und vermutlich war er schwerhörig gewesen. Darauf deutete zumindest die Lautstärke des Fernsehers hin, der noch immer lief. Niemand hatte sich getraut, vor Bonfattis Eintreffen die Fernbedienung anzufassen.
Die Tür der Wohnung war aufgebrochen und der alte Mann war vor dem laut dröhnenden Fernseher erschlagen worden. Es konnte nahezu ausgeschlossen werden, dass der Täter gestört worden war, denn es hatten sich keine Zeugen gemeldet.
Die Nachbarn waren entweder ebenso schwerhörig wie Serra oder sie befanden sich außer Haus. Am wahrscheinlichsten war, dass die Nachbarwohnungen Familien aus Turin oder Mailand gehörten, die gerne auch in dieser Gegend von Ligurien ihr seconda casa unterhielten, um an den Wochenenden dem Smog und Lärm der Großstadt zu entfliehen.
Die Polizei war durch Livia Auci alarmiert worden. Die junge Frau saß mit noch immer blassem Gesicht in der Küche und umklammerte eine Tasse Kamillentee.
»Signora Auci«, Bonfatti sprach sie zunächst leise an und schaute hinüber zum Sanitäter. Als dieser ihm zunickte, fuhr er fort.
»Signora Auci, bitte entschuldigen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen nicht gut geht. Darf ich Ihnen trotzdem einige Fragen stellen?«
Die junge Frau nahm einen Schluck aus der Tasse und Bonfatti konnte ihr ansehen, dass sie versuchte, sich zu sammeln. Schließlich gab sie dem Commissario Auskunft.
Seit rund drei Jahren sei sie in Diensten bei Umberto Serra gewesen. Dreimal pro Woche habe sie die Wohnung sauber gemacht, eingekauft und gekocht. Immer am Montag und Freitagvormittag und am Mittwochnachmittag. Manchmal, wenn es ihre Zeit erlaubt habe, sei sie mit dem alten Mann mittwochs dann noch spazieren gegangen.
Das sei nicht Teil ihrer Dienstpflichten gewesen, und dafür bezahlt worden war sie auch nicht. Sie habe dennoch regelmäßig die 30 Minuten investiert. Sehr viel länger habe der alte Serra ohnehin nicht gehen können. Manchmal habe Serra sie dann mittwochs noch gebeten, einen Aperol Spritz zu mixen.
Bonfatti notierte nicht ein Wort auf den Notizblock, den er in der Hand hielt. Er schaute die junge Frau an und hörte ihr aufmerksam zu. Später würde er ein Protokoll schreiben und es Livia Auci dann am nächsten Tag zur Unterschrift vorlegen.
Am Morgen nach der Tat sei Livia Auci wie jeden Montag gegen zehn Uhr vor dem Haus Nummer 13 gestanden. Schon im Treppenhaus habe sie den Fernseher gehört und sich gewundert. Sie habe zwar gewusst, dass der alte Signore Serra die Lautstärke stets bis zum Anschlag aufdrehte, aber so laut hatte es im Treppenhaus noch nie gedröhnt.
Im zweiten Stock angekommen habe sie gesehen, dass die Tür offenstand und dachte, der Wind hätte sie aufgedrückt. Daraufhin war sei sie eingetreten und habe gerufen. »Buon giorno, Signore Serra! Hallo Signore Serra? Ich bin es, Livia« Dann sei sie in den salotto gelaufen.
Als sie die Blutlache am Boden gesehen hatte, habe sie schreien wollen, aber aus ihrer Kehle sei nur ein Wimmern gekommen. Ihre Hände hätten gezittert und sie habe kalten Schweiß auf der Stirn gehabt; dann sei sie zusammengesackt.
»Ich weiß nicht, wie lange ich da saß, mir war ganz schwindelig, ich fühlte mich elend. Ich dachte, ich müsste schauen, ob er noch lebt, aber da war so viel Blut und sein Kopf …« ihre Stimme stockte.
»Sie haben sich nichts vorzuwerfen, Signora«, sagte der Commissario.
»Signore Serra war schon seit gestern Abend tot. Sie konnten nichts für ihn tun, außer die Polizei zu rufen. Und das haben sie ja getan.«
Livia Auci sah Bonfatti in die Augen und fragte dann mit wütender Stimme: »Sagen Sie es mir, Commissario: Was bringt einen Menschen dazu, so etwas zu tun?«
Bonfatti dachte an die vielen Schläge, die der Täter dem alten Mann versetzt hatte und an die ausgeleerten Schubladen. Dann schüttelte er den Kopf.
»Ich weiß es nicht, Signora Auci. Aber ich bin hier, um es herauszufinden«, und nach einigen Sekunden ergänzte er: »Sie sollten jetzt nach Hause gehen und sich ausruhen. Zuvor möchte ich Sie aber noch um eine Sache bitten, wenn es geht.«
»Nur zu, Commissario, wie kann ich helfen?«, fragte Livia Auci.
Bonfatti bat die Haushälterin, in Begleitung einer jungen Polizistin durch die Räume der Wohnung zu gehen.
»Wenn etwas fehlt – insbesondere Wertsachen –, aber auch wenn Ihnen etwas auffällt, das an einem anderen Platz steht, dann sagen Sie es bitte, und die Kollegin wird es protokollieren.« Livia Auci nickte.
Bonfatti vereinbarte mit ihr einen Termin für den nächsten Tag um zehn Uhr im Polizeipräsidium und verabschiedete sich.
Der Commissario schaute hinüber zu der jungen Polizistin. Er machte zunächst mit der rechten Hand eine Faust, spreizte dann Daumen und kleinen Finger ab und führte die Hand zu seinem rechten Ohr.