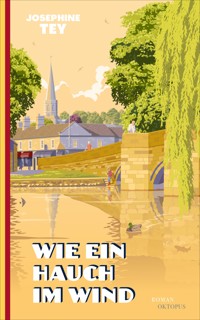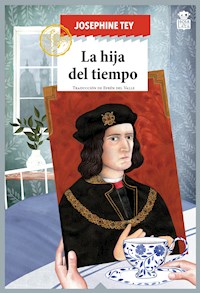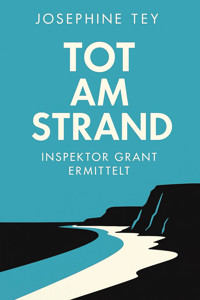
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KI Classics
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Tot am Strand" von Josephine Tey ist ein spannender Kriminalroman, der in der idyllischen Kulisse der englischen Küstenlandschaft spielt. Die Geschichte beginnt mit dem mysteriösen Tod einer jungen Schauspielerin namens Christine Clay. Ihr lebloser Körper wird an einem einsamen Strandabschnitt gefunden, und schnell steht fest, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Inspektor Alan Grant von Scotland Yard wird mit dem Fall betraut und findet sich in einem Netz aus Lügen, Geheimnissen und Verdächtigungen wieder. Jeder hat ein Motiv, Christine Clay aus dem Weg zu räumen, doch die Wahrheit ist schwer zu finden. Mit scharfem Verstand und detektivischem Geschick begibt sich Inspector Grant auf die Suche nach der Wahrheit, und er unzählige Fährten verfolgen muss. Während er die Puzzleteile des Falles zusammensetzt, wird ihm klar, dass die Lösung weit komplexer und erschütternder ist, als er es sich je vorgestellt hat. Josephine Teys Meisterwerk "Tot in den Wellen" entführt die Leser in eine Welt voller Intrigen, Spannung und unerwarteter Wendungen. Mit einer fesselnden Erzählweise und einer Vielzahl von gut ausgearbeiteten Charakteren entfaltet sich ein packendes Verwirrspiel, das bis zur letzten Seite fesselt und den Leser in Atem hält. Dieser Kriminalroman ist ein zeitloser Klassiker, der Liebhaber von raffinierten Mordmysterien gleichermaßen begeistern wird. Jetzt neu übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Josephine Tey
Tot am Strand
Inspektor Grant ermittelt
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
Impressum
KAPITEL 1
Es war kurz nach sieben Uhr an einem Sommermorgen, als William Potticary seinen gewohnten Weg durch das kurze, niedrige Gras auf der Klippe nahm. Zweihundert Fuß unter ihm lag der Kanal, still und glänzend wie ein milchiger Opal. Ringsum hing die helle Luft, noch leer von Lerchen. In der ganzen sonnendurchfluteten Welt gab es kein Geräusch außer dem Geschrei einiger Möwen am fernen Strand; keine menschliche Aktivität außer der kleinen, einsamen Gestalt von Potticary selbst, kantig und dunkel und kompromisslos. Eine Million Tautropfen, die auf dem jungfräulichen Gras glitzerten, deuteten auf eine Welt hin, die aus der Hand ihres Schöpfers stammt. Natürlich nicht für Potticary. Was der Tau Potticary verriet, war, dass sich der Bodennebel der frühen Morgenstunden erst lange nach Sonnenaufgang aufzulösen begann. Sein Unterbewusstsein nahm diese Tatsache zur Kenntnis und legte sie beiseite, während sein Bewusstsein darüber debattierte, ob er, nachdem er Appetit auf Frühstück bekommen hatte, an dem Gap umkehren und zur Küstenwache zurückkehren sollte, oder ob er angesichts des schönen Morgens nach Westover wandern wollte, um die Morgenzeitung zu holen und so zwei Stunden früher als sonst von dem jüngsten Mord oder was auch immer zu erfahren. Natürlich war die Morgenzeitung durch das Radio nicht mehr so interessant, wie man es sich vorstellen kann. Aber es war ein Ziel. Ob Krieg oder Frieden, man musste ein Ziel haben. Man konnte nicht nach Westover fahren, nur um den Strand zu sehen. Und wenn man mit der Zeitung unter dem Arm zum Frühstück zurückkam, fühlte man sich irgendwie gut. Ja, vielleicht würde er in die Stadt fahren.
Der Schritt seiner schwarzen, kantigen Stiefel beschleunigte sich leicht, ihre glänzende Oberfläche blinzelte im Sonnenlicht. Diese Stiefel hatten ihre Schuldigkeit getan. Man hätte meinen können, dass Potticary, der seine besten Jahre damit verbracht hatte, seine Stiefel zu putzen, seine Individualität behauptet, seine Persönlichkeit zum Ausdruck gebracht oder auf andere Weise den Staub einer unbedeutenden Disziplin von seinen Füßen geschüttelt hätte, indem er den Staub auf seinen Stiefeln gelassen hätte. Aber nein, Potticary, der arme Trottel, bürstete seine Stiefel aus Liebe. Wahrscheinlich hatte er eine Sklavenmentalität, aber er hatte nie genug gelesen, um sich darüber Gedanken zu machen. Was den Ausdruck seiner Persönlichkeit betraf, so würde er sie natürlich wiedererkennen, wenn man ihm die Symptome beschrieb. Aber nicht mit Namen; im Dienst nannte man das „Widerspenstigkeit“.
Eine Möwe tauchte plötzlich über der Klippe auf und verschwand schreiend aus dem Blickfeld, um sich ihren kreisenden Kameraden unten anzuschließen. Die Möwen machten einen fürchterlichen Lärm. Potticary näherte sich dem Rand der Klippe, um zu sehen, was die nun abebbende Flut ihnen an Treibgut hinterlassen hatte, um das sie sich stritten.
Die weiße Linie der sanft rauschenden Brandung wurde von einem grünlichen Fleck durchbrochen. Ein Stück Stoff. Baize oder so ähnlich. Seltsam, dass es nach so langer Zeit im Wasser immer noch so hell war.
Potticarys blaue Augen weiteten sich plötzlich, sein Körper wurde seltsam still. Dann setzten sich die quadratischen schwarzen Stiefel in Bewegung. Stampf, stampf, stampf, über den dichten Rasen, wie ein schlagendes Herz. Die Lücke war zweihundert Meter entfernt, aber Potticarys Zeit hätte keinen Athleten in Verlegenheit gebracht. Keuchend eilte er die groben, in den Kreidefelsen gehauenen Stufen des Gaps hinunter; in seine Aufregung mischte sich Empörung. Das kommt davon, wenn man vor dem Frühstück ins kalte Wasser springt! Wahnsinn, so wahr ihm Gott helfe. Anderen das Frühstück so zu verderben. Schaefer war der Beste, außer bei gebrochenen Rippen. Wahrscheinlich keine gebrochenen Rippen. Vielleicht nur eine Ohnmacht. Mit lauter Stimme dem Patienten versichern, dass es ihm gut geht. Seine Arme und Beine waren schmutzig wie der Sand. Deshalb hatte er das grüne Ding für ein Stück Stoff gehalten. Wahnsinn, so wahr ihm Gott helfe. Wer wollte schon im Morgengrauen ins kalte Wasser, wenn man nicht musste? Zu seiner Zeit hatte er auch schwimmen müssen. In diesem Hafen am Roten Meer. Er war mit einem Landungstrupp von Bord gesprungen, um den Arabern zu helfen. Warum hatte man diesen verdammten Bastarden helfen ... damals musste man schwimmen. Ja, man musste. Orangensaft und dünnen Toast auch. Keine Ausdauer. Wahnsinn, bei George.
Das Gehen am Strand war schwer. Die großen weißen Kieselsteine rutschten bösartig unter seinen Füßen weg, und die wenigen Sandflächen, die sich etwa auf Höhe der Flut befanden, waren weich und nachgiebig. Doch schon bald befand er sich mitten in der Möwenwolke, eingehüllt von ihrem Flügelschlag und ihrem wilden Geschrei.
Es gab keinen Grund für Schaefer, auch nicht für irgendeine andere Methode. Das sah er mit einem Blick. Dem Mädchen war nicht mehr zu helfen. Und Potticary, der so emotionslos Leichen aus der Brandung des Roten Meeres gezogen hatte, war seltsam gerührt. Es war nicht richtig, dass ein so junges Mädchen dort lag, wo die ganze Welt zu einem strahlenden Tag erwachte, wo so viel Leben vor ihr lag. Sie muss ein hübsches Mädchen gewesen sein. Ihr Haar sah gefärbt aus, aber der Rest war in Ordnung.
Eine Welle schwappte über ihre Füße und saugte spöttisch an ihren scharlachroten Zehenspitzen. Potticary, der wusste, dass die Flut in einer Minute nur noch wenige Meter entfernt sein würde, zog den leblosen Haufen ein Stück weiter den Strand hinauf, außer Reichweite des unverschämten Meeres.
Dann dachte er an das Telefon. Er suchte nach den Kleidungsstücken, die das Mädchen beim Schwimmen zurückgelassen haben könnte. Aber da schien nichts zu sein. Vielleicht hatte sie das, was sie trug, unterhalb des Hochwasserspiegels liegen lassen und die Flut hatte es weggespült. Vielleicht war sie aber auch gar nicht hier ins Wasser gegangen. Jedenfalls gab es jetzt nichts mehr, womit er ihren Körper hätte bedecken können, und Potticary wandte sich ab und begann wieder eilig den Strand hinaufzulaufen, zurück zur Küstenwache und zum nächsten Telefon.
„Leiche am Strand“, sagte er zu Bill Gunter, der den Hörer abnahm und die Polizei rief.
Bill schnalzte mit der Zunge gegen die Vorderzähne und warf den Kopf in den Nacken. Eine Geste, die den Überdruss an den Umständen, die Unvernunft der Menschen, die sich ertränken, und seine eigene Genugtuung darüber, dass er mit dem Schlimmsten im Leben gerechnet und recht behalten hatte, beredt und sparsam zum Ausdruck brachte. „Wenn sie Selbstmord begehen wollen“, sagte er mit seiner unterirdischen Stimme, „warum müssen sie es ausgerechnet hier bei uns tun? Es gibt doch die ganze Südküste.“
„Kein Selbstmord“, keuchte Potticary in die Pause des Hulloings.
Bill hörte ihm nicht zu. „Nur weil es an der Südküste teurer ist als hier! Man sollte meinen, wenn jemand des Lebens überdrüssig ist, hört er auf, beim Fahrpreis zu geizen, und macht sich stilvoll aus dem Staub. Aber nein! Sie nehmen das billigste Ticket, das sie kriegen können, und legen sich vor unsere Haustür!“
„Beachy Head bekommt auch eine Menge ab“, keuchte der gutmütige Potticary. „Selbstmord ist es jedenfalls nicht.“
„Natürlich ist es Selbstmord. Wozu haben wir die Klippen? Als Bollwerk für England? Nein. Nur für Selbstmörder. Schon vier in diesem Jahr. Und es werden noch mehr, wenn die Steuerbescheide kommen.“
Er hielt inne, als er hörte, was Potticary sagte.
„Ein Mädchen. Na ja, eine Frau. In einem hellgrünen Badekleid.“ (Potticary gehörte einer Generation an, die keine Badeanzüge kannte.) „Etwas südlich vom Gap. Etwa hundert Meter. Nein, niemand da. Ich musste telefonieren. Aber ich gehe gleich wieder hin. Ja, ich treffe Sie dort. Oh, hallo, Sergeant, sind Sie das? Ja, nicht der beste Start in den Tag, aber man gewöhnt sich dran. Oh nein, nur ein Badeunfall. Krankenwagen? Oh ja, den kann man praktisch bis zur Lücke fahren. Der Weg zweigt von der Hauptstraße nach Westover ab, gleich hinter dem dritten Meilenstein, und endet in den Bäumen landeinwärts vom Gap. In Ordnung, wir sehen uns.“
„Woher wissen wir, dass es nur ein Badeunfall war?“, fragte Bill.
„Sie hatte einen Badeanzug an, haben Sie das nicht gehört?“
„Nichts kann sie davon abhalten, einen Badeanzug anzuziehen und ins Wasser zu springen. Es muss wie ein Unfall aussehen.“
„Um diese Jahreszeit kann man nicht ins Wasser springen. Man landet auf dem Strand. Und es gibt keinen Zweifel, was sie getan hat.“
„Sie hätte so lange ins Wasser gehen können, bis sie ertrunken wäre“, widersprach Bill, der von Natur aus ein Leichengräber war.
„Ja? Sie hätte auch an einer Überdosis Bullenaugen sterben können“, sagte Potticary.
KAPITEL 2
Sie standen in einer feierlichen kleinen Gruppe um die Leiche herum: Potticary, Bill, der Sergeant, ein Constable und die beiden Sanitäter. Der jüngere Sanitäter machte sich Sorgen um seinen Magen und die Möglichkeit, in Ungnade zu fallen, aber die anderen dachten nur an ihre Arbeit.
„Kennen Sie sie?“, fragte der Sergeant.
„Nein“, sagte Potticary. „Ich habe sie noch nie gesehen.“
Keiner von ihnen hatte sie zuvor gesehen.
„Sie kann nicht aus Westover sein. Niemand würde aus der Stadt kommen, wenn er einen perfekten Strand vor der Haustür hat. Sie muss irgendwo aus dem Landesinneren stammen.“
„Vielleicht ist sie bei Westover ins Wasser gefallen und hier angespült worden“, schlug der Sergeant vor.
„Dafür war keine Zeit“, wandte Potticary ein. „Sie war noch nicht lange genug im Wasser. Sie muss irgendwo hier ertrunken sein.“
„Wie ist sie dann hierher gekommen?“, fragte der Sergeant.
„Mit dem Auto natürlich“, antwortete Bill.
„Und wo steht das Auto jetzt?“
„Dort, wo jeder sein Auto stehen lässt: Da, wo die Straße an den Bäumen endet.“
„Ja?“, sagte der Sergeant. „Nun, da steht kein Auto.“
Die Sanitäter stimmten ihm zu. Sie waren mit der Polizei aus dieser Richtung gekommen - der Krankenwagen wartete jetzt dort -, aber von einem anderen Auto war nichts zu sehen.
„Das ist seltsam“, fand Potticary. „Es ist ziemlich weit, um zu Fuß hierher zu kommen. Nicht um diese Zeit am Morgen.“
„Ich glaube nicht, dass sie so weit gelaufen sein kann“, bemerkte der ältere Sanitäter. „Teuer“, fügte er hinzu, als sie ihn zu fragen schienen.
Einen Moment lang betrachteten sie schweigend die Leiche. Ja, der Sanitäter hatte recht, es war ein teuer gepflegter Körper.
„Und wo sind ihre Kleider?“
Der Sergeant war beunruhigt.
Potticary erklärte seine Theorie zu den Kleidern: Sie hatte sie unterhalb der Hochwassermarke zurückgelassen und befand sich nun irgendwo auf dem Meer.
„Ja, das ist möglich“, sagte der Sergeant.
„Aber wie ist sie hierher gekommen?“
„Komisch, dass sie allein badet“, wagte der junge Sanitäter zu sagen und strapazierte seinen Magen.
„Heutzutage ist nichts mehr lustig“, schimpfte Bill, „ein Wunder, dass sie nicht mit einem Gleitschirm von der Klippe gesprungen ist. Mit leerem Magen schwimmen, ganz allein, das ist einfach zu blöd. Diese jungen Idioten bringen mich um.“
„Ist das ein Armband um ihren Knöchel?“, fragte der Polizist.
Ja, es war ein Armband. Ein Armband aus Platingliedern. Es waren merkwürdige Glieder. Jedes hatte die Form eines C.
„Nun“, der Sergeant richtete sich auf, „ich nehme an, wir können nichts anderes tun, als die Leiche in die Leichenhalle zu bringen und dann herauszufinden, wer sie ist. Dem Anschein nach dürfte das nicht schwer sein. Nichts 'Verlorenes, Gestohlenes oder Verirrtes' an ihr?“
„Nein“, stimmte der Sanitäter zu. „Der Butler telefoniert wahrscheinlich gerade ganz aufgeregt mit der Station.“
„Ja.“ Der Sergeant war nachdenklich. „Ich frage mich immer noch, wie sie hierhergekommen ist und was ...“
Sein Blick wanderte zur Felswand und er blieb stehen.
„Da! Wir haben Besuch!“, meldete er.
Sie drehten sich um und sahen die Gestalt eines Mannes auf dem Felsvorsprung am Gap. Erwartungsvoll stand er da und beobachtete sie. Als sie sich ihm zuwandten, machte er eine schnelle Rechtskurve und verschwand.
„Ein bisschen früh für Spaziergänger“, sagte der Sergeant. „Und warum rennt er weg? Wir sollten mit ihm reden.“
Aber bevor er und der Sergeant sich mehr als ein oder zwei Schritte bewegt hatten, wurde klar, dass der Mann keineswegs weggelaufen war, sondern sich lediglich auf den Eingang der Schlucht zubewegte. Seine dünne, dunkle Gestalt kam nun aus der Mündung der Schlucht und näherte sich ihnen in einem schlurfenden Lauf, wobei er ausrutschte und stolperte und auf die kleine Gruppe, die seine Ankunft beobachtete, den Eindruck des Wahnsinns machte. Sie konnten hören, wie er mit offenem Mund keuchte, als er sich näherte, obwohl die Entfernung zum Abgrund nicht groß war und er noch jung war.
Er stolperte in ihren engen Kreis, ohne sie anzusehen, und stieß die beiden Polizisten beiseite, die sich unbewusst zwischen ihn und die Leiche geschoben hatten.
„Oh nein, das ist sie! Oh, sie ist es, sie ist es!“, rief er, hockte sich ohne Vorwarnung hin und brach in lautes Weinen aus.
Sechs verblüffte Männer sahen ihn eine Weile schweigend an. Dann klopfte ihm der Sergeant freundlich auf die Schulter und sagte idiotisch: „Schon gut, mein Sohn, schon gut!“
Aber der junge Mann wiegte sich nur hin und her und weinte noch mehr.
„Komm, komm“, beschwichtigte der Sergeant. (Es war wirklich eine schreckliche Szene an einem schönen, hellen Morgen.) „Das hilft niemandem, wissen Sie. Reißen Sie sich zusammen“, fügte er hinzu und bemerkte die Qualität des Taschentuchs, das der junge Mann hervorholte.
„Eine Verwandte von Ihnen?“, erkundigte sich der Sergeant, wobei sich seine Stimme deutlich von dem zuvor geschäftsmäßigen Ton unterschied.
Der junge Mann schüttelte den Kopf.
„Wie, nur eine Bekannte?“
„Sie war so gut zu mir, so gut!“
„Wenigstens können Sie uns helfen. Wir haben schon über sie gerätselt. Sie können uns sagen, wer sie ist.“
„Sie ist meine Gastgeberin.“
„Ja, aber ich meinte, wie ist ihr Name?“
„Den kenne ich nicht.“
„Sie kennen ihn nicht! Hören Sie, Sir, reißen Sie sich zusammen. Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Sie müssen den Namen der Dame kennen, bei der Sie gewohnt haben.“
„Nein, nein, den kenne ich nicht.“
„Wie haben Sie sie denn genannt?“
„Chris.“
„Chris, und weiter?“
„Einfach Chris.“
„Und wie hat sie Sie genannt?“
„Robin.“
„Ist das Ihr Name?“
„Ja, mein Name ist Robert Stannaway. Nein, Tisdall. Früher hieß ich Stannaway“, fügte er hinzu und fing den Blick des Sergeanten auf, der eine Erklärung für nötig zu halten schien.
Das Auge des Sergeanten sagte: „Gott, gib mir Geduld!“ Seine Zunge sagte: „Das klingt alles etwas seltsam, Mister ... eh ...“
„Tisdall.“
„Tisdall. Können Sie mir sagen, wie die Dame heute Morgen hierher gekommen ist?“
„Oh, ja. Mit dem Auto.“
„Mit dem Auto, ja? Wissen Sie, was mit dem Auto passiert ist?“
„Ja. Ich habe es gestohlen.“
„Sie haben was?“
„Ich habe es gestohlen. Ich habe es gerade zurückgebracht. Es war eine schlimme Sache. Ich fühlte mich wie ein Schuft, also kam ich zurück. Als ich sah, dass sie nirgendwo auf der Straße war, dachte ich, ich würde sie hier finden. Dann sah ich euch alle um etwas herumstehen - oh je, oh je!“ Er fing wieder an, sich zu schütteln.
„Wo haben Sie mit dieser Dame gewohnt?“, fragte der Sergeant in sehr geschäftsmäßigem Ton. „In Westover?“
„Oh nein. Sie hatte - ich meine - oh je! - Ein Cottage. Briars, heißt es. Gleich außerhalb von Medley.“
„Etwa anderthalb Meilen landeinwärts“, fügte Potticary hinzu, als der Sergeant, der kein Einheimischer war, fragend dreinblickte.
„Waren Sie allein oder ist dort Personal?“
„Es gibt nur eine Frau aus dem Dorf, Mrs. Pitts, die zum Kochen kommt.“
„Ich verstehe.“
Eine kleine Pause entstand.
„Also gut, Jungs.“ Der Sergeant nickte den Sanitätern zu, die sich mit der Trage an die Arbeit machten. Der junge Mann atmete scharf ein und bedeckte sein Gesicht wieder mit den Händen.
„In die Leichenhalle, Sergeant?“
„Ja.“
Die Hände des Mannes lösten sich abrupt von seinem Gesicht.
„Oh nein! Auf keinen Fall! Sie hat ein Zuhause. Bringt man Menschen nicht nach Hause?“
„Wir können die Leiche einer fremden Frau nicht in einen unbewohnten Bungalow bringen.“
„Es ist kein Bungalow“, korrigierte der Mann automatisch. „Nein. Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist schrecklich - das Leichenschauhaus. Oh Gott im Himmel“, brach es aus ihm heraus, „warum musste das passieren?“
„Davis“, sagte der Sergeant zum Constable, „Sie gehen mit den anderen zurück und erstatten Bericht. Ich gehe mit Mr. Tisdall rüber nach - wie war das? - Briars.“
Die beiden Sanitäter knirschten schwerfällig über den Kies, gefolgt von Potticary und Bill. Das Geräusch ihres Vorankommens war längst verklungen, als der Sergeant wieder sprach.
„Es ist Ihnen wohl nicht in den Sinn gekommen, mit Ihrer Gastgeberin schwimmen zu gehen?“
Ein Anflug von Verlegenheit huschte über Tisdalls Gesicht. Er zögerte.
„Nein. Ich fürchte, das ist nicht mein Ding: Schwimmen vor dem Frühstück. Ich war schon immer ein Spielverderber.“
Der Sergeant nickte unverbindlich. „Wann ist sie denn schwimmen gegangen?“
„Das weiß ich nicht. Sie hat mir gestern Abend gesagt, wenn sie früh aufwacht, geht sie zum Gap schwimmen. Ich bin auch früh aufgestanden, aber da war sie schon weg.“
„Ich verstehe. Nun, Mr. Tisdall, wenn Sie sich erholt haben, werden wir uns sicher gut verstehen.“
„Ja. Ja, natürlich. Mir geht es gut.“ Er stand auf, und gemeinsam und schweigend überquerten sie den Strand, stiegen die Stufen zum Gap hinauf und kamen zu dem Auto, das Tisdall dort im Schatten der Bäume geparkt hatte, wo der Weg endete. Es war ein schönes Auto, wenn auch ein wenig zu opulent. Es war ein cremefarbener Zweisitzer mit einem Raum zwischen den Sitzen und der Motorhaube für Pakete oder, wenn es eng wurde, für einen zusätzlichen Passagier. Aus diesem Laderaum holte der Sergeant einen Damenmantel und ein Paar Schaffellstiefel, wie sie Frauen bei den Winterrennen trugen.
„Das hatte sie an, als sie zum Strand ging. Nur der Mantel und die Stiefel über dem Badeanzug. Und ein Handtuch.“
Da lag es. Der Sergeant holte es hervor: ein leuchtendes Objekt in Grün und Orange.
„Seltsam, dass sie es nicht mit an den Strand genommen hat“, sagte er.
„Normalerweise trocknet sie sich in der Sonne.“
„Sie scheinen viel über die Gewohnheiten einer Dame zu wissen, deren Namen Sie nicht kennen.“ Der Sergeant setzte sich. „Wie lange leben Sie schon mit ihr zusammen?“
„Bei ihr“, entgegnete Tisdall, und zum ersten Mal schwang eine gewisse Schärfe in seiner Stimme mit. „Verstehen Sie das richtig, Sergeant, und Sie könnten sich eine Menge Ärger ersparen: Chris war meine Gastgeberin. Nichts weiter. Wir lebten unbeaufsichtigt in ihrem Haus, aber ein Regiment von Dienern hätte unser Verhältnis nicht korrekter gestalten können. Kommt Ihnen das so merkwürdig vor?“
„Sehr“, sagte der Sergeant offen. „Was machen die hier?“
Er schaute in eine Papiertüte, in der sich zwei ziemlich fade Brötchen befanden.
„Ach, die habe ich ihr zum Essen mitgebracht. Mehr konnte ich nicht finden. Als Kinder haben wir immer ein Brötchen gegessen, wenn wir aus dem Wasser kamen. Ich dachte, sie würden sich über etwas freuen.“
Das Auto rutschte den steilen Weg zur Hauptstraße zwischen Westover und Stonegate hinunter. Sie überquerten die Hauptstraße und kamen auf der anderen Seite in eine tiefe Gasse. Auf einem Schild stand „Medley 1, Liddlestone 3“.
„Sie hatten also nicht vor, das Auto zu stehlen, als Sie ihr zum Strand folgten?“
„Natürlich nicht“, sagte Tisdall so entrüstet, als ob das einen Unterschied machen würde. „Es kam mir nicht einmal in den Sinn, bis ich den Hügel hinaufkam und das Auto dort stehen sah. Selbst jetzt kann ich nicht glauben, dass ich es wirklich getan habe. Ich war ein Narr, aber so etwas habe ich noch nie getan.“
„War sie schon im Meer?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgesehen. Wenn ich sie auch nur in der Ferne gesehen hätte, hätte ich es nicht tun können. Ich habe einfach die Brötchen reingeworfen und bin weggefahren. Als ich wieder zu mir kam, war ich auf halbem Weg nach Canterbury. Ich drehte einfach um, ohne anzuhalten, und fuhr sofort zurück“.
Der Sergeant gab keinen Kommentar ab.
„Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie lange Sie schon in der Hütte sind?“
„Seit Samstag um Mitternacht.“
Jetzt war Donnerstag.
„Und Sie wollen mir immer noch weismachen, dass Sie den Nachnamen Ihrer Gastgeberin nicht kennen?“
„Nein. Es ist ein bisschen komisch, ich weiß. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich bin konventionell erzogen. Aber sie hat es ganz natürlich gemacht. Nach dem ersten Tag haben wir uns einfach akzeptiert. Es war, als würde ich sie schon seit Jahren kennen.“ Als der Sergeant nichts sagte, sondern Zweifel ausstrahlte wie die Hitze eines Backofens, fügte er mit einem Anflug von Wut hinzu: „Warum sollte ich Ihnen ihren Namen nicht sagen, wenn ich ihn wüsste?“
„Woher soll ich das wissen?“, erwiderte der Sergeant wenig hilfreich. Aus den Augenwinkeln beobachtete er das blasse, aber gefasste Gesicht des jungen Mannes. Er schien sich bemerkenswert schnell von seinem Anfall von Nervosität und Kummer erholt zu haben. Leichtgewichte, diese modernen Menschen. Kein echtes Gefühl für irgendetwas. Nur Hysterie. Was sie Liebe nannten, war nur eine Übung im Stall, alles andere hielten sie für „sentimental“. Keine Disziplin. Kein Aushalten. Wenn es schwierig wurde, liefen sie weg. Sie wurden in ihrer Jugend nicht genug geohrfeigt. Diese ganze moderne Idee, den Kindern ihren eigenen Willen zu lassen. Und wohin hat das geführt? In der einen Minute heulen sie am Strand, in der nächsten sind sie kalt wie eine Gurke.
Und dann bemerkte der Sergeant das Zittern der feinen Hände am Lenkrad. Nein, was immer Robert Tisdall sonst noch war, kalt war er nicht.
„Ist es hier?“, fragte der Sergeant, als sie vor einer Gartenhecke zum Stehen kamen. „Das ist es.“
Es war ein Fachwerkhaus mit etwa fünf Zimmern, das von einer sieben Fuß hohen Hecke aus Dornen und Geißblatt von der Straße abgeschirmt war und von Rosen überwuchert wurde. Ein Geschenk des Himmels für Amerikaner, Wochenendausflügler und Fotografen. Die kleinen Fenster gähnten in die Stille, die hellblaue Tür stand einladend offen und gab im Schatten den Blick auf eine Messingwärmeschale an der Wand frei. Das Häuschen war „entdeckt“.
Als sie den gepflasterten Weg hinaufgingen, erschien auf der Türschwelle eine schlanke, kleine Frau, die in einer weißen Schürze glänzte; ihr schütteres Haar war am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengebunden, und ein rundes Vogelnest aus schwarzem Satin saß unsicher auf der Spitze ihres gewölbten, glänzenden Kopfes.
Tisdall zögerte, als er sie erblickte, als wolle ihm die erhabene offizielle Haltung des Sergeants mit der Deutlichkeit eines Sandwich-Tabletts Ärger ankündigen.
Aber Mrs. Pitts war die Witwe eines Polizisten, und ihr kleines, angespanntes Gesicht zeigte keinerlei Besorgnis. Messingknöpfe, die den Weg hinaufkamen, bedeuteten für sie, dass eine Mahlzeit zubereitet werden musste, und ihr Verstand reagierte entsprechend.
„Ich habe ein paar Griddle Cakes zum Frühstück gemacht. Später wird es heiß. Es ist besser, den Ofen auszulassen. Sagen Sie Miss Robinson Bescheid, wenn sie kommt, ja, Sir?“ Dann, als ihr klar wurde, dass Knöpfe ein Amtsabzeichen waren, sagte er: „Sagen Sie mir nicht, dass Sie ohne Führerschein gefahren sind, Sir!“
„Miss Robinson, ja? Sie hatte einen Unfall“, begann der Sergeant.
„Das Auto! Meine Güte! Sie war immer so unvorsichtig damit. Ist es schlimm?“
„Es ist nicht das Auto. Es war ein Unfall im Wasser.“
„Oh“, sagte sie langsam. „So schlimm!“
„Was soll das heißen, so schlimm?“
„Ein Unfall im Wasser kann nur eines bedeuten.“
„Ja“, stimmte der Sergeant zu.
„Ach, ach, ach“, sagte sie traurig, nachdenklich. Dann änderte sich ihr Verhalten schlagartig: „Und wo waren Sie?“, schnappte sie und musterte den geknickten Tisdall wie einen Fisch am Samstagabend an der Fischtheke in Westover. Ihre oberflächliche Bewunderung für die „Reichen“ war angesichts der Katastrophe verschwunden. Tisdall erschien ihr als der „Haufen Nichtsnutz“, für den sie ihn insgeheim gehalten hatte.
Der Sergeant war interessiert, aber distanziert. „Der Herr war nicht da.“
„Er hätte da sein müssen. Er ist gleich nach ihr gegangen.“
„Woher wissen Sie das?“
„Ich habe ihn gesehen. Ich wohne in der Hütte am Ende der Straße.“
„Kennen Sie Miss Robinsons andere Adresse? Ich nehme an, das ist nicht ihr ständiger Wohnsitz.“
„Nein, natürlich nicht. Sie hat diese Wohnung nur für einen Monat. Sie gehört Owen Hughes.“ Sie hielt beeindruckt inne, um die Bedeutung des Namens zu klären. „Aber er dreht gerade einen Film in Hollywood. Er hat mir erzählt, dass es darin um einen spanischen Grafen geht. Er sagte, er habe schon italienische und französische Grafen gespielt und dachte, es wäre eine neue Erfahrung für ihn, einen spanischen Grafen zu spielen. Mr. Hughes ist sehr nett. Kein bisschen verwöhnt, trotz des ganzen Rummels, der um ihn gemacht wird. Sie werden es nicht glauben, aber einmal kam ein Mädchen zu mir und bot mir fünf Pfund, wenn ich ihr die Laken gäbe, in denen er geschlafen hatte. Was ich ihr gab, war ein Stück meines Geistes. Aber sie schämte sich nicht. Sie bot mir fünfundzwanzig Schilling für einen Kissenbezug. Ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist, dass nichts mehr ...“
„Welche Adresse hatte Miss Robinson noch?“
„Ich kenne keine andere Adresse als diese.“
„Hat sie nicht geschrieben, dass sie kommt?“
„Geschrieben! Nein! Sie hat telegrafiert. Ich nehme an, sie konnte schreiben, aber ich nehme an, sie hat es nie getan. Auf dem Postamt in Liddlestone kamen täglich etwa sechs Telegramme an. Meistens nahm mein Albert sie mit, zwischen den Unterrichtsstunden. Manche brauchten drei oder vier Formulare, so lang waren sie“.
„Kennen Sie jemanden von den Leuten, die sie hier unten getroffen hat?“
„Sie hatte keine Bekannten hier. Außer Mr. Stannaway, meine ich.“
„Niemand?“
„Nicht ein einziges Mal. Einmal - es war, als ich ihr den Trick mit der Klospülung zeigte; man muss kräftig ziehen und dann geschickt loslassen - einmal sagte sie: 'Werden Sie, Mrs. Pitts', fragte sie, 'nie müde, die Gesichter der Leute zu sehen?' Ich sagte, manche täten mir ein wenig leid. Sie sagte: 'Nicht einige, Mrs. Pitts. Sondern alle. Ich bin der Menschen überdrüssig.' Ich sagte, wenn ich mich so fühle, nehme ich eine Dosis Rizinusöl. Sie lachte und sagte, das sei keine schlechte Idee. Aber jeder sollte es nehmen, und was für eine schöne neue Welt würde das in zwei Tagen sein. 'Mussolini hat nie an so etwas gedacht', sagte sie.“
„War sie aus London?“
„Ja. Sie war in den drei Wochen, die sie hier ist, nur ein- oder zweimal oben. Das letzte Mal am vergangenen Wochenende, als sie Mr. Stannaway mitbrachte.“ Wieder tat ihr Blick Tisdall als etwas weniger als menschliches ab. „Er kennt ihre Adresse nicht?“, fragte sie.
„Niemand kennt sie“, antwortete der Sergeant. „Ich werde ihre Papiere durchsehen und sehen, was ich herausfinden kann.“
Mrs. Pitts führte den Weg ins Wohnzimmer, das kühl war und nach süßen Erbsen duftete.
„Wo haben Sie sie hingebracht - die Leiche, meine ich?“, fragte sie.
„Ins Leichenschauhaus.“
Das schien zum ersten Mal die Tragödie zu verdeutlichen.
„Meine Güte.“ Langsam schob sie das Ende ihrer Schürze über den polierten Tisch. „Und ich mache Griddle Cakes.“
Das war kein Lamento über verdorbene Griddle Cakes, sondern ihr Gruß an die Seltsamkeit des Lebens.
„Ich nehme an, Sie brauchen ein Frühstück“, sagte sie zu Tisdall, beruhigt durch ihr unbewusstes Wissen, dass auch die Besten nur Marionetten des Schicksals sind.
Aber Tisdall wollte kein Frühstück. Er schüttelte den Kopf und drehte sich zum Fenster, während der Sergeant den Schreibtisch durchsuchte.
„Ich hätte nichts gegen einen dieser Griddles“, erklärte der Sergeant, während er in den Papieren blätterte.
„Sie werden in Kent keine besseren finden, auch wenn ich das sage. Und vielleicht möchte Mr. Stannaway einen Tee?“
Sie ging in die Küche.
„Sie wussten also nicht, dass sie Robinson heißt?“, fragte der Sergeant und sah auf.
„Mrs. Pitts hat sie immer 'Miss' genannt. Und sah sie so aus, als hieße sie 'Robinson'?“
Auch der Sergeant glaubte keinen Augenblick, dass sie Robinson hieß, und ließ das Thema fallen.
Jetzt sagte Tisdall: „Wenn Sie mich nicht brauchen, gehe ich wohl in den Garten. Hier ist es stickig.“
„Gut. Vergessen Sie nicht, dass ich den Wagen brauche, um nach Westover zurückzufahren.“
„Ich habe es Ihnen doch gesagt. Vorhin war es eine plötzliche Eingebung. Jedenfalls kann ich ihn jetzt nicht stehlen und hoffen, damit durchzukommen.“
Gar nicht so dumm, entschied der Sergeant. Und ganz schön temperamentvoll. Keine Nullnummer.
Auf dem Schreibtisch lagen Zeitschriften, Zeitungen, halbleere Zigarettenschachteln, Puzzleteile, eine Nagelfeile und Nagellack, Seidenmuster und ein Dutzend anderer Kleinigkeiten; eigentlich alles außer Briefpapier. Die einzigen Dokumente waren die Rechnungen der örtlichen Handwerker, die meisten mit Quittung. Wenn die Frau auch unordentlich und unmethodisch war, so hatte sie doch wenigstens einen Hauch von Vorsicht an den Tag gelegt. Die Quittungen waren zerknittert und schwer zu finden, aber sie waren nicht weggeworfen worden.
Der Sergeant, beruhigt durch die Stille des frühen Morgens, die fröhlichen Geräusche von Mrs. Pitts, die in der Küche Tee kochte, und die Aussicht auf die bevorstehenden Griddle Cakes, begann, während er an seinem Schreibtisch arbeitete, seinem einzigen Laster zu frönen. Er pfiff. Es war ein sehr tiefes, rundes und sanftes Pfeifen, das der Sergeant von sich gab, aber es war immer noch ein Pfeifen. „Sing to me sometimes“, pfiff er, ohne die Melodie gedankenlos zu variieren, und sein Unterbewusstsein empfand große Befriedigung bei dieser Darbietung. Seine Frau hatte ihm einmal einen Artikel in der Mail gezeigt, in dem es hieß, Pfeifen sei ein Zeichen für einen leeren Geist. Aber auch das hatte ihn nicht geheilt.
Und dann wurde die Ruhe des Augenblicks jäh unterbrochen. Ohne Vorwarnung klingelte es an der angelehnten Wohnzimmertür - tum-te-ta-tum-tumta-TA! Eine Männerstimme rief: „Hier versteckst du dich also!“ Mit einem Ruck wurde die Tür aufgerissen und in der Öffnung stand ein kleiner, dunkler Fremder.
„Na d-a-aan“, sagte er und machte mehrere Silben daraus. Er stand da und starrte den Sergeant an, amüsiert und breit grinsend. „Ich dachte, Sie wären Chris! Was macht die Polizei hier? Gab es einen Einbruch?“
„Nein, kein Einbruch.“ Der Sergeant versuchte, sich zu sammeln.
„Erzählen Sie mir nicht, dass Chris eine wilde Party geschmissen hat! Ich dachte, das hätte sie schon vor Jahren aufgegeben. Das passt nicht zu all den anspruchsvollen Rollen.“
„Nein, eigentlich ...“
„Wo ist sie?“ Er erhob seine Stimme zu einem fröhlichen, nach oben gerichteten Schrei. „Huhu! Chris! Komm runter, du alte Schachtel! Du versteckst dich vor mir!“ Zum Sergeant: „Hat uns jetzt fast drei Wochen im Stich gelassen. Zu viel Stress, glaube ich. Früher oder später kriegen die alle Angst. Aber das letzte Mal war so ein Erfolg, da wollen sie natürlich abkassieren.“ Er summte mit gespielter Ernsthaftigkeit einen Takt von 'Sing to Me Sometimes'. „Deshalb habe ich Sie für Chris gehalten, weil Sie ihr Lied pfeifen. Und Sie pfeifen es verdammt gut.“
„Ihr - ihr Lied?“ Der Sergeant hoffte, dass ihm bald ein Licht aufgehen würde.
„Ja, ihr Lied. Von wem denn sonst? Sie haben doch nicht geglaubt, dass es meins ist, mein lieber Freund, oder? Nie im Leben. Ich habe es geschrieben, gewiss. Aber das zählt nicht. Es ist ihr Lied. Und vielleicht hat sie es nicht richtig rübergebracht! Oder doch? War das nicht eine Show?“
„Das kann ich nicht genau sagen.“ Wenn der Mann aufhören würde zu reden, könnte er die Sache aufklären.
„Vielleicht haben Sie noch nicht 'Stangen aus Eisen' gesehen?“
„Nein, das kann ich nicht sagen.“
„Das ist das Schlimmste an kabellosen Geräten und Schallplatten und so: Sie nehmen einem Film den ganzen Schwung. Wenn man Chris ständig diesen Song singen hört, ist man wahrscheinlich so voll, dass man sich beim Ad-lib auskotzt. Das ist dem Film gegenüber nicht fair. Für Songwriter und so ist das okay, aber für einen Film ist das sehr, sehr hart. Da sollte es eine Art Abmachung geben. Hey, Chris! Ist sie nicht hier, nach all der Mühe, die ich mir gegeben habe, um sie zu finden?“ Sein Gesicht senkte sich wie das eines enttäuschten Babys. „Dass sie reinkommt und mich findet, ist nicht halb so gut, wie wenn ich sie überrasche. Meinen Sie, dass ...“
„Einen Moment, Mr. ... Ich kenne Ihren Namen nicht.“
„Ich bin Jay Harmer. In meiner Geburtsurkunde steht Jason. Ich habe 'If It Can't Be in June' geschrieben. Das pfeifen Sie wahrscheinlich auch ...“
„Mr. Harmer. Verstehe ich das richtig, dass die Dame, die hier wohnt oder gewohnt hat, eine Filmschauspielerin ist?“
„Eine Filmschauspielerin ist!“ Langsames Erstaunen verschlug Herrn Harmer für einen Moment die Sprache. Dann wurde ihm klar, dass er sich geirrt haben musste. „Sagen Sie, Chris wohnt hier, nicht wahr?“
„Die Dame heißt Chris, ja. Aber - na ja, vielleicht können Sie uns helfen. Es gab ein paar Probleme - sehr bedauerlich - und offenbar sagte sie, ihr Name sei Robinson.“
Der Mann lacht amüsiert. „Robinson! Das ist ein guter Witz. Ich habe immer gesagt, sie hat keine Fantasie. Konnte keinen Witz schreiben. Haben Sie geglaubt, dass sie ein Robinson ist?“
„Nein, das schien mir unwahrscheinlich.“
„Was habe ich Ihnen gesagt? Nun, um sie dafür zu entschädigen, dass sie mich wie ein Stück Fleisch behandelt hat, werde ich sie verraten. Sie wird mich wahrscheinlich für vierundzwanzig Stunden in den Kühlschrank sperren, aber das ist es wert. Ich bin sowieso kein Gentleman, also werde ich mir nicht wehtun, wenn ich das erzähle. Der Name der Dame, Sergeant, ist Christine Clay.“
„Christine Clay!“, entfuhr es dem Sergeanten. Sein Kiefer löste sich und fiel unkontrolliert nach unten.
„Christine Clay“, hauchte Mrs. Pitts, die in der Tür stand und ein vergessenes Tablett mit Griddles in den Händen hielt.
KAPITEL 3
„CHRISTINE CLAY! Christine Clay!“, riefen die Plakate um die Mittagszeit.
„Christine Clay!“, schrien die Schlagzeilen. „Christine Clay!“, brüllte das Radio. „Christine Clay“, sprach der Nachbar zum Nachbarn.
Überall auf der Welt hielten die Menschen inne und sprachen diese Worte. Christine Clay war ertrunken! Und in der ganzen Zivilisation fragte nur ein Mensch: „Wer ist Christine Clay?“ - Es war ein intelligenter junger Mann auf einer Bloomsbury-Party. Und er war einfach nur „intelligent“.
Überall auf der Welt passierte etwas, weil eine Frau ihr Leben verloren hatte. In Kalifornien rief ein Mann ein Mädchen in Greenwich Village an. Ein texanischer Pilot flog nachts extra mit Clay-Filmen für eine dringende Vorführung. Eine New Yorker Firma stornierte einen Auftrag. Ein italienischer Adliger ging bankrott: Er hatte gehofft, seine Yacht verkaufen zu können. Ein Mann in Philadelphia aß zum ersten Mal seit Monaten eine anständige Mahlzeit, dank einer „Ich kannte sie damals“-Geschichte. Eine Frau in Le Touquet sang, weil ihre Chance gekommen war. Und in einer englischen Kathedralenstadt dankte ein Mann Gott auf Knien.
Die Presse, die in der Lethargie der langweiligen Jahreszeit feststeckte, kam in Bewegung, als ein so unerwarteter Wind wehte. Der Clarion rief Bart Bartholomew, ihren „Society“-Mann, von einem Schönheitswettbewerb in Brighton zurück (sehr zu Barts Dankbarkeit - er kam zurück und fragte sich laut, wie Metzger Fleisch essen), und „Jammy“ Hopkins, ihren „Verbrechen und Leidenschaft“-Star, von einem sehr langweiligen und minderwertigen Pokermord in Bradford. (So weit war der Clarion gesunken.) Die Pressefotografen verließen die Rennstrecken, die Theaterlogen, die Hochzeiten der Society, das Kricket und den Mann, der in einem Ballon zum Mars fliegen wollte, und stürzten sich wie die Fliegen auf das Cottage in Kent, die Maisonettewohnung in der South Street und das möblierte Herrenhaus in Hampshire. Dass Christine Clay, die ein so bezauberndes Landhaus wie das letztgenannte gemietet hatte, dennoch ohne Wissen ihrer Freunde in ein unbekanntes und unbequemes Cottage geflohen war, war eine sehr angenehme Begleiterscheinung der Hauptsensation ihres Todes. Fotografien des Herrenhauses (mit Gartenfront, wegen der Eiben) erschienen mit der Bildunterschrift „Der Ort, der Christine Clay gehörte“ (sie hatte es nur für die Saison gemietet, aber es erzeugte keine Emotionen, wenn ein Ort nur gemietet war); und neben diesen beeindruckenden Bildern waren Fotografien des rosenumrankten Hauses platziert, mit der Bildunterschrift „Der Ort, den sie bevorzugte“.
Ihr Pressesprecher vergoss Tränen. So etwas kommt erst, wenn alles vorbei ist.
Jeder Naturwissenschaftler, der sich nicht allzu sehr mit den Folgen der Natur beschäftigt, hätte feststellen können, dass der Tod von Christine Clay zwar Mitleid, Bestürzung, Entsetzen, Bedauern und ein halbes Dutzend anderer Emotionen in unterschiedlichem Ausmaß auslöste, aber niemanden in Trauer zu versetzen schien. Der einzige wirkliche Gefühlsausbruch war Robert Tisdalls hysterischer Anfall angesichts ihrer Leiche gewesen. Und wer weiß, wie viel davon Selbstmitleid war? Christine war eine zu internationale Figur, um zu so etwas Kleinem wie einem „Set“ zu gehören. Aber in ihrem unmittelbaren Umfeld war Bestürzung die deutlichste Reaktion auf die schreckliche Nachricht. Und nicht nur das. Coyne, der ihren dritten und letzten Film in England drehen sollte, war vielleicht der Verzweiflung nahe, aber Lejeune (der frühere Tomkins), der in der anderen Hauptrolle engagiert worden war, war erleichtert; ein Film mit Clay mochte ein Glücksfall für die Vita sein, aber er war ein Pech für die Kinokassen. Die Herzogin von Trent, die ein Mittagessen mit Clay arrangiert hatte, um sich in den Augen Londons als Gastgeberin zu rehabilitieren, knirschte vielleicht mit den Zähnen, aber Lydia Keats jubelte unverhohlen. Sie hatte den Tod vorausgesagt, und das war selbst für eine erfolgreiche Wahrsagerin ein guter Treffer. „Liebling, wie wunderbar von Ihnen“, riefen ihre Freunde. „Liebling, wie wunderbar von Ihnen!“ Und so weiter. Bis Lydia vor lauter Freude den Verstand verlor und ihre Tage damit verbrachte, von einem Treffen zum nächsten zu laufen, um diese köstliche Bewunderung noch einmal zu erleben - um sie sagen zu hören: „Da ist Lydia! Liebling, die...“ und sich im Glanz ihres Erstaunens zu sonnen. Nein, soweit man sehen konnte, brachen keine Herzen, dass Christine Clay nicht mehr war. Die Welt entstaubte ihre schwarzen Anzüge und hoffte auf Einladungen zum Begräbnis.
KAPITEL 4
Aber zuerst kam die Untersuchung. Und während der Untersuchung gab es das erste schwache Anzeichen für eine viel größere Sensation.