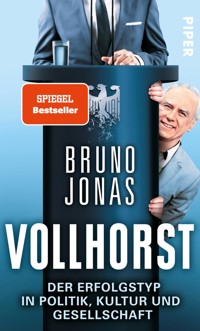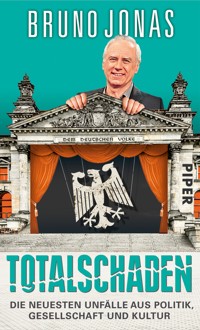
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wenn er sich den aktuellen politischen Debatten widmet, kommt es Bruno Jonas manchmal so vor, als würden wir gerne mit Vollgas und voller Absicht vor die Wand fahren. Der Totalschaden als Endziel und zum eigenen Vorteil, das zeigt sich in vielen politischen Possen und der Albernheit mancher öffentlichen Diskussion. Ob es um politische Sprachschäden einer Flintenfrauke geht, die Irrwege des Länderfinanzausgleichs oder rhetorische Ausfälle des Innenministers – ungnädig und amüsant widmet sich Bruno Jonas den kleinen Freuden des Politikbetriebs und des gesellschaftlichen kollektiven Wahnsinns zwischen Willkommensangela und Grenzhorst – gewohnt böse, pointiert, treffend und sehr, sehr lustig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95274-3
Oktober 2018
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Covermotiv: Lennart Preiss/Getty Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Ohne Worte
Wer den Schaden hat
Benutzeroberfläche
Müll to go
Ich als Weißer
Hallo Nachbar
Frei laufende Gänsefüßchen
Lacher im Treppenhaus
Trotzdem denken
Richtig falsch
Links herum
Rechts herum
Populus und Ismus
Es reicht
Selbstgespräch mit anderen
Reisen bildet
Die Chinesen kommen
Nie wieder
Eurexit
Diplomatische Vermüllung
Eva folgt nicht
Tiefdruckgebiet
Hosen voll
Bis in alle Ewigkeit
Denken schadet dem Hirn
Integration gelungen
Lieber A. M.
Verschwunden in der Transzendenz
Die putzen wir
Schande für Deutschland
Plebiszite
Geduldsfaden
Ein glatter Einser
Ein Satz für Doofe
Klimageschäfte
Klimaforscher
Grüne Eiszeit
Aktivisten
Dumm gelaufen
Mehr Druck
Der reine Erdoğan
Vordenker und Nachdenker
Zurück zu Tucholsky
Neues von Charlie Hebdo
Unfaires Spiel
Jetzt wird’s ernst
Von morgens früh bis abends spät
Themaverfehlung
In der Abgeschiedenheit
So ein Käse
Vollkommen ungebildet
Die Legende der Petra H.
Faust, auch so einer
Transparenz für Durchblicker
Gabriel, der Edemann
Mehr Milch
Kann man so sehen
Live is Life
Kopfprobleme
Die nicht !
Rückrufaktion
Komplexität
Einbrüche
Airportchen
Une catastrophe
Wahr ist das Gegenteil
Die AfD gehört zu Deutschland?
Elefantenrunde
Ganz normal
Rentenrituale
Nepalhilfe
Klugscheißer
Ganz normale Werbung
Im Wilden Westen
Titel sind wichtig
Ich sag es Ihnen gleich : Ich bin eine ironische Person ! Ich will nur darauf hingewiesen haben, damit Sie sich keine falschen Vorstellungen machen. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, alles, was ich hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln aufgeschrieben habe, bierernst zu nehmen. Bedenken Sie dabei aber bitte immer, dass alles anders gemeint sein könnte.
Ohne Worte
Man soll nicht viele Worte machen. Der Satz ist vielleicht als Einstieg in ein Buch, das im Wesentlichen aus Worten besteht, nicht gerade ideal. Aber sinnvoll ist er schon, weil er auf den Titel Totalschaden verweist. Jeder, der vom Totalschaden erzählen will, muss über ein passendes Vokabular verfügen, um das ganze Ausmaß des Schadens in allen Facetten beschreiben zu können. Das geht nicht mit ein paar gesetzten Worten. Dazu braucht es schon ein Buch!
»Ach was!«, sagt Rosi. »Laber nicht rum, komm auf den Punkt, und vor allem rede nicht so gescheit daher!«
»Das kann ich nicht versprechen. Ich kann mich nicht dümmer stellen, als ich bin!«
»Doch!«, beharrt sie. »Ich erinnere mich an Situationen, da ist es dir sehr gut gelungen.«
»Kann ich mich nicht erinnern!«, erwidere ich.
»Probier es wenigstens! Das Gescheitdaherreden kommt nie gut an.«
»Da hast du vollkommen recht. Dummdaherreden kommt immer besser an. Das ist auch meine Erfahrung.«
»Soll das jetzt eine Anspielung auf bayerische Politiker sein?«
»Auf keinen Fall! Die sind dermaßen begabt, da kann man nur noch von Ausnahmeintelligenz sprechen. Das ist auch der Grund dafür, warum sie so erfolgreich sind.«
»Demnach müsstest du Spitzenpolitiker sein.«
»Ich weiß«, halte ich dagegen, »aber ich bin halt auch ein Wortkünstler. Daraus erwächst eine gewisse Verpflichtung.«
»Ironie hilft auch nicht immer!«, winkt Rosi ab.
»Mein Publikum kennt mich und erwartet das Spiel mit Worten. Ich habe einen Ruf zu verlieren.«
»Redundanz!«, murmelt Rosi. »Verbales Geröll!«
Sie behauptet, ich würde oft zu viele Worte machen. Die Leute seien schließlich nicht begriffsstutzig.
»Manche schon!«, insistiere ich. »Denen muss man alles zweimal sagen.«
»Aber die kaufen dein Buch nicht. Dein Publikum ist intelligent und weist eine hohe Sprachkompetenz auf.«
In diesem Punkt muss ich ihr recht geben. Ich habe neulich bei meinem Publikum eine Umfrage gemacht. »Halten Sie sich für intelligent?«, habe ich gefragt. Und es haben alle ohne Ausnahme mit »Ja« geantwortet. Das hat mich zu einer weiteren Frage ermutigt: »Halten Sie sich für humorvoll?« Und auch darauf gab es nur positive Antworten! Ich habe allen Grund, auf mein Publikum stolz zu sein! Wer kann schon auf ein solch humorvolles und vernünftiges Publikum verweisen? Ich hab dann kühn auf Kosten meines Publikums einen Witz gemacht. Um die Probe aufs Exempel zu machen. Ich habe gesagt: »Wenn ich Sie so anschaue, habe ich den Eindruck, dass man mit Ihnen schon über die Rente sprechen muss.« Es hat keiner gelacht. Alle haben sehr vernünftig reagiert. Also stimme ich ihr zu: »Ich habe ein sehr kluges und vernünftiges Publikum.«
»Schon wieder!«, sagt meine Frau.
»Was denn?«, stutze ich.
»Klug und vernünftig!« – »Wie bitte??«
»Es reicht einmal vernünftig! Und wer vernünftig ist, der ist normalerweise auch klug.«
»Ich weiß nicht, ob das stimmt. Grade in der Politik gibt es vernünftige Leute, die sich ziemlich dumm verhalten können.«
»Ich sehe da einen Widerspruch«, sagt Rosi. »Wer dumm handelt, kann nicht vernünftig sein.«
»In der Politik schon. Da geht es oft gar nicht anders. Auch das Dumme kann vernünftig sein für einen Politiker, wenn es ihm und seiner Machtposition nützt. Andererseits kann der unbegrenzte Ausbau einer Machtposition zum Totalschaden eines ganzen Volkes führen. Deshalb warne ich schon seit Jahren davor, die Frauenquote auszubauen.«
»Ach was! Immer diese Spitzfindigkeiten! Das ist typisch für dich!«
»Das ist mein Job.«
Wer den Schaden hat
Zugegeben, der Titel hat wenig Romantik, kaum Konstruktives, dafür aber ganz viel Nihilismus. Wer vom Totalschaden spricht, zieht eine Reparatur nicht mehr in Erwägung.
Es gibt eine Lust am Scheitern. Mit Vollgas an die Wand! Und dann sehen wir weiter. Es sollte um Schadensbegrenzung gehen, dennoch läuft es im Politikbetrieb immer wieder auf eine Schadenserweiterung hinaus. Im parteipolitischen Kampf um Wählerstimmen und Machterhalt will jede Seite der anderen möglichst großen Schaden zufügen, um daraus den größtmöglichen Nutzen für sich und das eigene Fortkommen zu ziehen. Das Schadensprinzip ist Teil der politischen Handlungsethik. Der Flughafen in Berlin, »das europäische Haus«, der Euro, die Staatsfinanzierung, die Asylpolitik, der Länderfinanzausgleich, die deutsche Sozialdemokratie, die CSU und auch die CDU, das deutsche Parteienwesen, alle interpretieren das Prinzip Schadenserweiterung immer wieder neu. Jeder strebt den größtmöglichen Schaden zum eigenen Vorteil an. Selbstverständlich ausschließlich zum Wohle aller! Und jedes Mal übersteigen die Reparaturkosten den Restwert.
Der Totalschaden eröffnet dabei eine Perspektive, die vielen Menschen immer plausibler erscheint. Es gibt eine große Sehnsucht nach dem Nichts. Der Nietzsche hat damit angefangen und ist darüber wahnsinnig geworden. Was ich hoffe, vermeiden zu können. Nur gehört es zum Wesen des Wahnsinns, dass der davon befallene Mensch es nicht mehr merkt – tröstlich! Und immer mehr wollen auch mal in den Genuss eines Totalschadens kommen.
Es gibt eine Faszination des Nichts. J.-P. Sartre hat sich auch daran delektiert und einen fetten Wälzer dazu vorgelegt, dem er den Titel Das Sein und das Nichts gab. Ich hab es mal gelesen und nichts davon behalten. Gar nichts. Ein voller Erfolg, das Buch!
Benutzeroberfläche
Wir sitzen am Küchentisch unserer alten Küche. Die neue kriegen wir frühestens 2025. Die Spülmaschine bläst mächtig. Sie befindet sich im Trockenmodus. Zitronenduft weht mich an.
»Was fiept denn da?«, frage ich.
»Der Wäschetrockner!«, stellt Rosi trocken fest.
Der müsste ausgeschaltet werden. Möglicherweise ist der Wasserbehälter voll? Ich sag es nicht. Ich denke es für mich. Ich sage: »Rosi, ich muss dir ein Geständnis machen.«
Sie blickt von ihrem iPhone auf und hebt eine Augenbraue. Sie macht sich auf etwas gefasst. »Du machst den Trockner aus?«
»Nein, aber du bestätigst, was ich gerade gedacht habe. Ich bin eine Benutzeroberfläche.«
Sie haucht ein erstauntes »Aha« und wendet sich wieder ihrem iPhone zu.
Stille.
Schließlich nimmt sie nach einer angemessenen Verzögerung den Gesprächsfaden wieder auf und überrascht mich ganz nebenbei mit einem kleinen, charmanten Seitenhieb. »Nimm es mir nicht übel«, sagt sie, »wenn du eine Benutzeroberfläche bist, solltest du einige Apps mal updaten.«
»Ich weiß, meine Namens-App zum Beispiel ist total kaputt. Ich versuche schon seit Stunden, auf einen Namen zu kommen, ich sehe die Person vor mir, doch der Name dazu fällt mir nicht ein. Ich habe die Stimme im Ohr. Eine ganz berühmte Synchronstimme.«
»Wen siehst du denn vor dir?«
»Kann ich dir nicht sagen, weil mir der Name nicht einfällt. Du kennst sie auch, die Person.«
»Mann? Frau? Schauspieler? Sänger?«
»Ja.«
»Wie alt?«
»Schwer zu schätzen. Älter. Könnte aber auch jünger sein. Eher jünger als älter. «
Rosi verliert die Lust an dieser Recherche und googelt stattdessen »deutsche Schauspieler – jünger, aber auch älter«.
»Es liegt an meinem Akku«, sage ich. »Ich muss dauernd ans Netz und mich aufladen. Ich leide unter einer energetischen Unterversorgung. Mir fehlt ein superschnelles Datenprotokoll. Beispielsweise ein Datenprotokoll, wie es das neue Samsung Galaxy Edge 7 bereitstellt.«
Rosi bleibt der Mund offen stehen: »Woher kennst du das Samsung Galaxy Edge 7?«
»Ich kenne es nicht, ich habe nur eine Werbung zur Kenntnis genommen und gedacht, Donnerwetter, das neue Samsung Galaxy Edge 7 ist vielleicht ein Produkt, das zu mir passen könnte.«
»Nein«, sagt Rosi, »dich überfordert schon das Ausschalten des Wäschetrockners!«
»Sehr witzig«, antworte ich. »Weißt du, dass das neue Samsung Galaxy Edge 7 über Bluetooth 4.0. verfügt, ebenso über diverse Protokolle zum multimedialen Datenaustausch?«
Rosi staunt: »Nein, weiß ich nicht.«
»Das überrascht mich«, sage ich. »Hätte ich nicht gedacht. Wo du doch sonst immer auf dem Laufenden bist, wenn es um technische Erneuerungen geht. Ich kann dir sagen, das neue Galaxy Edge 7 von Samsung hat auch Wifi Direkt, All Share Play, Grafikspeicherplatz 50 Gigabyte in der Dropbox-Cloud, und weißt du, was das Galaxy Edge 7 von Samsung so attraktiv macht? Es ist dem S6 von Apple haushoch überlegen.«
»Ich bin sicher«, sagt Rosi, »dass du all diese Funktionen dringend brauchst.«
»Selbstverständlich«, antworte ich.
»Aber was machst du, wenn Apple ein S8 oder S9 auf den Markt bringt, gegen das dein Galaxy Edge 7 alt ausschauen wird?«
»Das müssen wir abwarten«, meine ich selbstbewusst. »Aber aus heutiger Sicht fühle ich mich diesem Konkurrenzkampf gewachsen. Könnte sein, dass ich dann das neue Apple S9 kaufen muss. Ich glaube, dass ich beide haben muss.«
»Unbedingt«, sagt Rosi, »du hast mich überzeugt. Du bist eine Benutzeroberfläche. Die Unternehmen spielen mit dir.«
»Ich habe auch schon dran gedacht, ob ich zusätzlich zur Benutzeroberfläche nicht auch noch eine Spielkonsole bin.«
»Eine PlayStation!?«, fragt Rosi.
Ich nicke.
»Aber so, wie ich dich kenne, laufen auf dir nur uralte Spiele.«
»Uralte Spiele? Wie darf ich das verstehen?«
»WOW läuft bei dir nicht. Und Diablo auch nicht.«
»Doch, Heldenspiele hab ich auch im Angebot. Kitchen Hero! Kennst du dieses Spiel? Kitchen Hero, das ist der Typ, der den Müll aus dem Eimer zieht und runterbringt zum Container und jede Menge Abenteuer dabei bestehen muss. Er ist ein Held der Entsorgung. Er arbeitet ohne Mundschutz. Um die Abfälle am Geruch aussortieren beziehungsweise fachgerecht trennen zu können.«
»Langweilig. Dein Spiel braucht dringend ein Add-on. Da musst du ein paar neue Items einbauen. Extended Version mit Staubwedel und Laubbläser! Da bieten sich ganz neue Herausforderungen.«
»Ich weiß nicht, ich leide jetzt schon an Overuse!«
»Was? Du und Overuse? Kann ich mir nicht vorstellen!«
»Doch, ich leide an Übernutzung! Dieser permanente Leistungsdruck macht mich fertig! Ich werde den Eindruck nicht los, dass sich das Verhältnis vom Konsumenten zum Kaufprodukt umgekehrt hat, vielleicht noch nicht total, aber der Akzent hat sich zum Produkt verschoben. Früher hatte man als Kunde das Gefühl, Herr über das Produkt zu sein.«
Rosi winkt ab: »Das war bei dir nie der Fall. Erinnerst du dich an unseren ersten Computer?«
»Natürlich. Sehr gut sogar. Es war ein Dings, ein äh … na, hilf mir, ein Amerikaner, ich komm nicht drauf, eine Riesenkiste. Der Marktführer war es. Ich sehe ihn vor mir stehen, aber ich komme nicht auf den Namen. Compaq? Hewlett Packard?«
»IBM war’s.«
»Aber egal, was es war, es kann auch ein Fernseher, ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine gewesen sein, die Macht über das Gerät lag bei mir, beim Käufer. Ich wusste, wo man das Teil einschaltet und wo man es ausschaltet.«
»Auch damit hattest du manchmal Probleme«, kontert Rosi. »Aber worauf willst du hinaus?«
»Jetzt ist es umgekehrt. Die Geräte haben die Macht über die Kunden übernommen. Die Dinge sind stärker als wir. Wir werden von den elektronischen Geräten beherrscht. Das iPhone kann mehr als ich. Nicht ich benutze das iPhone, es benutzt mich.«
Die Feng-Shui-App auf meinem iPhone fordert mich jetzt schon wochenlang auf, die Wohnung umzuräumen. Außerdem komme ich nicht hinterher mit den Updates, die ich zulassen soll. Ich habe den Verdacht, es gibt bereits eine spezielle Update-App, die mich beim Updaten berät. Das Feld meiner freiwilligen Selbstentmündigung nimmt immer größere Ausmaße an.
»Du, ich glaub, ich bin eine produktorientierte Persönlichkeit. Ich bin nicht sicher, ob ich ohne mein iPhone überhaupt noch lebensberechtigt bin.«
»Das ist der Fortschritt«, bemerkt Rosi lapidar. »Irgendwann wird das neue Samsung Galaxy Edge 7 eine Rechenleistung anbieten, die das Unmögliche möglich macht.«
Ich nicke eifrig. »Was immer das sein wird. Bestimmt kann man das neue Galaxy Edge 7 auch als mobile Kochplatte benutzen, um die ›Suppe to go‹ auf dem Weg zur Arbeit zu wärmen. Per Drohne werden die Lebensmittel angeliefert, egal, wo du dich grade befindest, ob daheim oder irgendwo im unwirtlichen Draußen. Hier, das ist auch interessant, das Galaxy Edge 7 macht Fotos.«
»Nein! Das ist jetzt aber mal was Neues! Ich bin beeindruckt!«
»Moment! Es macht Fotos, die niemand gemacht hat. Es erfindet selbstständig Bilder von Menschen.«
»Was?«, fragt Rosi. »Erfindet Bilder von Menschen? Unglaublich. Die Menschen gibt es aber schon?«
»Zum Teil«, antworte ich. »Es gibt sie, aber das Galaxy Edge 7 gestaltet sie neu. Quasi Schönheits-OP per App!«
»Ja, aber das ist doch sinnlos. Die Menschen schauen ja trotzdem in Wirklichkeit so aus, wie sie ausschauen.«
»Wirklichkeit? Was ist das denn? Das neue Galaxy Edge 7 ist die Wirklichkeit. Wirklichkeit ist ein überholtes Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Die Wirklichkeit wurde irgendwann in den letzten Jahren abgeschafft. Samsung hat die Urheberrechte daran. Und seitdem ist immer nur das wirklich, was das Galaxy Edge 7 als wirklich erfasst. Und diese Wirklichkeit nimmt ständig zu. Je mehr Nutzungsmöglichkeiten, desto mehr Wirklichkeit.«
Rosi betrachtet mich und sagt: »Ich mach dir einen Termin beim Arzt.«
»Brauche ich nicht. Das neue Galaxy Edge 7 hat kostenlos eine Medical App vorinstalliert. Davon träumt jeder Arzt. Mit dieser App kannst du dir deine Krankheiten individuell zusammenstellen. Mit Disease Optimum 7.0 findet der Mensch die Beschwerden, die er braucht, bis er ratlos vor seinen Symptomen resigniert. Aber Samsung Galaxy Edge 7 hat auch für diesen Fall vorgesorgt. Du kannst dir zusätzlich die Diagnostic App und die Therapy App herunterladen und die sind automatisch mit der Website der Apotheken Umschau verlinkt … – Sky du Mont! Jetzt ist er mir eingefallen. Der Schauspieler. Er heißt Sky du Mont. Die Namens-App funktioniert wieder.«
»Das ist nicht die Namens-App, das ist dein Arbeitsspeicher«, entgegnet Rosi. »Der hat ein ziemliches Delay, der müsste mal aufgerüstet werden. Obwohl, das packt dann wahrscheinlich dein Prozessor nicht.«
»Ich mach jetzt den Wäschetrockner aus!«
Müll to go
Mich hat es erwischt. Ich weiß nicht, warum, aber ich trage den Müll raus. Nicht nur raus, auch runter. Wir wohnen im zweiten Stock! Anfangs hat mich das schon gewundert, aber inzwischen hab ich mich daran gewöhnt. Es gibt Notwendigkeiten, die erledigt werden müssen. Denke ich jedes Mal, wenn ich die Mülltüte aus dem Eimer ziehe. Natürlich habe ich mich gefragt, warum wir diese verantwortungsvolle Tätigkeit nicht zwischen uns aufteilen. Offen gesagt, haben Rosi und ich die Mülldebatte nie explizit geführt und deshalb ist die Entsorgungsfrage zwischen uns bis zum heutigen Tag nicht eindeutig geklärt. Wir operieren mit unausgesprochenen Annahmen und Erwartungen. Im Großen und Ganzen hat sich dieses Modell bewährt.
Da Rosi eher zum Aufheben und Bewahren neigt, ich von meinem Naturell her der Wegwerfer bin, ergab es sich mehr oder weniger zwangsläufig, dass mir die Müllkompetenz zufiel.
Anfangs war ich natürlich unsicher. Klar, ich hatte ja keine Erfahrung. Ich war unbeholfen. Habe mich ungeschickt angestellt und jede Menge Fehler begangen. Beispielsweise habe ich anfangs die Tüte überstopft und damit die Reißfestigkeit des Materials überstrapaziert, was zur Folge hatte, dass die Tüte im Treppenhaus auf halbem Weg nach unten riss. Faules Obst, Essensreste, Milchtüten, alles kullerte über die Stufen unaufhaltsam nach unten. Nachbarn, die grade im Haus unterwegs waren, bedauerten mich zwar und kommentierten dieses Missgeschick mitfühlend mit einem »Oh« oder etwas intensiver mit einem »Ach du liebe Güte«, aber es war doch eine ziemlich peinliche Situation.
Mit der Zeit allerdings entwickelte ich eine an der Müllentsorgung orientierte Kompetenz, die sich in der täglichen Routine verfestigte. Ich bin da irgendwie reingewachsen. Je länger ich diese wichtige Aufgabe nun schon erfülle, desto selbstbewusster nehme ich diese tägliche Herausforderung an. Ich habe mir inzwischen im Viertel einen Ruf als Entsorgungsfachmann für Hausmüll erarbeitet. Wildfremde Menschen sprechen mich auf der Straße an, um sich von mir in Müllfragen beraten zu lassen. Ich überlege daher, eine Gebrauchsanleitung für die fachgerechte Entsorgung als Buch herauszubringen. Nachbarn fragen mich nämlich immer wieder, welche Mülltüten ich empfehlen könne. Ich gebe immer bereitwillig Auskunft, füge aber hinzu, dass die Lage inzwischen komplex sei und man je nach Bedarf die Tütenfrage entscheiden müsse. Es komme eben darauf an, ob mehr Plastikmüll anfalle oder weniger. »Schinken vegan« zum Beispiel wird in einer Plastikverpackung angeboten, die meiner Meinung nach eine sehr hohe Wegwerffreundlichkeit aufweist.
Die Trennungsfrage sollte man überdies dabei nie aus den Augen verlieren. Ich habe auch schon mit alternativen Wegwerfstrategien experimentiert, um das Müllverhalten der Nachbarschaft besser einschätzen zu können.
Zu diesem Zweck habe ich eine mit normalem Mischmüll gefüllte Mülltüte im Treppenhaus vor unserer Wohnungstür deponiert, um zu sehen, wie die Nachbarn darauf reagieren. Ich hatte die Hoffnung, dass ein Nachbar einer spontanen Regung nachgibt und die prall gefüllte Tüte beherzt mitnimmt, um sie im Container unten im Hof zu entsorgen. Und tatsächlich ist genau das zweimal passiert. Jemand aus dem Haus griff sich auf dem Weg nach unten unseren Müll, um ihn zu entsorgen. Soziologisch ist dieses Phänomen hochinteressant. Es sieht so aus, als gäbe es eine Gesamtverantwortung für Müll bei uns in der Nachbarschaft. Das ist sicher erfreulich. Dennoch blieb die Tüte auch immer wieder stehen. Es gibt wohl auch Mitmenschen, denen es an der nötigen Achtsamkeit fehlt. Was sind das bloß für Nachbarn? Ich habe Bernadette, Andreas’ Frau, im Verdacht, dass sie es ist, die unsere Mülltüte mit nach unten nimmt, um sie in den Container zu werfen. Sie ist eine achtsame Frau, die mit offenen Augen durch das Leben geht und tut, was getan werden muss. Doch diese soziale Einstellung ist nicht bei allen Hausbewohnern in ausreichendem Maße vorhanden. Leider!
Manchmal werden Kisten voll abgelesener Bücher auf dem Bürgersteig vor unserer Hofeinfahrt abgestellt, zusammen mit Stühlen, Tischen, Möbeln, die man für Sperrmüll halten könnte, ausgediente Fernseher, Monitore und anderes Elektrogerät finden sich auch immer wieder auf dem Gehsteig. Irgendwo klebt dann ein Zettel: »Zum Mitnehmen!« Ich habe deshalb schon überlegt, ob ich nicht auch einmal unseren Müll dort deponiere, in der Hoffnung, dass irgendeiner ihn als Geschenk erkennt und kurz entschlossen mitnimmt.
Ich als Weißer
Eine Hörerin schickt mir eine Mail nach Ausstrahlung meines Programms im Radio. »Man soll erst einmal darüber schlafen«, schreibt sie, »wenn man sich ärgert, und dann mit Abstand die Sachlage und die Kritik daran objektiv und neutral bewerten.«
Ach du liebe Güte. Scheint so, als hätte ich jemand um den Schlaf gebracht. Tatsächlich ist es so, denn die aufmerksame Hörerin bekennt: »Das gelingt mir nicht, und das ist genau der Grund, warum ich Ihnen schreibe.«
Um Gottes willen, das war nie meine Absicht, jemanden so zu ärgern, dass er nicht mehr einschlafen kann. Andererseits besteht die Aufgabe von Satirikern nicht darin, den Leuten in den Schlaf zu helfen. Es soll eher der gegenteilige Effekt entstehen. Wenn man den vielen Kritikern unserer Kunst glauben will, muss Satire vor allem aufrütteln. Und nun musste jemand wegen ein paar Formulierungen, die ich geäußert habe, eine Nacht oder, was noch schlimmer wäre, mehrere Nächte wach liegen.
Um was geht es also? Ich habe das N-Wort gebraucht. Ja, das stimmt. Ich habe darüber sinniert, warum man das Wort Neger nicht mehr gebrauchen darf. Ich habe öffentlich darüber nachgedacht, wie es zu diesem Missbrauch des N-Wortes kommen konnte.
»Seit vielen Jahren«, schreibt die Hörerin, »bin ich antirassistisch motiviert und lehne Äußerungen in diesem Kontext ab.«
Ich lehne Rassismus ebenfalls ab. Vorsichtshalber füge ich das hier gleich ein, um dem Verdacht vorzubeugen, ich hätte absichtlich, aus reiner Effekthascherei, rassistische Formulierungen gebaucht.
»Nein, Herr Jonas, es geht überhaupt nicht darum, was Sie als Mensch weißer Hautfarbe empfinden und denken, wenn Sie sich mit dem anachronistischen, nicht mehr legitimen N-Wort auseinandersetzen, es geht auch nicht darum, was Sie fühlen und denken.«
Aha! Darum geht es also nicht. Und nun bin ich gespannt, um was es geht.
»Rassismus ist, wenn man wie Sie das N-Wort weiterhin legitimiert, schon allein dadurch, wenn Sie als Mensch weißer Hautfarbe über Negerküsse aus der Kindheit erzählen.«
Das habe ich getan. Aber wie sollte ich sonst davon erzählen?
Statt von Negerküssen könnte ich von Mohrenköpfen schwärmen. Nur ist das bestimmt nicht weniger rassistisch, als von Negerküssen zu sprechen. Ja, aber wie soll ich denn nun sprachlich verfahren? Ich könnte von Schokoladenküssen berichten. Nur sprachlich entspricht das nicht dem, was wir in meiner Kindheit damit verbunden haben. Es gab keine Schokoladenküsse in meiner Kindheit! Ich weiß schon, es geht nicht darum, was ich »als Mensch weißer Hautfarbe« dabei empfinde, »es geht darum, was ein Mensch schwarzer Hautfarbe dabei empfindet«, schreibt mir diese Hörerin ins Gewissen. »Und solange Sie, Herr Jonas, das nicht verinnerlicht haben, reproduzieren Sie Rassismus!«
Schlimm ist das! Na ja, versuche ich mich zu rechtfertigen, wenn der Gebrauch des Wortes Negerkuss rassistisch sein sollte, ist es bestimmt nur eine milde, liebevolle Form von Rassismus, wenn überhaupt, weil ich mit Negerküssen nur die besten Erinnerungen verbinde und überhaupt nichts Abwertendes oder Diffamierendes.
Kommt es auf die Bedeutung an oder das Wort? Worte bestehen aus Zeichen. Das böse N-Wort besteht aus Buchstaben, N, E, G, E, R, die in dieser Abfolge lange Zeit das Wort Neger darstellten. Für sich genommen, ist daran nichts Böses. Die fünf Buchstaben sind Zeichen, die in der obigen Reihenfolge hingeschrieben, das Wort Neger bilden. Linguistische Klugscheißer, zu denen ich auch gehöre, würden uns jetzt vielleicht etwas vom Verhältnis der Semiotik/Semantik erzählen. Eventuell auf die bedeutungstragende Einheit des Morphems, der Wortgrenze, der Isolierbarkeit und anderer Formelemente des Wortes verweisen, und wir würden in den Schlaf fallen, den meine Hörerin leider nicht gefunden hat. Ganz Schlaue würden möglicherweise noch aus Sicht der Dekonstruktion das Phänomen Neger analysieren wollen. Neger wäre dann ohnehin nur eine soziale Konstruktion, die zu dekonstruieren wäre, um zu verstehen, was damit gemeint sein könnte. Und wenn wir uns darauf einließen, würde sich der Schlaf wie von selbst einstellen. Das Wort Schlaf ist übrigens auch nur eine soziale Konstruktion, die auf jenen Zustand verweist, den wir so dringend brauchen, um uns beispielsweise von des Tages Mühen zu erholen.
Neger ist also zunächst nur ein Wort, das von zwei Seiten gelesen werden kann.
Von rechts nach links stoßen wir auf die soziale Konstruktion Regen, mit der wir die Bedeutung von nassen Schauern verbinden. Es kommt beim Gebrauch von Wörtern vor allem auf die Bedeutung an, die man beim Aussprechen damit verbindet. Man kann diesen Bedeutungszusammenhang auch als Semantik bezeichnen. Wenn wir von Negern sprechen, betreten wir den semantischen Hof der Bedeutungen, die wir damit in unserem Bewusstsein aufrufen. Ich denke bei Negern an Menschen. Vielleicht zähle ich in diesem Fall als »Mensch weißer Hautfarbe« zu den Ausnahmen. Sicher gibt es mehr Menschen, die das Wort Neger in rassistischer und herabsetzender Weise in ihrem Sprachgebrauch verwenden. Wie aber wollen wir mit jenen Menschen umgehen, die von Regen sprechen, dabei an Neger denken und damit nichts anderes als Rassismus produzieren? Schwierige Frage!
Tja, die Gedanken sind frei, wer will sie erraten …
Brauchen wir Sprachpolizisten, die in unseren Köpfen Streife gehen, um unseren Sprachgebrauch zu kontrollieren? Sie könnten uns jederzeit zur Rede stellen und fragen, was wir denken, wenn wir Wörter wie Neger gebrauchen.
Dazu fällt mir ein Witz ein, der einem Comedian, dessen Name mir entfallen ist, passiert ist: Er stand auf der Bühne und sagte zu einem dunkelhäutigen Mann in einem auffallend weißen T-Shirt, der unten in der ersten Reihe saß: »Schickes T-Shirt!« Worauf der Mann schlagfertig antwortete: »Tja, wer’s pflückt, der darf’s auch tragen!«
Ist das jetzt rassistisch, wenn ich darüber herzhaft lachen kann? Oder beinhaltet schon die Verbindung von dunkelhäutigem Mann und weißem T-Shirt versteckten Rassismus? Hallo, liebe Zuhörerin, vielleicht können Sie mich mal – während einer Ihrer vielen Wachphasen – darüber aufklären, selbstverständlich nur, nachdem Sie »objektiv und neutral« die Sachlage bewertet haben!
Hallo Nachbar
Ich neige immer noch dazu – ich weiß, das ist naiv –, Sprache als Verständigungsmöglichkeit zu nutzen. Ich glaube daran, mich durch Sprache mitteilen zu können, ich hoffe, in meinem von mir beabsichtigten Sinn verstanden zu werden. Aber ist das noch erlaubt? Oder anders gefragt, ist es nicht geradezu doof, auf ein Verstehen im beabsichtigten Sinn zu hoffen? Wenn etwas gesagt wurde, ist es zur Interpretation freigegeben. Es darf nicht nur jeder sagen, was er kann. Jeder darf auch verstehen, was er will!
Das demonstriert auf selten bizarre Weise die Debatte, die durch ein Zitat des AfD-Spitzenmannes Alexander Gauland ausgelöst wurde. Ich fühle mich dazu angehalten, erst einmal zu versichern, dass mich nichts mit dieser Partei verbindet. Warum eigentlich? Weil ich daran zweifle, richtig verstanden zu werden.
Es geht mir um die Interpretation eines Satzes, der von Alexander Gauland in die Welt gesetzt wurde. Er sagte angeblich, so stand es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, während eines Gesprächs mit Redakteuren über Jérôme Boateng: »Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.«
Angenommen, ich hätte diesen Satz gesagt, so hätte man ihn nur so verstehen können, wie ich ihn gemeint hätte. Nämlich als Satz, mit dem ich, falls ich ihn gesagt hätte, auf den latent verbreiteten Rassismus in der Bevölkerung hätte aufmerksam machen wollen.
Da der Satz aber nun von dem AfD-Spitzenmann Alexander Gauland unter Zeugen in einem »Hintergrundgespräch« mit zwei respektablen Journalisten der FAS ausgesprochen wurde, kam niemand auf die Idee, den Satz als antirassistische Äußerung zu verstehen. Ich halte inne und überlege, ob ich mich damit in die Nähe der AfD manövriere? Lieber stelle ich noch einmal klar, dass ich mit dieser Partei nichts zu tun habe! Ich schätze die AfD in ihrer Eigenschaft als satirisches Stoffangebot. Das ist alles.
Worte richtig zu gebrauchen ist aber auch sehr schwer geworden. In den USA ist es noch komplizierter als bei uns, berichtet Adrian Kreye im SZ-Feuilleton anlässlich des Boateng-Zitats: »Wer dort einem Afroamerikaner das Kompliment macht, er sei ›sehr eloquent‹, wie man das Barack Obama öfter nachsagte, unterstellt ihm ja, dass er sich qua Herkunft nicht so gewählt ausdrücken könne.«
Da habe ich neue Herausforderungen vor mir. Wenn ich demnächst einer Frau das Kompliment machen sollte: »Sie sind nicht nur sehr eloquent, Sie sind auch in der Lage, kluge Gedanken vorzutragen!«, werde ich mich dafür entschuldigen müssen. Im Subtext könnte meine Aussage als Unterstellung decodiert werden, ich hielte Frauen generell für Wesen, die mit minderer Intelligenz ausgestattet seien.
Frau? – Ich halte inne, wegen des Wortes. Ich bin nicht sicher, ob es noch korrekt ist, dieses Wort zu gebrauchen. Es könnte sein, dass Frau inzwischen verpönt ist. Die Philosophin Judith Butler vertritt die These, dass es »wirkliche Frauen« nicht gibt. Bei der »wirklichen Frau« handele es sich um »eine zwanghafte gesellschaftliche Fiktion«. Ach so! Ich bin also mit einer zwanghaft gesellschaftlichen Fiktion verheiratet!
Ich rechne immer damit, nicht richtig verstanden zu werden. Sprache ist wahnsinnig kompliziert geworden. Vielleicht war sie das immer schon, aber inzwischen wissen wir sehr viel mehr darüber. Es kommt auf den Subtext an und auf das, was einer hört beziehungsweise nicht hört, hören kann und vor allem hören will! Die relevanten Botschaften werden immer im Subtext transportiert und dabei spielt der Kontext die entscheidende Rolle. Es geht also bei sprachlichen Botschaften um den Subtext im Kontext, der wiederum vom Subtext unterstützt wird. Nicht auf das Gesagte kommt es an, nur das Unausgesprochene zählt. Am schlimmsten ist es, wenn einer gar nichts sagt – dann entfaltet der Subtext seine verheerendste Wirkung!
Andrian Kreye ist ein schlauer Mensch. Doch, sonst wäre er nicht bei der SZ. Er hat die politische Strategie der AfD durchschaut. Gauland und andere AfD-Spitzenpolitiker laden die Alltagssprache mit Subtexten auf, um auf diese Weise eine schleichende Radikalisierung des Bürgertums zu erreichen und die Politik der Ausgrenzung voranzutreiben. Mit dem Boateng-Zitat habe die AfD den Fußball politisiert. Das auch noch!
»Ein wichtiger Schritt für eine Partei der Ausgrenzung, denn weniges besitzt in Deutschland so viel integrative Kraft wie der Sport.« Das ist scharf beobachtet. Nur dummerweise verhält sich die Wirklichkeit nicht so, wie sie der Kreye sieht. Das Publikum auf den Rängen in den Fußballstadien solidarisierte sich mit Transparenten, auf denen sich die Menschen zur Nachbarschaft mit Boateng bekannten. Also hat die AfD das Gegenteil von dem erreicht, was sie beabsichtigte mit der von Kreye so scharf »herausgearbeiteten Strategie«.
Außerdem habe die AfD das Wort Nachbar politisch aufgeladen, indem sie die nationale Verteidigungshaltung ihres Parteiprogramms ins Persönliche gezogen hat. Aha. Das Wort Nachbar ist meines Wissens schon immer politisch aufgeladen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wie oft haben uns unsere Politiker die Formel von »unseren Nachbarn in Europa« ins Ohr gepfiffen! Immer wieder hat man uns auf »unsere Nachbarn im Westen« aufmerksam gemacht.
Nachbar ist ein grundsätzlich ausgrenzendes Wort, weil das Wort im Kern klarmacht, dass der Nachbar in der Nachbarschaft lebt und wohnt und nicht hier bei uns! Vorsichtshalber versehe ich »Nachbar« ab sofort immer mit Gänsefüßchen. »Nachbar« enthält zu viel politisches Gift. »Nachbar« wird aus dem deutschen Vokabular gestrichen. Das Wort hat gute Chancen, als Unwort des Jahres verpönt zu werden. Vielleicht ein anderes Wort für »Nachbar« einsetzen? Anwohner? Oder Beiwohner? Anrainer? Mitbewohner! Das ist es!
Selten hat jemand in Talkshows öffentlich seine Dummheit so offensiv eingestanden wie Alexander Gauland. Er hat keine Ahnung, von wem er spricht, sagt er. Boateng kennt er lediglich, weil der Reporter der FAS ihn nach diesem Boateng gefragt hat und seine Parteigenossin Frau von Storch ihm mitgeteilt hat, dass Boateng ein Deutscher ist, und er jetzt erst weiß, dass er nicht sein »Nachbar« ist. So ähnlich lautete seine Argumentation.
Und wenn Gauland mein »Nachbar« wäre, wüsste ich, was ich tun würde: Ich würde rübergehen zu ihm und ihn bitten, einfach mal den Mund zu halten. Sollte er sich daran halten, würde das unseren Deutungsspielraum ungeheuer erweitern.
Frei laufende Gänsefüßchen
ARD-Tagesthemen: In Hannover musste wegen einer Terrorwarnung ein Fußballstadion geräumt werden. Die deutsche Nationalmannschaft konnte nicht auflaufen. Das Spiel gegen Frankreichs Equipe wurde vor dem Anpfiff abgepfiffen. Aufregender Abend.
Die Berichterstatter »vor Ort« sind ganz aus dem Häuschen. Judith Rakers gibt das Terrormodel der ARD und bemüht sich, ihrer Überforderung Herr zu werden. Rapunzel lässt ihr Haar herunter. Sie fragt einen Kollegen, wo sich die Menschen nun befinden, nachdem sie das Stadion verlassen haben. Selten doofe Frage. Ja, wo sollen sie denn sein? Auf der Straße? Zu Hause? In der Kneipe? Na ja, sie ist aufgeregt, normalerweise liest sie Meldungen aus dem Teleprompter vor, und nun soll sie selber denken. Gemein ist das.
Journalisten interviewen sich gegenseitig und versichern glaubwürdig, nichts zu wissen, versprechen aber, »sich sofort zu melden, falls es neue Informationen gibt«. Im Minutentakt wird gefragt: »Wie ist die Lage vor Ort?« Öffentlich-rechtliches Getue. Sie sind live drauf! Wir wissen nichts, aber das teilen wir allen mit, weil wir »live drauf sind«. Und das Nichtwissen ist eben auch live zu haben. Die ARD ist ein Informationssender.
Zu den gesicherten Nachrichten dieses Abends gehört die Mitteilung, dass ein »herrenloser Koffer« gesichtet wurde. Ich frage mich sofort, woran man einen »herrenlosen Koffer« erkennt? Wie unterscheidet sich der herrenlose Koffer vom damenlosen Koffer? Tut sich hier eine neue, bisher komplett vernachlässigte Genderproblematik auf? Eine Diskriminierung von Herren mit und ohne Koffer? Warum sind Koffer nie damenlos? Wo bleiben unsere überzeugten GenderInnen, die Kämpferinnen für eine geschlechtsneutrale Sprache!
Ich frage mich, ob es korrekt ist, von einer »geschlechtsneutralen« Sprache zu sprechen, ohne sie in Anführungszeichen zu setzen. »Geschlechtsneutrale Sprache« sieht mit Gänsefüßchen ziemlich gut aus.
Die Anführungszeichen zeigen an, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich reihe mich damit ein in die Community derjenigen, die mit Gänsefüßchen kenntlich machen, dass sie den Gebrauch bestimmter Formulierungen reflektiert haben.