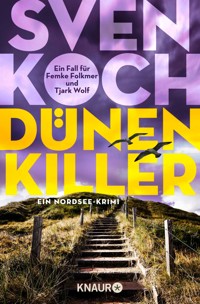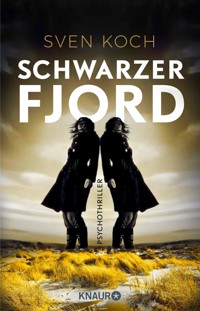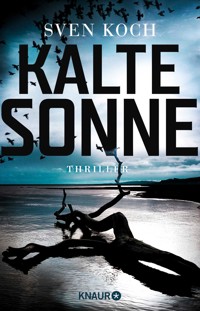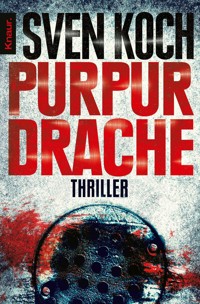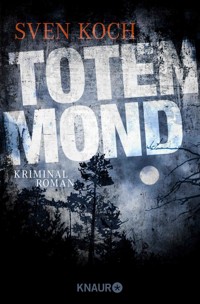
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen einer Polizeipsychologin und einem Serienmörder Polizeipsychologin Alexandra von Stietencron ist einem brutalen Serienmörder auf der Spur. Der Killer spielt ein perfides Spiel mit ihr und sendet ihr Songtexte als kryptische Hinweise auf seine grausamen Taten. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, um den Mörder zu stoppen, gerät plötzlich die Tochter von Alex' neuem Freund in die Fänge der Bestie. Der Serienmörder stellt Alex vor eine grausame Wahl: Ihr eigenes Leben - oder das des unschuldigen Mädchens. In "Totenmond" von Bestseller-Autor Sven Koch erwartet die Leser ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit, in dem eine mutige Ermittlerin alles riskiert, um das Leben eines Kindes zu retten und einen skrupellosen Serienkiller zur Strecke zu bringen. Ein blutig-rasanter Psychothriller, der unter die Haut geht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sven Koch
Totenmond
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Serienmörder spielt ein perfides Spiel mit Polizeipsychologin Alexandra von Stietencron und sendet ihr Songtexte als Hinweise auf seine Morde. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Dann gerät die Tochter von Alex’ neuem Freund plötzlich in die Fänge der Bestie – und der Killer stellt Alex vor die Wahl: Ihr Leben – oder das des Mädchens.
Inhaltsübersicht
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
Nachwort und Danksagung
The killing moon
will come too soon
Echo & The Bunnymen
1.
Die aufgeplatzten Lippen der Beute stießen weiße Atemfahnen aus. Das Keuchen trieb den Kreislauf an. Pumpte das Blut aus den Schnitten. Es lief seitlich in Rinnsalen an den Rippen entlang, sammelte sich in kleinen Pfützen auf dem rostigen Metall der Tischoberfläche. Dann riss die Beute die Augen auf. Wirbelte mit dem Kopf herum. Links. Rechts. Links. Sah erst die alten Leuchten unter der Decke an. Starrte nach vorne und wurde vom Licht der Scheinwerfer geblendet, die neben dem Kamerastativ standen. Wollte sich bewegen und begriff, dass das nicht möglich war, weil die Hand- und Fußgelenke an den Tischbeinen mit Klebeband fixiert waren. Schließlich begann sie zu jammern und zu betteln.
Schweigend betrachtete der Mann die junge Frau. Er klappte das Rasiermesser zusammen, ließ es in der Tasche verschwinden und zog seinen Schal etwas enger. Es war fürchterlich kalt, und er hoffte, dass er sich keinen Schnupfen einfangen würde. Dann neigte er den Kopf zur Seite und blickte aus dem mit Eisblumen überzogenen Fenster, hinter dem der Vollmond sein fahles Licht vom sternenlosen Himmel auf die tiefverschneite Landschaft warf. Noch stand er nicht hoch genug.
»Kennst du die Band Creedence Clearwater Revival?«, fragte der Mann beiläufig und wandte sich wieder um.
Die Beute verneinte und klapperte mit den Zähnen. »Bitte«, flüsterte sie, »ich mache alles, was Sie wollen.«
»Ich weiß«, antwortete er mit einem Seufzen, zog den Handschuh aus und griff ihr an den Hals. Drückte einmal zu und ließ dann wieder locker. Sie zuckte und bäumte sich auf.
»Nicht!«, schrie sie. Nein, es war mehr ein Kreischen und tat in den Ohren weh. Unangenehm. Die Melodie der Verzweiflung. Sie hallte zwischen den Wänden der leerstehenden Möbelfabrik wider.
Als endlich wieder Ruhe herrschte, dozierte der Mann: »Ich bin der Meinung, dass Creedence nur das schmückende Beiwerk für ihren Frontmann John Fogerty waren, ein Genie.«
Er nahm die Hand wieder fort und betrachtete die Beute. Wie alt war sie noch gleich? Zweiundzwanzig? Fünfundzwanzig? Spielte das eine Rolle? Natürlich nicht.
»Fogerty«, fuhr er fort, »hat Rocking all over the world geschrieben, das Status Quo für alle Zeiten verdorben hat. Wirklich nie von Creedence gehört?«
»Nein, tut mir leid«, keuchte die Beute.
»Dabei gibt es einen Klassiker, der gut zu unserer Situation passt. Bad Moon Rising. Im Text heißt es: Treib dich heute Nacht nicht herum, denn man hat es auf dein Leben abgesehen. Weil ein böser Mond aufgeht.«
Er schenkte der Beute ein Lächeln und rieb sich die Hände. Die Kälte kroch sogar ihm bis in die Handschuhe. Er warf erneut einen Blick aus dem Fenster und sah, dass es nun an der Zeit war. Kurz darauf spürte er es auch am Reißen und Zerren in seiner Haut, am Zittern jedes einzelnen Muskels. Seine Nasenflügel blähten sich.
Die Bestie kam hervor.
2.
Hallo, mein Name ist Alexandra Stietencron«, sprach Alex in das Handy.
»Sie sollen alle abhauen! Ansonsten werde ich einen nach dem anderen erschießen!«
Alex lockerte den Schal. Nicht mehr lange, dann würde sie im eigenen Saft kochen. Die Heizungen hier in der Stadtbücherei gegenüber dem Alexander-von-Kemper-Gymnasium mussten auf Anschlag stehen.
Sie antwortete: »Darüber muss ich mit dem Einsatzleiter sprechen. Ich habe nicht die Befugnis, es selbst anzuordnen.«
»Sie haben fünf Minuten!«
»Okay, ich habe verstanden«, sagte Alex und blickte zu Rolf Schneider. Er saß wie ein dicker Buddha rechts neben ihr, hatte ein Headset auf und sah sie abwartend aus kleinen Schweinsäuglein an. Hinten an den Buchregalen stand Stephan Reineking mit dem Leiter des Sondereinsatzkommandos, gegen den er wie ein Strich in der Landschaft wirkte. Reineking trank Kaffee aus einem Pappbecher und verfolgte das Gespräch über Lautsprecher. Seine Geheimratsecken versteckte er unter einer Cap. Reineking hatte bis auf weiteres die Einsatzleitung – so lange, bis die Verhandlungsgruppe eintreffen würde. Vor ihm stand einer der Rollwagen, mit denen die Bibliothekare normalerweise Bücherstapel hin und her fuhren. Heute lagen zwei Laptops darauf, daneben Funkgeräte, eine schusssichere Weste, zwei Thermoskannen und ein Korb voller Süßigkeiten.
Wieder brüllte die Stimme aus dem Telefon. »Fünf Minuten, kapiert?«
»Ich werde das mit dem Chef besprechen. Ich kann aus rechtlichen Gründen selbst keine Entscheidungen treffen.«
»Reden Sie keinen Scheiß! Ich weiß doch, wie das läuft. Sie sind die Psychotante und sollen mich beruhigen – und pfeifen Sie die Scharfschützen zurück!«
»Ich glaube, hier sind keine Scharfschützen«, antwortete Alex.
»Für mich interessiert sich doch eh kein Arsch! Aber das wird sich ändern – und reden Sie keinen Mist, ich habe Hubschrauber gehört!«
»Das war bestimmt das Fernsehen. Ich könnte mich darum kümmern, dass die Reporter verschwinden – möchten Sie das?«
Gernot schwieg eine Weile. Dachte nach. Alex nutzte die Zeit, um sich noch einmal vor Augen zu führen, was in solchen Situationen erforderlich war. Eingehen auf den Geiselnehmer. Analytisch zuhören. Eine persönliche Basis aufbauen, Stress vermeiden. Im Konjunktiv bleiben. Und in diesem besonderen Fall Aufmerksamkeit schenken, bemüht sein – denn das Szenario war hochsensibel. Es sah wie folgt aus:
Der Oberstufenschüler Gernot Brinkmann war bewaffnet in das Lemfelder Gymnasium eingedrungen und hatte fünfzehn Schüler einer Chinesisch-AG als Geiseln genommen. Die Waffen stammten vermutlich aus dem Besitz des Vaters. Er war Jäger und besaß zwei großkalibrige Revolver, die für Fangschüsse benutzt wurden. Schüler hatten die Polizei vom Handy aus alarmiert und berichtet, was geschehen war und dass es Schüsse gegeben hatte. Angeblich waren dadurch Personen verletzt worden. Aktuell hatte sich Gernot in einem Klassenraum verbarrikadiert. Was er wollte, war unklar. Möglicherweise handelte es sich um einen Racheakt, vielleicht ging es um ein Mädchen, in das Gernot verliebt war. Einen klassischen Amoklauf schloss die Polizei jedenfalls aus, denn dann würde Gernot sicher nicht mit der Polizei telefonieren, sondern wäre damit beschäftigt, so viele Schüler wie möglich zu töten.
»Sind Sie noch da, Gernot?«
»Ja. Nein … Ist mir egal, die mit den Kameras können bleiben, nur die Bullen sollen endlich verschwinden.« Er klang nun etwas ruhiger.
»Okay, ich werde das gleich besprechen. Würden Sie mir denn sagen, ob es Ihnen gutgeht und in welcher Verfassung die anderen sind?«
»Drei liegen schon in der roten Soße, und davon wird es gleich noch mehr geben!« Damit brach die Verbindung ab.
Schneider massierte sich den Nasenrücken. »Drei angeschossene Personen – wir müssen die Verletzten rausholen. Und dazu müssen wir da rein.«
Alex legte das Handy beiseite und fragte in den Raum: »Kann ich bitte etwas zu trinken bekommen?« Sie zog sich den dunklen Rolli zurecht und band ihre schwarzen Haare mit einem Gummi im Nacken zusammen. Niemand gab ihr eine Antwort. Also ging sie selbst los, um sich ein Mineralwasser einzugießen, und hörte Reineking sagen: »Wir sollten es weiter mit Reden versuchen. Aushandeln, dass wir die Verletzten rausholen können.«
Der SEK-Einsatzleiter widersprach ihm. »Er hat bereits drei angeschossen. Er wird weitere Personen verletzen. Mein Vorschlag: Ich bringe ein Team an der Hinterseite des Gebäudes in Position. Da sieht er uns nicht. Wir gehen über die Umzäunungen des Sportplatzes und dann ins Hauptgebäude. Das zweite Team setzen wir vom Hubschrauber aus auf dem Dach ab. Wenn er sich über die Rotoren beklagt, sagen wir ihm, ein Notarzt sei eingeflogen worden.«
Reineking dachte nach und nickte schließlich zögernd. »Gut. Einverstanden.«
Das Telefon klingelte erneut. Alex stellte den Pappbecher ab und hastete zurück zu Schneider, der ihr bereits das Handy entgegenstreckte.
»Ja? Stietencron?«
»Ich weiß es jetzt«, sagte Gernot Brinkmann. »Sie sind wirklich die Psychotante. Sie waren in der Zeitung und im Radio.«
»Okay«, erwiderte Alex zäh, »ich bin die Psychotante.«
»Ich will, dass Sie zu mir reinkommen. Sie können von hier aus weiter mit denen reden, aber ich will Ihnen dabei in die Augen sehen.«
Schneider klappte die Kinnlade runter. »Was soll denn das jetzt?«
Alex deckte mit der Hand die Sprechmuschel ab und fragte in die Runde: »Was nun?«
Sie blickte zu Reineking, dessen Adamsapfel nervös auf und ab hüpfte. Darauf schien er nicht vorbereitet zu sein. Niemand war darauf vorbereitet. Alex sagte zu ihm: »Es hilft nichts, Stephan. Wir müssen flexibel reagieren.«
»Gebt ihr ein Headset«, sagte Reineking. Zwei Kollegen in Uniform setzten sich sofort in Bewegung.
»Gernot?«, fragte Alex, nachdem sie das Handy wieder ans Ohr genommen hatte.
»Ja?«
»Ich komme.«
»Sollte ich noch irgendwen anders sehen, gibt’s hier Tote.« Damit beendete er das Gespräch.
Alex hob die Augenbrauen, blähte die Backen und steckte das Handy ein. Ein Streifenpolizist heftete ihr ein Sende-Empfänger-Modul an den Gürtel und gab ihr das Headset. Ein anderer reichte ihr eine Schutzweste. Sie schlüpfte hinein und zurrte die Klettverschlüsse fest. Sie zog ihre Dienstwaffe aus dem Gürtelholster, lud eine Patrone in die Schusskammer und steckte die Pistole zurück. Sie steckte sich den Kopfhörerknopf ins Ohr und pappte sich das Kehlkopfmikro unter ihren Rollkragen. Dann zog sie ihre Daunenjacke über.
Der SEK-Leiter sagte zu Alex: »Die Situation hat sich zwar verändert, aber wir halten am bisherigen Plan fest. Das bedeutet: Keine Alleingänge, klar?«
Alex schüttelte den Kopf.
»Unter gar keinen Umständen. Das ist unser Job.«
Alex nickte und zog die Daunenjacke mit dem Reißverschluss zu.
»Schönen Gruß dann an den Geiselnehmer«, sagte Schneider. Er hob die Hand zum Abschied. Alex atmete noch einmal tief ein und aus wie eine Schwimmerin, bevor sie ins Becken springt. Dann machte sie sich auf den Weg.
3.
Der kalte Wind schlug Alex entgegen. Wie Krümel aus Styropor tanzten kleine Schneeflocken vom grauen Himmel und ließen sich auf ihrem Haar nieder. In den kahlen Bäumen des Kemper-Parks vor der Bücherei hingen die bereits eingeschalteten Glühbirnen der städtischen Weihnachtsbeleuchtung. Von der nahen Fußgängerzone her strahlten die Lichter des Weihnachtsmarkts herüber.
Vereinzelt flackerte das Blaulicht von Streifenwagen auf. Sie standen an Kreuzungen und auf Straßen, um den Bereich rund um das Gymnasium abzusperren. Auf dem Parkplatz der Bücherei hielten sich Rettungswagen in Bereitschaft. Dazwischen parkten zivile Polizeifahrzeuge mit NRW-Kennzeichen. Kollegen in gelben Signalwesten mit der Aufschrift »Polizei« sahen Alex hinterher.
Ihre Schritte knirschten im gefrorenen Schneematsch auf der Straße, als sie auf das große Eingangstor der Schule zuging. Alex hob das rot-weiße Plastikband einer Polizeiabsperrung hoch, schlüpfte darunter hindurch und betrat den Schulhof. Links und rechts waren in den schmucklosen Nebengebäuden die Verwaltung sowie die Kunst- und Musikräume untergebracht. Der zentrale, mehrgeschossige Haupttrakt war ein historischer Bau. Er glich mit seinen Säulen und Friesen einem klassizistischen Schloss.
»Ich betrete das Gebäude«, sagte Alex in das Kehlkopf-Mikrofon und hörte kurz darauf Reinekings Stimme antworten: »Mach einen Deal mit ihm. Wir müssen die Verletzten rausholen, und das SEK muss Zeit gewinnen, um in Stellung zu gehen.«
Alex nickte und stellte sich vor, wie die Scharfschützen jeden ihrer Schritte durch Ferngläser verfolgten. Sie streckte die Hand aus, fasste nach dem Knauf der Eingangstür und lauschte in die Leere. Da war nur der Wind, der um das Gebäude pfiff. Schließlich betrat sie die Pausenhalle im Hauptgebäude.
An den Wänden hingen abstrakte Bilder – wahrscheinlich von Schülern des Kunst-Leistungskurses gemalt. Die hohe Decke wurde von zwei Säulen getragen. Am Ende der Halle führte eine geschwungene Treppe nach oben. Ausgestreckt lag auf den untersten Stufen eine Frau in einer Blutpfütze.
»Weibliche Person unterhalb der Treppe am Boden«, murmelte Alex in das Mikrofon. Ihre Gummisohlen quietschten laut auf dem Linoleum. Sie hockte sich hin, um nach dem Puls der Verletzten zu fühlen. Das junge Mädchen trug eine Pudelmütze mit Lappland-Muster und einen Parka, der an der Schulter zerfetzt und vom Blut durchnässt war. Eine Schusswunde. Vielleicht war sie außerdem die Treppe hinabgestürzt.
»Sie ist verletzt. Schussverletzung in der rechten Schulter. Eventuell Frakturen durch Treppensturz.«
»Verstanden«, bestätigte Reineking.
Alex richtete sich wieder auf. Stufe für Stufe erklomm sie die Treppe und gelangte auf den Flur des ersten Stocks. Auch hier Bilder an den Wänden. Klassenraumtüren, die weit offen standen.
»Das SEK ist jetzt am Hauptgebäude, Alex«, hörte sie Reineking, während sie die Treppe ins zweite Geschoss hochging. »Eine Gruppe geht wie besprochen unten rein, die andere wird auf dem Dach abgesetzt und seilt sich ab.«
Alex sagte nichts. Sie erreichte den Flur im zweiten Stock. Links befanden sich wieder offen stehende Klassenraumtüren – und vor einem Getränkeautomaten lagen zwei Personen am Boden.
»Zwei weitere Verletzte im linken Flügel nahe der Treppe«, sagte Alex.
Mit drei ausladenden Schritten war sie bei den beiden Frauen. Die ältere wahrscheinlich eine Lehrerin, ihre blonden Haare waren blutverschmiert. In der rechten Schläfe befand sich ein Loch, das eine schwarze Korona aus Schmauchspuren aufwies. Direkt neben der Lehrerin lag eine jüngere Frau. Dunkelbraune Haare. Graue Jacke aus Fleece, die in der Mitte dunkel verfärbt und mit Blut vollgesogen war. Alex ging in die Hocke, streckte die Hand aus und legte Zeige- und Mittelfinger auf die Halsschlagader des Mädchens.
»Die ältere Person ist tot. Die andere lebt noch, eine Schülerin, Schussverletzung in der Bauchgegend.«
»Alex, sieh zu, dass du eine Vereinbarung mit ihm triffst. Hol ihn auf den Flur und bring ihn fort von den Geiseln.«
»Okay«, flüsterte sie und stellte sich wieder hin.
»Die alte Schlampe habe ich sauber erwischt, oder?«, gellte eine Stimme durch den Flur.
Alex wirbelte herum und zwang sich, nicht nach ihrer Waffe zu greifen. Gernot. Er trug einen schwarzen Schlumpf mit keltischem Muster, das an eine Tätowierung erinnerte. Die Kapuze hatte er weit über den Kopf gezogen. Eine Armee-Tarnhose. Springerstiefel. Verspiegelte Pilotensonnenbrille. Mit dem Revolver in der rechten Hand zielte er in das Innere des Klassenraums, dessen Tür er eben geöffnet hatte. Wahrscheinlich mit einem Schulterstoß, denn er hatte keine Hand frei: In der Linken hielt er einen zweiten Revolver, der auf Alex gerichtet war.
»Hallo, Gernot«, sagte Alex und hob die Hände leicht an, die Handflächen zu ihm gewandt.
Er hob das Kinn an und blaffte: »Wenn Ihnen jemand gefolgt ist, gibt es ein Blutbad!«
»Was ich nicht möchte«, entgegnete Alex mit ruhiger Stimme. »Und was möchten Sie?«
»Dafür interessiert sich doch sowieso kein Schwein!«
»Doch, ich.«
»Bring ihn ans Fenster«, sagte Reinekings Stimme im Kopfhörer, »und mach einen Deal.«
Alex sagte: »Gernot, ich glaube, dass Sie keine weiteren Menschen verletzen möchten. Ich soll Sie fragen, ob es okay ist, wenn wir die Verletzten auf dem Flur …«
»Ist mir egal, was die fragen wollen!« Gernot griff seine Waffen fester. Er blickte hektisch zwischen dem Klassenraum und Alex hin und her.
»Bring ihn ans Fenster«, redete Reineking wieder dazwischen.
Alex biss die Zähne aufeinander. Das Dazwischenfunken und Fernsteuern störte sie. Sie musste sich konzentrieren. Das hier war nun ihr Spiel, weil sie explizit ins Spiel gebracht worden war, und sie hatte bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sehr wohl in der Lage war …
»Alex«, sprach Reineking weiter, »das SEK braucht noch vier Minuten, bring ihn weg von der Tür ans Flurfenster!«
Alex griff sich ans Ohr, riss den Kopfhörer am Kabel ab und rupfte damit auch das Mikrofon von ihrer Haut. Sie hielt das Headset demonstrativ in Richtung von Gernot und warf es dann auf den Boden.
»Ey!«, rief Gernot. Er war nun wieder voll auf Alex konzentriert.
»Wenn es Ihnen egal ist, was die wollen, ist es mir auch egal. Sie wollten mit mir reden, Gernot. Und hier bin ich. Die Psychotante. Also. Reden wir.«
»Wieso haben Sie das gemacht?«
»Damit Sie mir vertrauen.«
»Aha.« Gernot klang baff.
Alex sagte: »Ich möchte die Verletzten rausbringen und bin im Gegenzug bereit, etwas für Sie zu tun. Gibt es jemanden, mit dem Sie reden wollen? Ihre Mutter? Ein Mädchen?«
Gernot zögerte. Er schien sich auf die neue Situation einstellen zu müssen. Dann sagte er mit einem Achselzucken: »Okay, von mir aus.« Er bewegte den Kopf ruckartig in Richtung des Klassenzimmers. »Jasmin!«, brüllte er. »Hierher!«
Ein strohblondes Mädchen trat heraus. Gernot presste ihr den Lauf einer seiner Waffen an den Kopf. »Aua!«, machte Jasmin und blickte Gernot sauer an.
»Die Schlampe hat mich im Internet angeschissen! Gemobbt!«
Aus den Augenwinkeln nahm Alex am Flurfenster einen Schatten wahr und kurzfristig ein grellrotes Blitzen. Laserlicht von einer Zieleinrichtung. Das SEK.
»Warum hast du das getan, Jasmin! Siehst du nicht, dass Menschen deinetwegen sterben mussten? Und jetzt musst du sterben!« Gernot spannte mit dem Daumen den Abzughahn.
Alex senkte langsam die rechte Hand. »Gernot, weg mit der Waffe.«
Er reagierte nicht, sondern schrie weiter. »Jetzt weißt du, wie man sich fühlt, Jasmin! Du hast noch drei Sekunden! Drei …«
Gernot hielt zwar nach wie vor einen Revolver auf Alex gerichtet. Aber er war voll und ganz auf das Mädchen konzentriert. Alex’ Hand senkte sich weiter, kam an der Hüfte an und tastete unter dem Saum der Daunenjacke in Richtung Hosenbund.
»… zwei!«
Alex spürte den Knauf der Walther. Sie stellte die Beine etwas auseinander, um einen sicheren Stand zu haben.
»… eins!«
Alex riss die Waffe hoch.
Gernot wirbelte herum.
Dann krachten drei Schüsse. Das Echo hallte laut nach. Hülsen tanzten um Alex’ Füße.
Als der Rauch sich gelegt hatte, zog Gernot Brinkmann die Kapuze herunter, nahm die Sonnenbrille ab und kratzte sich nachdenklich das kunstvoll rasierte Kinnbärtchen. Er hatte drei nass glänzende rote Farbflecken auf Brust und Bauch.
»Ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne des Erfinders war«, sagte Mario Kowarsch, der die Rolle des Geiselnehmers übernommen hatte.
Kowarsch war muskulös, klein und kompakt. Er ließ die zwei schlumpfblauen Waffen in den Taschen seiner Jacke verschwinden. Es waren ebenfalls mit Markierungs-Patronen gefüllte Varianten vom Original. Sie wurden zu Übungen verwendet und waren aus Sicherheitsgründen farbig gekennzeichnet, damit man sie von echten unterscheiden konnte.
»Wieso?«, fragte Alex und steckte die Trainings-Walther weg.
Neben Mario stand die Kollegin namens Finja Werner. Sie durfte heute das Opfer des Geiselnehmers darstellen und rieb sich den kreisrunden Abdruck an der Schläfe. Sie murmelte etwas davon, dass Kowarsch ja wohl nicht so fest hätte zudrücken müssen.
»Mensch«, sagte er zu Alex, »das war eine SEK-Übung und dazu gedacht, das Zusammenspiel der Kräfte zu simulieren!« Er suchte in der Seitentasche seiner Bundeswehrhose ein Funkgerät und sprach hinein: »Sie hat mich erledigt.«
»Wie, was, wer?«, rauschte es zurück. Es war die Stimme von Schneider.
»Alex«, funkte Kowarsch zurück. »Ich bin tot. Kannst alles abbrechen.«
»Nee, ne?«, krächzte Schneider. »Kacke, Reineking tobt, weil sie das Headset abgerissen hat, Mann, Mann.«
»Super gelaufen«, sagte Kowarsch sarkastisch und steckte das Funkgerät zurück. Aus den Augenwinkeln sah Alex, wie die beiden vom Jugendrotkreuz zu Opfern geschminkten Beamtinnen am Getränkeautomaten standen und sich streckten.
»Aber …«, stammelte Alex. »Ich meine, aus der Situation heraus habe ich richtig gehandelt, oder?«
Kowarsch rollte mit den Augen. »Darauf kommt es doch nicht an, wenn man einen koordinierten Einsatz übt. Der ganze Aufwand da draußen, wochenlanges Warten auf den Weihnachtsferienbeginn, Genehmigungen, Straßensperrungen, Hubschrauber – hast du darüber schon mal nachgedacht?«
Hatte sie darüber nachgedacht? Nein, hatte sie nicht. Sie hatte gehandelt. Wollte man ihr das nun vorwerfen? Schien so. Sie spürte, dass ihre Unterlippe zu beben begann. »Außerdem hast du mich hier reingeholt, das war nicht abgesprochen«, entgegnete Alex.
»Reineking wird dich in der Luft zerreißen.«
Alex ballte die Fäuste und sah trotzig zum Flurfenster hinaus. Sie hatte das Richtige getan und würde dafür ungerecht behandelt werden. Wieder einmal. Zwei SEK-Männer in Schwarz baumelten vor dem Glas und seilten sich langsam ab.
»Reineking«, sagte sie mit brechender Stimme, »kann mich mal!«
Damit drehte sie sich um und lief die Treppen runter. Sie wollte nichts als raus. Auf der letzten Stufe trat sie ins Leere und knickte mit dem Fuß um. Etwas knackte im Sprunggelenk. Ein scharfer Schmerz schoss durch den Unterschenkel – so, als habe ihr jemand mit einem Hammer auf den Knöchel geschlagen. Auch das noch. Alex hielt sich mit der Linken am Handlauf des Treppengeländers fest, schnaubte »Scheiße« und spürte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten.
4.
Der Mann trat von der Polizeiabsperrung zurück und gab sich alle Mühe, dass niemand seine Aufregung bemerkte. Er wandte sich zur Seite, faltete die Hände wie zum Gebet, versteckte das Gesicht dahinter und gab eine Art Stoßseufzer von sich. Keuchte seinen heißen Atem durch das Handschuhleder, der in einer weißen Wolke in der eiskalten Luft verpuffte. Wer ihn sah, mochte annehmen, er hätte sich bloß die Nase geputzt.
Dann drehte er sich wieder nach vorne und beobachtete die Frau weiter, die vom Gymnasium aus über die Straße ging und dabei ein Bein nachzog. Der Mann war darüber fast ein wenig empört. Sie schien sich verletzt zu haben. Das war nicht gut. Er wollte sie in Topform haben. Das Humpeln beeinträchtigte ihre ansonsten geschmeidigen Bewegungen. Beim Laufen, beim Einkaufen, wenn sie abends nach Hause kam.
Er hatte sie beobachtet und ihr einen Brief geschickt, den sie leider noch nicht beantwortet hatte. Aber er war sich sicher, dass sie sein Schreiben noch zur Kenntnis nehmen würde. Spätestens, wenn man seine letzte Beute fand, sollte sie auf die richtige Fährte geraten.
Sie, Alexandra von Stietencron. Polizeipsychologin in Lemfeld. Profilerin. Jägerin, und in dieser Hinsicht ein wenig wie er selbst.
Der Mann hatte alles über sie gelesen und den Fall mit dem Purpurdrachen und den Hexenmorden gebannt verfolgt. Sich gefragt, wie es wäre, wenn diese Alexandra hinter ihm her wäre, statt hinter irgendwelchen anderen, die nicht ansatzweise über die Komplexität seiner Persönlichkeit verfügten. Es wäre berauschend, zu verfolgen, wie sie sich ihm Schritt für Schritt annäherte, dachte der Mann. Und weil er das große Potenzial in Alexandra sah, hatte er entschieden, ihr eine Chance zu geben.
Ohnedies war sie die Einzige, die in Lemfeld dafür in Frage kam. Alexandra, dessen war er sich sicher, hatte Format, war nicht so dämlich und tapsig wie die anderen Bullen. Die Tölpel hatten keine Ahnung, standen viel weiter unten in der Nahrungskette und hatten bislang nicht einen einzigen seiner Hinweise verstanden.
Alexandra hingegen wäre vielleicht klug genug, um in Gänze zu erfassen, was er tat und warum. Wenn sie sich als stark genug erweisen würde, um die Bestie in ihm zu erlegen, würde er ihr sogar freiwillig die Kehle darbieten. Damit sie sie zerfetzen konnte. Je länger er darüber nachgedacht hatte, desto besser hatte ihm der Gedanke daran gefallen. Denn selbst würde er das Tier in sich niemals besiegen können.
Falls sie sich jedoch nicht als würdig erweisen würde und ihn enttäuschte, würde es eben andersherum laufen müssen. So war das in der Natur. Der eine jagte den anderen. Der Bessere setzte sich durch.
Nun hatte sie die andere Straßenseite erreicht. Bei jeder Bewegung tanzte der Zopf in ihrem Nacken. Ihr Gesicht war weiß wie der Schnee.
Sie blieb auf dem Bürgersteig stehen, besprach etwas mit einem ihr entgegenkommenden Polizisten und sah zur Seite. Zur Absperrung. Zu ihm. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Ein Moment, der ihn so sehr schaudern ließ, dass er sich am Mast eines Straßenschilds festhalten musste. Sie strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Eine Bewegung voller Anmut und Grazie, die seinem Herzen einen Stich versetzte. Dann war der Augenblick vorüber, und die Geräusche der Stadt drangen wieder an sein Ohr. Plappernde Menschen, knirschender Schnee. Das Krächzen von Funkgeräten.
Wenige Augenblicke später war Alex in der Bücherei schräg gegenüber verschwunden, und damit erlosch das Interesse des Mannes an der Übung. Er tat einen Schritt zur Seite und bewegte sich durch die Menschen. Er ging an Streifenwagen vorbei und nickte zwei Passanten zu, die ihn grüßten. Denn natürlich war er kein Unbekannter in Lemfeld, allerdings nicht allzu bekannt. Und niemand hatte einen Schimmer davon, nicht die geringste Ahnung, was und wer er wirklich war.
Im Gehen zog er den rechten Handschuh aus und vergrub die Finger in der Manteltasche. Sie suchten nach dem Rasiermesser und schlossen sich fest darum, nachdem sie es ertastet hatten. Sein Gewicht war beruhigend, wie das eines Handschmeichlers. Die hochelastische Klinge war aus Damaszener Stahl gefertigt. Ihre aufregende Optik entstand, indem man Stahlsorten unterschiedlicher Härte aufeinanderschmiedete und mit einer anschließenden Behandlung im Säurebad das charakteristische Tigerstreifenmuster hervorhob. Das Muster eines Jägers. Dann blieb der Mann an einer der Buden auf dem Weihnachtsmarkt stehen und kaufte ein paar warme Donuts.
Er ließ sie zum Mitnehmen einpacken und pfiff im Weggehen die Melodie von Bad Moon Rising.
5.
Leon, Franky und Hans hatten die Power. Sie waren Tush, was so viel bedeuten konnte wie »Müll«, »Eckzahn« oder einfach den Ausruf »Pah!«. Eine Menge von Möglichkeiten, und das hatte den aufgehenden Stern am Lemfelder Alternative-Rock-Himmel von Anfang an begeistert.
Gerade schlichen sie mit gegen die Kälte hochgezogenen Schultern über den alten Parkplatz an den Schliemannschen Werken, ihre Instrumentenkoffer im Schlepptau. Hans trug darüber hinaus Stativ sowie die digitale Spiegelreflex von seinem Vater. Es war Sonntag, arschkalt. Es lag Schnee, und sie wollten mit Selbstauslöser ein paar Band-Fotos machen. In ein paar Wochen hatten sie einen Gig im Station im alten Bahnhof, eigentlich ein Blues- und Jazz-Club. Aber es gab regelmäßig einen Tag im Monat für Nachwuchsbands, und sie brauchten Bilder für die Werbung.
»Krass«, sagte Franky, blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Ruine. Hans war ein langer dünner Schlaks mit gepiercter Augenbraue. Er hatte eine Wollmütze auf dem Kopf, rauchte eine Selbstgedrehte und kaute gleichzeitig ein Kaugummi.
»Ja, ne?«, meinte Hans und stellte den Kamera-Kram ab. Er war der Schlagzeuger und hatte deswegen keine Gitarrenkoffer zu schleppen, und ein ganzes Schlagzeug musste man für die Aufnahmen nun nicht ab- und wieder aufbauen.
Hans schnaubte in seinen Wollschal, zu dem er eine Army-Jacke trug. Er sah sich um. Es war an diesem trüben Tag kaum richtig hell geworden, aber noch war genug Licht. Die Kulisse der Ruine würde sich astrein auf den Bildern machen. Die alten, verbrannten Holzbalken des Dachstuhls. Die langen Eiszapfen. Der Frost auf den Fenstern und alles. Total »spooky«, und außerdem passte es gut zum CD-Titel von Tush: Die CD hieß »Icemen«.
Leon stellte den Basskoffer ab und nickte. In seinem Bart hatten sich einige Schneeflocken verfangen. Über die Säume seiner weiten Cargohose hatte er graue Stricksocken gezogen. Die Stricksocken steckten in Springerstiefeln. Er sagte: »Geht glatt als ’nen New Yorker Hinterhof durch oder so.«
»Oder Seattle«, ergänzte Franky.
Leon grinste zufrieden und nickte immer noch. Er tat das dauernd, so, als folge er irgendeinem inneren Groove, den nur er und sonst niemand hörte. »Genau, Seattle. Kurt hätte seine wahre Freude gehabt.« Er meinte Kurt Cobain von Nirvana, die aus Seattle stammten. Kurt war längst tot und Nirvana wie Kurt eine Alternative-Rock-Legende.
Hans klappte das Stativ auseinander, stellte es vor sich und schraubte die Spiegelreflex obendrauf. »Vor der siffigen Wand mit den vereisten Fenstern wäre das geil«, sagte er. »Das gibt noch so visuelle Effekte, die bekommst du beim Bearbeiten gar nicht hin.«
»Echt ist immer besser.« Leon nickte, nahm den Bass aus dem Koffer und schlurfte zur Wand.
Der Putz war großflächig abgeplatzt und gab das Mauerwerk frei. Mannshohe, teils erblindete Fenster bildeten eine Art Glasfassade. Einige waren stellenweise mit Eis und Frost verkrustet. Leon stellte sich mit dem Rücken zur Wand in Pose. Er hielt das Instrument wie einen Baseballschläger in den Händen und schob das bärtige Kinn vor. »So?«
Hans schaute kurz hin. Sah gut aus. Er hob einen Daumen und grinste. Franky postierte sich mit Gitarre neben Leon und setzte einen möglichst coolen Gesichtsausdruck auf. Hans richtete die Kamera aus, wählte einen Bildausschnitt, der für ihn selbst noch genug Platz ließ, und stellte den Selbstauslöser ein. Schließlich lief er los, stellte sich zwischen seine Bandkollegen, stopfte die Hände in die Hosentaschen und versuchte, so zu gucken wie Dave Grohl auf einem der Foo-Fighters-Plakate, die zu Hause bei Hans an der Wand hingen. Grohl war früher Drummer bei Nirvana gewesen. Drummer wie Hans.
Dann löste die Kamera aus. Sofort geriet Bewegung in Tush. Die Musiker gruppierten sich um den Fotoapparat. Hans rief auf dem Display das Bild auf und war zufrieden.
»Stark«, kommentierte Franky.
Leon nickte. »Zoom doch mal ran, ich will sehen, wie wir gucken.«
Hans drückte auf die Taste mit der Lupe und vergrößerte das Bild. Im nächsten Moment war das Display von irgendeinem Muster auf den Fenstern ausgefüllt. Sah fast aus, als stehe ein Mensch dahinter, dachte Hans. Er scrollte den Ausschnitt zu den Gesichtern.
»Deine Augen sind zu, Leon«, sagte Hans. »Das geht nicht, müssen wir neu machen.«
»Okay.« Leon nickte und ließ die Antwort wie eine Frage klingen.
Franky sagte: »Zeig doch noch mal den Ausschnitt von eben. Das kam krass irgendwie.«
Hans scrollte zurück. Wieder kam es ihm so vor, als stehe da jemand hinter dem Fenster. Er skalierte den Ausschnitt noch etwas. Und hielt die Luft an.
Leon gab ein unbestimmtes Geräusch von sich. Franky ein leises »Wow«. Hans sagte kein Wort.
Er hatte plötzlich das Gefühl, als würde er in einem Fahrstuhl ungebremst in einen Abgrund sausen. Er rannte zum Fenster, legte beide Hände gegen die Scheibe und sein Gesicht an die Handkanten. Sein schneller Atem ließ das Glas beschlagen, aber er konnte immerhin erkennen, dass er sich nicht getäuscht hatte. Er flüsterte »Fuck«, machte einige Schritte rückwärts und sah hektisch hin und her. Irgendwo musste doch eine Tür sein.
Er hörte Franky rufen: »Was ist da, Hans?« Seine Stimme klang deutlich höher als üblich.
Hans ignorierte ihn, denn er hatte eine Tür entdeckt. Ein Rolltor. Er lief hin und prüfte, ob es offen war. Hinter sich hörte er Schritte im Schnee knirschen. Leon.
Leon sagte mit starrem Blick: »Alter, da ist nicht drin, was ich denke, dass da drin ist, oder?«
Hans antwortete: »Ich weiß nicht. Kann sein.« Er redete wie ferngesteuert, spürte sich selbst nicht mehr.
»Du willst da doch nicht rein jetzt, oder?«
Doch da hatte Hans schon am Rolltor geruckt. Es war nicht verschlossen und ließ sich ohne Probleme öffnen. Er trat ein. Der Rest von Tush folgte ihm.
Die leere Halle war in diesiges Zwielicht getaucht. Deswegen verstand Hans zunächst nicht, was er da sah. Als er es begriff, hatte er das Gefühl, sich gleich in die Hose machen zu müssen.
»Alter«, hörte er Leon keuchen. »Alter, das sieht aus wie in einem Horrorfilm. Haben die hier einen krassen Film gedreht?«
Mit Ersterem hatte Leon völlig recht. Da stand ein rostiger Metalltisch, der aussah, als habe jemand darauf einen Kanister schwarzes Altöl ausgeschüttet. Allerdings glaubte Hans nicht, dass es Öl war. Und sie waren noch nicht einmal in dem Raum, in den er von draußen hineingeschaut hatte. Dieser lag noch etwas weiter rechts. Eine Stahltür führte dorthin. Sie stand offen. Hans ging zu der Tür. Seine Schritte hallten durch den Raum. Die von Leon und Franky ebenfalls.
Hinter der Tür lag eine Art Heizungsraum mit jeder Menge Rohren. Und mit jeder Menge Blut auf dem Boden. Darüber hing an einem Stahlseil das, was Hans auf dem Foto und danach durchs Fenster gesehen hatte. Der Körper einer Frau. Die Füße nach oben, Kopf nach unten. Schneeweiß und wie ein umgedrehter Jesus. Bauch und Brust waren aufgebrochen. So, als habe sich etwas von innen durch Fleisch und Knochen nach außen gewühlt.
Hans drehte sich wie in Zeitlupe zu seinen Band-Mitgliedern um. Ihnen war das Entsetzen wie mit einem Meißel ins Gesicht gezogen worden. Franky zitterte wie Espenlaub und fasste nach rechts, um sich irgendwo festzuhalten. Da war ein Hebel. Als Franky danach packte und ihn umklammerte, setzte er einen Mechanismus in Gang. Es rumpelte laut, und Hans verstand, dass der Griff zu einer Seilwinde gehörte, die über Rollen unter der Decke verlief.
Er folgte dem Stahlseil mit dem Blick – und verfolgte, dass sich der zerfetzte Körper mit einem Ruck absenkte und nach unten rauschte. Der Kopf schlug mit einem entsetzlichen Geräusch auf und knickte zur Seite. Dann fiel der Rest der steifgefrorenen Leiche auf den Boden.
Ein lauter Schrei gellte durch den Raum. Hans hatte keine Ahnung, ob seiner oder der von Leon oder Franky. Was er allerdings bewusst mitbekam war, dass Leon sich zur Seite beugte und sich übergab. Er selbst sackte auf die Knie und spürte, wie es heiß zwischen seinen Beinen wurde, als sich seine Blase schlagartig entleerte.
6.
Er ist ein Dreckskerl.«
Helens Stimme übertönte das Kindergeschrei. Sie biss in ein Stück Mikrowellenpizza.
»Ein mieser Dreckskerl sogar«, entgegnete Alex in der gleichen Lautstärke.
Die Luft war zum Schneiden. Es roch nach einem Gemisch aus Körperausdünstungen, Fritteusenfett und Reinigungsmitteln. Zu Hause, dachte Alex, würde sie als Erstes gründlich duschen und ihre Sachen sofort in die Waschmaschine werfen. Zwei Jungs sausten auf Dreirädern an dem weißen Plastiktisch vorbei und fuhren beinahe den Stuhl um, auf dem Lisas Sachen lagen.
Helen war Alex’ beste Freundin und mit ihrer Tochter übers Wochenende zu Besuch. Nachher würden sie wieder zurück nach Düsseldorf fahren. Lisa hüpfte auf dem Trampolin der Indoor-Spielewelt mit der Schwerkraft um die Wette, während Alex sich eine Pause gönnte. Sie hatte den nackten Fuß auf einem Klappstuhl hochgelegt. Hoffentlich würde sie als Andenken nicht einen Pilz zwischen den Zehen bekommen. Aber ohne Socken kam man besser die Luftkissenrutsche hoch – ein Trick, den Lisa Alex verraten hatte. Der zweite notwendige Trick war, die Zähne zusammenzubeißen und nicht an den Schmerz im Fußgelenk zu denken.
»Weißt du«, sagte Helen, »ich habe ihn zwar verlassen, aber das gibt ihm noch lange nicht das Recht, sich sofort eine andere zu nehmen. Für wen hält der mich? Für ein Möbelstück, das man einfach ersetzen kann?« Helen mümmelte an der Pizza. Unter ihren wippenden blonden Locken funkelten die blauen Augen. »Und guck mich nicht so vorwurfsvoll an. Diese Pizza ist verdammt lecker!«
Alex sagte: »Es ist normal, dass du sauer auf ihn bist. Das ist gekränkte Eitelkeit.«
»Also bitte«, fiel Helen Alex ins Wort und legte ihre Pizza auf den Pappteller. »Eitelkeit? Ich und eitel? Und dieser Mistkerl ist das absolute Gegenteil von eitel. Ich wünschte, er wäre mal ein wenig eitel gewesen, statt seine Nasenhaare so lang wachsen zu lassen, dass man ihm einen Bauernzopf hätte flechten können, Schneewittchen!«
Alex schmunzelte und verdrehte kurz die Augen.
Schneewittchen.
Seit sie sich auf der Polizeiakademie kennengelernt und schnell Freundschaft geschlossen hatten, nannte Helen Alex in Anspielung auf ihr Aussehen so. Schwarze Haare, kirschroter Mund, blasse Haut. In diesem Moment kam sie sich in der Tat vor wie eine ungeküsste Prinzessin im Dauerschlaf. Hier saß sie nun an einem mit Ketchup und Fanta beschmierten Klapptisch und dokterte an der gescheiterten Beziehung ihrer besten Freundin rum. Immerhin hatte Helen schon ein Kind und bald eine Ehe hinter sich. Und was hatte Alex? In Kürze ihren dreiunddreißigsten Geburtstag, eine dicke Katze, die Hannibal hieß, und einen angesehenen Düsseldorfer Anwalt zum Vater, der es ihr gegenüber mittlerweile aufgegeben hatte, von Enkelkindern zu sprechen, und die Kleine seiner zweiten Tochter Jule demonstrativ mit Geschenken und Bausparverträgen überhäufte. Alex hatte nicht einmal jemanden, mit dem sie Weihnachten verbringen konnte – und damit keine Ausrede, um an Heiligabend dem familiären Overkill bei ihren Eltern zu entgehen.
»Ich meine doch nicht diese Art von Eitelkeit«, sagte Alex und tastete ihr Gelenk ab. »Es ist die Ego-Kränkung. Aber es ist gut, sauer auf ihn zu sein, und ja, er ist ein Dreckskerl, der nie begriffen hat, was er an dir hat, und er soll mit seiner dummen Pissnelke glücklich werden oder auch nicht.«
Helen blickte Alex einen Moment lang fragend an. Dann brach sie in ihr lautes, etwas ordinäres Lachen aus. »Pissnelke«, wiederholte Helen, wackelte mit dem Kopf und ließ sich das Wort auf der Zunge zergehen. »Gar nicht schlecht.« Sie blickte auf Alex’ Knöchel und tippte einmal vorsichtig mit der Fingerspitze drauf. »Solltest du damit nicht langsam mal zum Arzt gehen?«
»Halb so wild.« Alex winkte ab. In ihrer aktiven Zeit als Triathletin hatte sie oft genug mit Verletzungen zu tun gehabt, um zu wissen, dass man sich von einem verknacksten Knöchel nicht davon abhalten lassen durfte, zum Ziel zu kommen. Dann verfinsterten sich Alex’ Gedanken und wanderten zurück zu dem Probeeinsatz am Kemper-Gymnasium. Versagt hatte sie in den Augen der anderen, obwohl sie doch das einzig Richtige in der Situation getan hatte. Aber darauf kam es offenbar nicht an. Es kam darauf an zu funktionieren. Wie ein Rad im Getriebe. In gewisser Weise war die Übung an der Schule symptomatisch für ihr Leben: Ganz allein auf sich gestellt, hatte sie ihr Ding durchgezogen und Erfolg damit gehabt – aber niemand hatte es anerkannt.
Unvermittelt fragte Helen: »Was machen eigentlich deine Männer?«
»Bitte?«
»Entschuldigung, ich frage ja bloß. Ich meine, schau dich an: Du bist bildhübsch, ich würde umfallen, wenn ich ein Mann wäre und mit dir arbeiten müsste. Du bist intelligent, einfühlsam, zehnmal so ordentlich wie ich und hast auch noch einen stinkreichen Vater.« Helen machte eine Pause und sah ein paar Kindern hinterher, die kreischend mit Gokarts an ihnen vorbeifuhren.
Die Antwort war einfach: Es war noch nicht der Richtige dabei gewesen. Außerdem nahm ihr Job sie vollends ein, nachdem ihr zuvor das Studium und die Ausbildung alles abverlangt hatten. Und davor hatte es Benji gegeben. Benjamin. Damals, als Alex siebzehn war, hatte ein Unbekannter ihre erste große Liebe auf dem Parkplatz einer Disco erstochen. Benji war in Alex’ Armen verblutet. Manchmal klaffte die Erinnerung daran noch wie eine offene Wunde.
Alex zuckte mit den Schultern. »Du weißt genau, dass meine Stelle in Lemfeld befristet ist, ein auf drei Jahre festgeschriebenes Pilotprojekt, und es ist meine große Chance. Ich darf das nicht vergeigen, und gerade habe ich bei der Übung angeblich Mist gebaut, da kann ich mir keinen weiteren Patzer leisten.«
»Was hat denn ein Kerl mit Patzern zu tun?«
»Ich will mich nicht ablenken lassen.«
»Es gibt mehr als die Arbeit im Leben.«
Alex zuckte mit den Schultern.
Helen machte eine abschneidende Geste. »Jeder macht Fehler, nur dass du dir keine erlauben willst. Du meinst immer noch, du müsstest deinem Dad beweisen, dass es mindestens so toll ist, wenn er eine bekannte Kriminalpsychologin zur Tochter hat wie eine renommierte Düsseldorfer Rechtsanwältin. Aber bei allem vergisst du dich selbst. Du vergisst zu leben. Und du als Psychologin solltest das selbst wissen, statt es dir von einer pummeligen Kripo-Beamtin sagen zu lassen.«
»Bei dir ist das anders, Helen. Du bist anders. Sicher, wir haben vieles gemeinsam, aber wir sind auch grundverschieden. Ich bewundere, wie du mit deiner Rolle als alleinerziehende Mutter klarkommst.«
»Das ist alles Fassade«, sagte Helen und aß noch ein Stück Pizza. »In Wahrheit war es ein grandioses Scheitern, eine Bankrotterklärung an alle Ziele, die ich im Leben hatte. Aber soll ich von morgens bis abends jammern?« Helen schüttelte den Kopf. »Keine Chance.«
Wie ein an Land gezogener Fisch begann Alex’ Handy auf dem Tisch zu zappeln. Helen zog verächtlich eine Augenbraue hoch, weil Alex nach wie vor das einprägsame Titelthema von Beverly Hills Cop als Klingelton verwendete. Alex warf einen Blick auf das Display. Es zeigte Schneiders Nummer an. Schneider war inzwischen so etwas wie Alex’ Partner bei der Polizei. Wer ihn nicht kannte, mochte ihn für einen tumben Typen halten. Doch hinter der Maske eines Kegelbruders versteckte sich ein glasklarer Verstand. Schneider war außerdem der Einzige gewesen, der nach der Sache im Gymnasium in Alex’ Büro gekommen war und gesagt hatte, sie solle sich mal wieder einkriegen, außerdem sei Kowarsch verantwortlich, weil er sich nicht an den Ablaufplan gehalten habe.
Schneider am Sonntag, das konnte jedenfalls nur zwei Dinge bedeuten: Ärger oder Arbeit.
Alex griff nach dem Telefon, presste sich das linke Ohr mit dem Zeigefinger zu und meldete sich mit einem knappen: »Hallo?«
»Ich störe dich ja nur ungern am Wochenende, aber …« Schneider unterbrach sich. »Sag mal, was ist denn das da für ein Lärm, bist du im Hallenbad?«
»Nein, Kinderspielewelt.«
»Soso. Ich würde ja gerne noch weiter mit dir plaudern, aber ich friere mir hier draußen mit der Spusi den Arsch ab. Dein Typ wird verlangt.«
»Was gibt’s denn?«, fragte Alex ernst und schaute Helen in die Augen, die besorgt zurückblickte, während sie sich mit dem Handrücken den Mund abwischte.
»Eine Tote. Die alten Schliemannschen Möbelwerke – weißt du, wo das ist?«
»Sicher.«
»Komm in die Strümpfe. Und zieh dir was Warmes an.« Dann beendete er das Gespräch.
»Arbeit?«, fragte Helen.
Alex nickte stumm, zog sich eilig ihren roten Pullover über und schlüpfte in die mit Fell gefütterte Bomberpiloten-Lederjacke, steckte das Handy in die Seitentasche und stieß dabei an den dämlichen Briefumschlag von neulich, den sie immer noch nicht abgeheftet hatte.
»Leichenfund«, entgegnete Alex geistesabwesend, band sich die Haare zusammen, knotete den Schal um und zog den Haustürschlüssel aus ihrer Tasche, um ihn Helen zu reichen. »Tut mir leid, ihr wollt ja gleich wieder nach Düsseldorf fahren, und eure ganzen Sachen …«
»Kein Problem«, sagte Helen und nahm den Haustürschlüssel entgegen. »Ich lege ihn wieder unter den Blumenkübel.«
»Sag Lisa, dass ich …«
»Mach dir keine Gedanken«, kürzte Helen ab.
Alex entschuldigte sich mit einem Lächeln und humpelte so schnell wie möglich in Richtung Ausgang. Als sie ihn fast erreicht hatte, hörte sie Helen rufen.
»Alex!«
Alex drehte sich um und tastete dabei instinktiv ihre Taschen ab. Hatte sie etwas vergessen? Ihre Geldbörse? Ihre … Dann sah sie, was Helen mit spitzen Fingern hochhielt. »Deine Socken!«
7.
Die alten Schliemannschen Werke lagen im Zentrum einer Gewerbebrache direkt gegenüber dem früheren Holzlager von Schwering und Söhne – einst das pumpende Herz der Region, das die Lemfelder Möbelindustrie mit Rohmaterial aus aller Welt versorgt hatte. Doch die goldenen Zeiten waren lange vorbei. Der Strukturwandel hatte tiefe Wunden gerissen.
Um eine solche handelte es sich bei den Schliemannschen Werken, deren seit Jahren offen stehenden Schlagbaum Alex’ Mini gerade passierte. Das ehemalige Pförtnerhäuschen war mit Graffiti besprüht, der weitläufige Hof dahinter mit Neuschnee bepudert. Links und rechts lagen die beiden Hauptgebäude, die über eine Versorgungsbrücke verbunden waren. Gewaltige Eiszapfen hingen davon herab. Alex konnte sich der Vorstellung nicht erwehren, vom mit durchsichtigen Reißzähnen bewehrten Schlund eines Tiefseemonsters verschlungen zu werden. Ein Streifenpolizist in neongelber Signaljacke stellte sich ihr in den Weg. Er schwenkte eine rote Haltekelle, winkte Alex aber durch, nachdem er sie erkannt hatte, und deutete in Richtung Hauptgebäude, wo einige Streifenwagen und zivile Fahrzeuge parkten.
Der zentrale Bau der Fabrik war zur Hälfte eingestürzt. Alex sah zerplatze Fenster, zerborstene Wände und die verkohlten Balken der Dachkonstruktion, die wie die Rippen eines auf dem Rücken liegenden Brandopfers in den schmutzig grauen Himmel stachen. Aus einigen der noch intakten Verglasungen des Erdgeschosses strahlte gleißendes Licht. Es musste von den Scheinwerfern der Spurensicherung stammen.
Alex brachte den Mini zum Stehen, setzte die Strickmütze auf und griff vom Beifahrersitz nach der neuen Umhängetasche, die sie sich selbst zum Nikolaustag geschenkt hatte. Sie war aus grauen Wolldecken gefertigt und trug ein aufgenähtes Schweizer Kreuz als Eyecatcher. Dann glitt Alex in die Handschuhe und zog den Reißverschluss der gefütterten Lederjacke bis oben zu. Im Aussteigen hängte sie sich die Tasche um und kam kurz darauf an einer grünlichen Stahltür zum Stehen, vor der Schneider rauchend wartete. Der Qualm vermischte sich mit der weißen Fahne seines Atems. Mit einem Blick auf Alex’ Tasche nuschelte er: »Ah, das Rote Kreuz. Na hoffentlich haste einiges an hochherrschaftlichen Pflastern in deinem Notarztbeutel dabei, Frau Doktor.«
Hochherrschaftlich. Ständig diese Anspielungen auf den Titel in ihrem Namen. Alexandra von Stietencron. Sie war schon als Kind genug damit gehänselt worden. Und dieses blöde Frau Doktor – bloß, weil sie Psychologin war und auch ein paar Semester Medizin studiert hatte. Ihr wäre lieber, wenn Rolf ab und zu mal Frau Kommissarin sagen würde. Schließlich hatte sie sich diesen Titel mit Abschluss an der BKA-Akademie und einer ordentlichen Polizeiausbildung mehr als verdient.
Alex öffnete den Mund, schluckte dann aber runter, was sie hatte antworten wollen, und entgegnete lediglich ein trockenes: »Hallo, Rolf.«
Schneider nickte knapp. »Du humpelst.«
»Blitzmerker«, antwortete Alex. Schneider brummte. Dann führte er sie nach drinnen.
In der geräumigen Halle, in der früher die Maschinen gestanden haben mussten, war es trotz der Scheinwerfer der Spurensicherung kaum wärmer als draußen. Das grelle Licht verlieh der Szenerie etwas Unwirkliches. Alex fröstelte. Sie sah die dunklen, gefrorenen Pfützen. Ihr Blick wanderte zu einem der Kriminaltechniker, der in seinem weißen Overall wie ein Gebirgsjäger in Schneetarn aussah. Er hantierte an einem Stativ herum. Darauf war etwas befestigt, das auf den ersten Blick einem Akkuschrauber glich.
»Neues Spielzeug«, erklärte Schneider mit einer Geste zum Stativ, drückte die Zigarette an einer Wand aus und ließ die Kippe in der Jacke verschwinden. »Spherocam High Dynamic Range für die fotorealistische Dokumentation. Die Kamera zeichnet in einem Winkel von 360 Grad horizontal und 180 Grad vertikal auf. Das System lässt hinterher jeden nur erdenklichen Betrachtungswinkel zu. Du kannst dich wie in einem virtuellen Raum bewegen – ganz großes Kino.«
»Aha«, entgegnete Alex und betrachtete einen Metalltisch, der geradezu in Blut getaucht worden zu sein schien. Schwarz und glänzend reflektierte seine kristallisierte Oberfläche das Licht der Scheinwerfer. An den Tischbeinen war das Blut in langen Schlieren herabgelaufen. Dort befanden sich auch Reste von Klebestreifen. Alex presste die von der Kälte aufgesprungenen Lippen aufeinander, als sie sich vorstellte, was auf diesem Metalltisch geschehen sein musste. Ohne die Augen abzuwenden fragte sie Schneider: »Wo ist …«
»Die Leiche ist nicht hier«, sagte Schneider. Er deutete mit dem Kopf nach rechts in Richtung einer weit offen stehenden Schiebetür, aus der ebenfalls Scheinwerferlicht fiel, das die langen Schatten von zwei Männern auf den Boden warf. »Sie ist nebenan bei Reineking und Kowarsch.« Schneider hielt inne, verzog das Gesicht und kratzte sich das unrasierte Kinn. »Ein paar Jungs haben die Leiche heute Nachmittag entdeckt. Sind jetzt für Zeugenaussagen auf der Wache. Ziemlich durch den Wind, die drei. Und leider haben sie uns den Tatort versaut.« Dann sah er Alex an. »Bereit, dir das Weihnachtsfest zu verderben?«
Alex ließ die Hände in den Jackentaschen verschwinden und knibbelte mit dem Daumen nervös an der Ecke des zusammengefalteten Briefumschlags. Dann schluckte sie und nickte stumm.
8.
Zuerst fielen ihr die merkwürdigen Zeichen an der Wand auf. Dann sah sie Reineking, der einen Beweismittelbeutel gegen das Licht hielt. Schließlich Kowarsch, der mit einem Kriminaltechniker sprach. Den Rest, dessen war sich Alex sicher, würde sie nie mehr wieder vergessen können.
Rolf sagte mit gesenkter Stimme: »Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist.«
Alex sah den Körper. Die gefrorenen Blutlachen. Ihre Kehle fühlte sich an, als sei sie verstopft. Sie räusperte sich und fragte: »Nicht das erste Mal?«
Rolf legte ihr die Hand auf die Schulter. »Es gab einen Fall wie diesen vor deiner Zeit. Den Fall Nele Bender. Aber lass dich davon jetzt nicht ablenken. Sieh dich um. Den Rest erkläre ich dir später.«
Und Alex sah sich um.
Der Raum glich einem Schlachthaus. Im Scheinwerferlicht schien alles wie für ein Filmsetting hergerichtet. Die Blutpfützen auf dem Boden wirkten wie ausgegossener Lack und waren mit einer feinen Frostschicht überzogen. Genau wie der aufgebrochene Körper einer jungen Frau.
Die nackte Leiche lag mit ausgebreiteten Armen wie eine herabgestürzte Christusfigur vor dem mit Rostflecken besprenkelten Kessel. Um die Fußgelenke war ein Stahlstrick gebunden, der zu einer Seilwinde zu gehören schien. Ihre vereiste, zerschnittene Haut war wie von Klauen zerfetzt. Die Brustwarzen waren entfernt worden. Alex sah gefrorene Organe. Der Kopf war fast abgerissen, die Augen ausgestochen, das Hüftgelenk sah zertrümmert aus. Auf den ersten Blick schienen ganze Fleischstücke zu fehlen. Als sei eine wilde Bestie über das Mädchen hergefallen, um sie zu fressen.
Und dann waren da die Zeichen. Für Alex war es keine Frage, dass der Täter das Blut seines Opfers benutzt hatte, um sie an die Wände zu schmieren. Zeichen, die Alex noch nie zuvor gesehen hatte. Auf den ersten Blick schienen es astrologische oder archaische Symbole zu sein. Doch was auch immer der Täter geschrieben hatte, dachte Alex, es war seine Signatur. Die Unterschrift des Bösen.
9.
Sie hatten etwa zwei Stunden am Tatort zugebracht und gewartet, bis das Team der Rechtsmedizin aus Münster erschienen war. Dann konnten sie einen schweren Gang nicht mehr weiter aufschieben, den Besuch der Mutter des Opfers. Es war nicht schwer gewesen, sie ausfindig zu machen: Der Täter hatte den Personalausweis des Opfers dagelassen. Er klemmte zwischen den Zähnen der Leiche.
Unterwegs hatte Schneider Alex kurz erklärt, der andere Fall habe sich vor ihrer Zeit in Lemfeld zugetragen, und er werde ihr nachher noch die vollständige Akte zeigen. Auf ihre Nachfrage, warum sie die nicht längst kannte, hatte er etwas pampig angemerkt, dass sie erstens nicht erwarten könne, dass ihr jeder offene Fall auf dem Silbertablett und mit Zucker bepudert serviert werde. Zweitens habe wahrscheinlich niemand daran gedacht, weil sie in der letzten Zeit mit den Purpurdrachen- und den Hexenmorden sowie der Restrukturierung der Polizeibehörde mehr als genug zu tun gehabt hatten. Ansonsten hatten sie kaum ein Wort gewechselt. Zu tief saß der Schreck über das, was sie eben gesehen hatten.
Die Aussicht, einer Mutter die Nachricht vom Tod ihrer Tochter zu überbringen, machte es nicht besser. Niemand mochte das, weil sich das Objekt Leiche dabei wieder in etwas Menschliches verwandelte. An die Toten konnte man sich gewöhnen. Sie schrien nicht über den Verlust und rissen sich nicht die Haare aus oder zerkratzten sich das Gesicht. Außerdem war Antje an Huef mit ihren einundzwanzig Jahren nicht bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war von einem namenlosen Monstrum zerfleischt worden.
Antje an Huef war der Name des Opfers. Eine Tochter aus gutem Hause, wie es schien. Ihr verstorbener Vater Ernst-Wilhelm an Huef war General bei der Bundeswehr gewesen. Die Mutter bewohnte heute allein das Haus der Familie – eine alte Jugendstilvilla im eleganten Viertel außerhalb des Zentrums an den Hängen des Stausees, auf dessen gefrorenem Eis seit Tagen Schlittschuhläufer ihre Runden drehten.
Als Alex und Schneider ausstiegen, roch es nach Schnee. Alex schaute auf, und für einen Moment hoffte sie, dass Hilde an Huef nicht zu Hause wäre. Vielleicht bei einer Freundin zu Besuch oder bei einem der anderen Kinder, die nach den ersten Ermittlungen in Wiesbaden und Hamburg lebten. Als Alex die zwei hellerleuchteten Fenster sah, war dieser Augenblick vorüber. Sie nestelte mit den Lippen an ihrem über das Kinn hochgezogenen Schal und atmete tief ein, als Schneider die Klingel drückte, worauf ein sanfter Gong aus dem Inneren ertönte. Sie fühlte sich, als hätte sie den ganzen Tag lang noch keinen Bissen, stattdessen aber fünf Liter Kaffee zu sich genommen. Dann ging die Tür auf.
Alex blickte in das noch ahnungslose schmale Gesicht einer großen und schlanken Frau. Sie trug eine Hausjacke aus rotem Mohair, über der ein abstraktes Medaillon an einer Goldkette baumelte. Unter dem dunklen Pagenschnitt musterten grüne Augen die Besucher.
»Ja, bitte?«, hörte Alex die leise Stimme.
Abwartend hob Hilde an Huef die fein gezupften Augenbrauen und schaute zwischen Schneider und Alex hin und her, bis sich Alex schließlich ein Herz nahm und sagte: »Mein Name ist Alexandra von Stietencron, und das ist mein Kollege Rolf Schneider. Wir sind von der Kriminalpolizei und müssen Ihnen leider eine sehr schlimme Mitteilung machen.«
10.
Hilde an Huef hatte die Nachricht vom Tod ihrer Tochter stoisch aufgenommen. Wie die Frau eines Soldaten, dachte Alex, die sich mit dem Gedanken hatte abfinden müssen, dass jederzeit ein dunkler Wagen vorfahren könnte und ihr gesagt würde, dass ihr Mann in irgendeinem fremden Land gefallen war. Auch jetzt noch, nachdem Alex in klaren Worten, wenn auch ohne Details zu nennen, berichtet hatte, was vermutlich mit ihrer Tochter geschehen war, saß Hilde an Huef in dem schweren Sofa gefasst und mit im Schoß gefalteten Händen.
»Darf … darf ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte sie leise. »Ich habe eben einen Tee aufgesetzt.«
Schneider hob die Augenbrauen und murmelte ein »Danke, nein«, während Alex ein »Gerne« hervorbrachte.
Hilde an Huef nickte, stand langsam auf und strich sich ihren Rock zurecht. Dann machte sie Anstalten, um den Wohnzimmertisch herumzugehen, und strauchelte wie an einem unsichtbaren Hindernis. Gerade noch schaffte sie es, die Lehne eines Esszimmerstuhls zu fassen, um nicht den Halt zu verlieren, und brach schluchzend in Tränen aus.
Schneider wollte vom Sofa aufstehen und der Frau zu Hilfe zu kommen, aber Alex legte ihm mit einem Kopfschütteln die Hand auf den Oberschenkel. Hilde an Huef war keine Frau, die es zulassen würde, sich von Wildfremden in den Arm nehmen und trösten zu lassen.
Schon hatte sie sich wieder gefasst. Ihr Körper gewann an Spannung, und sie wischte sich mit der Handfläche über die Augen, wobei sie darauf achtete, den Polizisten den Rücken zuzukehren. Dann sagte sie kaum lauter als das Ticken der großen Standuhr, die unter den vielen anderen Antiquitäten das Wohnzimmer dominierte: »Wissen Sie, wie mein Mann Antje immer genannt hat? Meine kleine Mondfee.« Mit einem gequälten Lachen, das mehr wie ein Stoßseufzer klang, drehte sie sich um.
Alex nahm das Lächeln auf. »Das ist sehr schön. Verraten Sie mir, warum Mondfee ihr Spitzname war?«
»Ach«, winkte Hilde an Huef mit ihren zitternden, schmalen Händen ab. »Das war so eine Marotte von den beiden. Ernst hatte ein Faible für Astronomie, und er hat mit Antje Traumreisen zu den Sternen erfunden …« Sie brach mitten im Satz ab, zog den Stuhl etwas zurück und setzte sich. Ihr Blick verlor sich in der Ferne.
Alex verschränkte die Hände ineinander und ließ ihre Augen über die teuren Möbelstücke gleiten, auf denen Fotos in edlen Rahmen standen.
»Wissen Sie«, fuhr die Frau fort und stützte den Kopf auf, »als Sie eben geschellt haben, da dachte ich … Ich dachte, es ist Antje, die zum Tee vorbeikommt, und dass sie wieder mal ihren Hausschlüssel vergessen hätte. Es ist so eine Angewohnheit von ihr …« Wieder wischte sie sich durch die Augen und korrigierte sich. »Verzeihen Sie, es war so eine Angewohnheit von ihr.«
Dann brach Schneider sein Schweigen. »Es tut mir wirklich leid, Frau an Huef, aber ich fürchte, wir werden Ihnen noch ein paar Fragen stellen müssen. Hatte Ihre Tochter einen Lebensgefährten? Gibt es Ex-Freunde, von denen sie sich im Streit getrennt hat? Wo hat sie zuletzt gewohnt, und wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit ihr?«
Hilde an Huef schüttelte den Kopf. »Antje hatte keinen Freund, was ich nie verstanden habe. Sie war so ein hübsches Mädchen, lebenslustig. Ich vermute, es hat an ihrem Beruf als Krankenpflegerin und ihren Wechselschichten gelegen, dass sie einfach nicht die Zeit und Gelegenheit dazu hatte, jemanden kennenzulernen. Ich habe zuletzt Anfang der Woche mit ihr telefoniert. Sie hat eine kleine Mietwohnung.« Hilde an Huef nannte Schneider die Adresse und fügte hinzu: »Wir wollten eigentlich gemeinsam über Weihnachten zu ihrer Schwester nach Hamburg fahren.«
»Mhm.« Schneider nickte und spielte verlegen an seinen Fingern.
Alex deutete auf die Bilder in den Silberrahmen, die auf einem exklusiven Sekretär aufgereiht waren. »Sind das alles Familienbilder?«, fragte sie sanft.
»Ja.«
»Darf ich?«
Hilde an Huef nickte stumm. Alex stand auf, ging über den tiefen Flor des hellen Teppichs und betrachtete die Aufnahmen. Dann erhob sich auch die Frau, deren Familie diese Galerie gewidmet war, stellte sich neben Alex und strich mit dem Finger über den Silberrahmen, in dem sich ein Foto befand, das drei Mädchen in verschiedenen Altersstufen zeigte. Ein Sommerbild. Die Kinder trugen Bikinis, hatten Zöpfe und spritzten mit einem Schlauch im Garten herum. »Die Größere ist Gritta, sie lebt jetzt mit ihrer Familie in Hamburg und hat zwei Kinder. Daneben steht Ronja. Sie wohnt in Wiesbaden und hat gerade ihr erstes Kind bekommen. Und die Kleine hier ist meine Antje – sie war damals etwa sieben Jahre alt.«