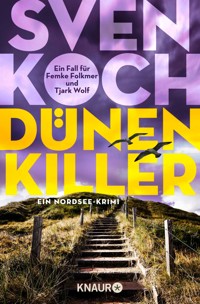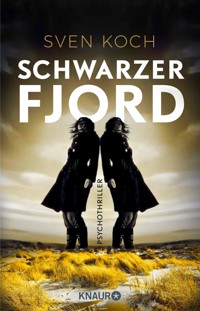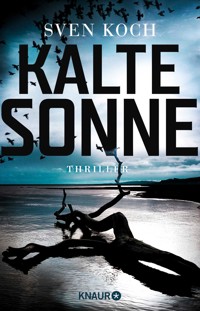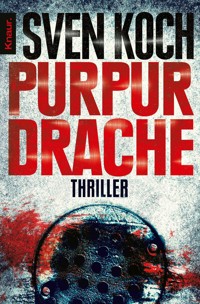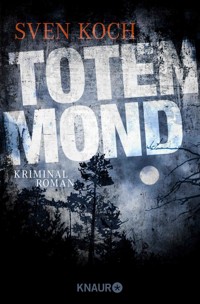9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Femke Folkmer und Tjark Wolf
- Sprache: Deutsch
Showdown im Auge des Orkans: »Dünensturm« ist der 7. ostfriesische Küsten-Krimi um die Kommissare Tjark Wolf und Femke Folkmers: actionreich, hochspannend und mit viel Nordsee-Atmosphäre. Eigentlich hatte Tjark Wolf den Dienst quittiert, doch Kommissarin Femke Folkmers und seine Kollegen von der Sonderkommission für Schwerverbrechen überreden ihn zur Rückkehr: Auf Langeoog wurde die Tochter des Gangsters Attaman entführt, den Tjark einst als engen Freund betrachtet hat. Nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall ist Attaman untergetaucht. Wenn jemand eine Chance hat, den Mann zu finden, dann Tjark. Allerdings ist nicht nur das LKA Niedersachsen brennend an Attaman interessiert. Und die Entführer seiner Tochter sind zu allem bereit, um ihn als erste in die Finger zu bekommen. Während sich über Langeoog ein gewaltiger Orkan zusammenbraut, blicken Tjark und sein Team in Abgründe, die ebenso tief sind wie lebensgefährlich … Der perfekte Urlaubskrimi für alle, die es etwas düsterer und mit handfester Action mögen Mit Kommissar Tjark Wolf hat Krimi-Autor Sven Koch einen kantigen, knallharten Ermittler erschaffen, den die Hannoversche Allgemeine Zeitung zurecht »den ostfriesischen Bruce Willis« nennt. Mit der taffen Kommissarin Femke Folkmers an seiner Seite nimmt Tjark es auch mit den ganz schweren Jungs auf. Die Küsten-Krimis von Sven Koch sind die perfekte Urlaubslektüre für Ferien im Norden! RTL+ verfilmt die Dünen-Reihe mit Hendrik Duryn und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen. Die actionreichen Nordsee-Krimis von Sven Koch sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Dünengrab (Grab am Strand) - Dünentod (Tödliche Falle) - Dünenkiller (Tod auf dem Meer) - Dünenfeuer (Falsches Spiel) - Dünenfluch (Die Frau am Strand) - Dünenblut (Schatten der Vergangenheit) - Dünensturm (Tödliche Geheimnisse) - Dünenwahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sven Koch
Dünensturm
Ein Nordsee-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eigentlich hatte Tjark Wolf den Dienst quittiert, doch seine Kollegen von der Sonderkommission für Schwerverbrechen überreden ihn zur Rückkehr: Auf Langeoog wurde die Tochter des Gangsters Attaman entführt, den Tjark einst als engen Freund betrachtet hat. Nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall ist Attaman untergetaucht. Wenn jemand eine Chance hat, ihn zu finden, dann Tjark. Allerdings ist nicht nur das LKA Niedersachsen brennend an Attaman interessiert. Und die Entführer seiner Tochter sind zu allem bereit, um den Flüchtigen als Erste in die Finger zu bekommen. Die Abgründe, in die Tjark und sein Team plötzlich blicken, sind tief und lebensgefährlich …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Epilog
1.
Die Nordsee gibt, die Nordsee nimmt.
Viele, die hier lebten, wussten von jemandem, den sie verschlungen hatte. Sie war nicht berechenbar, rau und stand für den Kampf des Menschen gegen die Natur. Sie war ein gefährlicher Gegner, Fluch und Segen zugleich. Sie formte das Land, und sie konnte es zerstören. Sie war undurchdringlich. Niemand wusste, was sie in ihren Tiefen verbarg. Einen ersten Schluck an Bord goss man vor dem Ablegen ins Meer – noch heute. Es hieß, es wäre ein Opfer für die Götter der Winde, doch es war eher eines für die See: Ich gebe dir, damit du mir nichts nimmst. Denn am Ende, das wusste jeder, der sich mit dem Wasser anlegte, am Ende siegte immer das Meer.
Tjark rauchte die Zigarette auf und blickte auf die grauen Wogen, über denen sich ein ebenso grauer Himmel spannte. Auch er hatte eine gespaltene Beziehung zum Meer. Er liebte es – und hasste es. Auf seinem Arm war eine große Woge tätowiert, frei nach einem bekannten japanischen Holzschnitt. Seine Mutter war ertrunken, wofür er sich lange verantwortlich gefühlt hatte. Und obwohl die Umstände ihres Todes mittlerweile geklärt worden waren, verschwand das Schuldgefühl nie ganz. Denn sie war bei einer Reise ums Leben gekommen, die Tjark seinen Eltern geschenkt hatte. Und letztlich blieb es ein Fakt: Sie würde noch leben, hätte er ihnen die Reise nicht geschenkt.
Und doch fühlte er sich zum Meer hingezogen – womöglich, da er in den Gischtkronen die Seele seiner Mutter zu erkennen glaubte? Da es nur einige Schritte und etwas Mut brauchte, um sie wiederzusehen und eins zu werden mit dem Wasser? War es das, was er fürchtete? Den Abgrund in sich selbst?
Tjark bohrte die Kippe in den Sand. Dort steckten schon einige Filter. Die Wolken hatten die Farbe des Betons der halb im Strand versunkenen Bunker, mit denen der Küstenstreifen bei Hvide Sande gesprenkelt war. Hier in Dänemark hatte die Wehrmacht die Invasion aufhalten wollen. Dabei hatten sich die Planer um ein paar Tausend Kilometer verschätzt. Weil man die Betonklötze nicht sprengen konnte und das Entsorgen viel zu aufwendig gewesen wäre, hatte die dänische Regierung beschlossen, die Trumme der Natur zu überlassen – und manchen Künstlern, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit den Relikten aus dunklen Zeiten befasst hatten. An Tjarks Lieblingsbunker war ein Schild mit der Aufschrift »Motel« angebracht. Denn nichts anderes war diese Welt: ein Ort, an dem man ein und aus ging, der mal von diesen, mal von jenen bewohnt und in den vergangenen Jahrtausenden von den verschiedensten Machthabern regiert worden war.
Nicht weit davon hatte Tjark kürzlich ein Ferienhaus auf unbestimmte Dauer gemietet. In seinem vorherigen hatten sich Dinge zugetragen, an die er sich nicht gerne erinnerte. Und vor allem wollte er Anne Madsen dem nicht aussetzen.
Anne war Polizistin wie Tjark, lebte in Århus und war in den letzten Monaten häufig zu Besuch gewesen – seit sie gewissermaßen ein Paar waren. Einer dieser Besuche würde ihr und Tjark bis in alle Ewigkeit in schlechter Erinnerung bleiben, und das Echo jener Geschehnisse schien zwischen den Wänden des Hauses widerzuhallen. Daher hatte Tjark entschieden, das Mietverhältnis zu beenden und ein neues abzuschließen.
Dieses Mal hatte er ein Haus gewählt, das dunkelrot gestrichen war, ein schwarzes Dach und weiße Firste und Fensterrahmen hatte. Dänischer ging es kaum. Allerdings war es modern gebaut und eingerichtet, verfügte über große Panoramafenster und einen ebenfalls rot gestrichenen Carport, in dem Tjarks schwarzer BMW Z4 parkte – sein persönliches Batmobil.
Madsen hatte Tjark vorgeschlagen, dass er bei ihr in Århus wohnen könne, wann immer er wolle. Doch er war nicht auf das Angebot eingegangen. Denn Tjark war sich nicht sicher, ob ihre Beziehung reif genug dafür war. Vielleicht wollte er es ruhig angehen lassen, weil sie beide Verwundete waren und erst wieder Vertrauen gewinnen sollten. Womöglich machte er sich auch schlicht zu viele Gedanken, statt Tatsachen zu schaffen.
Er war kein einfacher Mann, was Madsen wusste. Noch immer machte er sich Vorwürfe wegen der runenförmigen Narbe an ihrem Oberschenkel. Madsen stand mit beiden Beinen im Leben und war eher praktisch veranlagt. Für sie war die Narbe nur eine Narbe. Behauptete sie zumindest. Tjark ahnte jedoch, dass sie log.
Denn er wusste, dass Madsen ihm in vielerlei Hinsicht ähnlich war und auf Knopfdruck einen Schutzschild hochfahren konnte. Dumm war nur: Wenn ein Dampfkochtopf zu viel Druck hatte und kein Ventil, flog er einem früher oder später um die Ohren. Tjarks Ventil funktionierte einigermaßen. Bei Madsen war er sich dessen nicht so sicher. Sie war fraglos hart im Nehmen, aber von der zerbrechlichen Seite her kannte er sie nicht gut genug. Und deshalb bereitete ihm große Sorge, dass sie nach ihrer Freistellung in der Folge der Vorfälle mit dem Runenkiller wieder mitten in intensiven Ermittlungen steckte: Am Ostseeufer nahe Århus waren zwei junge Frauen brutal ermordet aufgefunden worden.
Ganz anders Tjark: Er hatte auf Drängen seines damaligen Chefs Hauke Berndtsen gekündigt, um die Kollegen von der Sonderkommission für Gewaltverbrechen und organisierte Kriminalität, kurz SKO, zu schützen.
Aber wie es nun für ihn weitergehen sollte und was er mit seinem Leben anstellen würde? Hier in der klaren Luft an der Nordsee würde er womöglich eine Antwort darauf finden – und wenn es nur die war, ein neues Buch zu schreiben.
Seit seinem True-Crime-Erfolg Am Abgrund vor einigen Jahren war der Verlag an einem Nachfolger interessiert. Tjark hatte das vor sich hergeschoben, weil er die Erfahrung gemacht hatte, dass der Abgrund in einen zurückschaute, wenn man nur lange genug hineinstarrte. Aber in seiner neuen Lebenssituation lagen die Dinge womöglich anders. Und von irgendetwas würde er leben müssen. Seine Ersparnisse und die Renditen aus Anlagegeschäften sowie die Tantiemen würden nicht für ewig und schon gar nicht für große Sprünge reichen, zumal es an den Börsen nicht gut lief. Er hätte sich von einem Teil seiner Comic-Sammlung trennen können, aber … Nein, da musste es etwas Besseres geben, um langfristig über die Runden zu kommen.
Er nahm einen Schluck aus der halb vollen grünen Bierflasche und betrachtete das Meer. Dann warf er einen Blick auf die Leinwand, die er gegen den Wind auf der Staffelei mit Klebeband fixiert hatte, verglich die Farben auf der Palette mit denen der echten Wellen, stellte gravierende Unterschiede fest und murmelte: »Scheiß drauf.«
Er machte sich ans Werk, die dunkleren Töne aufzutragen, und sagte sich, dass Künstler wie Vincent van Gogh vor demselben Problem gestanden hatten, wenn sie in der freien Natur malten. Nämlich dem Problem, dass sich mit dem wechselnden Sonnenlicht permanent die Farben änderten und einem im Grunde nichts anderes übrig blieb, als sich für ein bestimmtes Graublau zu entscheiden. Es ging nicht darum, die Natur zu kopieren. Dann sollte man besser ein Foto machen. Es ging darum, eine subjektive Auffassung einzufangen – wenngleich Tjark manches Mal objektiv festgestellt hatte, dass es zwischen dem Bild und selbst dieser subjektiven Auffassung eine massive Diskrepanz gab.
Das lag an seinem mangelnden Talent. Tjark war ein entsetzlicher Maler.
Anne Madsen hatte ihn gefragt, ob die Bilder an den Wänden des Ferienhauses von Kindern aus seiner Familie stammten und er gezwungen sei, sie aufzuhängen. Seine Antwort war gewesen, dass er die Bilder selbst gemalt habe, aber künstlerisch durchaus Luft nach oben sehe. Madsen hatte das lächelnd bestätigt.
Silje vom Supermarkt, bei der er Farben und Leinwände bestellte, hatte unbedingt mal seine Werke sehen wollen. Er hatte eines abfotografiert und ihr auf dem Handy gezeigt. Siljes Kommentar war gewesen, dass es ja doch in erster Linie um den Spaß an der Sache gehe und nicht jeder ein Leonardo sein könne.
Das Malen beruhigte Tjark jedenfalls. Immer schon. Außerdem hatte er ein Faible für Comic-Kunst und Comics generell, Superheldenhefte aus den Sechzigern insbesondere, die er nicht nur als Geldanlage sah: In jungen Jahren hatte er sich nie welche leisten können. Jetzt schon.
Früher hatte er probiert, den Silver Surfer aufs Papier zu bannen, seinen Lieblingshelden, und war spektakulär an den anatomischen Gesetzmäßigkeiten gescheitert sowie an verkürzten Perspektiven: Es gab nach Tjarks Meinung nichts Schwierigeres, als einen ausgestreckten Finger zu zeichnen, der direkt auf den Betrachter deutete. Die Erfahrung hatte seinen Respekt vor Comic-Künstlern wie John und Sal Buscema oder Jack Kirby noch vergrößert – den Respekt vor Künstlern generell. Also hatte er sich auf Landschaften spezialisiert, wenngleich er auch in diesem Genre die Grenzen seines Könnens blitzschnell erreichte.
Wie auch beim aktuellen Gemälde. Das zweitmieseste Bild von der dänischen Küste hatte er bereits gemalt. Dieses hier war nicht ganz so übel, was immerhin bedeutete, dass er nicht schlechter, sondern behutsam besser wurde.
2.
Django stand knöcheltief im Watt und starrte auf die Nordsee. Sie wirkte geschwollen und mächtig. Ihre Wellen bewegten sich wie die grauen Rücken von Walen auf und ab. Die gleißend weißen Schaumkronen erinnerten an übers Wasser kreisende Möwen, die nach Krebsen und Muscheln im dunklen Watt Ausschau hielten, das seinerseits gurgelte und gluckerte, als sei es hungrig und dabei, etwas zu verdauen.
Django zog an seinem Zigarillo und paffte eine Wolke in den knallblauen und wolkenlosen Himmel. Die Sonne brannte ihm auf den Schädel. Die verbliebenen grauen Haare waren zum Pferdeschwanz gebunden, der wie das Ende eines Drachens im Wind zappelte.
Die schlanken Finger von Lady Macmeth legten sich auf den in schwarzer Tinte gestochenen Kojotenkopf auf dem Oberarm und bedeckten das grinsende Gesicht der Comic-Figur mit den spitzen Zähnen mit Sonnencreme. Faktor fünfzig. Djangos Haut war hell, empfindlich und bereits leicht gerötet.
»Du musst aufpassen, Baby«, gurrte sie in seinem Nacken und rieb seinen bloßen Oberkörper von hinten ein.
»Schon klar«, knurrte Django.
Aber hier am Meer konnte er am besten nachdenken, mit der Nase im Wind und den Füßen im Schlick, und darauf warten, dass ihm etwas einfiel und dass die Nachricht eintraf. Wenn er zu Ende gedacht und das »Ja« oder »Nein« erhalten hatte, würde er sich umdrehen und zum Strandkorb gehen, wo ein paar Dosen Bier in der Kühlbox standen.
Lady Macmeth trug die Jeansshorts, die er so scharf fand. Sie war zwar ebenfalls schon jenseits der fünfzig, konnte solche Hosen aber gut tragen, besser als manche Dreißigjährige. Dazu das enge T-Shirt, auf dem der Roadrunner aufgedruckt war – dieser Comic-Vogel, der so irre schnell rannte. Django hatte gelesen, dass es solche Biester sogar in echt gab. Kein Scheiß: flitzende Vögel. Wozu sollte das gut sein, wo die doch fliegen konnten? Kapierte er nicht. In den Cartoons wurde der Runner stets von einem Kojoten gejagt.
»Ist genau wie bei uns, Baby«, hatte die Lady erklärt, »hinter mir ist auch ein heißer Kojote her.«
Damit war er gemeint, Frank »Django« Feddersen, weil er der Präsi des Motorradklubs »Bad Coyotes« war. Vor ein paar Jahren hatten sie ihn dazu bestimmt, nachdem sein Vorgänger von einem miesen Bullen vom Bike geschossen und anschließend in den Knast gewandert war. KHK Tjark Wolf, der Bastard, hatte die Knarre gehalten. Na ja, wenn man ehrlich war, hätte Django dem Mistkerl sogar dankbar dafür sein sollen, denn andernfalls wäre er niemals Präsi geworden. Aber er war ihm nicht dankbar, oh nein, kein Stück.
Denn Django hatte danach erneut mit dem Torfkopp Tjark Wolf zu tun gehabt, der ihn sogar in seiner Werkstatt aufgesucht hatte, und das war keine schöne Begegnung gewesen, absolut nicht. Nein, der Dreckskerl hatte die Coyotes und die Northern Riders gegeneinander ausgespielt und dafür gesorgt, dass die Kacke nicht nur gedampft hatte, sie war sogar übergekocht. Mit dem Ergebnis, dass die Riders mittlerweile nahezu keine Rolle mehr spielten, wofür Django dem Bullen eigentlich ebenfalls dankbar hätte sein sollen. Aber das war er nicht. Kein Stück.
Und scheiße, ja: Die Lady hatte absolut recht. Django war wie der Teufel hinter ihr her, genau wie der Kojote hinter dem Roadrunner. Sie war seine Queen, seine Bitch, seine große, weise Dame und die heißeste Milf aller Zeiten – auch wenn sie keine Kinder hatte. Allerdings war er der Meinung, dass sie sich deutlich zu viel reinzog – und zwar von allem, was sie in die Finger bekam. Im Laufe der Jahre war sie davon zunehmend durchgeknallt und litt an so etwas wie mangelnder Impulskontrolle, wie Django mal in einem Blog über Drogenkonsum und Spätfolgen gelesen hatte.
Aber hey. Na und? Django stand drauf. Es war besser, zu verglühen als zu verblassen. Und sie saßen an der Quelle, was wollte man da erwarten? Ein Bäcker oder Schlachter stopfte sich ja auch Kuchen oder Steaks rein.
Die »Bad Coyotes« hatten im Norden Ostfrieslands die Hosen an und kontrollierten den Drogenhandel. Sie hatten so viel Meth, dass selbst Walter White aus Breaking Bad Freudentränen weinen würde. Der Stoff kam aus Holland und Polen oder wurde hier oben in Scheunen im Niemandsland zwischen Watt, Wiesen und Deichen gekocht.
Und deswegen nannte Django sie zärtlich seine »Lady Macmeth«: Weil sie auf das Zeug stand und gleichzeitig seine irre Queen war, und er war der King. Wie bei Shakespeare.
Django paffte, während ihm die Lady schweigend den Rücken eincremte und dann wieder zurück zum Strandkorb ging. Sie wusste, wann sie ruhig zu sein hatte. Zum Beispiel jetzt, denn Django musste eine Entscheidung treffen, die eine halbe Million Euro in seine Kasse spülen könnte. Es war verdammt keine leichte Entscheidung, das war mal klar. Denn an die Zahlung der halben Million war ein Name gebunden und insbesondere ein Code zu einem Lagerraum oder Schließfach.
Den Code kannte Django nicht, und das war das größte Problem. Der Name war das zweite Problem, denn er lautete einerseits Vural Attaman, und zu allem Überfluss wusste niemand, unter welchem Stein sich diese Kakerlake verkrochen hatte. Zuvor hatte er einen größeren Einbruch begangen. Dann hatte er sich offenbar von einer internationalen Bande anheuern lassen, die in Rotterdam einen Juwelenraub plante. Das endete mit einer Schießerei und Verhaftungen. Vural konnte entkommen, hatte sich dann aber in Luft aufgelöst und war abgetaucht, nachdem sein Name gefallen war und ihm deswegen Europol an den Hacken klebte.
Aber natürlich löste sich niemand jemals in Luft auf. Es gab immer Spuren und jemanden, der etwas wusste. Weswegen Django ein paar Coyoten mit Brechstangen nach Aurich geschickt hatte, wo Cem Demirici einen Dönerstand betrieb. Cem war Vurals Buddy. Er hatte ein paar Zähne ausgespuckt, nachdem die Jungs mit ihm fertig waren, doch dummerweise keinen Code. Dafür aber immerhin, dass sich Vural in die Türkei abgeseilt hatte. Nein, schlimmer: nach Kurdistan, das zur Hälfte im Irak und weiß der Geier wo sonst lag. Schöne Scheiße.
»Aber was ist mit Tarik und Serhat?«, hatte Lady Macmeth geflüstert und Djangos Laune schlagartig verbessert.
Genau darüber dachte er nach. Über Tarik und Serhat. Die beiden waren Kurden und hatten Kontakte in ihre Heimat. Sie kannten sich aus. Doch das, was Django vorschwebte, war nicht so einfach zu bewerkstelligen und außerdem teuer und gefährlich.
Das Handy in der Hintertasche seiner Jeans summte. Schien so, dass das Warten endlich ein Ende hatte und er bald mit dem Nachdenken würde abschließen können.
Django zog das Smartphone aus der Tasche, schattete das Display gegen die Sonne ab und las die WhatsApp, die nur aus den zwei Buchstaben O und K bestand. Damit war grünes Licht für mehr Geld und etwas mehr Zeit gegeben. Perfekt, dachte Django, suchte eine Nummer aus dem Speicher und rief sie an.
»Tarik«, sagte er, »wo geiht di dat?« Er fragte nur aus Routine und erwartete keine Antwort. »Schnapp dir Serhat – und dann ab in die heiße Heimat, oder? Bring mir mit, worauf ich stehe. Fetter Bonus für euch beide.«
Er beendete das Gespräch, steckte das Handy wieder ein und inhalierte die herrliche frische Luft. Dann drehte er sich um und ging mit schmatzenden Schritten zurück zum Strandkorb, wo sich Lady Macmeth in der Sonne aalte.
Scheiße, dachte Django, jetzt hatte er aber so richtig Bock auf Bier und ein Krabbenbrötchen im Schatten. Beides hatte er sich redlich verdient, denn ihm glühte der Schädel, was nicht nur an der Sonne lag. Django war nicht gut im Nachdenken. Es strengte ihn körperlich an. Aber nun würde alles seinen Weg gehen.
Alles easy, altes Haus.
3.
Ein kühler Wind wehte an diesem klaren Morgen über die Hochebene nahe Mossul im Nordirak und trieb Sandkörner die staubige Straße entlang. Sie zog sich durch ein flaches Gebirge, dessen Höhenzüge sich noch violett gegen den dunkelblauen Himmel abzeichneten, an dem die letzten Sterne wie glühende Stecknadelköpfe leuchteten. Auf der schnurgeraden Straße fuhr ein weißer Datsun-Pick-up in Richtung Süden. An der Antenne war eine Flagge befestigt – eine Trikolore in den Farben Rot, Weiß und Grün mit einem gelben Sonnensymbol in der Mitte. Man nannte sie Ala Rengîn, was farbige Flagge bedeutete.
Sie galt als Hoheitszeichen der Autonomen Republik Kurdistan, die zumindest im Norden Iraks seit Mitte der Zweitausenderjahre anerkannt war. Insgesamt erstreckte sich das kurdische Siedlungsgebiet auf die Türkei, den Irak, Iran und Syrien. Die Republik war bereits 1970 ausgerufen worden, hatte sich jedoch bis nach dem Zweiten Irakkrieg nicht durchsetzen können, schon gar nicht auf türkischem Gebiet. Die Region Kurdistan gab es hingegen bereits seit über tausend Jahren. Und auch wenn der Landstrich mal in die Hände der einen, mal in die von anderen gefallen war, die Kurden hatten hier immer gelebt und sich stets als solche verstanden.
Wenige Minuten später bog der Wagen auf eine steinige Piste ab. Sie führte zu einer Ansiedlung von vier verlassenen Steinhäusern. Es waren einfache Bauten. Graue Holzzäune wiesen darauf hin, dass hier einmal Ziegen gehalten worden waren. Ihre Besitzer mussten geflohen sein. Vielleicht waren sie auch alle tot, denn unterhalb dieser Siedlung erstreckte sich eine Senke, die nach mehreren Kilometern auf die Vororte von Mossul traf.
Der Islamische Staat war zum Greifen nah. Er hatte in Syrien und im Irak vor einigen Jahren einen Flächenbrand entfacht und überall entsetzlichen Terror verbreitet. Er war zurückgedrängt worden, und in den Kurdengebieten hatte die Bevölkerung das selbst in die Hand genommen, genauer: die Peschmerga, die Streitkräfte der Autonomen Republik Kurdistan. Der Begriff bedeutet so viel wie »die dem Tod in die Augen Sehenden«. Tausende Kurden waren aus der ganzen Welt gekommen, um sich ihnen anzuschließen.
Im öffentlichen Bewusstsein Europas war der IS längst besiegt. Aber das stimmte nicht. Seine Kämpfer terrorisierten den Irak und die kurdischen Gebiete nach wie vor. Sie verkrochen sich in der Wüste, in Tunneln, in Höhlen, verübten Anschläge und verbreiteten unverändert Angst und Schrecken. Der Krieg war stiller geworden. Doch er war nicht beendet.
Genau das war der Grund, weswegen die kurdische Peschmerga-Patrouille in dem weißen Datsun hierherkam. Mit knirschenden Reifen kam der Wagen im Schatten eines der kargen Gebäude zum Stehen. Drei Männer stiegen aus. Die ersten beiden waren regelrechte Hünen, größer als eins neunzig. Sie wirkten wie Bodybuilder, denen man statt Hanteln deutsche G-36-Sturmgewehre in die Hand gegeben hatte. Sie trugen gesprenkelte Tarnanzüge in Sandfarben und waren braun gebrannt. Auf den Unterarmen und am Halsansatz zeichneten sich bei beiden die Linien alter Tätowierungen ab. Einer trug einen Kinnbart. Sein Name war Serhat. Der andere hatte die Haare zu einem kurzen Zopf gebunden und hieß Tarik.
Der Dritte namens Vural war kleiner, schlanker und älter. Er war etwa Mitte vierzig, trug ebenfalls einen Kampfanzug und einen grau-weißen Dreitagebart. Sein Kopf war kahl geschoren. Die schwarzen Augen lagen tief unter fein geschwungenen Brauen. In die Stirn hatte sich ein Canyon aus feinen Falten gezogen. Eine AK-47-Kalaschnikow hing ihm von der Schulter. Die rechte Hand ruhte schussbereit am Griff der Waffe. In der Linken hielt er ein leistungsstarkes Fernglas.
Die drei Männer bewegten sich um die Häuser herum, gingen dicht an einer Wand entlang und hielten auf einen Felsvorsprung zu, von dem aus sich ein guter Blick über die Ebene bot. Die drei wechselten einige Worte auf Deutsch miteinander, das sie weitaus besser sprachen als Kurdisch. Weswegen der Kommandant der Miliz sie zusammen losgeschickt hatte.
Die beiden Hünen waren erst kürzlich eingetroffen, um ihre Landsleute im Kampf der Peschmerga gegen den IS zu unterstützen. Vural war schon länger hier und erfahrener.
Er ging voraus und nahm dabei nicht wahr, dass die beiden anderen ihre Schrittfrequenz reduzierten und sich etwas zurückfallen ließen, bis sie stehen blieben. Am Ende der Hauswand stoppte auch er und stellte sich auf einen großen Stein. Er markierte die Grenze zu einer schroffen Böschung, die nahtlos in einen steilen Abhang überging. Darunter erstreckte sich die vom Islamischen Staat kontrollierte Wüste.
Vural warf einen langen Schatten. Bald, wenn die Sonne höher stand, würde sie brutal und heiß auf das Land brennen. Um ihn herum pfiff und jaulte der Wind.
Er blickte nach vorn, aber statt das Fernglas hochzunehmen, drehte er sich zu seinen Mitfahrern um, die nun sechs oder acht Meter hinter ihm standen.
»Was ist?«, fragte er.
Die beiden Kämpfer antworteten nicht. Sie nahmen die Gewehre in den Hüftanschlag und richteten die Läufe auf Vural, der sich nicht einen Zentimeter bewegte. Er reagierte kein bisschen.
»Gib uns den Code!«, sagte Tarik mit dem Zopf.
Vural schwieg. Blinzelte nicht einmal.
Er überlegte einige Momente und verstand, dass die zwei Männer aus Deutschland nicht für den Kampf gegen den IS hierhergekommen waren. Und ganz ehrlich: Das war auch nicht sein Beweggrund gewesen. Aber offenbar wusste das jemand und hatte ihm die beiden auf den Hals gehetzt. Irgendjemand, der von dem Code wusste, und das waren nicht viele. Keine Handvoll, nein, man konnte es an drei Fingern abzählen, und er fragte sich allen Ernstes, wie sie ihn hier hatten finden können und was sie mit diesem Code wollten, der nichts zu bedeuten hatte und der lediglich …
»Weg mit der Waffe!«, sagte Serhat, der mit dem Bart.
Vural ließ das Fernglas fallen. Sein AK behielt er an Ort und Stelle.
»Die Waffe«, wiederholte Serhat.
Vural fragte: »Wer schickt euch?«
»Der Tod«, erwiderte Tarik.
»Deiner oder meiner?«, fragte Vural.
Serhat sagte nichts, blinzelte nur. Tarik schluckte schwer. Man konnte selbst von hier aus sehen, wie sich der Adamsapfel bewegte.
Es war nicht das erste Mal, dass Vural Attaman in den Lauf einer Waffe schaute. Den meisten Menschen allerdings war Folgendes nicht bewusst: Wenn du eine Waffe auf einen anderen Mann richtest, musst du bereit sein, sie zu verwenden. Bist du das nicht, nutzt dir die Waffe gar nichts. Es legitimiert jedoch dein Gegenüber, aus Gründen des Selbstschutzes auf dich zu schießen. Richtest du also die Waffe auf einen anderen, musst du damit rechnen, zu sterben. So einfach ist das.
An dieses Gefühl gewöhnte man sich im Krieg. Für die beiden Gorillas, die auf ihn zielten, dürfte es jedoch neu sein. Sie waren im Unterschied zu Vural nicht daran gewöhnt und verstanden vielleicht gerade in diesem Moment, was das Quidproquo bedeutete, wenn man die Waffe auf jemanden richtete. Außerdem waren sie keine Profis. Absolut nicht. Profis wären das anders angegangen.
Zusammengenommen ergaben sich also einige Vorteile für Vural, wenn man denn von Vorteilen überhaupt sprechen mochte: Sie waren unerfahren, sie waren Amateure, und sie hatten Angst vor der eigenen Courage.
»Wenn du abdrückst und mich erschießt«, sagte Vural, »bekommst du keinen Code. Und in jedem Fall werde ich noch genug Zeit haben, zurückzuschießen.«
»Ich schieße dir erst in die Kniescheiben. Dann in den Ellbogen. Den Code spuckst du schon aus.«
Vural schüttelte schwach den Kopf. »Ich werde verbluten und vor Schmerzen schreien, ihr Schwachköpfe, aber den Code werde ich nicht ausspucken. Der Code hat nichts zu bedeuten, aber im Moment ist er meine Lebensversicherung. Sobald ihr ihn habt, legt ihr mich um. Also sage ich kein Wort. Was auch immer ihr mit dem beschissenen Code anfangen wollt, solange ich ihn für mich behalte, werde ich leben.«
Die beiden schwiegen.
»Und jetzt?«, fragte Vural.
»Waffe weg!«, herrschte Tarik ihn erneut an.
Er und Serhat nahmen die Gewehre fester in den Hüftanschlag, um ihre Entschlossenheit zu unterstreichen. Nahmen sie hoch, um sich die Kolben zwischen Wange und Schulter zu pressen und sich breitbeinig und stabil aufzustellen, so wie man es ihnen in der kurzen Ausbildung im Peschmerga-Camp beigebracht hatte. Für zwei Sekunden geriet dabei ihr Ziel aus der Achse von Kimme und Korn und musste neu justiert werden.
Jetzt oder nie.
Vural sprang hinter die Hausecke. Fast gleichzeitig krachte eine Kaskade von Schüssen. Er warf sich zu Boden. Im Fallen drehte er sich und schlug mit dem Rücken auf.
Von der Hausecke sprühten Putz und Steine herab. Splitter lösten sich in kleinen Explosionen vom Felsvorsprung und wirbelten jede Menge Staub auf. Instinktiv streckte Vural das AK-47 in die Höhe, um denjenigen mit einer Salve zu begrüßen, der sich als Erster um die Hausecke herum trauen würde. Aber es gab zwei solcher Ecken: eine vor Vural, eine hinter ihm. Und wenn die beiden Kerle nicht allzu bescheuert wären, würden sie von zwei Seiten um das Haus herum marschieren und ihn in die Zange nehmen.
Vural biss die Zähne zusammen und hockte sich hin. Er hatte sich offenbar den Kopf aufgeschlagen, heiß und klebrig lief ihm das Blut in den Nacken und verfärbte den Saum seines Hemdes tiefrot. Er bohrte die Hacken in den Boden, schob sich an der Wand nach oben, presste sich mit dem Rücken gegen die Mauer und griff mit der Linken in die Seitentasche seiner Armeejacke.
»Du bist tot!«, hörte er Serhats Stimme.
»Du hast keine Chance!«, ergänzte Tarik.
Beide Stimmen kamen aus derselben Richtung. Also waren sich die zwei noch nicht sicher, wie sie weiter vorgehen sollten, und setzten zunächst darauf, dass Vural aufgeben würde.
Fehler.
Was Vural aus der Tasche zog, hatte in etwa die Größe einer Coladose und wog ein knappes Pfund. Er klemmte sich das Gewehr zwischen die Schenkel, zog an einem Ring den Sicherungsstift aus der Zündmechanik und ließ den Schalthebel aufschnappen, den man normalerweise mit dem Handballen so lange zudrückte, bis man die Handgranate von sich schleuderte. Anschließend hatte man etwa vier Sekunden bis zur Explosion.
Doch Vurals Granate war bereits scharf.
Er wollte den Burschen keine vier Sekunden geben, in denen sie sich in Sicherheit bringen konnten, nachdem ihnen die Granate vor die Füße gefallen war – oder, schlimmer noch: sie sie aufnehmen und zurückwerfen konnten.
Vural zählte. Bei zwei drehte er sich um. Bei drei warf er die Granate quer über die Hausecke in die Richtung, in der Serhat und Tarik stehen mussten. Bei vier hatte die Granate das Dach überquert und explodierte einen Wimpernschlag später in etwa zwei Metern Höhe, wobei sie ihre volle Wirkung in allen Himmelsrichtungen über den Männern entfaltete.
Die Sprengladung im Kern der Granate zerfetzte den Splitterkörper, hinter dem sich mehr als sechstausend Stahlkugeln befanden, was im Radius von zehn Metern ziemlich tödliche Auswirkungen hatte.
Vural war weit genug entfernt und durch die Mauer geschützt. Dennoch spürte er die Druckwelle. Der Knall ließ seine Ohren taub werden. Er griff die Kalaschnikow, hielt sie mit einer aus dem Häuserkampf routinierten Geste um die Ecke und feuerte blind einige Schüsse ab. Dann riskierte er einen Blick und erkannte, dass er sich keine Gedanken mehr machen musste. Serhat und Tarik hatte es böse erwischt. Kein schönes Bild, wirklich nicht.
Er ging zu den zerfetzten Leichen und gab im Gehen noch einige Schüsse auf die Körper ab. Die Taubheit auf den Ohren legte sich langsam. Das Geräusch des heulenden Windes kam zurück.
Vural ging zum Datsun, öffnete die Türen und nahm ein Erste-Hilfe-Set heraus. Im Seitenspiegel betrachtete er seinen Kopf. Die Platzwunde war nicht schlimm, aber blutete wie verrückt, wie es oft bei Kopfverletzungen der Fall war. Er riss eine Verpackung auf und presste eine Kompresse auf den Cut, verklebte sie mit Pflastern.
Vural ging zurück zu den Leichen. Er untersuchte das, was von den beiden übrig war. Fand in den Taschen jeweils eingeschaltete Handys, stellte sie stumm und steckte sie ein. Dann packte er Tariks Körper an dem Bein, das noch einigermaßen fest an der Hüfte saß, und schleppte ihn zum Datsun. Vural wuchtete ihn auf die Ladefläche, gönnte sich zwei Minuten Pause. Dann schleifte er Serhats Körper zum Wagen und ging noch einmal zurück, um dessen rechten Arm zu holen. Die Explosion hatte ihn vom Körper und aus der Uniform gerissen.
Dabei fiel Vural die Tätowierung auf. Während er den Arm ebenfalls auf die Ladefläche warf, dachte er nach. Die Tätowierung sagte ihm etwas: ein stilisierter Hund und die Initialen B. C. Ja, verflucht, jetzt verstand er, woher die Burschen gekommen waren. Aber die Hintergründe blieben ihm dennoch schleierhaft.
Vural stieg schwitzend und von der Anstrengung halb ohnmächtig in den Wagen ein, leerte zwei Flaschen Wasser und ließ den Motor an. Bis zum Camp waren es fünfzig Kilometer. Er griff nach vorne und nahm das Satellitentelefon aus der Ablage, verständigte den Wachhabenden und erklärte, was geschehen war. Ziemlicher Schlamassel. Eine beschissene IS-Streife habe sie erwischt, und er – ja, er Vural Attaman – habe verdammtes Glück gehabt, ihn habe nur ein Splitter am Kopf getroffen.
Man sagte ihm, er solle zusehen, dass er sich in Sicherheit brachte. Sie würden ihm auf halbem Weg entgegenkommen.
Vural dachte an Shirin. Er warf ein paar Schmerztabletten ein und stellte sich ihr rabenschwarzes Haar vor, wie es in der Sonne glänzte. Manchmal trug sie es bis zu den Hüften. Wie es jetzt war, wusste er nicht. Er dachte an ihre helle Haut, ihre roten Lippen, die gütigen braunen Augen. An ihren Duft und das Gefühl, sie in den Armen zu halten, und den Klang ihrer warmen Stimme, wenn sie sagte: »Wir kriegen das schon hin.«
Was würde er dafür geben, sie wiederzusehen? Nur für einen kurzen Moment? Alles. Sein Bein, seine Arme, sein Herz, sein Leben. Es gab nichts Wichtigeres als sie. Nichts Wichtigeres als Shirin. Früher oder später würde er seine Tochter zu sich holen. Sie und Franziska, seine Frau. Dann wären sie wieder zusammen und eine Familie. Entweder hier in Kurdistan oder in einem anderen islamischen Land. Neue Identitäten. Ein neues Leben. Gemeinsam.
»Wir kriegen das schon hin«, flüsterte Vural Attaman, schnallte sich an und stemmte den Stiefel mit einem lauten Keuchen aufs Gaspedal. »Wir kriegen das schon hin.«
Die Reifen des Datsun drehten knirschend durch und wirbelten eine Staubfahne auf, sie ließ den Wagen in einer beigefarbenen Wolke verschwinden, die sich hell gegen den kobaltblauen Himmel abzeichnete.
4.
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub«, sagte der Pfarrer. Die Glocke schlug. Ansonsten war es still in der Kapelle auf dem Auricher Friedhof, wo der Gedenkgottesdienst stattfand. Zwei Bilder, die Serhat und Tarik zeigten, standen neben dem Altar. Django hätte sich einen anderen Spruch von dem Geistlichen gewünscht. Eher: »Like a true nature’s child we were born, born to be wild, we can climb so high, I never wanna die.«
Tja, das mit dem »never wanna die« hatte sich für die beiden jedenfalls erledigt. Ihre Leichen waren nach Deutschland geschickt worden, nachdem die Verwandtschaft sich doch dagegen entschieden hatte, sie in den jeweiligen Heimatdörfern in Kurdistan beizusetzen. Scheiße, warum denn auch: Tarik und Serhat waren in Deutschland geboren, selbst wenn sie sich als Kurden fühlten. Aber egal.
Django hatte die Krise bekommen. Zwei Kojoten hatte er wegen Vural nach Kurdistan gesandt. Zwei Leichen kamen postwendend zurück. Das war eine Kriegserklärung.
»Dafür muss er bezahlen«, hatte Lady Macmeth gesagt und Django in seiner Trauer beigestanden.
Jetzt saß sie neben ihm auf der Holzbank in der dritten Reihe hinter den Angehörigen und hielt seine Hand. Auf den anderen Bänken saß der Rest der »Bad Coyotes«. Alle trugen ihre Kutten und darunter Schwarz.
Django hörte das Weinen, das Jammern. Die Verwandten von Tarik und Serhat würden die beiden in einer eigenen Zeremonie verabschieden und dann ihre Asche beisetzen. Dennoch waren sie zur Gedenkfeier gekommen, um mit dem Motorradklub Abschied zu nehmen.
Djangos Hand verkrampfte sich in der von Lady Macmeth. Die Frauen der beiden Toten weinten herzergreifend. Die Mütter. Die Väter, die Brüder. Und allen, die Bescheid wussten, hatte Django versprochen, dass der Tod von Tarik und Serhat gerächt werden würde. Er stand jetzt im Wort. Abgesehen davon stand er auch bei dem Auftraggeber im Wort.
Tja, nur konnte Django ja schlecht weitere Biker nach Kurdistan schicken, um Vural zu finden und umzulegen. Außerdem würde er dann niemals an den Code kommen. Also musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Und wie so oft hatte Lady Macmeth eine neue Idee an ihn herangetragen, nachdem sie sich eine Nase Koks reingezogen hatte.
»Wir haben eine Sache noch nicht ausprobiert, weil wir dachten, es wäre zu gefährlich. Aber eigentlich ist es ganz einfach«, hatte sie gesagt und genauer erklärt, wie sie das meinte.
Denn Vural Attaman war sehr viel verwundbarer, als er selbst annahm.
Fire all your guns at once, and explode in space, dachte Django, knirschte mit den Zähnen und starrte auf die Porträtfotos am Altar.
Ich treffe dich da, Vural, wo es dich am meisten schmerzen wird.
5.
Und warum eigentlich nicht, dachte Lady Macmeth und stakste auf ihren Pumps über das Pflaster in der Fußgängerzone von Esens. Ein Gespräch von Frau zu Frau, und die Bullen würden ihr es kaum verwehren können, ein wenig zu shoppen. Falls sie sie überhaupt erkennen würden. Denn sie kam ja auf keinem Bike angerauscht, trug auch keine Kutte, sondern hatte sich eine ihrer Langhaarperücken mit der Betty-Page-Frisur auf den Kopf gesetzt, die aus ihrer Zeit als Stripperin stammte, und trug zudem eine übergroße Sonnenbrille auf der Nase. Die Jungs mochten Cem aufgemischt haben und Vural in Kurdistan. Erfolg hatte das kaum gehabt, und auf die naheliegende Idee war keiner gekommen.
Das heißt: Waren sie schon, aber das Haus von Franziska Attaman wurde von den Bullen überwacht. Da kam keiner rein, zu riskant. Bei der Boutique war das etwas anderes. Okay, vielleicht würde auch die überwacht, logo, aber, wie gesagt: Shopping war ja nicht verboten.
Sie verließ die Fußgängerzone, erreichte eine Nebenstraße und hielt sich an ihrer Handtasche fest, bis es eine Lücke im Verkehr gab und sie auf die andere Straßenseite huschen konnte. Und da war auch schon die Boutique – nicht groß, aber hübsch. Lady Macmeth linste über den Rand der Sonnenbrille hinweg in die Schaufenster. Schicke Mode. Das Geschäft sah außerdem leer aus. Kein Wunder um die Uhrzeit, morgens ging kaum wer einkaufen, weswegen sie diesen Zeitpunkt gewählt hatte.
Aber in erster Linie kam es ihr auf die Spiegelungen an, weil sie sehen wollte, ob irgendwo Autos parkten, die mit Personen besetzt waren. Natürlich war das kaum zu erkennen. Jedenfalls fiel ihr nichts auf, und eben beim Überqueren der Straße hatte sie auch nichts gesehen. Von daher …
Lady Macmeth öffnete die Tür und betrat das Geschäft. Sie nahm die Sonnenbrille ab, setzte sie aber sofort wieder auf, als sie eine Videokamera hinter der Kasse sah.
»Hallöchen«, sagte sie zur Verkäuferin, bei der es sich zweifellos um Franziska Attaman handelte. Die Lady kannte sie von Fotos. Sie hatte eine gute Figur, trug ein schickes, buntes T-Shirt und Jeans, war geschminkt und wirkte so überhaupt nicht wie die Frau von einem wie Vural Attaman, sondern total normal.
»Hallo«, sagte sie und war mit irgendetwas hinter der Kasse befasst, kam aber um den Tresen herum. »Kann ich Ihnen helfen?«
Lady Macmeth stürzte sich sofort auf einen Ständer mit Blusen im Ibiza-Stil. »Also die sind ja heiß. Genau das suche ich doch!« Sie lachte.
Franziska Attaman lächelte und nickte. »Die sind toll. Mögen Sie mal anprobieren? Größe achtunddreißig?«
»Aber ganz genau«, erwiderte die Lady und stöckelte sofort zur Umkleidekabine, die sich neben dem Verkaufstresen und damit außerhalb der Sichtweite der Videokamera befand. Sie ließ sich die Blusen von Franziska hinterhertragen. Mit Absicht. Denn sie wollte sie in Richtung Umkleide lotsen. Lady Macmeth blickte nach oben. Keine Kamera. Wäre ja auch noch schöner.
Sie ging rein, drehte sich mit einem strahlenden Lächeln um und nahm die Blusen mit der linken Hand in Empfang. Mit der rechten fasste sie in ihre Handtasche und zog die kleine Automatik hervor.
Franziska Attamans Lächeln gefror.
»Keinen Mucks. Und keine Bewegung, Schätzchen«, sagte Lady Macmeth. »Ich komme nicht wegen der Blusen. Ich komme wegen deinem Mann. Er hat etwas, das wir gerne haben möchten, und vielleicht hast du mitbekommen, dass der gute Cem ein paar Tage im Koma lag?«
An Franziskas Gesichtsausdruck war abzulesen, dass ihr das neu war.
»Tja, das lag daran, dass er nichts ausspucken wollte, außer ein paar Zähnen. Dann weißt du auch nicht, dass zwei Männer tot aus Kurdistan zurückgekehrt sind, weil sie deinen Mann dort auftreiben wollten?«
»Um Himmels willen …«, murmelte Franziska und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Tja, und wie es aussieht, bist du jetzt an der Reihe, ihm gut zuzureden. Auf dich wird er wohl hören, oder?«
Franziska Attaman schluckte schwer. Ihr Augenlid zuckte. »Was …« Sie stotterte. »Was wollen Sie? Die Polizei …«
»Die kannst du mal vergessen, die Polizei. Wo versteckt dein Mann seinen Plunder?«
»Ich weiß es nicht. Was wollen Sie von ihm?«
»Es geht um einen Code, Schätzchen. Den Code zu einem Schließfach oder einer Storagebox. Ich weiß es leider nicht genau. Aber ich weiß, dass ich diesen Code will und mit einem Rasiermesser zurückkomme und dir das Gesicht zerschneide, wenn ich ihn nicht erhalte. Und von deiner Tochter wollen wir noch gar nicht reden.«
Franziska Attaman blinzelte erneut. Sie zitterte.
»Weißt du«, sagte die Lady, »ich glaube dir sogar. Mein Django verrät mir auch nicht alles, wirklich nicht. Na, jedenfalls dachte ich, wir unterhalten uns mal von Frau zu Frau.«
Was sie dann taten. Bis Franziska Attaman leise und mit starrem Blick sagte: »Wenn ihr mir oder Shirin etwas antut … Dann wird er kommen. Er wird das nicht durchgehen lassen, glaub mir. Niemals.«
Lady Macmeth lächelte zufrieden und wackelte mit dem Bügel, an dem die Bluse hing. »Die nehme ich. Geht aufs Haus, nehme ich an?«
6.
Shirin lief.
Sie spürte den festen Sand unter den Füßen. Er konnte hart wie Beton werden, wenn das Wasser zurücklief und herausgesogen wurde. Er war weich wie Samt, wenn die Flut es wieder zurückspülte. Die Wellen hatten Muster in den Strand gezeichnet.
Shirin pumpte die frische Luft in die Lungen, die nach Salz und Tang roch, während die Sonne an diesem Morgen noch wie ein Pfirsich am blauen Himmel klebte und das flache Meer in Pastellfarben glitzern ließ. Möwen kreisten über der Langeoog vorgelagerten Sandbank und suchten nach Beute.
Jeden Morgen drehte Shirin ihre Runde am Strand, wenn das Wetter es zuließ. Einen Kilometer in die eine Richtung, einen Kilometer in die andere. Das machte sie fit für den Tag und für den Job im Café. Aus den iPods lieferte Rihanna den passenden Soundtrack. Manchmal suchte sich Shirin eher chillige Musik heraus, je nach Laune.
Jetzt kehrte sie zurück zu den Strandkörben. Neben dem mit der Nummer achtundsechzig hatte sie ihre Sachen abgelegt. Mit jedem Schritt gruben sich ihre Füße in den pudrigen Sand. Zerbrochene Muscheln pikten ihre bloßen Sohlen. Sie machte einen Sprung über den Graben, den Kinder am Vortag rund um den Strandkorb gezogen haben mussten, setzte sich und wischte den Sand von ihren Zehen ab, bevor sie in ihre Turnschuhe schlüpfte und einen großen Schluck Elektrolyte aus der Wasserflasche trank. Sie zog ihren Hoodie über, verstaute dann alles in dem kleinen Rucksack und blickte noch einmal aufs Meer.
Sie wusste, dass es die falsche Himmelsrichtung war, denn sie schaute nach Norden. Falls man dort etwas in ein paar Hundert Kilometern Entfernung entdecken wollte, dann wäre das Skandinavien. Aber sie glaubte kaum, dass Vural sich dort aufhielt. Nein, ihr Vater war woanders. Im Gegensatz zu ihrer Mutter wusste sie nicht, wo. Aber dennoch stellte sie sich vor, er wäre irgendwo dort hinter dem Horizont.
Sie erinnerte sich an den Tag, an dem er gegangen war. An dem er hatte gehen müssen.
»Wir kriegen das schon hin«, hatte er geflüstert und sie auf die Stirn geküsst. Dabei hatte er gezwinkert, weil das eigentlich ihr Spruch war. Dachte er zumindest, dabei stimmte das nicht. Shirin hatte ihn bloß übernommen. Denn ihr Vater hatte das immer gesagt, wenn sie als Kind Schwierigkeiten in der Schule oder sie sich das Knie aufgeschlagen hatte.
Was auch immer es gewesen war: »Wir kriegen das schon hin«, gesprochen in der unerschütterlichen Zuversicht und Selbstsicherheit eines Vaters, der wusste, dass man seine Tochter in Sicherheit wiegen musste – auch wenn er selbst nicht davon überzeugt war, dass tatsächlich alles wieder gut werden würde.
Irgendwann hatten sich die Rollen ins Gegenteil verkehrt, und Shirin hatte seinen Spruch übernommen.
Zum Beispiel, als ihre Mutter ins Krankenhaus musste und als ihr klar wurde, dass ihr Vater bis zum Hals in Problemen steckte. In gewaltigen Problemen, in die er sich selbst hereingeritten hatte, denn er war nun einmal …