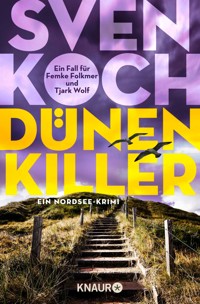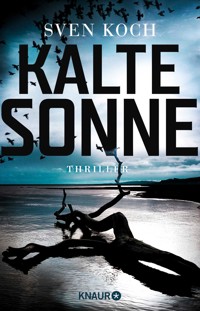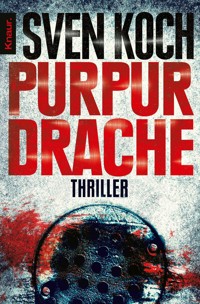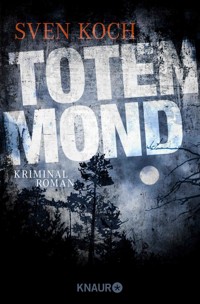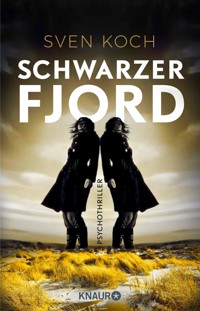
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Opfer oder Mörderin – wer ist Liv? Ein wendungsreicher Psycho-Thriller mit atmosphärischem Dänemark-Setting um das Geheimnis einer Nacht am Ringkøbing-Fjord Was geschah letzte Nacht am Ringkøbing-Fjord? Als Liv nach einem Treppensturz im Krankenhaus erwacht, kann sie sich nur vage erinnern: Sie war seit ein paar Tagen bei Magnus, dem Mann ihrer besten Freundin Vigga – seit Vigga spurlos verschwunden ist. Und sie hat etwas gefunden, das Magnus belastet. Es kam zu einer Auseinandersetzung … Die Polizei, die Liv im Krankenhaus bewacht, hat dagegen sehr klare Vorstellungen davon, was geschehen ist: Liv wollte den Platz ihrer Freundin einnehmen – warum sonst trägt sie Viggas Kleidung und gleicht ihr fast aufs Haar? Liv muss Licht ins Dunkel jener Nacht bringen, um ihre Unschuld zu beweisen – oder klebt tatsächlich Blut an ihren Händen? Der zweite Dänemark-Thriller nach »Kalte Sonne« von Sven Koch ist ein trickreiches Psycho-Spiel um Wahrheit und Identität für Fans von Skandinavien- und Domestic-Noir-Thrillern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sven Koch
Schwarzer Fjord
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was geschah letzte Nacht am Ringkøbing-Fjord? Als Liv nach einem Treppensturz im Krankenhaus erwacht, kann sie sich nur vage erinnern: Sie war seit ein paar Tagen bei Magnus, dem Mann ihrer besten Freundin Vigga – seit Vigga spurlos verschwunden ist. Und sie hat etwas gefunden, das Magnus belastet.
Es kam zu einer Auseinandersetzung …
Die Polizei, die Liv im Krankenhaus bewacht, hat dagegen sehr klare Vorstellungen davon, was geschehen ist: Liv wollte den Platz ihrer Freundin einnehmen – warum sonst trägt sie Viggas Kleidung und gleicht ihr fast aufs Haar?
Liv muss Licht ins Dunkel jener Nacht bringen, um ihre Unschuld zu beweisen – oder klebt tatsächlich Blut an ihren Händen?
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
1.
Mein Mörder hat kein Glück gehabt.
Ich lebe noch.
Ich atme tief ein und aus. Die Luft ist abgestanden und warm. Es riecht nach Menschen und Krankenhaus. Aber es ist Luft. Sie füllt meine Lungen aus. Ich kann atmen – und was das bedeutet, versteht man erst, wenn einem die Luft zum Atmen genommen wurde.
Mein Kopf schmerzt trotz der Medikamente, aber es ist auszuhalten. Ich komme klar. Es ist mehr ein dumpfes Dröhnen, eher ein Hintergrundrauschen als ein präsentes Pochen und Hämmern. Gemessen an dem, was mir widerfahren ist, sollte ich mich nicht darüber beschweren. Immerhin habe ich noch einen Kopf.
Trotzdem will ich im Moment nicht wissen, wie ich im Gesicht aussehe. Ich brauche bloß Arme und Beine anzuschauen. Die Kratzer und die Blutergüsse sind noch frisch und werden erst in den nächsten Tagen ihre volle Farbenpracht entfalten. Folglich kann ich mir den Rest denken und erspare mir den Anblick. Zum Glück ist der Spiegel ein paar Meter von meinem Bett entfernt. Ich werde bestimmt nicht aufstehen und mich inspizieren. Ich werde auch nicht hinschauen, falls ich auf dem Weg zur Toilette daran vorbeigehen muss.
Eigentlich will ich sowieso nicht aufstehen. Mir reicht es völlig aus, einfach hier zu liegen in diesen frischen, weißen Laken, an die ebenfalls weißen Wände zu starren und das Leben zu spüren. Denn ich bin noch da, obwohl ich hätte tot sein sollen, und ich erlebe die Welt mit allen Details intensiver als zuvor. Zumindest kommt es mir so vor. Vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Zustand und eine normale Reaktion, wenn man schon an der Schwelle zum Tod gestanden hat wie ich. Eine Art Hypersensibilität, die man mitbringt, wenn man mit einem Fuß auf der anderen Seite war. Vielleicht verschwindet sie wieder wie Flecken auf der Netzhaut, die man bekommt, wenn man zu lange ins Licht geschaut hat.
In diesem Augenblick zum Beispiel kann ich das Webmuster der Fäden erkennen, aus denen der Kopfkissenbezug hergestellt worden ist. Ich empfinde ein tiefes Glück über diese Banalität und darüber, dass es möglich ist, so etwas Feines überhaupt herzustellen. Ich stelle mir die vielen Menschen vor, die an dem Prozess beteiligt gewesen sind, meinen Kopfkissenbezug zu produzieren, und frage mich, in welchen Teilen der Welt sie leben und wie sie leben, unter welchen Umständen sie in den Fabriken arbeiten. Kurz freue ich mich darüber, dass dank diesem Kopfkissenbezug ihre Familien ein Essen auf dem Tisch haben – selbst wenn man sie in den Fabriken dafür ausbeutet. Bei dem Gedanken daran finde ich es jedoch plötzlich entsetzlich, auf solchen Laken zu liegen, und ich überlege, wie gut es mir doch eigentlich geht. Trotz allem Schrecklichen, das mir widerfahren ist.
Ich drehe mich zur Seite und stoße einen angestrengten Laut durch die Nase aus, weil sich die Platzwunde an meinem Schädel meldet. Sie ist mit mehreren Stichen genäht worden. Aber nicht nur die schmerzen. Alles schmerzt. Hinter dem dicken Vorhang aus Ibuprofen, Novalgin und was weiß ich was fühlt es sich an, als hätte ich einen Triathlon absolviert, weswegen ich mich so wenig wie möglich bewege.
Aber ich sehe es positiv. Der Schmerz ist ein Anzeichen dafür, dass es mich noch gibt. Ich kann fühlen. Schmerz ist Leben. Leben ist Schmerz. Für einen Moment schließe ich die Augen und lausche den leisen Geräuschen, die vom Klinikflur in mein Einzelzimmer dringen. Murmelnde Stimmen. Schritte. Das Klappern von Metall.
Ich öffne die Augen wieder und betrachte das Spiel der Sonne in dem mit einer klaren Flüssigkeit gefüllten Plastikbeutel. Er hängt an einer Art Stativ und ist über einen feinen Schlauch direkt mit meinem Handgelenk verbunden. Das Licht bricht sich in dem Material wie in einem Kaleidoskop. Es sieht wunderschön aus. Durch den Kunststoff betrachtet, wirken der blaue Frühlingshimmel und die daraufgetupften Wolken milchig. Wie durch einen Weichzeichner, der die Welt romantischer erscheinen lässt, als sie ist. Weniger hart. Die Glocke einer Kirchturmuhr schlägt. Es ist elf Uhr. Elf Uhr morgens drei Tage danach. Und ich bin noch da.
Ich.
Bin.
Noch.
Da.
2.
Liv? Geht es Ihnen gut?«
Ich drehe den Kopf und sehe Knud Nissen und Tine Kjær an. Sie sind von der für Mittel- und Westjütland zuständigen Kriminalpolizei aus Holstebro und damit verantwortlich für den Bezirk Ringkøbing-Skjern. Sie tragen ihre Dienstausweise an Kordeln um den Hals und sitzen vor mir auf Besucherstühlen, die ziemlich ungemütlich aussehen. Hinter ihnen steht ein schlichter weißer Tisch, der vollkommen leer ist.
Knud Nissen schätze ich auf Mitte fünfzig. Sein Haar ist licht und müsste wieder mal geschnitten werden. Sein Pullover hat eine undefinierbare Farbe zwischen Braun und Oliv. Wenn er lächelt, was eher selten passiert, stechen seine von geplatzten Äderchen geröteten Wangen hervor wie bei einer Kasperlefigur. Er wirkt auf den ersten Blick sympathisch, aber ich mag ihn nicht. Er hat etwas an sich, das ich verabscheue. Sein Blick, seine Art – ich kann es nicht festmachen, aber sobald ich ihn ansehe, fühle ich mich unwohl. Außerdem habe ich das Gefühl, dass er mich ebenfalls nicht mag. Er klickt mit seinem Kugelschreiber, wenn er nachdenkt, oder tippt mit ihm auf den Spiralblock, der auf seinem Schoß liegt. Ich bin mir sicher, dass das Geräusch manche Leute zum Ausrasten bringen kann. Vielleicht macht er es genau deswegen. Vielleicht ist es auch nur eine nervöse Angewohnheit.
Ich zum Beispiel wippe oft mit dem Fuß, was mir selbst kaum auffällt. Frederik, mein Ex-Freund, hat mich einmal grinsend gefragt, ob ich an einem Restless-Leg-Syndrom leide. Ich fand die Bemerkung überhaupt nicht witzig, weil ich das Gefühl hatte, dass er noch etwas hinzufügen wollte, sich aber nicht getraut hat, nämlich, dass das eine Nebenwirkung der Pillen sein könnte, die ich gelegentlich nehme. Das ist aber Blödsinn. Ich habe das schon als Kind getan. Das mit den Beinen. Die Pillen kamen erst später.
Tine Kjær dürfte mindestens zehn Jahre jünger sein als ihr Kollege und an die dreißig Kilo leichter. Sie trägt einen engen schwarzen Rolli, bestimmt Kaschmir, unter dem sich eine gertenschlanke Figur abzeichnet. Ich sehe ein paar lose blonde Haare auf der Wolle. Tine streicht sich häufig eine widerspenstige Strähne hinters Ohr, die einfach nicht hinter dem Brillenbügel stecken bleiben will. Sie trägt ein schwarzes, eckiges Kunststoffmodell, das ihre kühlen, wasserblauen Augen regelrecht einrahmt.
Tine hat ebenfalls einen Schreibblock sowie ein Aufnahmegerät. Ich vermute, es ist ein digitales. Sie hat mich vorher gefragt, ob es okay sei, wenn sie die Unterhaltung aufnimmt, und außerdem verdeutlicht, dass es sich bei dem Gespräch nur um eine Zeugenbefragung handele und um keine offizielle Vernehmung, zu der man mich vorladen müsse und zu der ich auch einen Anwalt mitbringen könne. Aber ich bin ja im Krankenhaus, von daher könnte ich ja von der Polizei gerade sowieso nicht vorgeladen werden, und Tine und Knud wollen nach ihren eigenen Worten erst mal nur verstehen, was in den vergangenen Tagen genau geschehen ist, weil es ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen könnte.
»Liv«, sagt Tine, »wir müssen jetzt Ihre Personalien aufnehmen.«
»Natürlich«, antworte ich, obwohl ich meine, dass die beiden schon alles über mich wissen müssten. Wir haben uns schließlich vorher schon unterhalten, bloß ohne Aufnahmegerät. »Noch mal?«, frage ich daher.
»Ja, noch mal«, bestätigt Tine.
Und dann frage ich: »Wo bin ich eigentlich genau?«
Knud Nissen hört auf, mit dem Kugelschreiber zu klicken, und sieht mich ausdruckslos an.
»Im Krankenhaus, Liv. Ist Ihnen das nicht klar?«, fragt Tine. Sie macht eine Pause und fragt dann: »Geht es Ihnen wirklich gut? Sollen wir jemanden kommen lassen?«
»Ja«, höre ich mich erwidern. »Nein. Ich meine: Nein, es muss niemand kommen. Und: Ja, es geht mir gut, und ich weiß, dass ich im Krankenhaus bin, logisch, aber …«
»Sie sind in der Klinik in Holstebro«, kürzt Knud Nissen ab. »Dorthin wurden Sie vor drei Tagen gebracht. Sie waren ohne Bewusstsein. Erst hier sind Sie wieder zu sich gekommen, waren bis zum Aufwachen auf der Intensivstation.«
Ich nicke schwach. Ja, natürlich erinnere ich mich. Also: teilweise. An einiges sehr klar. An anderes überhaupt nicht. Mein Schädel brummt. Aber ich weiß, dass ich mich jetzt zusammenreißen sollte und mich konzentrieren muss, was mir alles andere als leichtfällt.
»Wir möchten das noch einmal aufnehmen, Liv«, wiederholt Tine und sagt laut auf, was sie sich bereits notiert hat und was wir schon durchgekaut haben. »Liv Solberg, selbstständige Architektin, geboren am 18. Februar 1978 in Helsingør, wohnhaft in Kopenhagen in der Johan Semps Gade 11 – das ist in Christianshavn, sagten Sie?«
»Ja.«
Und dann kommt alles Weitere. Nicht verheiratet, keine Kinder, in keiner festen Beziehung lebend, meine Haare sind aschblond und lang, aber nicht zu lang. Meine Augen sind grüngrau. Ich wiege knapp sechzig Kilogramm, bin eins sechsundsiebzig groß …
Und wenn Tine noch weiterfragen würde, könnte ich antworten, dass ich sportlich bin, jeden Morgen jogge und gelegentlich Fitness mache, aber nicht Mitglied in einem Klub bin, sondern auf Zehnerkarten vertraue, und trotzdem gelegentlich mal eine Zigarette oder eine ganze Packung rauche. Dass ich meine BHs in 75B kaufe, meine Schuhe in Größe 38 und für mein Leben gern italienisch essen gehe, was ich mir allerdings nicht immer leisten kann, weil meine Aufträge überschaubar und nicht so irre gut bezahlt sind und mich, seitdem ich mit Frederik Schluss gemacht habe, selten jemand einlädt – wobei ich keine Ahnung habe, warum ich überhaupt noch Single bin, denn eigentlich finde ich mich ganz hübsch und erträglich.
Ich bin einigermaßen gebildet, spreche fließend Englisch, kleide mich modisch und bin ganz umgänglich sowie selten zickig – nehme ich jedenfalls an. Ich mag frische Blumen, Andalusien im Sommer, barfuß am Strand zu laufen und im Winter am knisternden Kamin Bücher zu lesen und dabei zuzusehen, wie es schneit und Kopenhagen sich in eine weiße Decke mummelt.
Und ich leide an Höhenangst.
Akrophobie nennt man das. Schon ein paar Meter können ausreichen, um mich in Panik zu versetzen. Also: nicht immer. Wie stark es ist, hat mit den allgemeinen Umständen und meiner Verfassung und Stimmung zu tun. Es gibt Tage, an denen komme ich gut klar. Es gibt andere Tage, an denen wird mir schon schwindelig, wenn ich die Treppe hinabgehe. Es fühlt sich an, als würde mich die Tiefe ansaugen und mich eine unsichtbare Kraft dazu zwingen wollen, in einen Abgrund zu springen. Ich bekomme Beklemmungen, Herzrasen, Schwindel, Atemnot. Im Englischen und Französischen gibt es jeweils einen Terminus dafür, der das Gefühl viel besser trifft als das deutsche »Höhenangst«. Es heißt »call of the void« oder »l’appel du vide«, was so viel wie Lockruf der Tiefe bedeutet. Tatsächlich scheint irgendetwas Dunkles dort im Abgrund zu lauern und zu flüstern: »Na komm, spring. Wie es sich wohl anfühlt? Probier es aus. Mach schon. Komm zu mir.«
In der Therapie habe ich gelernt, dass meine Höhenangst nichts mit Selbstmordgedanken zu tun hat, sondern mit Zwangsgedanken, Kontrollverlust und Angst vor dem sprichwörtlichen Sich-fallen-Lassen. Flugangst habe ich merkwürdigerweise nicht. In meinem Beruf ist das manchmal natürlich schwierig. Man muss auf Gerüste klettern und all solche Dinge, aber ich habe einige Vermeidungsstrategien entwickelt, um mich aus der Affäre zu ziehen. Ich behaupte dann, dass ich mir den Knöchel verknackst habe, oder ich erkläre, dass ich gerade noch etwas besprechen oder telefonieren muss. Inzwischen bin ich darin ziemlich überzeugend.
Höhenangst ist angeboren oder durch ein traumatisches Ereignis erlernt. Und so viel ist mal klar: Meine ist nicht angeboren. Aber sie ist nach meiner Meinung auch nicht erlernt. Ich habe als Kind etwas Entsetzliches erlebt, und ich finde daher, dass sie mir aufgezwungen wurde. Außerdem hat das nichts damit zu tun, dass ich getötet werden sollte. Überhaupt nicht.
Tine und Knud haben mir vorhin ein paar Haare abgeschnitten, womit ich einverstanden war, sowie wegen der DNA eine Speichelprobe gezogen. Mit einem mobilen Scanner haben sie mir außerdem die Fingerabdrücke abgenommen und sie irgendwohin gesendet. Tine hat mir erklärt, dies alles müsse sein, um meine Spuren von allen anderen unterscheiden zu können. Meine Daten würden in jedem Fall wieder gelöscht, wenn man sie nicht mehr brauche. Von mir aus können sie auch gerne noch meine Zehen- und Zahnabdrücke haben und eine Urinprobe obendrauf. Tine will ihre Arbeit so gut wie möglich machen, Knud ebenfalls, und das liegt absolut in meinem sehr persönlichen Interesse. Immerhin bin ich beinahe ermordet worden.
»Wie ist es genau dazu gekommen?«, fragt Knud jetzt.
Ich blinzle, verstehe nicht, worauf er hinauswill. Also antworte ich mit Gegenfragen: »Aber … Das wissen Sie doch? Sie waren doch außerdem vor Ort?«
»Waren wir?« Knud sieht mich mit einer Miene an, die alles und nichts bedeuten kann. Jetzt klickt er wieder mit dem Kugelschreiber.
»Ja? Oder etwa nicht? Keine Ahnung, aber ich habe es so verstanden. Ich meine: Ich habe das alles nicht mitbekommen, ich kam ja erst hier wieder zu mir, und … ehrlich gesagt, verstehe ich Ihre Frage nicht. Wir haben eben doch schon darüber gesprochen … Und was vorher alles passiert ist, das wissen Sie doch auch?«
Knud nickt. Er tippt mit dem Kuli auf eine dicke, rote Akte. Sie ist mit einem Namen beschriftet, den ich gut lesen kann, obwohl die Buchstaben auf dem Kopf stehen, weil ich ihn so gut kenne. Mein Name.
»Es wäre schön, wenn wir alles noch einmal rekapitulieren könnten. Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen«, sagt Knud, klickt erneut mit seinem Kugelschreiber und nickt in Richtung des Aufnahmegerätes.
Langsam, aber sicher regt der Kerl mich auf.
Ich schaue zu Tine. Sie rutscht näher mit ihrem Stuhl zu mir, räuspert sich und sagt: »Liv, wissen Sie: Für uns ist jedes Detail wichtig. Manchmal vergisst man etwas. Manchmal fällt einem etwas wieder ein, wenn man es ein zweites Mal erzählt. Es sind sehr schlimme Dinge passiert, die müssen wir lückenlos aufklären. Außerdem haben Sie eine Gehirnerschütterung, sicherlich auch einen Schock erlitten und daher manches auf Anhieb nicht mehr so präsent. Deswegen fragen wir erneut nach, und wenn man erst einmal ins Erzählen kommt, fügen sich auf einmal Dinge zusammen, die vorher keinen Sinn ergaben, aber jetzt – nach allem, was geschehen ist – durchaus für Sie und für uns Sinn ergeben können.«
»Das gilt für den Abend selbst. Das gilt auch für die Zeit davor«, ergänzt Knud.
Tine nickt. »Wir müssen den Abend genau rekonstruieren. Und wir müssen verstehen, wie es aus Ihrer Sicht dazu gekommen ist.«
Sicher, das ist mir klar. Fraglos müssen sie alles akribisch aufarbeiten, denn natürlich wird das später in einer Gerichtsverhandlung gegen das Schwein, das mich umbringen wollte, wichtig sein.
Ich frage: »Was sagt er denn dazu?«
Tine und Knud wechseln einen Blick. »Wie meinen Sie das?«, fragt Tine.
»Wie er es darstellt, will ich wissen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er sich herausredet, um Ihnen alles zu erklären.«
»Wir sind hier«, sagt Knud, »weil wir es von Ihnen hören wollen. Alles andere ist im Moment nicht relevant.«
»Für mich schon. Er wollte mich umbringen. Ist Ihnen klar, wie man sich da fühlt?«
Knud schweigt, also rede ich weiter. »Ich habe überlebt, und ich bin verdammt glücklich darüber. Ich will, dass der Mistkerl für immer in den Knast wandert.«
Tine und Knud sagen nichts.
Mir wird eiskalt. Ich habe die schreckliche Ahnung, dass sie ihn nicht verhaftet haben könnten. Der Gedanke war mir bislang noch gar nicht gekommen. Der Gedanke, dass er draußen herumläuft und ich nach wie vor in großer Gefahr schwebe und er es vollenden will.
Er, mein Mörder.
Aber vielleicht weiß er nicht, dass ich überlebt habe. Er hat möglicherweise an dem Abend am Fjord angenommen, dass er erfolgreich war und ich tot bin, und ist dann geflohen. Oder er wollte mich zum Sterben zurücklassen, zum Verrecken.
Tatsächlich bin ich ja erst im Krankenwagen gestorben, hat man mir erzählt. Das Herz setzte aus. Sie haben mich zurückgeholt, aber für einige Sekunden war ich definitiv tot. Wäre der Krankenwagen fünf Minuten später gekommen, dann wohl für immer. Es ist sehr erschreckend, das zu wissen.
Ich frage leise: »Er … Er sitzt doch im Gefängnis? Sie haben ihn doch verhaftet? Ist er auf der Flucht?«
Knud und Tine werfen sich wieder einen Blick zu.
»Wir dürfen im Moment nicht darüber sprechen«, sagt Knud.
»Wie bitte?«, frage ich.
Tine beugt sich etwas zu mir. »Es ist ein schwebendes Verfahren, und Sie sind die Hauptzeugin. Wir dürfen Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Details über bestimmte Umstände geben. Das ist gewiss schwer zu verstehen, aber es hat rechtliche und formelle sowie ermittlungstaktische Gründe. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass Sie keine Angst vor ihm haben müssen.«
»Wirklich nicht?«
»Nein.«
»Ich brauche …«
»Es kann Ihnen nichts passieren. Wir haben außerdem eine Beamtin vor der Tür Ihres Zimmers postiert.« Tine wechselt erneut einen Blick mit Knud, der stumm bleibt und sich einige Notizen macht. Dann sagt sie: »Liv, Sie müssen uns jetzt bitte noch einmal alles ganz genau erzählen.«
»Alles?«
»Ja, alles.«
»Sie meinen: Nur über den Abend – soll ich das wiederholen? Oder von Anfang an?«
»Von Anfang an.«
Ich atme tief durch und schließe die Augen. Ich hab gehofft, der Albtraum sei ein für alle Mal vorüber. Aber so einfach ist es wohl nicht.
Ich höre Tines Stimme: »Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, brechen wir ab oder machen eine Pause, Liv. Wir können auch jederzeit eine Schwester oder einen Arzt rufen und uns später weiter unterhalten. Aber wir müssen in dieser Sache vorankommen.«
»Es geht schon«, sage ich leise. »Es geht schon.«
Ich öffne die Augen wieder und betrachte die Farbmuster in dem Infusionsbeutel. »Es ist etwa drei Wochen her«, beginne ich. »Ich erinnere mich noch gut an die Fahrt zum Fjord …«
3.
Ich war ziemlich schnell unterwegs, deutlich schneller als erlaubt, und war die ganze Zeit über in Gedanken versunken. Dann wollte ich unbedingt eine rauchen. Ich rauche nicht im Auto, deswegen fuhr ich in eine Haltebucht an der Straße, die mich von der Autobahn aus in Richtung Ringkøbing geführt hatte, und stieg aus. Ich blickte auf den Fjord – wobei man bei dem Begriff »Fjord« für gewöhnlich an die tiefen Schluchten im Norden Skandinaviens denkt, die das Gletscherwasser nach der Eiszeit in die Felsen gefressen hat. Am Ringkøbing-Fjord ist hingegen alles flach und der Fjord selbst eher ein Binnengewässer, lediglich durch eine schmale Nehrung von der Nordsee getrennt. Ich meine mich zu erinnern, dass der Fjord sowohl mit Salzwasser als auch mit Süßwasser von Flüssen wie dem Skjern gespeist wird, was seine Flora und Fauna recht besonders macht.
Jedenfalls gibt es überall kleine Fischerhütten und bunte Holzboote, die kieloben am Ufer liegen, denn der Fjord ist ein Paradies für Hobbyangler und Surfer. Wenn er zugefroren ist, kann man auf ihm sogar Schlittschuh laufen oder Eishockey spielen.
Ich atmete tief durch und konnte das Meer riechen, bevor ich mir eine ansteckte, tief inhalierte und den Rauch in die Luft blies. Der kalte Wind von der Küste strich durch das hohe Riedgras an den Ufern und zerrte an meinen Haaren. Die untergehende Sonne tauchte das Land und die riesige Wasserfläche in Pastellfarben. Ich lehnte mich an den Kotflügel, stützte mich auf der noch warmen Motorhaube ab und sog die Leere in mich ein. Um mich herum gab es nur flache Landschaft. Die einzigen Zeichen von Zivilisation waren die Straße, die Boote und eine einzelne Fischerhütte, die einige Hundert Meter entfernt direkt am Ufer lag und aussah wie ein kleines Hexenhäuschen – aus fast schwarzem Holz gebaut und mit einem einzelnen, strahlend weißen Fensterkreuz versehen. In seiner Nähe waren Bündel von Riedgras gestapelt, mit denen später einmal die Dächer von Reethäusern eingedeckt werden würden. Ich erinnerte mich an meine Kindheit, sah mich selbst mit langen Zöpfen und meiner besten Freundin mit Blumen im Haar um eine sehr ähnliche Hütte herumhüpfen.
Im nächsten Moment zog ein Vogelschwarm darüber hinweg. Vom Himmel her gellte das Zwitschern und Krächzen der Stare aus Tausenden von Vogelkehlen. Jetzt im Frühjahr rasteten hier ebenso wie im Herbst unzählige Exemplare. Irgendwo hatte ich gelesen, dass Stare in der Mythologie als Botschafter aus der Gegenwelt gelten. Ich glaube eigentlich nicht an solche Dinge, habe mit Esoterik oder ähnlichen Dingen absolut nichts am Hut; dazu bin ich viel zu rational. Ich glaube an alles, was messbar ist, was man wiegen, analysieren, berechnen und kategorisieren kann. Doch an diesem Tag zu dieser Stunde und in dieser Situation kamen mir die Stare vor wie die unheimlichen Überbringer einer Todesnachricht. Ich vermute, dass sich meine Ängste und unbewussten Gedanken in einer solchen Vorahnung manifestierten.
Jedenfalls lief mir ein Schauder den Rücken hinab. Mir wurde eiskalt, mein Herz verkrampfte sich in einer Panikattacke. Zwar war der Moment bald vorbei, doch sein Echo dauerte an.
Ich zog an der Zigarette und pumpte Nikotin in die Lungen. Mit jedem Zug ging es mir besser. Ich starrte auf meine Schuhspitzen, blickte wieder zum Himmel. Der Vogelschwarm war verschwunden. Ich steckte mir eine zweite Zigarette an, um mich noch etwas zu sammeln, damit ich auf der Fahrt zur Küste nicht noch einen Unfall baute. Es war nicht mehr weit bis zum Haus meiner besten Freundin Vigga.
Vigga war spurlos verschwunden.
Deswegen war ich hier.
4.
Die ersten Mails von Magnus waren einige Tage zuvor bei mir angekommen. Ob ich etwas von Vigga gehört oder eine Ahnung habe, wo sie stecken könnte. Ob sie vielleicht bei mir sei oder sich gemeldet habe. Natürlich war nichts davon der Fall gewesen.
Magnus’ Fragen hatten mich irritiert, denn woher sollte ausgerechnet ich etwas über seine Ehefrau wissen? Der Kontakt zwischen Vigga und mir war in der letzten Zeit nicht mehr sonderlich intensiv gewesen. Ich ging davon aus, dass Magnus das mit der Funkstille wusste. Es war nichts allzu Schlimmes zwischen Vigga und mir vorgefallen, und es beunruhigte mich auch nicht, dass unser Verhältnis zurzeit eher im Winterschlaf lag. Das war eben manchmal so, und dafür gab es ein Füllhorn von Gründen – vor allem diese eine Sache. Abgesehen davon hatte mein Umzug nach Kopenhagen die Distanz zwischen uns vergrößert. Vigga hatte Magnus geheiratet, und sie und ich hatten neue Jobs begonnen, die uns jeweils sehr in Anspruch nahmen. Unter dem Strich hatten wir uns also immer weniger gesehen und immer seltener miteinander geredet und einander geschrieben. Trotzdem bedauerte ich es, wenn ich darüber nachdachte, dass der Kontakt abbrach, weil wir uns nie ausgesprochen hatten.
Dabei ist es keineswegs so, dass ich keine anderen sozialen Beziehungen pflegen würde. Ich habe meine Freunde, gute Kollegen, und ich komme auch mit meinem Ex Frederik und seinem Vorgänger immer noch prima aus. Aber das ist etwas anderes. Vigga und ich sind durch dick und dünn gegangen, und, ehrlich gesagt: Ich vermisste das. Ich vermisste jemanden, der mich intuitiv verstand und dem ich alles anvertrauen konnte, weil er mich mein Leben lang noch nicht ernsthaft enttäuscht hatte. So wie Vigga.
Vigga und ich waren schon im Alter von fünf Jahren Freundinnen gewesen. Ich sehe uns noch, wie wir uns auf dem Hof der alten Dorfschule zum ersten Mal trafen – ich total verschüchtert, weil ich niemanden kannte. Vigga nahm mich bei der Hand, sagte, dass ich neben ihr sitzen solle, und fragte nach meinem Namen.
Schon nachmittags spielten wir an der alten Fischerhütte Prinzessinnen im Schloss. Als Kinder sind wir sogar oft für Schwestern gehalten worden, für Zwillinge, weil wir uns so ähnlich sahen. Die Haarfarbe natürlich nicht, ihre sind schwarz, und vom Wesen her unterschieden wir uns auch sehr. Aber rein optisch schon, die Gesichtszüge, die Körpergröße. Manchmal hatten wir uns einen Spaß daraus gemacht und sogar die gleichen Sachen angezogen. Und vielleicht war Vigga tatsächlich die Schwester, die ich nie hatte, und ich war dasselbe für sie. Tja, am Ende ist man immer klüger und merkt, dass einem wichtige Abschnitte im Leben wie Sand durch die Finger geglitten sind, ohne dass man es bewusst bemerkt hätte, dachte ich später.
Bei ihrem letzten Besuch in Kopenhagen war gerade eine meiner Beziehungen vor die Wand gefahren, und es ging mir überhaupt nicht gut. Außerdem bekam ich Torschlusspanik und alles – mit Mitte dreißig plötzlich wieder Single, die biologische Uhr tickte unüberhörbar, wie das eben manchmal so ist. Alles bricht über einem zusammen. Man sieht keinen Ausweg mehr. Und schließlich geht es dann doch irgendwie weiter, weil es ja immer irgendwie weitergeht. Etwas später im selben Jahr trafen wir uns dann noch einmal, aber nur auf ein Abendessen, als ich ihr Frederik vorstellte – meine neue Beziehung. Und, na ja, danach … Ich weiß nicht, wahrscheinlich lag es nur an mir, dass ich ihr anschließend etwas übel nahm. Es war ja auch nichts wirklich Schlimmes passiert, gar nicht. Nur zwei, drei Bemerkungen, mehr nicht, aber …
Aber ich schweife ab. Jedenfalls war ich einerseits alarmiert, anderseits auch irritiert, weil es absolut nicht Viggas Art ist, sich nicht abzumelden. Einfach von der Bildfläche verschwinden? Nein, das war nicht Vigga, überhaupt nicht.
Vigga ist ein Kontrollfreak. Das war sie früher in der Schule schon. Sie beschriftete ihre Hefte äußerst akkurat in klaren, kleinen Buchstaben. Ihr Kinderzimmer war im Gegensatz zu meinem stets aufgeräumt, ihre Bücher und Spielsachen ordentlich sortiert. Darum kümmerte sie sich ohne Aufforderung – einfach, weil sie es so am liebsten hatte. An den Wänden hingen gerahmte Spiegel in allen möglichen Größen, in denen sie sich selbst betrachten und überprüfen konnte. Sie führte mit Leidenschaft Listen, zum Beispiel über ihre Bücher und CDs oder Filme, die sie gesehen hatte. Ihre Tage plante sie gerne mittels Fotokopien von Stundenplänen minutiös durch und wich selten davon ab. In späteren Jahren war die Erfindung des Filofax-Kalenders für sie eine der größten Entdeckungen des zwanzigsten Jahrhunderts, bis dieser von digitalen Kalendern und Excel-Listen abgelöst wurde.
Das klingt vielleicht alles ein bisschen neurotisch, autistisch oder streberhaft oder nach so einem Typen wie in der Fernsehserie »Monk«, aber sie war eigentlich ziemlich normal, immer meine beste Freundin und neben ihren Ordnungsmarotten herzlich, liebenswert, betörend witzig sowie absolut verlässlich. Und sie war großzügig und tolerant. Also: nie böse oder eingeschnappt darüber, dass andere Menschen nicht so waren wie sie.
Vigga nahm es einfach hin, dass manche Zimmer, zum Beispiel meines, nicht so aussahen wie ihres. Wenn sie mich zum Spielen besuchen kam, dann stand sie da wie ein Leuchtturm und blickte sich langsam um, aber mit der Art von Blick, die mir kein schlechtes Gefühl vermittelte. Trotzdem wusste ich natürlich, was sie dachte, und dann war mir meine Unordnung etwas peinlich. Aber Vigga hat nie eine Bemerkung über das Chaos gemacht. Nachdem sie es gescannt hatte, stürzte sie sich vor Freude kreischend mitten hinein und machte noch mehr Chaos.
Das war auch so, als wir älter wurden. Also: nicht das mit der Unordnung. Ich meine ihre monkische Marie-Kondo-Art – ja, mit der kann man sie gut vergleichen. Marie Kondo, diese Aufräum- und Ordnungsqueen mit ihrer eigenen Serie auf Netflix, die ihre Slips faltet wie Liebesbriefe und sich beim Haus bedankt, bevor sie es aufräumt, lächelnd jedes Chaos um sich herum ignoriert und den hilflosen Messies mit einem Lächeln einfach sagt, sie sollen lediglich behalten, was sie glücklich macht – und das dann bitte dritteln und hochkant in die Schubladen stellen.
Meine Jugendbude wirkte auf Außenstehende meist, als sei eine Rohrbombe im Kleiderschrank explodiert und habe den Inhalt über den gesamten Raum verstreut, in dem sich außerdem jede Menge leere Kartons, Tüten, Sprudelflaschen, Tassen, Teller und Verpackungen befanden. Im Studium hatte ich ein kleines Zimmer – Vigga und ich hatten kurz überlegt, uns gemeinsam eine Wohnung zu nehmen, kamen dann aber zu dem Schluss, dass das keine gute Idee wäre. Früher oder später wären uns unsere unterschiedlichen Ordnungssysteme um die Ohren geflogen, und wir hätten uns zerstritten. Wir hatten uns also tief in die Augen geschaut, und ich hatte gesagt: »Vielleicht sollten wir den Gedanken doch lieber verwerfen«, und Vigga hatte nur genickt.
In Kopenhagen waren dann zu meinem Klamotten-Chaos noch Berge von Büchern und Papier hinzugekommen, was es nicht besser machte. Und auch das hatte Vigga nie kommentiert – das heißt: Ein einziges Mal hatte sie es getan. Sie stand in meinem Zimmer, sah mich an und sagte: »Ich glaube, du studierst Architektur, weil du eigentlich Ordnung und Struktur liebst und sie wenigstens in deinem Kopf haben willst.« Da war sicherlich etwas dran. Aber Vorwürfe hat sie mir trotzdem nie gemacht.
Ähnlich verhielt sie sich, wenn andere Verabredungen vergaßen oder sich verspäteten. In Viggas Augen konnte das eben passieren. So war die Welt. Sie regte sich darüber nicht auf, sondern nahm lediglich zur Kenntnis, dass andere Menschen nicht so waren wie sie selbst. Vigga verpasste nie eine Verabredung und erschien fast immer auf die Minute genau.
Auch in späteren Jahren war diese außerordentliche Pünktlichkeit typisch für sie. Kam ich zu spät, saß sie einfach da an einem Kaffeetisch, perfekt gekleidet und geschminkt, musterte mich kurz, fuhr sich mit den Fingern durch die rabenschwarzen Haare und spülte jedes schlechte Gewissen mit einem Lächeln hinweg. Wie … Ja, wie eine Königin.
Wenn sie selbst es hingegen mal nicht rechtzeitig in ein Café schaffte, durfte ich zu hundert Prozent damit rechnen, dass sie anrief und mir dann Sachen erklärte wie: »Ich parke gerade erst ein. Es tut mir wirklich leid, aber ich werde vermutlich vier Minuten später da sein.«
Ich meine: Hallo? Vier Minuten? Für mich ist innerhalb des akademischen Viertels jede Verspätung hinnehmbar. Aber für Vigga war es selbstverständlich, Bescheid zu geben. Sie meinte: »Wo ist das Problem? Wozu gibt es Mobiltelefone? Wenn man 19 Uhr sagt, dann meint man doch 19 Uhr und nicht 19.05 Uhr oder 18.55 Uhr? Sonst würde man ja sagen: Ich komme um fünf vor sieben oder um fünf nach sieben. Man gibt kurz Bescheid, und jeder weiß, woran er ist. Ich erwarte das von niemand anderem, aber ich erwarte es von mir selbst.«
Insofern konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass Vigga Magnus nicht hinterlassen würde, wo sie war und wie man sie erreichen konnte. Das war nicht ihr Stil.
Und drittens irritierte mich, dass Magnus’ Mails implizierten, dass irgendetwas mit Vigga los sein musste. Vigga und verschwunden? Wohin denn und warum denn, du meine Güte?
Deswegen machte ich mir Sorgen. Vielleicht war ihr etwas passiert. Aber was sollte das sein? Wahrscheinlicher erschien mir, dass etwas mit Magnus und ihr nicht in Ordnung war – ein Monsterstreit, wenngleich er davon nichts erwähnt hatte. In meinen Augen waren die beiden ein Traumpaar, aber das musste nichts heißen. Und Vigga war seit jeher der Typ, der Kummer mit sich allein ausmachte. Man sah ihn ihr nicht einmal an der Nasenspitze an, wenn man sie nicht so gut kannte wie ich. Von daher wäre es grundsätzlich nicht untypisch, wenn sie keine Freundin anrief, um ihre persönlichen und vielleicht intimen Befindlichkeiten mitzuteilen. Solche Sachen musste man förmlich aus ihr herausquetschen und präzise hinhören.
Also hatte ich auf einen ernsten Streit getippt – und mich erst mal lieber aus der Sache rausgehalten. Aber trotzdem schickte ich Vigga WhatsApps. Es kam keine Antwort. Dann rief ich sie an. Ihr Handy war ausgeschaltet. Nicht einmal die Mailbox war aktiv. Ja, und so wurden meine Bedenken größer.
Schließlich rief mich Magnus an, und das Telefonat beunruhigte mich dann noch sehr viel mehr.
»Ihr Handy ist immer noch ausgeschaltet«, sagte er. »Ich erreiche sie nicht telefonisch, nicht per Mail oder WhatsApp. Ich habe bei allen Bekannten und Verwandten gefragt, wo sie sein könnte, aber niemand weiß es. Sie hat sich bei keinem gemeldet, auch nicht bei ihren Eltern.«
Diese waren vor einigen Jahren nach Kanada ausgewandert.
Magnus sagte: »Sie ist einfach fort.«
»Aber warum? Und wohin?«
»Ich weiß es nicht. Seit drei Tagen ist sie wie vom Erdboden verschluckt.«
»Ist sie spontan verreist? Vielleicht ist sie ja zu ihren Eltern, und …«
»Nein. Ihre Eltern waren beunruhigt, aber ich habe gesagt, dass bestimmt alles okay sei, und gelogen, dass wir uns gestritten hätten. Aber sie kann nicht dort sein. Es fehlt nichts. Alle ihre Sachen sind noch da. Ihr Auto. Ihr Schlüssel. Ihr Ausweis. Der Reisepass. Sie hat keine Tasche gepackt, gar nichts fehlt – bis auf das, was sie morgens anhatte, und ihr Handy und ihre Jacke.«
»Magnus, ist zwischen euch etwas vorgefallen?«
»Nein. Alles war wie immer. Wie ich dir erzählt habe: Wir haben gefrühstückt. Wir haben uns verabschiedet. Ich bin zur Arbeit gefahren. Als ich zurückkam, war sie fort. Keine Nachricht. Nichts.«
»Habt ihr euch gestritten?«
»Nein.«
»Aber das ist überhaupt nicht ihre Art. Vigga ist nicht der Typ …«
»Ich weiß, wie sie ist. Deswegen ja.«
»Irgendeinen Grund muss es doch geben.«
»Ich weiß es nicht«, sagte er leise und mit erstickter Stimme. »Ich weiß es einfach nicht.«
»Magnus – Vigga verschwindet nicht einfach so und taucht ab. Ist wirklich nichts vorgefallen?«
»Nein! Und das macht mich verrückt. Ich stehe kurz vor dem Durchdrehen, Liv. Ich schlafe nicht mehr, ich esse nicht mehr …«
»Hast du die Polizei angerufen?«
»Das werde ich gleich tun.«
Ich wunderte mich etwas, dass er das nicht schon sofort gemacht hatte, also: nach einer Nacht. Ich wäre an seiner Stelle die Wände hochgegangen. Drei Tage schienen mir doch etwas lang zu sein. Nach meiner Meinung sprach sein Abwarten dafür, dass zwischen den beiden doch etwas vorgefallen sein musste. Magnus schien Vigga Zeit geben zu wollen, und wenn man das tut, dann mit einem triftigen Grund. Schließlich war ihm diese Zeit zu lang geworden, und die Hoffnung, dass sie wieder zur Besinnung kommen würde, war der Sorge um sie gewichen. So stellte ich es mir jedenfalls vor.
Ich hörte ihn tief seufzen. Weinte er? Meine Kehle schnürte sich zusammen, und ich spürte, wie mir selbst das Wasser in die Augen schoss. Ich konnte verstehen, wie sich Magnus fühlen musste – ich fühlte all das ja selbst: Verwirrung, Verzweiflung, Machtlosigkeit, Furcht, Selbstvorwürfe, Einsamkeit …
»Hoffentlich ist nichts passiert«, sagte er.
»Was soll denn passiert sein?«
»Ich weiß nicht. Ein Unfall. Keine Ahnung.«
»Kann ich irgendetwas tun? Ist irgendjemand bei dir und für dich da? Soll ich … Soll ich kommen?«
»Ich bin mir nicht sicher, Liv. Es macht dir sicher Umstände und …«
»Es macht keine. Ich kann sofort kommen.«
Magnus seufzte wieder. Er wirkte unentschlossen.
»Ich bin ihre Freundin, Magnus. Vielleicht gibt es irgendetwas, das ich tun kann oder das mir einfällt. Oder auffällt.«
»Okay«, sagte er leise. »Wenn du meinst.«
»Ich komme.«
Also hatte ich rasch ein paar Sachen zusammengepackt und war losgefahren. Und hier war ich nun.
Meine beste Freundin war verschwunden, und ich hatte keine Ahnung, was ich tun könnte – aber ich wollte in jedem Fall da sein. Da sein für Magnus. Da sein für Vigga und Teil dessen, was nach der Vermisstenmeldung folgen würde – was auch immer das sein mochte.
Doch ich hatte fürchterliche Angst, genau wie Magnus. Vorher war es nur unterschwellig gewesen. Aber indem er es laut ausgesprochen hatte, hatte er mich infiziert. Ich hatte schreckliche Angst davor, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte.
5.
Ich blieb noch einige Momente am Fjord stehen, rauchte die zweite Zigarette auf und trat die Kippe aus. Ich warf einen letzten Blick zur Fischerhütte, dachte an früher und sah zwei Prinzessinnen kreischend um ihr Schloss herumlaufen. Dann stieg ich ins Auto und fuhr weiter.
Vigga und Magnus wohnten nicht weit entfernt. Ich bog von der Hauptstraße in einen schmalen Weg ab, der in die weitläufige Dünenlandschaft unweit des Fjords führte. Zunächst war die Straße noch asphaltiert. Dann wurde sie zur Kiespiste und verwandelte sich später wieder in eine feste Oberfläche, die schwarz und neu aussah und wohl bereits zum Grundstück gehörte.
Das Haus war kein gewöhnliches, beileibe nicht. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann stünde in jedem Fall auf der Liste: Ich möchte gern, dass ein Bauherr zu mir kommt und mir freie Hand in der Gestaltung in einer derartigen Lage lässt, und außerdem, dass alle beteiligten Behörden den Bauantrag anstandslos genehmigen. So etwas schien hier passiert zu sein. Der Bau war zeitlos, so elegant wie modern, und orientierte sich eindeutig an Frank Lloyd Wrights klassischen Ideen von der Symbiose aus zeitgenössischer Architektur und Umwelt sowie frühen Bauhaus-Konzepten. Außerdem wirkte er mit seinen strengen, klaren Formen sehr nordisch.
Es gab drei Baukörper. Im Sockelgeschoss befanden sich zwei aus naturbelassenem Beton, die mit einem rundum verglasten Durchgang verbunden waren. Hier war der Treppenaufgang. Quer darübergesetzt war das Obergeschoss – ein weißer Kubus, der sehr filigran wirkte, weil wesentliche Teile der Fronten von oben bis unten verglast waren, damit man Himmel, Landschaft, Fjord und Meer jederzeit sehen konnte, das Haus von der Natur durchdrungen war und es sich durch seine Transparenz außerdem gut in die Umgebung einfügte. Magnus und Vigga hatten ziemliches Glück gehabt, das Haus kaufen zu können.
Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem Vigga mir das Exposé der Immobilie gemailt hatte, um mich nach meiner Einschätzung zu fragen. Mir waren fast die Augen aus dem Kopf gefallen, und ich hatte am Telefon lediglich »Kaufen« gekeucht, »sofort kaufen!«. Der Vorbesitzer war verstorben und hatte das Haus an seine Frau vererbt, die dort aber nicht mehr leben mochte. Der Kredit, den sie dafür aufgenommen hatte, war noch nicht vollends getilgt. Also hatte sie sich an die Bank gewandt, für die Vigga arbeitete. Sie hatte der Erbin vorgeschlagen, die laufenden Verträge und Kredite zu übernehmen, und ein paar Dinge geregelt, obwohl es eigentlich nicht ganz sauber war, Privates und Dienstliches miteinander zu verquicken.
Jedenfalls hätte das Haus auf dem freien Markt gewiss weitaus mehr eingebracht, als Magnus und Vigga am Ende dafür bezahlt hatten. Natürlich kostete es dennoch einen Batzen Geld, aber darüber verfügte Magnus dank seinem Software-Unternehmen, in das Vigga zudem ihr betriebswirtschaftliches Know-how einbrachte.
Während ich den auf einen Pfahl gepflockten amerikanischen Briefkasten passierte, musste ich an einen Leuchtturm denken. Es dämmerte, und in den meisten Zimmern war das Licht eingeschaltet. Dank der großen Fensterfronten wirkte es so, als strahle das von Dünen umgebene Gebäude von innen heraus – wie um Vigga den Weg nach Hause zu weisen.
Ihr Wagen war vor der Garage geparkt: ein Cabrio von Saab. Daneben stand der Mercedes-SUV von Magnus. Alles in allem hätte man annehmen sollen, dass hier ein sehr wohlhabendes, sehr stilvolles und sehr glückliches Paar wohnte. Das war ja auch der Fall.
Vielleicht aber auch nicht, dachte ich beim Einparken. Vielleicht war alles nur Fassade, und Glück lässt sich wohl nur in den seltensten Fällen an Oberflächen ablesen.
Magnus musste meinen Wagen gehört haben, oder ihm war das aufblitzende Abblendlicht von draußen aufgefallen. Er stand bereits in der offenen Tür und wartete auf mich. Ich nahm meinen Weekender aus dem Kofferraum, ging zu ihm hin, und wir umarmten uns. Er wirkte verzweifelt, und wir mussten beide erst mal weinen – so lange, bis wir es schrecklich fanden und fast darüber lachen mussten.
»Danke, dass du gekommen bist«, sagte er.
»Gibt es etwas Neues?«
Magnus schüttelte den Kopf, löste die Umarmung und bat mich hinein.
Ich war nicht oft hier gewesen. Man kann es an einer Hand abzählen. Das erste Mal hatte ich das Haus in Augenschein genommen, um Vigga eine Expertise über den Gebäudezustand zu geben und weil sie einige kleine bauliche Änderungen vornehmen wollte, was statische Fragen aufwarf. Dann kam ich noch einmal, um ebendiese Arbeiten zu begutachten. Schließlich zur Einweihungsparty und danach zu Viggas Geburtstag. Mein letzter Besuch musste ungefähr vier Jahre her sein.
Seither hatte sich nicht viel verändert. Die Einrichtung war dieselbe, für meinen Geschmack eine Spur zu modern, aber es passte natürlich zum Stil des Hauses: jede Menge Weiß, viel Schwarz, Bauhaus-Sessel, eine große und antiseptisch wirkende Küche, die in ein Esszimmer mit Eames-Stühlen und ein weitläufiges Wohnzimmer überging. Darauf fiel Licht aus in der Decke eingelassenen LED-Lampen. An den Wänden hingen Drucke von modernen Künstlern, um allem etwas Farbe zu verleihen. Der Boden bestand aus grauem Estrich, auf den Teppiche gelegt waren. Eine Treppe mit verchromten Handläufen führte nach oben zu einer Galerie und den übrigen Räumen – ich hatte den Grundriss noch im Kopf.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, in Viggas Reich einzudringen, ohne dass die Herrscherin da war. Seltsam, ja, aber genau so kam ich mir vor: wie ein Eindringling.
Etwas später saßen Magnus und ich am Tisch, tranken eine Flasche Wein und gingen noch einmal alles durch. Ich machte eine Liste, systematisch angelegt wie ein Bauantrag, und wir hakten ab: wo Vigga sein könnte, wer etwas wissen würde, warum sie vielleicht verschwunden war. Mit dem Ergebnis, dass weder mir noch Magnus etwas dazu einfiel. Magnus hatte bereits alle Personen kontaktiert, die ihm in den Sinn gekommen waren und die etwas über Vigga wissen könnten. Zumindest hatte er das so gesagt.
Ich merkte, dass ich langsam betrunken wurde. Ich hatte kaum etwas gegessen, dann die lange Fahrt, das viele Reden …
»Ich hoffe«, sagte ich, »dass die Polizei etwas herausfinden wird.«
»Das glaube ich eher nicht«, sagte Magnus.
»Warum nicht? Du hast Vigga doch als vermisst gemeldet?«
»Schon, aber die Polizei sieht es nicht als Vermisstenfall an.«
»Wie bitte?«
Magnus schüttelte den Kopf, als könne er es selbst nicht fassen. »Die Polizei hat einige Dinge überprüft und mir gesagt, sie sähen keine Anhaltspunkte dafür, dass Vigga das Opfer einer Straftat geworden sein könnte oder in einen Unfall verwickelt gewesen sein könnte. Auch spräche nichts für Selbstmord. Vigga sei auch nicht gefährdet – also: Sie nimmt keine Medikamente, auf die sie angewiesen ist. Man hat mir erklärt, dass eine erwachsene Frau sehr wohl das Recht hat, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, ohne es jemandem mitzuteilen. Falls es also keine Gefahr für Leib und Leben gibt, wird die Polizei nicht tätig. Und falls sie doch tätig wird, nimmt sie lediglich eine Aufenthaltsermittlung vor. Das heißt: Die Polizei würde zum Beispiel den Aufenthaltsort von Vigga feststellen und sie dann fragen, ob sie damit einverstanden wäre, dass die Polizei den Angehörigen Bescheid sagt. Damit hat es sich dann, falls die gesuchte Person wohlauf ist und keine strafbaren Handlungen begangen hat. Kurz: Wenn Vigga nicht will, dass ich erfahre, wo sie ist, dann werde ich es auch niemals erfahren – zumindest nicht von der Polizei.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. »Du … du meinst, die werden nichts unternehmen?«
»Die Polizei hat ja schon ein bisschen was getan – Krankenhäuser abtelefoniert zum Beispiel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es weit darüber hinausgehen wird. Ich meine: Auf den ersten Blick sieht es schlicht und ergreifend so aus, als ob sie mich einfach verlassen hat.« Magnus zuckte unter seinen eigenen Worten zusammen, als habe ihm jemand in den Magen geboxt. »Und in diesem Fall wird die Polizei kaum etwas unternehmen. Selbst wenn sie Vigga finden würden, dann … Also, sie hätte ja in der Zwischenzeit ein Lebenszeichen von sich geben können. Hat sie aber nicht. Dann wird es ihr wohl auch in Zukunft egal sein.«
Ich fasste nach Magnus’ Hand und drückte sie. »Glaubst du denn, dass sie aus eurem Leben ausbrechen wollte?«
»Nein. Aber … Ich weiß es nicht. Ich muss mich wohl den Fakten stellen. Vielleicht habe ich die Vorzeichen nicht erkannt oder nicht erkennen wollen, und sie ist auf diese Weise gegangen, weil es für sie so am einfachsten war.«
»Möglich«, antwortete ich.
Einerseits konnte ich es mir einfach nicht vorstellen, das war nicht Viggas Stil. Andererseits, wenn es um eine intime, emotionale Krise ging – wer wusste das schon? In meiner Erinnerung hat sie nie eine Konfrontation gescheut, hat sich beispielsweise auch immer mit Lehrern angelegt. Ich war nie so mutig wie sie gewesen. Doch wenn es um ihre persönlichen Angelegenheiten ging, war sie meist stumm wie ein Fisch. Sie drehte sich einfach um und ging, wenn man mit ihr derlei Probleme diskutieren wollte.
»Aber«, sagte Magnus, »sie müsste es dann ja von langer Hand geplant haben. Sie braucht doch Geld, Klamotten, ein Auto, ein … Meine Güte, ein Flugticket und Ausweise – aber es ist ja noch alles da?«
»Man kann Ersatzdokumente beantragen«, sagte ich. Was ich wusste, weil ich am Flughafen mal meinen Pass vergessen hatte. Dort kann man sich für die Dauer einer Reise einen Ausweis ausstellen lassen, der fast überall innerhalb von Europa gilt.
Magnus zuckte wieder schwach mit den Schultern.
Ich massierte mir die Augen, weil ich vor Müdigkeit und vom Wein schon Doppelbilder sah.