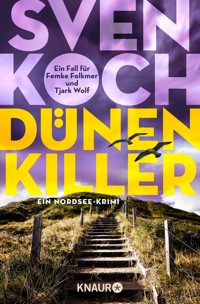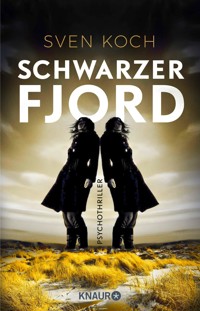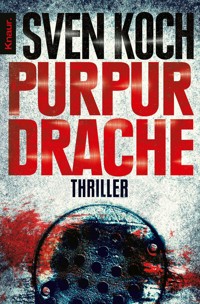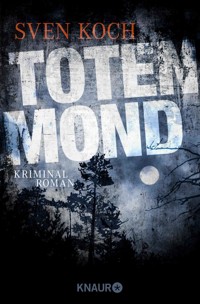9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Femke Folkmer und Tjark Wolf
- Sprache: Deutsch
Drogen-Schmuggel und ein Serienkiller auf Rachefeldzug: »Dünenwahn« ist der 8. Nordsee-Krimi mit Tjark Wolf und dem knallharten Ermittlerteam für Schwerverbrechen in Ostfriesland. Ein heißer Tipp führt die Kommissare Tjark Wolf und Femke Folkmer auf die Spur eines Schiffes vor der ostfriesischen Küste. An Bord soll eine große Ladung Drogen von Amsterdam ins Baltikum geschmuggelt werden. Trotz schweren Seegangs kann Tjarks Team das Schmugglerschiff schließlich stellen, doch ein Teil der Landung fehlt. Wurden die Drogen über Bord geworfen? In Holland setzt Kartellboss Cliff van Doorn alle Hebel in Bewegung, um seine Ware zurückzubekommen – koste es, was es wolle! Währenddessen bricht in Dänemark der Killer, der sich selbst »Sandmann« nennt, nach Deutschland auf. Denn Tjark ist jemandem noch etwas schuldig, und der Sandmann wird dafür sorgen, dass er bezahlt … Der perfekte Urlaubskrimi für alle, die es etwas düsterer und mit handfester Action mögen Die Krimi-Serie von Sven Koch punktet mit viel Ostfriesland-Atmosphäre, actionreichem Thriller-Feeling und einer Prise augenzwinkerndem Humor. Harte Kerle und taffe Frauen bekommen es mit schrägen Typen zu tun, während ihnen eine steife Brise um die Nase weht. RTL+ verfilmt die Dünen-Reihe mit Hendrik Duryn und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen. Die actionreichen Nordsee-Krimis von Sven Koch sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Dünengrab (Grab am Strand) - Dünentod (Tödliche Falle) - Dünenkiller (Tod auf dem Meer) - Dünenfeuer (Falsches Spiel) - Dünenfluch (Die Frau am Strand) - Dünenblut (Schatten der Vergangenheit) - Dünensturm (Tödliche Geheimnisse) - Dünenwahn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sven Koch
Dünenwahn
Ein Nordsee-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein heißer Tipp führt die Kommissare Tjark Wolf und Femke Folkmer auf die Spur eines Schiffes vor der ostfriesischen Küste. An Bord soll eine große Ladung Drogen von Amsterdam ins Baltikum geschmuggelt werden. Trotz schweren Seegangs kann Tjarks Team das Schmugglerschiff schließlich stellen, doch ein Teil der Ladung fehlt. Wurden die Drogen über Bord geworfen? Während in Holland Kartellboss Joris de Jong alle Hebel in Bewegung setzt, seine Ware zurückzubekommen – koste es, was es wolle! –, bricht in Dänemark der Killer, der sich selbst »Sandmann« nennt, nach Deutschland auf. Denn Tjark ist jemandem noch etwas schuldig, und der Sandmann wird dafür sorgen, dass er bezahlt …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Morde entlang der friesischen Küste
Mehr von Bestsellerautor Sven Koch
Dünengrab
Dünentod
Dünenkiller
Dünenfeuer
Dünenfluch
Dünenblut
Dünensturm
1
Niemand, dachte Tjark, würde heute länger als ein paar Minuten überleben können. Keine fünf. Vielleicht nicht einmal drei. Wenn man in diesen Mahlstrom stürzte – gute Nacht. Chancenlos. Erst recht, falls man im Wasser schlagartig in Schockstarre verfiel, und das würde Tjark ohne Frage tun. Er hatte ein Problem mit dem Meer und das Meer mit ihm. Trotzdem trafen sie immer wieder aufeinander. Zum Beispiel hier und jetzt. Und ganz abgesehen davon: Den Aufprall aus rund dreißig Metern Höhe würde man ohnehin nicht überleben. Ein echter Trost war das allerdings nicht.
Tjark blickte nach unten, wo die Nordsee toste wie ein lebendiges Wesen.
Schwer zu sagen, wie hoch die graugrünen Wellen waren. Einige Meter sicherlich. Weit und breit sah er nichts anderes als das. Kein Land, kein gar nichts. Nur das Meer, bereit, ihn zu verschlingen und in die Tiefe zu reißen. Darüber spannte sich trügerisch der strahlend blaue Himmel. Er war wolkenlos, weil der Sturm jede Ansammlung von geballtem weißem Wasserdampf sofort wegblies und zerstäubte wie die Schaumkronen der Monsterwellen, deren Gischt er sogar hier oben spüren konnte, wo er an einem Strick baumelte. Der Lärm war ohrenbetäubend, der Geruch nach Abgasen intensiv, denn noch ein paar Meter weiter oben drehte der Rotor des Airbus EC155-Hubschraubers der Bundespolizei auf vollen Touren.
Tjark blickte auf und sah direkt in das grinsende Gesicht von Ceylan. Sie beide waren wie zu einem Bündel zusammengegurtet. Zwei Maschinenpistolen, die eng an die Körper geschnallt waren, und die Schwimmwesten trennten sie voneinander. Ceylan hatte offensichtlich ihren Spaß. Sie stand auf derlei Action. Tjark wiederum …
Nun.
Es gab Schöneres, als bei Windstärke zehn an der Seilwinde eines Hubschraubers mitten über der Nordsee zu baumeln, um auf einem Schiff abgesetzt zu werden, das von den Wellen hin und her geworfen wurde. Sehr viel Schöneres.
Eigentlich war alles besser als das.
Zudem war das aus Holland kommende Schiff selbst bei einer Länge von hundertfünfzig Metern und siebzehn Metern Breite kein verlässliches Ziel, denn der Mehrzweckfrachter Utrecht schaukelte auf und ab und hin und her. Auch der Hubschrauber wurde von den Sturmböen hin und her geworfen. Tjark und Ceylan an der Seilwinde erst recht, wenngleich sie auf Anweisung des Kollegen an der Steuerung die Arme zu den Seiten ausstreckten, um sich zu stabilisieren. Sie sahen vermutlich aus wie die Jesus-Statue auf dem Corcovado in Rio de Janeiro, dachte Tjark.
Ceylan rief irgendetwas, das wie »Juhu!« in Tjarks Kopfhörern klang, und als sie sich zur Seite drehte, um nach dem Frachter zu spähen, prallten ihre Helme einmal aneinander, woraufhin sie lachte und »Ups! Headbanging!« rief.
Tjark sah den Frachter immer noch nicht. Er musste irgendwo hinter ihm sein, außerhalb des Sichtfelds. Dafür erkannte er jetzt die Jade. Das Boot des Zollkommissariats Küstenwache Nordsee war fast achtundzwanzig Meter lang, wirkte in den Wogen aber wie ein Spielzeug. Die Wellen barsten an ihrem Bug.
Die Jade war in Wilhelmshaven ausgelaufen und kreuzte jetzt den Kurs der Utrecht, die nach Tjarks letzten Informationen auf Anweisung des Zolls die Fahrt gestoppt hatte und die Maschinen nur noch laufen ließ, um sich in den Wellen zu stabilisieren. Wegen des massiven Seegangs hatten sie den Hubschrauber angefordert, um auf die Utrecht zu gelangen – von Schiff zu Schiff war das aktuell nicht möglich. Außer Tjark und Ceylan sollten vier Bundespolizisten aus dem Eurocopter abgeseilt werden, worüber der Kapitän der Utrecht eben informiert worden war. Zwei der Kollegen waren bereits an Bord. Und Tjark hoffte inständig, dass die Mannschaft des Frachters sich in der Zwischenzeit nicht ein paar Schnellfeuergewehre organisiert hatte, um das Schießen auf mobile Ziele zu trainieren.
Andererseits wäre es dann wenigstens schnell vorbei. Schneller, als in der verfluchten Nordsee zu ertrinken oder an der Reling zerschmettert zu werden und sich sämtliche Knochen zu brechen.
Das Herz sackte Tjark in die Hose, als der Hubschrauber an Höhe verlor, nachdem er gerade eben wegen des Windes hatte aufsteigen müssen. Wie in einem Fahrstuhl: auf, ab, ab, auf, Vollspeed.
Endlich sah er das Deck der Utrecht unter sich, auf dem einige Container befestigt waren und außerdem nagelneue Sportboote, die nach Litauen geliefert werden sollten. Jetzt schwebten sie nur noch zehn Meter über dem Schiff. Unten standen die Bundespolizisten, die die Vorhut bildeten, im sogenannten Helotransfer trainiert waren und Tjark und Ceylan in Empfang nehmen sollten. Auch zwei Besatzungsmitglieder waren dort unten zu erkennen, die sich an den Aufbauten festhielten. Schnellfeuergewehre hatten sie zum Glück nicht in der Hand.
Schließlich ruckte die Seilwinde. Tjark und Ceylan sackten nach unten, drehten sich um die eigene Achse, baumelten im Wind.
»Das ist besser als jedes Karussell, oder?« Ceylan grinste wie ein Honigkuchenpferd.
Tjark sparte sich einen Kommentar. Er hatte das Gefühl, sich sofort übergeben zu müssen, sobald er den Mund öffnete.
Dann spürte er einen Griff an den Fersen. Jemand hielt ihn fest. Im nächsten Augenblick hatte er wieder Boden unter den Füßen und atmete auf.
Er wurde losgeschnallt. Karabinerhaken klickten. Er nahm den Helm ab und tauschte ihn gegen Knopfohrhörer mit Mikrofon, Ceylan ebenfalls, deren rabenschwarze Haare zum Zopf zusammengebunden waren. Er wurde vom Wind sofort verweht wie eine dunkle Rauchfackel, während die Seilwinde wieder nach oben gezogen wurde, damit die beiden nächsten Kollegen sich abseilen konnten. Erneut gewann der Heli an Höhe und glitt über die offene See zurück, um sich zu stabilisieren und dann den nächsten Anlauf zu nehmen.
Sie lösten die MPs, zogen die Schwimmwesten aus, legten sie mit den Helmen auf dem Boden ab und hängten sich die Heckler & Kochs an die Schultern.
»Wer hat hier das Sagen?«, rief Ceylan gegen den Lärm an, an die beiden Besatzungsmitglieder gewandt, die sich an der Vertäuung eines der unter Planen verpackten Schnellboote festhielten. Sie trugen signalrote Jacken.
»Ich bin Kapitän Brouwer!«, erwiderte der Größere mit niederländischem Akzent. Er hatte einen dichten Vollbart. »Das ist Bootsmann Kuipers!«, stellte er den Kleineren vor.
»Okay«, rief Ceylan und sah sich um.
Tjark folgte ihrem Blick. Seine Beine fühlten sich an, als bestünden die Gelenke aus Gummi. Er stand breitbeinig auf dem Deck, spürte das Schaukeln.
Ceylan fragte: »Sie haben die Anweisung, die deutschen Gewässer zu verlassen und zurück nach Amsterdam zu fahren, wo Sie vom Zoll und Europol in Empfang genommen werden, das ist bei Ihnen angekommen, ja?!«
»Ja!«, rief der Kapitän. »Deswegen verstehe ich nicht, was dieser Zauber soll!«
»Das lassen Sie mal unsere Sorge sein! Wenn wir fertig sind, fahren Sie retour. Wie viel Mann sind außer Ihnen beiden an Bord?«
»Sechs weitere. Vier feste Crewmitglieder. Zwei zusätzlich angeheuert.«
Und fraglos, dachte Tjark, waren die beiden genau die Burschen, auf die es ankam.
»Wo sind die?«, rief Ceylan.
Der Kapitän zuckte mit den Schultern. »In der Kabine? Ich habe nicht nachgesehen.«
»Namen?«
»Jimmy Dijkstra und Karsten Koning.«
»Wo befindet sich dieser Container?«
Sie zog einen Zettel aus der Jacke, den der Wind ihr beinahe aus den Händen riss, und hielt ihn dem Kapitän hin. Darauf standen Nummern und QR-Codes.
»Hinterdeck! Mittlere Reihe, ganz unten«, rief er.
»Dann mal los!«, erwiderte Ceylan und machte in Richtung von Tjark und den beiden Kollegen eine »Folgt mir«-Geste, während die zwei nächsten Bundespolizisten von oben herabschwebten.
Tjark nickte Ceylan zu und setzte sich in Bewegung. Im Gehen entsicherte er die MP5. Hoffentlich würde er sie nicht benutzen müssen.
2
Autsch, verflucht«, murmelte Femke und klammerte sich an dem Türgriff fest, gegen den sie gerade mit der Hüfte gestoßen war.
Durch die Scheiben im Steuerhaus der Jade konnte sie den Frachter sehen, über dem der Hubschrauber schwebte. Fred neben ihr hielt sich ebenfalls fest. Femke blickte auf den großen Monitor vor dem Kapitän, der die dunkelblaue Uniform der Bundespolizei trug. Die übrige Crew war draußen auf dem Deck und trug Schutzkleidung sowie Schwimmwesten. Einige warteten in Nähe des Beiboots, andere bei Feuerlöschern und der Box mit der Rettungsinsel – alles Routine bei Einsätzen mit Hubschrauberunterstützung, wie Femke und Fred eben erklärt worden war. Denn ein Unglück war nie auszuschließen. Der Heli konnte ins Meer stürzen oder die Personen, die abgeseilt wurden. Dann musste sofort Hilfe zur Stelle sein und gleichzeitig die Jade geschützt und gewährleistet werden, sodass sich die Besatzung im Ernstfall selbst würde retten können.
Femke sah, wie Fred nach vorn ruckte und dabei fast den Kaffee verschluckte, mit dem er ein Lachsbrötchen heruntergespült hatte. Zwei Stück hatte er sich am Hafen gekauft, bevor sie an Bord gegangen waren – weil er meinte, dass sie draußen auf dem Meer vor den Ostfriesischen Inseln ja nichts bekommen würden.
»Wie kannst du das nur runterkriegen«, murmelte Femke, deren Magen zwar robust und nordseeerprobt war, die aber dennoch ein leichtes Unwohlsein verspürte – wie nach einigen Runden im »Breakdancer« auf der Kirmes. Fred schien das gar nichts auszumachen – abgesehen von der Balance.
»Ich habe heute noch nichts gegessen. Das ist alles«, erwiderte er.
Femke streckte die freie Hand aus, um ihm einige Brötchenkrümel vom Sakkoaufschlag zu wischen. Fred trug meistens einen Anzug, weil er sich damit von dem »Gesindel« absetzen wollte, mit »dem ich es im Job zu tun habe, um automatisch eine überlegene Rolle einzunehmen«, wie er oft erklärte.
In der Tat hatte die SOK es oft mit »Gesindel« zu tun, wie Fred es so abschätzig ausdrückte. Die Sonderkommission für Organisierte Kriminalität des LKA Niedersachsen war für die schweren Fälle im Norden des Bundeslands an der Küste und rund um Wilhelmshaven tätig, wo die Gruppe mit Tjark, Fred und Femke unter Ceylans Leitung verortet war.
Zum Beispiel heute.
Aus den Niederlanden hatte es den Hinweis auf einen größeren Drogenschmuggel in die baltischen Staaten gegeben, der über Amsterdam abgewickelt wurde. Eine Ladung Kokain sollte sich in einem Container befinden, in dem in Südamerika hergestellte Sportartikel nach Litauen transportiert wurden. Der Hinweis war eingegangen, nachdem sich der betreffende Frachter Utrecht bereits in deutschen Gewässern befand. Der Zoll hatte sich zum Einschreiten entschlossen, ohne abwarten zu wollen, bis das Schiff über die Ostsee sein Ziel erreichte und in Klaipėdaeinlief, dem größten Hafen Litauens, und von den dortigen Behörden in die Mangel genommen werden würde. Denn auf dem Weg dorthin konnte viel passieren – zum Beispiel ein Motorboot außerhalb der Drei-Meilen-Zone die Drogen in Empfang nehmen und an einer unbestimmten Stelle der viele Hundert Kilometer langen Küste an Land bringen. Und vielleicht waren die Drogen nicht einmal für Empfänger in Litauen gedacht, sondern sollten bereits in Dänemark abgefangen werden.
Folglich hatten die relevanten Behörden dem Zoll grünes Licht gegeben, um den Drogenverdacht zu bestätigen, das Dope zu sichern und das Schiff dann unter Polizeischutz zurück in die Niederlande zu schicken, wo es in Amsterdam nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen werden würde.
Die konzertierte Aktion von Zoll, Küstenwache und Bundespolizei hatte das Interesse des LKA und der SOK geweckt, weil nicht auszuschließen war, dass deutsche Kriminelle involviert waren. Denn dem Vernehmen nach waren ein aus Deutschland stammender Mann und ein Niederländer mit an Bord der Utrecht gegangen, die als Zusatzcrew angeheuert hatten. Dabei, davon konnte man wohl ausgehen, handelte es sich um Begleitpersonal für die Drogenlieferung.
Wenn solcher Aufwand betrieben wurde, sprach das für die Verstrickung einer international operierenden und sehr gut vernetzten Bande sowie für eine große Menge an Drogen. Weiter war davon auszugehen, dass das Schutzteam auf dem Frachter bewaffnet sein würde, was das Risiko des Einsatzes dramatisch erhöhte.
Tjark und Ceylan hatten sofort zugesagt, dass sie mit dem Team der Bundespolizei an Bord gehen würden. Femke und Fred hatten keinerlei Einwände. Allein bei der Vorstellung, von einem Hubschrauber abgeseilt zu werden, hatten sich Femkes Nackenhaare aufgestellt. Mit dem Meer mochte sie keine Probleme haben. Mit einem Hubschrauber bei Windstärke zehn durchaus. Mit Grausen erinnerte sie sich daran, wie sie in dem kleinen Flugzeug im Sturm kürzlich nach Langeoog hatten fliegen müssen.
Ceylan hingegen stand auf solche Aktionen. Fred wiederum war viel zu gemütlich und außerdem deutlich runder gebaut als Tjark. Er hatte lediglich gesagt, dass ihm so ein bescheuertes SM-Geschirr aus Nylongurten sowieso nicht stehen und sein Sakko verknittern würde.
An Bord der Jade hörten sie den Funkverkehr der Einsatzgruppe mit. Demnach waren nun alle auf der Utrecht und Ceylan und Tjark auf dem Weg, um den betreffenden Container zu überprüfen. Femke machte sich Sorgen um Tjark. Sie wusste, dass er ein Problem mit dem Meer hatte. Seine Mutter war vor vielen Jahren ertrunken, wofür er sich verantwortlich fühlte. Seither war seine Beziehung zum Wasser eher traumatisch, und vielleicht hätte er sich besser einen Job in den Alpen suchen sollen als bei der Polizei in Ostfriesland. Stattdessen besaß er eine Wohnung in Oldenburg, pendelte nach Wilhelmshaven und hielt sich immer wieder in einem Ferienhaus an der Küste in Dänemark auf. Von daher war seine Beziehung zum Meer wohl eher von einer Hassliebe geprägt – zudem er eine Tätowierung auf dem Unterarm trug, die einem bekannten japanischen Holzschnitt nachempfunden war und eine alles verschlingende Welle zeigte. Dennoch: Tjark auf einem Schiff inmitten der stürmischen Nordsee und zuvor an einer Seilwinde baumelnd über den Wogen – sie konnte sich gut vorstellen, wie er sich fühlte.
»Wie groß soll noch mal der Drogentransport sein?«, hörte sie Freds Stimme und kurz darauf ein Schlürfen, als er einen weiteren Schluck Kaffee nahm und ihn wie eine Mundspülung gegen die Lachs- und Zwiebelreste zwischen den Zähnen verwendete.
»Haben sie nicht genau beziffert«, erwiderte Femke. »Es soll sich um mehrere Hundert Kilo handeln. Was genau, wissen wir ebenfalls nicht – Kokain, Speed, Crack …«
Fred nickte und ließ die Utrecht nicht aus den Augen, deren Weg die Jade im Abstand von rund zweihundert Metern blockierte. »Ist irgendwie bescheuert, oder?«
»Was genau?«
»Der Zoll sagt denen Bescheid, dass wir kommen, und warnt sie vor. Ich meine: Das ist wie bei einer Razzia, und wir rufen vorher an und fragen, ob es gegen fünfzehn Uhr passen würde.«
Femke erklärte: »Der Kapitän der Jade hat gemeint, dass so nun mal die Vorschriften sind. Außerdem würden sie unser Schiff und den Hubschrauber sowieso sehen. Und wohin sollten sie denn flüchten? Ins Meer springen? Wohl kaum.«
»Auch wieder wahr«, erwiderte Fred und schlürfte weiter an seinem Kaffee. »Trotzdem bescheuert.«
3
Jimmy Dijkstra und Karsten Koning hatten die Hosen gestrichen voll. So haben wir nämlich nicht gewettet, dachte Jimmy und wusste, dass Karsten es genauso sah. Man konnte es von seinen Augen ablesen, die weit aufgerissen waren mit Pupillen vom Durchmesser eines Centstücks. Karsten war ebenso voll mit Speed wie Jimmy, und diese Tatsache trug nicht eben dazu bei, ruhig Blut zu bewahren. Ganz und gar nicht.
Karsten warf einen weiteren der gekennzeichneten Kartons in die tosende See, Jimmy ebenfalls. Einen nach dem anderen zogen sie aus dem Container, schmissen ihn über Bord. Bei dem Seegang wurde jeder sofort abgetrieben.
»Das ist völlig irre«, keuchte Karsten. »Das sind eine Milliarde Kartons!«
Richtig, aber hilft ja nichts, dachte Jimmy und pushte noch eine Pappkiste über die Reling. Sie ackerten wie die Doofen. Wie dieser Sissy wer weiß was, der den Stein den Berg hochrollte, wo er dann wieder runterrollte – oder so in der Art. Mit dem Unterschied, dass der Typ das seit Jahrtausenden so machte und es dabei nicht um seinen Arsch ging. Denn in dem Container steckten eine Milliarde Kartons, in denen insgesamt eine Tonne Koks versteckt war. Das war an sich nicht schlimm, sondern so geplant. Aber eben war ein Polizeischiff aufgekreuzt, was nicht geplant war, nachdem der Kapitän zuvor gesagt hatte, dass der Zoll sich gerade angemeldet habe. Und dann hatten sie auch noch den Polizeihubschrauber am Himmel entdeckt, von dem sich auf einmal Typen abseilten.
Na ja, und die Sache war sehr einfach, oder? Bevor die Bullen das Zeug in die Finger bekamen, musste die Fuhre von Bord. Simple as that.
Jimmy starrte in den Container, der immer noch rappelvoll war. Vollkommen unmöglich, den zu leeren. »Weitermachen!«, keuchte er trotzdem und packte sich den nächsten Karton. »Amsterdam wird es zu schätzen wissen. Die werden sagen: Jimmy und Karsten – die haben Initiative gezeigt. Die haben kreativ gedacht. Alter, die werden uns beglückwünschen und …«
Karsten lugte noch mal um die Ecke, um zu checken, was die Cops da machten – und zuckte zurück, als wären ihm zwanzig Taranteln gleichzeitig ins Gesicht gesprungen.
»Die kommen«, keuchte er und zog die Pistole aus dem Hosenbund, um damit herumzufuchteln.
»Viele?«, fragte Jimmy.
»Voll viele, die kommen! Fuck, fuck, fuck!«
Leck mich, dachte Jimmy. Karsten hatte recht. Hatte keinen Zweck. Zu viele Kartons, zu wenig Zeit. Er warf die Containertür wieder zu und zog ebenfalls seine Waffe.
»Und jetzt?«, flüsterte Karsten, was wegen des starken Windes an Deck der Utrecht kaum zu hören war.
Gute Frage. Und jetzt bahnte sich ein Trupp Polizisten den Weg zum Container, was sollte man darauf schon antworten? Ein Schiff voller deutscher Polizei – und er und Karsten beide voll drauf und mit einer Tonne Kokain im Rücken, verpackt in Sporttaschen, die in Kartons steckten. Sie sollten auf die Fuhre achten und gewährleisten, dass alles sicher in Litauen ankam. Der Stoff hatte immerhin einen Wert von rund hundert Millionen Euro. Es war eine große Ehre und ein enormer Vertrauensbeweis, dass Karsten und Jimmy darauf aufpassen sollten, weswegen sie sich mit Speed wach hielten, um stets auf Zack zu sein, denn man wusste ja nie.
Tja, damit hatten sie recht behalten, oder? Woher wussten die Bullen von den Drogen, verdammt? Aber letztlich war das im Moment egal. Einzig wichtig war, was Karsten eben gefragt hatte: »Und jetzt?«
Denn Karsten durfte sich keinesfalls schnappen lassen. Er hatte vorher geflennt, dass er aus Deutschland verschwunden sei, weil es einen Haftbefehl gegen ihn gäbe. Er hatte mit irgendwelchen Rockerbanden zu tun gehabt, die die Polizei im Norden zerschlagen hatte. Jimmy durfte sich ebenfalls nicht schnappen lassen, weil noch eine Bewährungsstrafe gegen ihn lief. Er würde in jedem Fall für ein paar Jahre in den Knast wandern – natürlich mit einem Add-on auf die ausgesetzte Strafe, weil er mit einer Tonne Koks durch die Gegend schipperte und außerdem so viel Speed im Blut hatte wie die halbe Wehrmacht, als sie in Holland einmarschiert war.
»Und jetzt?«, wiederholte Jimmy. »Ins Wasser springen können wir wohl schlecht, oder willst du sofort ertrinken? Hast doch gesehen, was da unten los ist?«
»Ich weiß, aber … Scheiße, wir hätten in Amsterdam anrufen sollen und denen sagen, dass die Cops an Bord kommen, und fragen, was wir tun sollen, statt …«
»Alter, noch mal: So ein Blödsinn. Was hätten die schon sagen sollen? Die werden stolz auf uns sein.«
»Ja, aber wie kommen wir von hier weg, Mann?! Die sind im Anmarsch! Die haben Waffen!«
»Da«, sagte Jimmy und deutete mit der Pistole auf das Rettungsboot.
Er schwitzte wie ein Ochse, was sicherlich auch an den Drogen lag. Genau wie die Schlussfolgerung, die er gerade gezogen hatte. Sie war unsinnig, der pure Wahnsinn, komplett irrational. Dennoch kam Jimmy in diesem Augenblick alles logisch und unproblematisch vor. Denn so ein Rettungsboot war schließlich für Rettungsmaßnahmen vorgesehen – und wenn für ihn und Karsten gerade keine nötig wäre, wann denn dann? So ein paar Wellen würden dem Ding schon nichts anhaben, und Jimmy hatte bereits schlimmere gesehen. Meine Güte, was war übler: bisschen Schaukelei oder zehn Jahre Knast?
Das knallorangefarbene Vehikel war an den strahlend weißen Aufbauten am Heck der Utrecht angebracht, auf denen im siebten Stockwerk das Steuerhaus des Frachters thronte. Man konnte es mit einem Kran zu Wasser lassen. Kein Problem. Einfach reinsetzen, Knopf drücken, ab dafür. Am Heck gab es außerdem eine Rettungsinsel, die auf einer Rutsche befestigt war. Die konnte man aber vergessen, Nonsens, die ließ sich ja nicht steuern, damit konnte man nicht fliehen.
»Das Rettungsboot?«, rief Karsten.
Jimmy nickte. Die Ladezone des Schiffs, die bis zum Bug reichte, stand zur einen Hälfte voll mit Motorbooten als Ware für den Verkauf und zur anderen mit Containern wie dem, vor dem Jimmy und Karsten standen und auf dem vier weitere gestapelt waren. Sie müssten sich nur fünfzig Meter Weg bahnen. Das war nicht viel.
»Wir müssen verschwinden, Mann. Wir müssen das Rettungsboot erreichen – und dann nichts wie weg hier«, sagte Jimmy.
»Die dürfen uns nicht schnappen!«
»Die kriegen uns nicht, Alter«, erwiderte Jimmy, der dachte: Genau, wir lassen das Ding zu Wasser, bekommen die Bullen gar nicht mit, dann Außenborder auf Vollgas, und anschließend würden sie in Amsterdam alles erklären, dass irgendwer aus dem Inner Circle sie verpfiffen haben musste und sie echt nix hätten machen können. Klar, würde der Boss sagen, schon großer Mist. Eine Tonne durch die Lappen gegangen. Aber: Supertypen, ihr habt genau das Richtige getan, danke für den Hinweis, und jetzt reißen wir dem Maulwurf den Arsch auf, und ihr bekommt einen Bonus für euren Einsatz. Klasse, denn so einen Bonus könnte Jimmy echt gut gebrauchen, Karsten sicher auch. Allerdings: Vielleicht redete er sich das auch nur ein, so voll, wie er mit Drogen und Adrenalin war. Vielleicht würden sie auch sagen: »Ihr Vollidioten«, und ihnen stattdessen eine Kugel verpassen.
Aber lieber positiv denken, oder?
»Was?«, fragte Jimmy, der von Karsten aus den genialen Ideen zum Fluchtplan gerissen wurde.
»Ob du so ein Scheißding fahren kannst?«
Was für eine Frage. Jimmy war Holländer. Welcher Holländer konnte nicht Boot fahren?
»Logisch«, erwiderte er.
»Und die Bullen?«
Jimmy lud die Glock durch. »Ich lasse mich jedenfalls nicht aufhalten. Du?«
»Auf keinen Fall«, erwiderte Karsten und tat mit seiner Glock dasselbe.
4
Ceylan hatte dem einen Zweierteam die Anweisung erteilt, sich an der rechten Schiffsseite vorzuarbeiten. Das andere bewegte sich auf der gegenüberliegenden vorwärts. Ceylan und Tjark gingen ab durch die Mitte. Nach den Angaben von Kapitän Brouwer befand sich der betreffende Container nahezu am anderen Ende des Schiffs. Zum Glück, dachte Tjark, waren sie hier in dem sehr schmalen Gang zwischen den haushohen Türmen einigermaßen vor Wind, Wellen und dem Schwanken geschützt. Wie überdimensionale Legoklötze waren die Container und die zum Verkauf gedachten Motorboote auf das Deck der Utrecht gepflanzt worden und reizten die Fläche bis zum Maximum aus. Tjark wusste, dass pure Containerschiffe anders konstruiert waren als Mehrzweckschiffe wie dieses und noch der letzte Fingerbreit verplant war.
»Mir machen die beiden neuen Besatzungsmitglieder Sorgen«, sagte Tjark.
Ceylan nickte im Gehen. »Die Wachmannschaft für die Lieferung. Deswegen haben wir die Artillerie dabei, Cowboy.«
Sie tätschelte die MP5, Standardwaffe bei der Polizei, wenngleich ihre Tage gezählt waren und schon geraume Zeit über ein Update gesprochen wurde. In jedem Streifenwagen lag eine für den Fall, dass man mal eine höhere Durchschlagskraft benötigte oder Distanzen größer waren. Praktischerweise brauchte man dieselbe Munition wie für die Dienstpistolen, die Tjark deutlich lieber waren. Seine steckte im Holster am Gürtel. Die MP hatte er wieder von der Schulter genommen und sich umgegürtet.
Die Frage war, wo sich diese beiden Burschen aufhielten. Aber als Erstes würden sie den Container checken, die Ladung sichern und sich dann um alles Weitere kümmern.
Einen Moment später war Tjark klar, dass es genau andersherum passieren würde.
5
Jimmy blickte um die Ecke. Ihm blieb beinahe das Herz stehen, als er zwei Polizisten in Kampfmontur sah, die sich an der Reling in Richtung zu ihm und Karsten entlangarbeiteten. Dieser Weg zum Rettungsboot fiel aus. Er gab Karsten ein Zeichen, dass sie die andere Seite nehmen mussten, durch die Mitte in Richtung Steuerhaus, unten rein und dann durch die Seitentür wieder raus zum Boot. Half ja nichts.
Karsten nickte, bewegte sich aber keinen Zentimeter. Er hielt die Glock mit beiden Händen so, als suchte er daran Halt.
»Los jetzt!«, zischte Jimmy und drängte sich an ihm vorbei.
Er ging entlang der Containerwand, lugte um die Ecke – und sah einen Mann und eine Frau in Zivilkleidung direkt auf sich zukommen. Sie waren etwa zwanzig Meter entfernt und schienen bewaffnet zu sein. Ohne Frage waren das ebenfalls Polizisten. Da sie keine Kampfmontur trugen, wirkten sie aber schwächer. Der geringere Widerstand. Der bessere Weg, dachte Jimmy.
»Fuck«, hörte er Karsten hinter sich.
Er hatte die zwei ebenfalls entdeckt. Und die beiden natürlich auch Jimmy und Karsten.
»He!«, rief die Frau. »Polizei! LKA. Was tun Sie da?«
Fast hätte Jimmy über diese dämliche Frage gelacht. Was sollten sie hier schon tun? Offenbar hatte sie keine Ahnung und außerdem nicht bemerkt, dass er eine Pistole in der Hand hielt.
Und weil ihm absolut nichts Besseres mehr einfiel, als sich den Weg zum Rettungsboot freizuschießen, tat er genau das, nahm die Glock hoch und fing einfach an zu ballern.
6
Der Mann trat einfach in den Gang zwischen den Containern, nahm die Hand hoch und schoss los. Tjark sprang instinktiv zur Seite, nach rechts, presste sich gegen eine Wand und suchte nach der Dienstwaffe an seiner Hüfte. Kugeln schlugen in die Metallwand ein. Es klang wie Hammerschläge.
Ceylan sprang ebenfalls zur Seite – in eine Nische zwischen zwei Containerstapeln. Sie nahm die MP von der Schulter, entsicherte sie, blickte zu Tjark, um sich zu vergewissern, dass mit ihm alles okay war.
Er bewegte sich etwas vorwärts, suchte ebenfalls nach einer Deckung. Seine Hand fand den Pistolengriff. Er zog die Waffe.
»Haut ab!«, schrie der Mann. »Verpisst euch, wenn ihr leben wollt!«
Völlig durchgedreht. Der Kerl bewegte sich rückwärts, fuchtelte mit der Pistole herum. Er zuckte zusammen, als weitere Schüsse krachten. Eines der Einsatzteams musste sich von der Seite nähern.
Tjark ging in die Hocke, riss die Pistole hoch, zielte auf den Mann.
Dann kam ein Zweiter hinzu. Die beiden standen Rücken an Rücken, schossen einfach nach links und rechts in die Gänge.
»Haut ab! Verpisst euch!«, schrie der Kerl erneut. Tjark sah den einen zwischen Kimme und Korn.
Er spürte den Sicherungsknopf am Abzug.
Er bewegte den Zeigefinger und schoss zweimal.
Der Krach war ohrenbetäubend.
Zwischen Kimme und Korn sah Tjark nun keinen Mann mehr, denn der lag auf dem Boden. Dafür wirbelte der zweite herum und eröffnete das Feuer auf Tjark. Tjark spürte einen Schlag an der linken Schulter. Kochend heißes Wasser ergoss sich darüber. Weitere Hammerschläge gegen die Containerwände.
Dann bewegte sich Ceylan in den Gang, trat aus der Deckung, die MP5 im Anschlag. Sie gab mehrere Feuerstöße ab, ging vorwärts.
Drei Schuss.
Ein Schritt.
Drei Schuss.
Ein Schritt.
Die ausgeworfenen Patronenhülsen regneten auf den Boden.
Der zweite Mann wurde einige Male getroffen. Er fiel rückwärts um, gab noch ein paar Schüsse in die Luft ab und blieb dann liegen wie eine Marionette, der man die Fäden abgeschnitten hatte.
»Fuck!«, rief Ceylan. »Scheiße! Vollidioten! Dämliche Vollidioten!«
Im nächsten Moment drangen von links und rechts die Teams der Bundespolizei in den Mittelgang. Sie zielten auf die beiden am Boden liegenden Männer, kickten die Waffen zur Seite, checkten, ob die Kerle noch lebten. Dem Kopfschütteln war zu entnehmen, dass das nicht der Fall war.
»Krasse Scheiße!«, rief Ceylan erneut.
Ihr musste das Adrenalin bis zur Halskrause stehen. Sie wendete sich Tjark zu. Er fasste sich an die linke Schulter, spürte dort zerfetzten Stoff und immer noch dieses Brennen. Er sah Blut an den Fingerspitzen. Es war nicht viel.
»Oh Gott, alles okay, Tjark?«
Ceylan hängte sich die MP um und rannte zu ihm. Tjark rappelte sich auf, steckte die Pistole ein, öffnete die Jacke und zog sie über die Schultern. Am oberen linken Bizeps war sein Shirt ebenfalls eingeritzt und blutig. Ein Streifschuss, aber nur ein sehr leichter, wie es aussah. Er hatte verdammtes Glück gehabt. Vielleicht würde das noch nicht einmal genäht werden müssen.
»Nicht so schlimm«, sagte Tjark.
Ceylan sah sich die Wunde an und nickte. »Die Kugel hat dich nur geritzt.«
Sie nahm eine Packung Taschentücher aus der Jackentasche, gab Tjark eines, der sich damit das Blut abtupfte, das Tempo unter den Shirtärmel klemmte und die Jacke wieder überzog.
»Die haben einfach drauflosgeschossen, die Idioten. Komplett verrückt.«
»Allerdings«, erwiderte Tjark und folgte Ceylan, die sich schon wieder umgedreht hatte und mit großen Schritten zu den Polizisten und den beiden am Boden liegenden Angreifern ging. Sie blieb dort stehen, Tjark ebenfalls. Die zwei Männer lagen in großen Blutlachen, die offenen Augen matt. Da war nichts mehr zu machen. Die Kollegen hatten die beiden bereits durchsucht. Beutel mit Tabletten lagen auf ihnen, aufgeklappte Geldbörsen, Ausweise.
»Jimmy Dijkstra und Karsten Koning«, sagte Ceylan. »Karsten Koning kennen wir, oder?«
Tjark nickte. »An dem haben wir Interesse gehabt, ja. Abgetauchter Drogenkurier bei den Bad Coyotes.«
Eine Biker-Gang, mit der sie im Norden immer wieder Probleme hatten. Außerordentlich große Probleme zuletzt, als die Bande Vural Attamans Tochter entführt hatte.
Ceylan blickte auf, sah Tjark direkt in die Augen. »So ein Mist. Wir haben zwei Menschen erschossen.«
Tjark nickte. »Weil sie sonst uns erschossen hätten. Oder einen der Kollegen.«
Er hob die Hand, um sie Ceylan tröstend um die Schultern zu legen. Aber daran hatte sie kein Interesse, suchte die Ablenkung und wich aus. Sie setzte sich wieder in Bewegung und sah sich nach dem Container um, in dem sich die Drogen befinden sollten. Und nach dieser Schießerei bestand kein Zweifel mehr daran, dass sie fündig werden würden. Sie betrachtete einige, glich die Nummern mit ihrem Zettel ab.
»Bingo«, sagte Ceylan, klopfte gegen einen Container und bog um die Ecke.
Als Tjark neben sie trat, hantierte sie bereits an der Türe, um den Mechanismus zu öffnen. Einen Augenblick später sprang sie auf. Tjark sah jede Menge Kartons mit dem Aufdruck eines Sportartikelherstellers. Sie hatten das Format einer Umzugskiste. Man sah auf den ersten Blick, dass einige fehlten. Was dreierlei bedeuten konnte.
»Das sind alles Trainingstaschen«, sagte Ceylan, »aber es sieht aus, als seien nicht alle da, oder? Zwei Paletten sind leer. Drei sogar. Außerdem war der Container nicht mehr verplombt. Entweder, sie haben unterwegs bereits einige Kartons ausgeliefert. Oder es sind nicht alle mitgekommen. Oder …«
»… sie haben einige über Bord geworfen, als sie hörten, dass wir im Anmarsch sind.«
Ceylan nickte, drehte sich um, blickte aufs Meer. Tjark tat das ebenfalls, sah allerdings nichts weiter als meterhohe Wellen.
Falls jemand die Kartons in die See geworfen hatte, dann waren die längst auf dem Grund oder weit abgespült worden. Es wäre die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen mitten in einem Wirbelsturm. Unmöglich. Manchmal waren Drogenverpackungen mit kleinen Sendern ausgestattet, damit man sie orten konnte. Das galt für Lieferungen, die per se ins Meer geworfen und von Booten aufgefischt wurden. Aber diese Lieferung in den Kartons – nein, die war für das Verladen auf dem Festland vorgesehen, und es waren viel zu viele Kartons.
Tjark drehte sich um, zog ein Schweizer Taschenmesser aus der Hosentasche, klappte es auf und schnitt einen Karton auf. Darin befanden sich jede Menge in Plastikfolien verpackte und wie zu Flundern zusammengepresste Taschen in allen möglichen Farben, die von Polsterplastik und Styropor eingefasst waren. Er nahm einige raus, warf sie zur Seite – und fand dann in der Mitte zehn in Folie gewickelte Briketts, die eine weiße Substanz enthielten und jeweils ungefähr ein Kilo wogen, wie Tjark abschätzte.
Ceylan wendete sich ihm zu. Er drückte ihr einen der Briketts in die Hand. »Immerhin hat es sich gelohnt.«
»Tjark?«
Tjark legte den Kopf schief. Er hörte eine Stimme im Kopfhörer. Femkes Stimme.
»Tjark?«, wiederholte sie. »Was …«
7
»… ist da bei euch los?«
Femke hielt sich immer noch am Türgriff fest. Fred hatte sich mittlerweile auf eine Bank gesetzt und starrte durch ein Fernglas nach draußen.
»Wir haben einen Treffer«, hörte sie Tjark sagen.
Aber das war nicht das, was sie hören wollte. Denn natürlich hatten sie im Funkverkehr wahrgenommen, dass es zu einer Schießerei an Bord gekommen war und dass offensichtlich zwei verdächtige Personen tot und ein Polizist verletzt worden war. Und darüber hätte sie gerne mehr Informationen.
Jetzt redete Ceylan. »Die haben einfach auf uns geschossen. Tjark und ich haben das Feuer erwidert und die Angreifer neutralisiert. Das ist alles. Tjark hat einen Streifschuss am Oberarm abbekommen.«
»Nur ein Kratzer«, sagte Tjark.
Femke presste die Lippen zu einem schmalen Band zusammen und sah, dass Fred das Fernglas herunternahm und in ihre Richtung mit den Augen rollte.
Er mischte sich in das Gespräch ein. »Könnt ihr auch mal was überprüfen, ohne dass es ausartet?«
»Die haben geschossen«, wiederholte Ceylan. »Sie wurden neutralisiert. Einer von Tjark. Einer von mir. Ist das so schwer zu kapieren?«
Neutralisiert. Ihre Stimme klang eiskalt und nüchtern und so gar nicht nach Ceylan. Sie musste im Schock sein.
»Schon gut«, sagte Fred.
»Tjark«, fragte Femke, »geht es euch gut?«
»Bis auf den Seegang so weit okay. Meine Wunde ist nicht schlimm.«
»Du brauchst einen Arzt.«
»Erst mal müssen wir uns um ein paar Dinge kümmern und dann irgendwie wieder vom Schiff runterkommen«, erklärte er.
Damit klinkte er sich aus.
»Ceylan«, fragte Femke, »wie geht es dir?«
»Könnte nicht besser sein. Wir haben in dem Container Drogen gefunden. Das ist das Wichtigste. Möglicherweise fehlt ein Teil. Vielleicht wurde auf See bereits etwas weitergeleitet, ging über Bord oder gar nicht erst an Bord.«
»Wie, ich meine …«
»Der Container ist voller Kartons. Es fehlen einige. Capisce?«
»Ja, ist ja schon gut, ich …«
»Ich muss mich jetzt um ein paar Dinge kümmern. Bis später.«
Damit klinkte sie sich ebenfalls aus.
»Meine Güte«, sagte Femke zu Fred. »Was für eine Bitch.«
Fred machte eine abwinkende Geste und ließ dann den Zeigefinger an der Schläfe kreiseln. »Die sind gerade nicht zurechnungsfähig. Auf sie wurde geschossen, und sie haben zwei Leute umgelegt. Leichte Schocklage. Gib ihnen etwas Zeit, dann kommen sie wieder klar.«
Femke nickte. »Okay. Und wo ist der fehlende Teil der Drogen gelandet? Was glaubst du?«
Fred stand auf und wankte zu Femke. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter und drückte sanft zu. »Das ist zum Glück nicht unsere Baustelle, sondern die vom Zoll. Wir sind hier fertig.« Aus heiterem Himmel wechselte er das Thema. »Habe ich dir eigentlich schon von meinem neuen Rasenmähroboter erzählt? Mit GPS-Funktion?«
»Nein«, erwiderte Femke und rang sich ein Lächeln ab. Ein gequältes, denn sie spürte einen heißen Kloß in der Speiseröhre. Und der sagte ihr, dass sie noch längst nicht fertig waren.
8
Cliff van Doorn beendete das Telefonat und fuhr sich mit den manikürten Fingernägeln durch die blonden Haare mit den dunkelbraunen Ansätzen. Natürlich alles gefärbt, ansonsten wäre er bereits grau. Er stand auf, zupfte sich die Aufschläge des beigefarbenen Sakkos zurecht, ebenfalls das Paisley-gemusterte Seidentuch am Hals. Dann verließ er den Tisch, kümmerte sich nicht weiter um das Fünfzig-Euro-Steak auf dem Teller und spürte die Blicke im Nacken, kümmerte sich aber auch darum nicht.
Er ging quer durch das am heutigen Mittag voll besetzte Restaurant De Gouden Jongen in Amsterdams bester Lage, das im Wesentlichen ihm gehörte, aber früher schon Goldjunge geheißen hatte. Wobei van Doorn stets sagte, dass das ja wohl wie die Faust aufs Auge passe – »Goldjunge« so wie er, der »Golden Boy«.
Im Slalom passierte er einige Tische, erreichte die Bar und ging einfach daran vorbei zur Flügeltür, die in die Küche führte. Eine der Bedienungen an der Kasse wollte ihn zunächst stoppen, wurde aber von einem Kellner mit einem Kopfschütteln zurückgehalten – das Mädchen war neu und wusste offenbar nicht, wer Cliff van Doorn war.
Er stieß die Flügeltür auf und stand in der Küche, in der Hochbetrieb herrschte. Alle sahen ihn an, sagten aber kein Wort, und er auch nicht. Er ging weiter, suchte mit den Blicken die Edelstahltische und die Wände ab. Dann sah er ein Handbeil auf einem Hackbrett liegen und ging dorthin, schob einen der Köche zur Seite und griff nach den Rinderrippen, die hier gerade vorbereitet wurden.
Van Doorn nahm das Beil, wog es in der Hand. Es war schwer und wirkte messerscharf. Mit der anderen zog er die Rippen auf das hölzerne Hackbrett, holte aus und schlug mit aller Kraft zu.
Knochen splitterten. Fleisch spritzte gegen sein helles Jackett.
Das Beil bohrte sich mit der Spitze in das Holz. Van Doorn zog es heraus, hieb erneut zu. Wiederholte den Prozess. Jetzt nahm er beide Hände. Schlug auf die Rippen ein. Zerhackte sie. Fleisch und Knochen spritzten ihm ins Gesicht, besprenkelten sein Sakko. Das Seidenhalstuch hatte sich längst gelöst. Die normalerweise zurückgekämmten Haare hingen ihm ins Gesicht, das zu einer wilden Fratze verzerrt war, während er wie ein Irrer auf das Fleisch einprügelte und tiefe Kerben in den Holzblock schlug. Er knurrte wie ein wildes Tier.