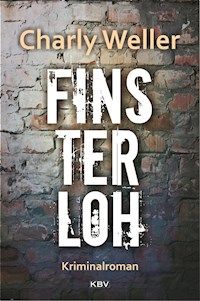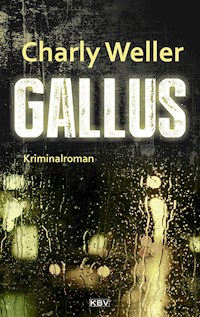Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Kalt weht der Wind im Vogelsberg … Ein Auto im Graben einer abgelegenen Landstraße im Vogelsberg. Im Kofferraum die Leichen eines Ehepaars mit aufgeschlitzten Pulsadern. Selbstmord oder Verbrechen? Und was hat es mit der abgetrennten Fingerkuppe auf sich, die am Vorabend auf der Polizeiwache abgegeben wurde? Diesen und einer Reihe weiterer Fragen müssen Kommissar Roman Worstedt und seine Kollegin Regina Maritz nachgehen, um mit ihren Ermittlungen schließlich in Namibia zu landen. Denn die Hintergründe des Falls reichen zurück bis in die Kolonialzeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Eulenkopf
Finsterloh
Katzenkönig
Charly Weller, geb. 1951 in Marburg a. d. Lahn, ist von Hause aus Filmemacher. Nach seiner Jugend in Gießen und Wetzlar studierte er zunächst Theologie, es folgte das Jura- und Publizistikstudium in Berlin. Zwischenzeitlich betätigte er sich als Fotograf, Journalist, Taxifahrer, Versicherungsvertreter und Kinobetreiber. Nach der Regieassistenz unter Peter Fleischmann drehte er erste eigene Filme und wurde ausgezeichnet, u. a. mit dem Prix du Jury in Cannes und dem Max-Ophüls-Förderpreis. Er war Regisseur zahlreicher Folgen von TV-Krimi-Serien wie Ein Fall für Zwei, Die Kommissarin, Im Namen des Gesetzes, Auf Achse und anderen.
Sein erster Kriminalroman Eulenkopf wurde 2015 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Debüt nominiert. Heute lebt er mit seiner Ehefrau Ritchie als freier Autor und Regisseur in der Nähe von Gießen und ist als Dozent an der Technischen Hochschule Mittelhessen tätig.
CHARLY WELLER
TOTENWIND
Originalausgabe© 2017 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlaggestaltung: Ralf Krampunter Verwendung von: Sabphoto - www.fotolia.deLektorat: Volker Maria Neumann, KölnDruck: CPI books Ebner & Spiegel GmbH, UlmPrinted in GermanyPrint-ISBN 978-3-95441-388-1E-Book-ISBN 978-3-95441-399-7
für Nora & Bernd
Inhalt
PROLOG
ABBENE KUPPE
DICK MOCK
JIM KNOPF
GLÜCK GEHABT
UNTER MISTELN
ICH KENNE DICH
DIE HEIDE BRENNT
ALLE WEG
DER WEG
TAXI
DAS TRIBUNAL
WENN ROMAN KOMMT
RAIFFEISEN RAPPORT
NASILUP
BELLSCHOU
KEIN WORT ZU NIEMANDEM
AFF
PARTISANENKÄSE
HIER DU ARSCH
YELLOWCAKE
BROSSARTS WELT
ADERLASS
ASCHE FÜR LA TACHE
DER AUFRECHTE GANG
AUF NUMMER SICHER
SOWJETREPUBLIK VOGELSBERG
HERR DER WÜRSTE
ENDE DER GAUKLER
FEUERLILIE
BONZEN TROPFEN
BÖSER MÜLL
EINE GUTE NACHRICHT
KATUTURA
FRÜCHTE DES VERGIFTETEN BAUMES
SÜDEN
HEISSE BILDER
HASENFUSS
DER LETZTE JOB
SANDFONTAIN
IN HAFT
VERKEHRTER LINCOLN
GEHT NOCH
DREIUNDZWANZIG
DAS GRÜNE BÜCHLEIN
WINDHOEK
KRANKER VOGEL
DER KAMERAMANN
MASCHNDRAHTZAUN
ROSALINDE
ÜBERRASCHUNG
KLIPPSCHLIEFER
GUT NEIT MÜLLER
EIN WINDHUND
MASKEN
QUID PRO QUO
MÜLLERS AUTO
DAS GEISTERHAUS
DAS URTEIL
LION SLEEPS TONIGHT
WINDHOEK ADIEU
NACHWORT & DANKE
GLOSSAR
»Einst behandelte Deutschland seine Afrikaner wie ein strenger, doch liebender Stiefvater, der sie bestrafte, wo es geboten schien, nicht selten mit dem Tod … Heute lebt der Herero unter dem Dach seines Stiefvaters. Vielleicht haben Sie, die mir jetzt zuhören, ihn selbst gesehen. Er bleibt wach nach den Sperrstunden und beobachtet seinen schlafenden Stiefvater unsichtbar. Im Schutz der Nacht, die seine eigene Farbe trägt. Was denken all diese Hereros? Wo sind sie heute Nacht? Was tun sie, jetzt, in diesem Augenblick, eure dunklen, geheimnisvollen Kinder?«
Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel
PROLOG
Nur weg von hier, hämmerte es in seinem Kopf, nur weg.
Nachdem er den Zaun hinter sich gebracht hatte, steuerte er schnurstracks über eine Wiese hinweg den nahegelegenen Wald an. Er lief, was das Zeug hielt, auf Leben und Tod. Er traute sich nicht, zurückzublicken. Zu groß war seine Angst, Gewehre könnten auf ihn abgefeuert oder Hunde hinter ihm hergehetzt werden. Im Wald stürzte er wie blind durch Sträucher, Gestrüpp und Astwerk. Seine Füße begannen zu schmerzen. Sein Blut pochte in den Adern. Er lief wie blind geradeaus. In der Lunge rasselte sein Atem. Alles tat weh.
Er wusste nicht, was geschehen war, was hinter ihm lag. Und noch weniger, was ihn wohl erwarten mochte. Was vor ihm lag. Das Einzige, was überlebensgroß vor ihm stand, war, dass es kein Zurück mehr für ihn gab.
Seinen ersten Stopp hatte er, als er an eine Straße kam. Die Fahrbahn glänzte im gleißenden Mondschein wie ein zugefrorener Fluss. Am Horizont erschienen zwei Augen. Mit dem Näherkommen begannen sie zu leuchten und entpuppten sich als die Scheinwerfer eines Autos. Er verschanzte sich im Graben neben der Straße. Der Wagen zog vorbei, ohne dass etwas geschah.
Als alles wieder ruhig war, betrat er vorsichtig die Fahrbahn. Zunächst zögerlich, dann mit raschen Sätzen überquerte er sie und tauchte auf der anderen Seite wieder ein in den Wald.
Er wusste nicht, wie lange er schon so unterwegs war, als ein Gefühl von Hunger in ihm aufstieg. Er hatte Angst, dass er nicht lange überleben würde, wenn er nicht etwas zu essen fand. Zu essen und zu trinken.
Dann irgendwann hielt er inne. Er schnupperte in die Luft, die vor ihm lag, und meinte, in dem aufkommenden Wind einen Geruch wahrzunehmen, der Hoffnung in ihm aufkeimen ließ. Blut, dachte er, das war der Geruch von Blut. Er folgte seiner Witterung, bis er an einen Weg kam, der von Herbstlaub übersät war. Und auf dem ein Auto stand. Ein herrschaftlich weißes Auto mit roten Ledersitzen darinnen und außenherum blitzend und blinkend.
Und vor diesem Auto auf dem kleinen Meer von bunten Blättern lag etwas, das er zunächst nicht ausmachen konnte. Aber dann erkannte er, worum es sich handelte: zwei Leiber. Leblos. Er näherte sich vorsichtig. Einen Mann und eine Frau konnte er erkennen. An den Fußgelenken aneinandergefesselt. Ihre Pulsadern aufgeritzt. Daher der Geruch von Blut. Zu dem sich nun auch von dem Auto her der Geruch von etwas Trinkbarem gesellte. Gerettet, schoss es ihm erleichtert durch den Kopf.
Er näherte sich den beiden. Der Mann hatte den Mund verschlossen und blickte zum Himmel. Der Kopf der Frau lag auf der Seite. Sie hatte ihren Mund geöffnet und blickte leer in den Wald hinein.
Es dauerte einen Moment, bis er sich erinnern konnte, diese Augen zu kennen. Er erinnerte sich an die unzähligen Male, die er sie angefleht hatte, sich seiner zu erbarmen. Aber das haben sie nie. Sie ließen sich nicht erweichen.
Dann meldete sich wieder sein Hunger.
ABBENE KUPPE
Einen Finger?«, fragte der Polizist.
Und der Mann ihm gegenüber antwortete: »Keinen ganzen. Nur das vordere Glied von einem. Gewissermaßen eine Finger-Kuppe.« Dann begann er, das Taschentuch auseinanderzufalten, das er zuvor auf den Tresen der Wachstube gelegt hatte.
Es war der Tag, an dem in der Zeitung stand, dass für die kommende Nacht ein seltenes Himmelsschauspiel zu erwarten sei. Weil der Mond der Erde so nah komme wie seit siebzig Jahren nicht mehr.
Am späten Nachmittag wurden im Radio Leute zu der bevorstehenden Nacht befragt. Ein Taxifahrer meinte, er hasse Vollmondnächte, weil es da zigmal mehr Zahlungsstreitigkeiten gebe als sonst. Ein Polizist trug vor, in solchen Nächten seien unverhältnismäßig mehr Körperverletzungen und Gewalttaten zu verzeichnen. Und nur eine Frau, die als Sexarbeiterin aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel vorgestellt wurde, erklärte, solche Nächte zu lieben. Und zwar aus dem Grund, weil ihre Kunden da weitaus eher vorzeitige Samenergüsse hätten. Was für ihre harte, aufreibende Tätigkeit ausgesprochen erleichternd sei.
Günter Grabowski hörte diese Stimmen, als sein Radiowecker ihn aus einem Traum rettete, den er in letzter Zeit oft hatte. Es war immer das Gleiche: Er lag schlafend in seinem Bett, während jemand versuchte, zum Fenster des Raums einzusteigen. Das Gesicht des Eindringlings war nicht zu erkennen. Er trug eine Motorradmaske und schwarze Lederhandschuhe.
So sehr Günter sich in seinem Traum auch bemühte, aufzuwachen und dem Eindringling entgegenzutreten, es wollte ihm nicht gelingen. Immer und immer wieder konnte er trotz aller Anstrengung seine Augen gerade mal einen winzigen Spalt weit öffnen, um sogleich wieder wegzudämmern.
Er war der Situation hilflos ausgeliefert und ihm blieb nichts anderes übrig, als tatenlos zuzusehen, wie der Fremde das Zimmer betrat und sich an seinen Sachen zu schaffen machte. Das Ganze schien endlos lange zu dauern und endete erst, als aus der Ferne Stimmen zu vernehmen waren, die die bevorstehende Vollmondnacht kommentierten.
Am ganzen Körper schwitzend fuhr Günter stumm empor und musste sich erst einmal vergegenwärtigen, dass es lediglich ein Traum gewesen war, in dem bei ihm eingestiegen wurde.
Er hatte an dem Tag Frühschicht gehabt und sich nach dem Mittagessen schlafen gelegt. Das war sein über Jahre hinweg bewährtes Ritual, sich auf die bevorstehende Nachtschicht einzustimmen.
Nach dem Hinlegen sah es mit Einschlafen allerdings nicht gut aus. Er bekam den Kopf nicht frei. Weshalb es nur für ein gedankenverlorenes Dösen reichen musste. Dass er dann schließlich doch eingeschlafen war und auch noch aus einem Traum erwachte, verwunderte ihn im Nachhinein sehr.
Im Wachwerden dachte er für einen Moment, Marion liege neben ihm. Er griff vorsichtig zum anderen Teil des Bettes. Aber da war niemand. Nur abgelegte Kleidung, die längst hätte gewaschen werden müssen.
Marion war weg. Seit acht Wochen schon. Dazu war es gekommen, als seine Schwester mit ihrem Mann zu Besuch gewesen war. Da hatte sie eine Bemerkung über das Tuch gemacht, das Marion um den Hals getragen hatte.
Als die beiden wieder weg waren, wollte Günter wissen, was seine Schwester damit gemeint haben könnte, dass es bei ihnen ja wohl noch recht leidenschaftlich zugehen müsse. So nahmen die Dinge ihren Lauf, an deren Ende offenbar wurde, dass sich unter dem Halstuch ein Knutschfleck befand. Weil selbiger nicht von Günter stammte, wollte er um alles in der Welt erfahren, wer ihr den verpasst habe.
»Sag mir den Namen von dem Typen!«, hatte er so laut geschrien, dass die Nachbarschaft jedes Wort mithören konnte, »Ich will sofort wissen, wer das war!«
Nachdem eine Weile hin und her gebrüllt worden war und er knapp an ihrem Kopf vorbei ein Loch in das Türblatt zur Speisekammer geschlagen hatte, rückte sie endlich kleinlaut raus mit der Sprache.
Sie sagte: »Kein Er, Günter, das war kein Er.«
»Was?«, hatte er entgegnet, nachdem er einen Moment gebraucht hatte, bis er verstand, was gemeint war.
Er setzte sich danach an den Küchentisch, regungslos vor sich hin auf die Tischdecke stierend, während sie im Schlafzimmer Sachen in einen Koffer packte, mit dem sie dann das Haus verließ.
Hätte der Knutschfleck von einem Mann gestammt, hätte er sich fragen können, was der habe und er nicht. Dass er besser aussehe, mehr verdiene, ein leidenschaftlicherer Liebhaber sei, was auch immer. Aber bei einer Frau gab es nichts. Da war null, was er hätte vergleichen können. Er hatte keine Ahnung, was daraus werden sollte.
Seitdem kam Marion einmal die Woche vorbei, wenn er auf Schicht war, und holte sich weitere Sachen aus der Wohnung. An manchen Tagen hat er schon gedacht, ob er sie nicht abfangen sollte. Dann könnte er ihr vorschlagen, dass sie ihre Beziehung zu der Frau, die – wie er mittlerweile erfahren hatte – Chrissi hieß, hinter seinem Rücken würde ausleben können, wenn sie nur zu ihm zurückkäme. An anderen Tagen aber fand er solche Gedanken schlichtweg absurd.
Unterm Strich kam es aber immer häufiger vor, dass er meinte, Leute würden über ihn tuscheln, wenn er ihnen auf der Straße begegnete oder er einen Raum betrat. Manchmal meinte er sogar, schon gehört zu haben, dass es hieß, es sei doch nie so weit gekommen, wenn er gewissenhaft seinen ehelichen Pflichten nachgekommen wäre. Er wusste nicht, wie lange er die Fassade würde aufrechterhalten können. Und im Prinzip konnte er froh sein, dass man auf der Dienststelle noch nicht Wind davon bekommen hatte.
In den letzten Wochen war ihm mehr und mehr klar geworden, dass Marion nicht zu ihm zurückkehren würde und er über kurz oder lang sein Leben neu ausrichten müsste.
Wahrscheinlich wäre es sowieso am besten, wenn er wegzog und sich eine ganz andere Arbeit suchte. Schichtdienst, so hieß es immer wieder, sei auf Dauer der sichere Tod jeder Beziehung. Schon zu oft hatte er Kollegen erlebt, die meinten, dass sie mit dieser Arbeit ihr Leben verpfuscht hätten.
Deshalb seien Polizisten auch gerne darauf aus, möglichst früh in den Ruhestand versetzt zu werden. Jede noch so kleine körperliche Einschränkung werde dann zum Anlass genommen, um die Diensttauglichkeit zu hinterfragen. Wer als Polizist über fünfzig noch im Dienst sei – so hieß es oft – brauche schlichtweg das Geld, weil er ansonsten nicht mit seiner Pension über die Runden komme.
Als Günter Grabowski lange genug über das alles nachgedacht hatte, blickte er zu seinem Radiowecker. Das Display zeigte 16:04. Die 16 erinnerte ihn an seinen Geburtstag, der in sechs Tagen, am Sonntag, anstand. Es war der Tag, an dem auch sein Namensvetter Günter Grass Geburtstag hatte. Über den bekannten deutschen Schriftsteller wusste er gerade mal, dass sein berühmtestes Werk Die Blechtrommel war, dass er den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte und einen Bart trug wie ein Walross.
In Anspielung auf seinen Geburtstag am Sechzehnten hatte Günter in der Vergangenheit manchmal spaßeshalber gemeint, mit Joseph Ratzinger den Namenstag zu teilen, weil der ja als Papst schließlich Benedikt, der Sechzehnte heiße.
Die 04 auf dem Display erinnerte ihn an die Blauweißen aus seiner Heimat. Acht Jahre zuvor war er von Gelsenkirchen nach Grünberg gekommen. Dafür hatte er die ganze Tortur auf sich genommen, die Länderwechsler hinter sich bringen mussten, wenn sie als Polizeibeamte von einem Bundesland in ein anderes versetzt werden wollten. Von dem Moment an, da er seine Vorgesetzten im Pott über sein Versetzungsbegehren in Kenntnis gesetzt hatte, war er bei seinen Kollegen abgestempelt gewesen. Sie behandelten ihn dann nur noch wie einen Abtrünnigen.
Aber ihm war das egal. Marion war seine große Liebe. Sie hatten sich im Urlaub auf Teneriffa kennengelernt und sich hinterher ein halbes Jahr lang geschrieben, besucht und miteinander telefoniert. Und jedes Mal, wenn er bei ihr in Grünberg auf Besuch war, hat er sich gefühlt wie im Urlaub. Alles war ihm so überaus friedfertig vorgekommen. Die Stadt so puppenstubenhaft, die Landschaft so beruhigend, alles so herzerwärmend. Aber das ist lange her, dachte er. Jetzt kam ihm alles nur noch bedrohlich vor.
Die Anzeige im Display sprang auf 16:05. Er stand auf und ging ins Bad. Zunächst duschte er warm, dann kalt. Dann zog er sich eine frische Unterhose an, ging in die Küche und aß zwei Scheiben Eiweißbrot mit wenig Butter und Radieschen, die er zuvor in schmale Scheiben geschnitten und mit Salz bestreut hatte. Dabei blickte er aus dem Küchenfenster hinaus auf eine Straße mit Fachwerkhäusern: Grünberg.
Mit Schaudern dachte er daran, was ihm am kommenden Donnerstag bevorstand. Bis dahin waren es noch drei Tage. Nur noch drei Tage. Dann würde er im Rahmen des diesjährigen »Gallmärt«, wie der Gallusmarkt – bei dem es sich gewissermaßen um das oberhessische Oktoberfest handelte – im Vogelsberg genannt wurde, als einer der vier Wurzelbürger in den Kreis der »originären Grimmicher«, wie die Grünberger sich selbst nannten, aufgenommen werden.
Dafür würde er traditionsgemäß im Rahmen eines Frühschoppens im Festzelt eine Mundartprobe absolvieren müssen. Auf die Frage des zeremonieleitenden Bürschtmeisters, ob er der sei, für den er sich ausgab, müsste er in grimmicher Mundart antworten: »Jo, des san eich selbst.« Dann würde ihm ein Witz in Mundart vorgetragen, den er auf Hochdeutsch wiedergeben musste. Und abschließend würde er einen hochdeutschen Satz ins »grimmicher Platt« übersetzen müssen.
Danach würde ihm als Einbürgerungsritual zur Belustigung der Anwesenden mit einer Wurzelbürste der Rücken hin und her (»eribber un enibber«) sowie herunter und hinauf (»erabb un eroff«) gebürstet werden.
Bereits drei Monate zuvor war Günter Grabowski angetragen worden, ihm diese Aufnahme in die Gemeinschaft der Grünberger Bürgerschaft zuteil werden zu lassen. Hocherfreut hatte er sich damals bedankt und freudig angenommen. Aber da war Marion noch da gewesen und er wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, diese Ehrerbietung ohne sie wahrnehmen zu müssen.
Zwischenzeitlich hatte er immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es wieder zu einer Versöhnung komme, weshalb er es permanent vor sich hergeschoben hatte, der Festkommission abzusagen.
Es wäre naheliegend, dass er sich nicht mit irgendwelchen Ausreden würde retten können, wenn gefragt würde, warum Marion nicht an seiner Seite sei. Und vielleicht würde sich bei der Gelegenheit auch offenbaren, dass einige Leute bereits mitgekriegt hatten, was bei ihnen vorgefallen war.
Zwar hatte er stets, wenn die Frage auf seine Frau kam, die eine oder andere Ausrede parat gehabt. Aber auf der anderen Seite hatte er auch schon mitgekriegt, wie bei ähnlichen Anlässen die Meinung vertreten wurde, dass eine Frau, die sich so verhält, nur einen Mann bräuchte, der es ihr mal wieder ordentlich besorgt.
Beim Losgehen zu seinem Auto musste Günter Grabowski an frühere Aktenzeichen-XY-Sendungen denken. Da begannen die Berichte oft damit, dass jemand gezeigt wurde, der sich morgens von seiner Frau verabschiedet, um zur Arbeit zu gehen, während eine Sprecherstimme kommentiert: »Als Herr Soundso sich an diesem Morgen von seiner Frau verabschiedete, ahnte er noch nicht, dass er kurze Zeit später einem schlimmen Verbrechen zum Opfer fallen sollte.«
Er hatte sich immer wieder überlegt, was denn wohl geschehen wäre, wenn Herr Soundso eine entsprechende Vorahnung gespürt hätte. Ob er da vielleicht zu seiner Frau gesagt hätte: »Du, Schatz, irgendwie ist mir heute so mulmig. Ich glaub, ich bleib mal lieber daheim. Nicht, dass noch was Schlimmes passiert.«
Obwohl die Gedanken an die XY-Sendungen ihn nicht wirklich beunruhigten, war er doch erleichtert gewesen, als er in der Dienststelle eingetroffen war. Nach kurzer Übergabe von der Nachmittagsschicht hatte er sich damit beschäftigt, anstehenden Papierkram zu erledigen.
Kurz nach acht war dann ein Anruf eingegangen von einem gewissen Nesseldreh, Hans-Ulrich. Der hatte recht wirr etwas von einem gefundenen Finger erzählt. Weil Günter nicht heraushören konnte, was der Mann letztendlich meinte, forderte er ihn auf, zur Polizeistation zu kommen.
Zwölf Minuten später stand dieser dann auf der Matte. Er sah aus wie ein typischer Landwirt vom Vogelsberg, etwa Mitte fünfzig, auf dem Kopf eine Torfstechermütze, wie sie bevorzugt bei Arbeiten auf dem Feld getragen wurden. Dazu eine ausgewaschene, blaue Arbeitsjacke mit großkariertem Hemd darunter. Seine Füße steckten in olivgrünen Gummistiefeln, in die die Beine einer abgetragenen, hellbeigefarbenen Manchesterhose eingesteckt waren.
Beim Anblick der Hose musste Günter Grabowski an den Witz denken, wo ein Mann vom Arzt nach Hause kommt und die Frau fragt, was gewesen sei. Als der Mann daraufhin entgegnet, er solle nächstes Mal eine Urin-, eine Kot- und eine Spermaprobe mitbringen, meint sie: »Da bring ihm doch am besten die Manchesterhose von der Kellertreppe mit, da ist doch alles drin.«
Das wirr abstehende Haar des Mannes sowie seine unübersehbare Verwahrlosung ließ vermuten, dass er ohne Frau war. Seine Gesichtsrötung war offensichtlich die Folge einer unüberwindbaren Trunksucht.
Nachdem er das Taschentuch auseinandergewickelt hatte, kam darin, wie angekündigt, die Kuppe eines Fingers zum Vorschein.
Es konnte noch nicht lange her sein, dass das Glied abgetrennt worden war. Die Schnittstelle wies keine Verfransungen auf, es gab keine Verkrustungen, und das Blut leuchtete wie frischer Ketchup.
»Vielleicht von einem Zeigefinger«, sagte Nesseldreh, »vielleicht aber auch von einem Mittel- oder Ringfinger. Ich kenne mich da nicht so aus, bin ja kein Spezialist.«
»Wo genau haben Sie das gefunden«, wollte Grabowski erfahren.
»Wie gesagt, vor der Tür«, antwortete er, »vom Gut Ewig, dem Haupthaus.«
»Gut Ewig?«
»Richtig, zwischen Nieder-Seibertenrod und Stumpertenrod.«
»Bei der Sternwarte?«
»Auf der anderen Seite von der K 128, ungefähr einen Kilometer weit rein mit einem grünen Planweg am Waldrand.«
»Und wer wohnt da?«
»Die van Beuthens. Das ist der Hof der Familie van Beuthen. Beziehungsweise von Herr und Frau van Beuthen. Kinder haben die keine.«
»Aber von denen war niemand da?«
»Richtig. Keine Sau war da von denen, sozusagen, als ich ankam. Ich habe mich dann ein bisschen umgeguckt. Weil normalerweis ist da immer jemand da. Wenn nicht von den van Beuthens, dann wenigstens jemand von den Leuten, die da arbeiten.«
»Absolut niemand sozusagen?«
»Absolut niemand, richtig. Aber ihre Autos standen da. Beide. Beziehungsweise die Autos, die sie so jeden Tag fahren. Er einen Mercedes SUV, sie einen Jaguar Cabrio. Daneben haben sie ja noch drei Oldtimer: einen Mercedes 300 SE, dann noch einen Buckelvolvo P 544, und einen Triumph Roadster TR 4, alle drei wie neu und mit H-Kennzeichen. Weil vor dem Haus die beiden aktuellen Autos dastanden, bin ich nach hinten gegangen zu dem Car-Port, wo die Oldtimer stehen. Da war ein Platz leer. Das war der, wo sonst der Mercedes, also die ›Königsflosse‹, steht. An dem Pfosten daneben hängt ein Foto, wo der van Beuthen mit dem Wagen bei den Golden Oldies in Wettenberg einen Pokal bekommen hat. Da hat er sich mords was drauf eingebildet.«
»Noch mal zurück«, unterbrach Grabowski, »warum waren Sie überhaupt da? Was hatten Sie denn gewollt von den van Beuthens?«
»Ich wollte ihm, dem van Beuthen, seine Kettensäge zurückbringen. Die hatte er mir vor zwei Wochen ausgeliehen gehabt. Die wollte ich zurückbringen. Deshalb war ich da.«
»Wie viele Menschen leben denn insgesamt auf dem Hof?«
»Soviel ich weiß, insgesamt fünf. Die Eheleute van Beuthen. Dann noch die beiden Polen, der Stanislaw und der Marek, sein Bruder, die arbeiten da für die Nerzfarm von der Frau van Beuthen. Und dann noch die Jolanta, das ist die Frau von dem Marek, die kümmert sich um den Haushalt und so.«
Günter Grabowski notierte alles, was der Mann sagte. »Wissen Sie, was der Herr van Beuthen so macht? Ich meine, was er arbeitet oder so?«
»Soviel ich weiß, ist er in der Weinbranche zugange, hat da wohl einen Handel in Frankfurt. Was Genaues weiß ich aber nicht. Aber daneben hat er noch jede Menge andere Sachen am Laufen.«
»Was für Sachen?«
»Was weiß ich, mit Grundstücken und so. Keine Ahnung. Will da auch nichts gesagt haben.«
»Und die Frau van Beuthen? Arbeitet die auch was?«
»Na ja, die hat ihre Nerzfarm. Direkt bei dem Hofgut. Deshalb sind ja auch die beiden Polen da. Die kümmern sich um das Ganze.«
»Und wie sind Sie dann zu dem Fingerglied gekommen?«
»Vor dem Eingang. Zufällig. Ich war schon wieder unterwegs zu meinem Auto, da habe ich was vor der Treppe liegen gesehen. Und als ich näherkam, habe ich gesehen, dass es ein Stück Finger ist.«
»Einfach so?«
»Na ja, das war schon was komisch. Ich habe mir das erst einmal von allen Seiten angucken müssen, bevor ich überhaupt erkannt hatte, um was es sich da gehandelt hat.«
»Und dann?«
»Dann habe ich mir ein Tempo rausgezogen und habe sie da reingewickelt.«
»Die Kuppe?«
»Jawoll, die abbene Kuppe.«
DICK MOCK
Wie heißt das Mutterschwein in Ilbeshausen?«, lautete die Frage des Prüfers, auf die der Prüfling wie aus der Pistole geschossen antwortete: »Dack.«
»Gut«, kommentierte der Prüfer, um sogleich fortzufahren: »Jetzt aber mal was Schweres: In Maar?«
Rund achtzig Personen hatten sich im Gerätehaus des Feuerwehrstützpunkts Ulrichsein eingefunden. Die Einsatzfahrzeuge waren zu diesem Zweck auf den Hof hinausgefahren worden. Anlass für die Veranstaltung war, dass fünf neue, hochwertige Wärmebildkameras, deren Anschaffung durch den Vogelsbergkreis finanziell unterstützt wurde, durch den Landrat ihrer Bestimmung übergeben werden sollten.
Wärmebildkameras wurden bei der Feuerwehr in erster Linie zum Aufspüren von Glutnestern, der Suche nach Personen sowie zur Ortung baulicher Gegebenheiten eingesetzt. Sie ermöglichten es, ohne aufwendiges Hinzuziehen von Bauplänen im Innern von brandbefallenen Gebäuden das Vorhandensein von Treppen, Fluren und anderen Räumlichkeiten zu lokalisieren. Weil derartige Kameras nicht gerade billig waren, sollten die fünf, die heute übergeben wurden, dafür vorgesehen sein, nach einem speziell ausgetüftelten Einsatzplan von den Wehren des Kreisfeuerwehrverbandes Vogelsbergkreis gemeinsam genutzt werden zu können. Zur Feier des Tages hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichstein kleine szenische Darbietungen einstudiert, die im Rahmen des abendlichen Programms aufgeführt werden sollten.
So begann nach den Reden der Vorsitzenden und des Kreisfeuerwehrverbandes sowie des Landrats und des Bürgermeisters das engagiert improvisierte Unterhaltungsprogramm. Für die Aufführung war eigens eine provisorische Bühne aus Holzpaletten mit einer blauweißen Bordüre zusammengezimmert worden.
Bei der ersten szenischen Darbietung handelte es sich um das Stück Das Landexamen – frei nach dem von seiner Mitarbeit bei den Magazinen Pardon und Titanic bekannten Satiriker und Zeichner F. W. Bernstein. Darin ging es darum, wie die listige Landbevölkerung des Vogelsberg sich gegen den Zuzug unerwünschter Städter wehrt, indem sie ihnen eine Sprachprüfung abverlangt.
Um die Feier in einen angemessenen Rahmen zu betten, hatten weibliche Mitglieder der Feuerwehr neben anderen kleinen Köstlichkeiten »hessische Tapas« vorbereitet – wie man heute so sagte. Womit gemeint war: Mettwürste, Ahle Worscht, Presskopp, Bauernbrot, Handkäs mit Musik sowie ein großer Hackepeter-Igel mit Stacheln aus Zwiebelstiften und Augen aus schwarzen Oliven. Männliche Mitglieder hatten indes für zwei Hektoliter Licher Pils gesorgt sowie diverse Flaschen Vogelsberger Hanjer und Lauterbacher Vogelsberggeist bereitgestellt.
Mit dem Fortschreiten des Landexamens nahm die Stimmung des Publikums Fahrt auf. Die Feuerwehrleute Christian Thielebein (als Prüfer) und Sebastian Moeser (als Prüfling), beide um die Fünfzig und in Uniformen, die ihnen in Lauf der Zeit zu eng geworden waren.
Als auf der Bühne der Prüfling auf die Frage, wie das Mutterschwein in Maar heiße, nach längerem Überlegen antwortete »Dack«, brachen erste ungebremste Lacher aus.
»Quatsch. Ich gebe Ihnen gleich ›Dack‹. Wie sagt man in Maar?«, spielte Christian Thielebein, die Geduld verlierend.
Daraufhin Sebastian Moeser zögerlich: »Dock?«
»Immer noch, jawoll. Und in Stockhausen?«
»Auch Dock.«
»Herbstein?«
»Dack. Nee, Fregglsau.«
»Sehr richtig. Und in Nieder-Brechen?«
»Nieder-Brechen? Das ist doch gar nicht im Vogelsberg.«
»Bravo, gut erkannt. Aber in Ulrichstein?«
»Mutterschwein in Ulrichstein, das Mutterschwein in Ulrichstein? – Motterschwie?«
»Unsinn. Mock natürlich. Merken Sie sich das. Nun aber: In Meiches?«
»Schmock? Nee, Zock.«
»Was fällt Ihnen ein? ›Fregglsau‹ immer noch, ja. Und in Volkartshain?«
»Volkartshain, Mutterschwein, es werd doch net die Fregglsau sein?«
»Sie strapazieren meine Geduld. Aber Fregglsau stimmt. Jetzt Freiensteinau. Aber bitte nehmen Sie sich zusammen.«
»Freiensteinau?«
»Ja genau, …«
Um dem Prüfer keinen Anlass zu liefern, die Frage als nicht beantwortet zu bewerten, ging Moeser in die Offensive: »Nein, nein, sagen Sie es nicht. Ich komme drauf, ich komme drauf … Dick Mock, richtig?«
»Sehr gut. Und jetzt als Letztes: Weickartshain?«
Bevor Sebasatian Moeser in seiner Rolle als Prüfling zum Besten geben konnte, wie das Mutterschwein auf Weickartshainerisch hieß, erklang in die lachbegründete Atemnot hinein plötzlich die Overture zu Rossinis Wilhelm Tell als Klingelton aus einem Smartphone.
Obwohl die staccatogeprägte Beschallungseinlage sich kaum gegen die hochdezibelige Belustigungs-Akustik in dem Raum durchzusetzen vermochte, empfand der eine oder andere sie doch als störend. Weshalb Martin Queckbörner, der Eigner des besagten Mobiltelefons, bei dem es sich im Übrigen um den Chef der Grünberger Polizeistation handelte, von rechts und links ein nervig gezischeltes »Psst« zu hören bekam.
Queckbörner, der in schmucker Paradeuniform als offizieller Vertreter seiner Dienststelle an der Feier teilnahm, wäre in dem Moment nur zu gerne im Erdboden versunken. Denn schließlich hatte er trotz vorheriger Ansage sein Handy nicht auf lautlos gestellt.
Um nicht durch weitere Klingelmusik noch mehr Unbill auf sich zu ziehen, nahm er das Gespräch mit einem kurzen »Augenblick« an, um sogleich in den angrenzenden Schulungsraum zu verschwinden. Dort, inmitten der aufgetischten Verköstigungen, nahm er sodann Günter Grabowskis Anliegen entgegen.
Nachdem dieser berichten konnte, was sich soeben auf der Wache in Grünberg zugetragen hatte, meinte Queckbörner, nicht richtig verstanden zu haben. Weshalb er sicherheitshalber nachfragte: »’n abbene Finger?«
Grabowski seinerseits entgegnete, dass es sich nicht um einen gesamten Finger handele, sondern lediglich um das vordere Glied von einem, wie gesagt, um die Kuppe eines Fingers.
»Aber trotzdem eine abbene?«, wollte Queckbörner schlussendlich bestätigt bekommen. Was ihm aber nicht nennenswert weiterhalf. Welche Strategie sollte er seinem wachhabenden Kollegen zur Klärung des Sachverhalts auftragen?
Unentschlossen und hilfesuchend blieb sein Blick an den mit schwarzen Oliven gestalteten Augen des vor ihm postierten Hackepeter-Igels hängen, bevor er weiterwanderte zu einer daneben aufgetischten Marzipan-Torte, auf die mit Schokoladenguss geschrieben stand: Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.
JIM KNOPF
Hektor Deutschross hing an einem Affenbrotbaum in seinem Garten. Seine Füße baumelten vierzig Zentimeter über dem Boden, und um seinen Hals lag eine Schlinge aus Draht. Das Metall hatte sich so weit in seine Kehle eingeschnitten, dass das ausgetretene Blut sein leuchtend weißes Hemd rotkehlchenhaft eingesaut hatte.
Der Tote war knapp über sechzig, zirka 1,80 Meter groß, hatte volles, weißes Haar und trug eine blaue Baumwollhose zu einer weißen Kapitänsjacke. Aus dem Mund ragte seine Zunge ein Stück weit heraus, und die leblosen Augen fixierten einen Punkt unterhalb der prächtigen Villa, die mit ihrem hell strahlenden Gegenlicht den Konturen der Leiche einen leuchtenden Kranz verlieh.
Noch jetzt, wo ihn fraglos das Zeitliche gesegnet hatte, strahlte Hektor Deutschross mit seiner energischen Kinnpartie eine Aura der Macht aus, die er bestimmt noch gerne eine Weile ausgeübt hätte. Kein Zweifel, bei diesem Menschen handelte es sich um den Prototyp eines Born-Leaders.
Aber nun hing er leblos in dem parkähnlichen Garten seiner pompösen Villa in Windhoeks Nobelviertel Ludwigsdorf. Neben den weißen Slippern, die nach wie vor an seinen Füßen hingen, lagen wild verstreut sechs leere Weinkisten.
Mehrere Rasensprenger zischelten rhythmisch zu einer sanften Brise Benguela-Wind, der von der Atlantikküste über Swakopmund und die Namibwüste hinweg bis in den Deutschross’schen Affenbrotbaum wehte. Was bei anderer Witterung nicht weiter auffällig gewesen wäre, aber in dieser Nacht für ein seltsames Schauspiel sorgte.
Denn an den Armen und Beinen der Leiche waren handelsübliche Kordeln aus Polypropylen befestigt, die mit Ästen des Baumes verbunden waren. Weshalb Deutschross’ Extremitäten durch den Wind, der sich in den Ästen verfing, in Bewegungen versetzt wurden, die an die Figuren der Augsburger Puppenkiste erinnerten.
Als Nelson Fontain vor dem Anwesen eintraf, standen dort auf der Straße und der Einfahrt davor bereits ein halbes Dutzend Einsatzfahrzeuge der Polizei und der üblichen Rettungskräfte mit eingeschalteten Lichtwarnbalken auf den Dächern. Der schon von Weitem erkennbare bunte Lichterschein hätte es mit der Lightshow jeder Diskothek aufnehmen können. Eine beeindruckende Demonstration von Polizeipräsenz, allerdings einer verspäteten.
Chief-Inspector Fontain hatte den Abend mit seinem Freund Jasper Kahli verbracht. Der war unangemeldet aufgetaucht, weil er Stress mit seiner Frau hatte. Die hatte nämlich beim Leeren seiner Taschen eine Quittung über ein Essen zu zweit im Stellenbosch gefunden gehabt, wo sie noch nie mit ihm war. Jasper betrieb eine Schrauberwerkstatt auf der Hans-Dietrich-Genscher-Street. Er hatte seiner Frau erklärt, dass die Quittung offenbar aus einem Wagen stamme, der zur Reparatur bei ihm sei. Aber sie wollte nichts davon hören. Für sie war klar, dass er eine andere ausgeführt hatte.
Nelson kam es nicht ungelegen, dass Jasper plötzlich vor seiner Tür stand. Denn bereits eine Woche zuvor war die Lichtmaschine seines Honda in die Knie gegangen und musste erneuert werden. Wofür man sich vornahm, das Auto am kommenden Tag in die Werkstatt zu transportieren.
Weil Nelson nichts zu trinken im Haus hatte, das er hätte anbieten können, waren die beiden zu Pick ’n Pay auf der Independence Avenue gefahren, um sich für den Abend mit Windhoek Lager einzudecken. Und weil sie schon mal da waren, hatten sie auch gleich eine Packung Boerewors mitgenommen, um den Abend mit einem Braai zu krönen.
Dabei handelt es sich um ein Grillen, bei dem traditionell keine fertige Holzkohle verwendet, sondern Holz von Kameldornbäumen verfeuert wird, das zunächst herunterbrennen muss, bevor es zu Kohle wird. Das dauert zwar länger, eröffnet aber dafür mehr Zeit für Geselligkeit und räumt den Grillmeistern die Möglichkeit ein, währenddessen schon mal die ersten Flaschen Windhoek Lager abzupetzen.
Bei Boerewors handelt es sich um eine ungebrühte Wurst, die zu einer Schnecke geringelt und mit reichlich Koriander gewürzt gegrillt oder besser gesagt »gebraait« wird.
Der Kauf von Boerewors im Supermarkt stellte – jedenfalls für Nelson Fontain – eine ganz besondere Herausforderung dar. Denn dabei war es unerlässlich, penibel darauf zu achten, dass bei den in zwanzig Zentimeter lange Zickzacklinien eingeschweißten Wurstschlangen nicht an den kritischen Knick-Stellen der dünne Wurstdarm gerissen war. Weil dann nämlich an diesen Stellen der Saft aus der Wurst tropfen und sie dadurch austrocknen würde.
Erschwert wurde diese detektivische Herausforderung dadurch, dass die Hersteller ihre Preisschilder mit Vorliebe an eben diese kritischen Stellen klebten, wodurch die Beschädigung – jedenfalls laut Nelson Fontain – kaschiert werden sollte.
Gerade als das durchgebrannte Kameldornbaumholz sich langsam in eine fette Glut verwandeln wollte und die Boerewors endlich hätte aufgelegt werden können, ging Nelsons Handy.
Jaspers Reaktion war ein vorahnendes »Oh nein«.
Aber da war es schon zu spät. Nelson hatte sich gemeldet und hörte zu, was ihm übermittelt wurde, bestätigte drei-, viermal in Katutura-speech »oreit«, wiederholte, dass es sich um eine Anschrift in Ludwigsdorf handele, und beendete das Gespräch, nachdem er dargelegt hatte, aus genussmitteltechnischen Gründen abgeholt werden zu müssen.
In jedem anderen, anständigen Beruf machen die Leute irgendwann Feierabend, hallte in seinem Kopf der Kommentar seines Freundes nach, als der Streifenwagen mit Nelson auf der Rückbank vor dessen Haus losfuhr.
»Habt ihr ein Kaugummi für mich?«, fragte er die uniformierten Kollegen auf den vorderen Sitzen. Der Beifahrer reichte ihm kommentarlos eine Packung Fisherman’s Friend Spearmint: »Hier, ist sogar noch besser.«
»Danke.«
Nelson nahm sich zwei Bonbons aus der Packung, steckte sie in den Mund und reichte die Packung wieder zurück.
»Wisst ihr, was da passiert ist?«, fragte Nelson seine uniformierten Kollegen.
»Ein Toter, so hieß es im Funk«, antwortete der Fahrer.
»Sonst nichts?«
»Höchstens noch, dass Diskretionsstufe eins gilt«, fügte der Beifahrer hinzu.
»Verstehe«, sagte Nelson und lutschte den Rest der Fahrt an seinen Fisherman’s Friend.
Unmittelbar nach Fontain trafen ein Leichenwagen und ein Löschzug der Feuerwehr vor dem Deutschross’schen Anwesen ein.
»Was ist passiert?«, wollte Fontain wissen, nachdem er aus dem Streifenwagen ausgestiegen und Inspektor Panda auf ihn zugetreten war. Panda, Ende vierzig, hieß eigentlich Alfred Shoopala und verdankte seinen Spitznamen zum einen seiner untersetzten Körperfülle, zum anderen der Tatsache, dass er einmal bei einer Weihnachtsfeier zum Besten gegeben hatte, froh zu sein für jede Nummer, die er nicht mehr schieben müsse.
»Ein Toter«, antworte er, »an einer Drahtschlinge, an einem Baum.«
»Selbstmord?«
»Schwer zu sagen. Neben ihm auf dem Boden lagen ein paar leere Weinkisten. Da könnte er sich draufgestellt und sie umgestoßen haben. Aber es könnte natürlich auch ganz anders gewesen sein.«
»Dass jemand anders ihn da draufgestellt und die Kisten umgetreten hat?«
»Zum Beispiel.«
»Wer ist der Mann?«, fragte Fontain.
»Hektor Deutschross.«
»Deutschross? Von der …?«
»Richtig. Von der Uran Mine, Deutschross Uranium Limited bei Swakopmund. Fast fünfhundert Mitarbeiter und weltweit einer der Marktführer im Tagebau von Uran für Kernkraftwerke.«
»Und warum wohnt er hier, wenn seine Firma ihren Sitz in Swakopmund hat?«
»Na, warum wohl? Wahrscheinlich, weil er Angst hat vor der Radioaktivität da.«
Fontain blickte sich um. Die Deutschross’sche Villa war wie alle Häuser in der Gegend mit schmiedeeisernen Gittern vor den Fenstern ausgestattet, die Türen mit Stahlblech beschlagen und die Gärten mit Mauern abgeschottet. Darauf jeder Vorsprung mit angeschliffenen Glasscherben bestückt und jede Brüstung mit Stacheldrahtrollen und Elektrozäunen gesichert. Nicht zu reden von obligaten Alarmanlagen und Security-Personal.
Als die Männer sich der Leiche näherten, konnte Fontain sich nicht die Bemerkung verkneifen, ob da vielleicht jemand ein bisschen zu viel Jim Knopf geguckt haben könnte.
»Bist du ruhig«, zischelte Panda, »wir sind hier in Ludwigsdorf und nicht in Katutura.«
Was so viel heißen sollte, dass man sich hier auf Boden befand, der »Apartheid hin, Apartheid her«, nach wie vor dem Lager der weißen Herrenmenschen zuzurechnen sei.
Das Fahrzeug der Feuerwehr wurde in die Nähe der herabhängenden Leiche manövriert und eine Rettungsleiter ausgefahren. Ein junger, sportlicher Feuerwehrmann schwang sich die Stufen hoch und konnte gerade noch davon abgehalten werden, das Drahtseil, an dem Hektor Deutschross hing, mit einem Seitenschneider durchzutrennen.
»Stopp!«, rief ein Mann, der sich sogleich als Rechtsmediziner zu erkennen gab, »immer der Reihe nach, ja.«
Nachdem er den jungen Feuerwehrmann die Leiter heruntergepfiffen hatte, stieg er selbst hoch und zog dem toten Deutschross seine hellblaue Baumwollhose runter, um seine rektale Erledigung in Angriff zu nehmen.