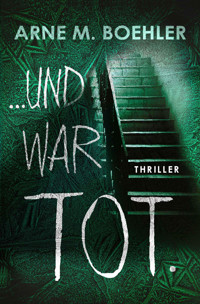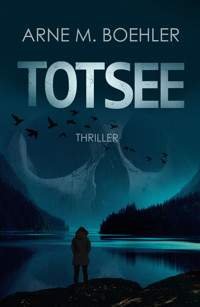
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nora Dahn ist die beste Personenschützerin Deutschlands. Sie hat Weltstars bewacht, Kanzler und Industrielle. Ihr neuer Auftrag hört sich harmlos an: Eine junge Frau beim Urlaub in den Bergen begleiten? Nichts leichter als das. Am idyllischen Bergsee angekommen merkt Nora jedoch schnell, dass ihren neuen Schützling ein düsteres Geheimnis umgibt. Noch bevor sie die Reißleine ziehen kann, steckt sie inmitten einer tödlichen Verschwörung, die ins dunkelste Kapitel der deutschen Vergangenheit zurückreicht. Nicht nur Noras eigenes Leben gerät in höchste Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Epilog
Dank ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
Das Weinen der Kinder
Leseprobe
Impressum
Erster Teil
Prolog
Mein Vater hat AIDS erfunden. Dieses gottverdammteGenie, denkt Karsten von Hallstein. Dabei wurde sein Vater nicht müde zu erklären, dass seine Mitstreiter und er die explosionsartige Ausbreitung der Afrikaner im Zaum halten wollten. Und ihre eigene, weiße Welt sauber.
Wie man inzwischen weiß, ist das Virus nicht auf dem schwarzen Kontinent geblieben. Es breitete sich ungehindert auf dem Planeten aus und raffte Tausende hinweg.
Doch Karsten von Hallsteins Vater verkaufte den kleinen Fauxpas als Erfolg. Immerhin habe die Seuche dafür gesorgt, den Schwulen, Schlampen und Junkies in unseren Gefilden ihre Grenzen aufzuzeigen.
Ein gottverdammtes Genie in der Tat, denkt Karsten von Hallstein.
Aber ich werde ihn übertrumpfen.
Nicht nur ihn. Sie alle.
Wilhelm von Hallstein zum Beispiel, der einem gewissen Adolf Hitler zur Macht verhalf. Oder Leonhard von Hallstein, der die Verschwörung verantwortete, die den wahren Ausgang des Ersten Weltkriegs vertuschte.
Karsten von Hallstein kann seine Ahnenreihe bis ins sechzehnte Jahrhundert rückverfolgen, als einer seiner Vorfahren mit dem Plan scheiterte, Martin Luther zu ermorden. Dass andere Verschwörungen der illustren Familie ebenfalls ein wenig aus dem Ruder liefen, ist den von Hallsteins nicht anzulasten. Wer rechnet schon damit, dass so ein läppischer Krieg sich über dreißig Jahre hinzieht?
Die Absichten der von Hallsteins und ihrer jeweils neunundzwanzig Mitstreiter waren dienten stets dem Wohle der Menschheit und – es ist ja keine Schande – auch dem der Privatschatulle.
Man sieht dem alten Adelsgeschlecht seine Rührigkeit nicht an. Der Stamm hat unscheinbare Menschen hervorgebracht, und Karsten von Hallstein könnte sich rühmen, der Unauffälligste zu sein. Er ist zwar groß, aber schmal und blass. Sein rötliches Haar wird bereits schütter, und wenn er lächelt, wird sein Mund schief. Seinen Job bei einem bekannten deutschen Familienunternehmen erledigt er unaufgeregt und zur vollen Zufriedenheit des Eigentümers. Er ist verheiratet, hat zwei niedliche Töchter und einen Labrador, der mindestens einmal in der Woche irgendwo im Schloss auf einen Teppich kotzt.
Richtig. Den alten Kasten mit den Türmen und Erkern besitzt Karsten auch. Und einen Berg von Schulden, denn so ein Schloss verschlingt ein Vermögen.
Karsten selbst hat noch nie dazu beigetragen, die Welt zu verbessern. Ein paar kleine Geschichten haben die Dreißig schon inszeniert, seit er dort Mitglied ist, klar. Da gab es das Skandälchen mit ein paar Nutten, das einen Wirtschaftsminister der Sozen dazu zwang, sein Amt niederzulegen. Oder ein Datenschutzgesetz, welches das genaue Gegenteil dessen bewirkte, was sein Name suggerierte. Nichts Weltbewegendes.
Beide Aktionen halfen vor allem Nummer drei dabei, seine Pfründe zu mehren.
Aber Karstens Zeit wird kommen. Er weiß es.
Dann treffen die Nachrichten des Herbstes ein – eine Flut von verstörenden Meldungen. Ein Aufschrei in der Presse und der Bevölkerung. Und Liesbeth, Karstens Frau, beginnt darüber zu spekulieren, was aus ihrem schönen Land, aus ihrem Europa nun werden würde, mit den ganzen Fremden, die da ankommen. Was mit den Arbeitsplätzen geschähe und der Sicherheit auf den Straßen. Und wie die Zukunft ihrer beiden Töchter aussähe.
Düster, antwortet Karsten. Sehr düster.
Aber er weiß, dass nun seine Stunde geschlagen hat. Es ist an der Zeit, den Club der Dreißig zu aktivieren und am ganz großen Rad zu drehen. Noch bevor er selbst zum Hörer greifen und eine Vollversammlung einberufen kann, meldet sich die Vierzehn bei ihm. Karsten ist die Achtzehn.
Er habe da so eine Idee, sagt die Vierzehn. Und wenn Karsten sich in der Sache bewähre, dann könne er an deren Ende vielleicht sogar die Sechzehn beerben, wer weiß? Die Sechzehn ist schwer krank und von ihrer Position ist der Weg nach oben sperrangelweit offen.
Klingt gut, klingt sehr gut, antwortet Karsten und legt den Hörer auf, noch bevor er ihm aus den vor Erregung feuchten Fingern gleiten kann.
Zwei Stufen aufzurücken klingt verlockend, in der Tat. Sein Vater, der gottverdammte Erfinder von AIDS, war am Ende seiner Laufbahn Nummer sieben.
Aber Karsten hat höhere Ziele.
Viel höhere.
Er will nach ganz oben. Er will Deutschland regieren.
Als sein König.
1
Mittwoch, 5. Juli
Die Reise war stressig. Nora Dahn schließt die Wohnungstür auf und stellt den Koffer ab. Sie zieht die Jacke aus, ihr Lieblingskleidungsstück. Grober, schwarzer Stoff mit runden Silberknöpfen – einst Teil der Uniform eines englischen Polizisten, von Nora auf einem Flohmarkt in London entdeckt.
Ohne großes Interesse sieht sie die Post durch, die jemand säuberlich auf der kleinen Kommode im Gang gestapelt hat.
Rechnungen und Werbung, das Übliche. Außer einem Brief, der mit Noras eigener, wenig geübter Handschrift adressiert ist.
Annahme verweigert – zurück an Absender.
Sie zerreißt ihn, so wie seine Vorgänger.
Die Rechnungen kommen ins Besteckfach, zu ihren Schwestern. Aus den Augen aus dem Sinn.
Das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee umschmeichelt ihre Nase.
Enes ist da. Wie schön, er macht anscheinend Home-Office. Noras Herz schlägt einen Tick heftiger.
Auf Zehenspitzen schleicht sie in die Küche.
Ein Sektkühler steht auf dem Tisch, darin eine angebrochene Flasche Moët & Chandon.
Zwei Gläser.
Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Woher kann er wissen, dass sie zwei Tage früher nach Hause kommt?
Kann er nicht. Sie will ihn ja überraschen.
Sie hat am Bahnhof extra einen Strauß rote Rosen für ihn gekauft.
Die beiden Sektkelche sind benutzt. An einem haftet Lippenstift.
Auf den wenigen Metern ins Schlafzimmer sucht Noras Gehirn fieberhaft nach einer unverfänglichen Erklärung für den Schampus und den roten Lippenabdruck.
Es findet sich keine.
Die Schlafzimmertür steht offen.
Auf dem Bett kniet eine nackte, blonde Frau mit großen Hängebrüsten. Ihre Hände sind mit Noras Handschellen auf den Rücken gefesselt, im Mund steckt Noras Knebel. Enes, geschmückt mit Noras Ledermütze, dringt gerade stöhnend in sie ein.
Ein Strauß roter Rosen fällt raschelnd zu Boden.
Sie verlässt die Wohnung und geht zurück zur U-Bahn. In Sneakers diesmal. Zusätzlich hat sie sich in das Kostüm geworfen, wie sie es nennt: die braune Baseballkappe aus Leder und den beigen Inspektor-Columbo-Mantel. Darunter Jeans und T-Shirt, wie immer. Im Gesicht trägt sie die dunkle Sonnenbrille.
Kappe und Mantel verströmen einen muffigen Geruch, weil sie beide schon lange nicht mehr aus dem Schrank geholt hat.
Aber heute muss es sein.
Wegen Enes, dem Arschloch, der ohnehin nicht der Richtige war, eh klar. Genauso wenig wie all die anderen vorher.
Aber nicht nur wegen ihm. Auch wegen des abermals zurückgewiesenen Briefs, den sie sofort zerriss.
Annahme verweigert.
Jetzt, nachdem die Arbeitsbienen ihre Büros und Werkbänke erreicht haben, ist die U 6 für Berliner Verhältnisse ziemlich leer. Während die Bahn Fahrt aufnimmt, lässt Nora sich in einen der Sitze plumpsen und nimmt die Brille ab. Das hässliche Muster der Bezüge erinnert sie an das Bildschirmrauschen, das früher nach Sendeschluss über die Fernseher flimmerte.
An der Station Friedrichstraße steigen zwei attraktive, junge Südländer mit umgedrehten Basecaps und Goldketten ein. Sie mustern Nora oberflächlich, flegeln sich dann in einen Sitz und beginnen, über ihr Informatikstudium zu palavern.
Die Bahn beschleunigt. Nora erinnert sich an den fremden Duft, der seit Kurzem an Enes haftete. Dass er viel häufiger »zu einer Konferenz nach Hamburg« gefahren ist als früher. Und nicht zuletzt an seinen neuen Fimmel, das eigene Gesicht vor dem Badezimmerspiegel akribisch nach Fältchen abzusuchen, um sich dann versichern zu lassen, dass er keinen Tag älter aussehe als dreißig. Sie hat es ihm gerne bestätigt. Wie bescheuert.
In Wedding verlassen die zwei Informatikstudenten die Bahn, einer nickt Nora freundlich zu, der andere hilft einer Frau mit Kinderwagen über die Kante. Dann geht die Fahrt weiter.
Nora würde Enes gerne eine reinwürgen. Aber wozu? Und sie wüsste ohnehin nicht, wie.
Jetzt ist erst mal etwas anderes dran. Der Drang ist wieder da. Stärker als je zuvor. Nur wegen diesem Saukerl.
An der Seestraße steigt sie aus der U-Bahn und fährt mit der Rolltreppe nach oben. Sie setzt sich wieder die große Sonnenbrille auf und geht den kurzen Weg in die Müllerstraße, wo sie einen Drogeriemarkt betritt.
Der Laden ist mäßig frequentiert: Ein leicht überfordert wirkender, junger Mann deckt sich mit Windeln, Reinigern und Klopapier ein. Eine Dame mittleren Alters, die Nora schon in der U-Bahnstation sah, begutachtet die Auswahl im Kondomregal und sieht sich dabei nervös um. Wenn sie aus demselben Grund wie Nora hier ist, sollte sie sich etwas unauffälliger gebärden.
Doch die Verkäuferin im weißen Kittel ist ohnedies abgelenkt. Ein paar Teenager stehen vor der Parfumauswahl, besprühen sich ausgiebig mit einem Testflakon und kichern dabei. Sollten Kids um diese Uhrzeit nicht in der Schule sein? Oder sind schon wieder Ferien?
Mit geübtem Blick sucht Nora die Decke ab. Ihr Herzschlag wird heftiger, aber das gehört dazu.
In zwei Ecken sind schräg gegenüber voneinander weiße Überwachungskameras installiert, die den ganzen Raum bestreichen. Kein Problem, Nora kennt die Tricks. Nur Anfänger sind auf den Aufzeichnungen solcher Kameras zu erkennen.
Sie geht zu einem Kosmetikregal und begutachtet die Auswahl. Nimmt mit schwitzigen Fingern einen bräunlichen Lippenstift von L’Oréal von der Stellage und hält ihn prüfend neben seinen helleren Cousin von Dior. Stellt den Stift wieder zurück, dreht sich unauffällig zur Seite, um ein letztes Mal sicherzugehen, dass die Kameras sie hier nicht erfassen können. Die Verkäuferin ist immer noch von den jugendlichen Parfumtesterinnen abgelenkt.
Nora nimmt zwei Dosen Puder und einen Lippenstift und steckt sie langsam in die Tasche des Trenchcoats. Sie steht so, dass ihr Körper den Vorgang vor den elektronischen Augen verbirgt.
Langsam schlendert sie mit einem freundlichen Gruß an der Verkäuferin vorbei und verlässt den Markt. Adrenalin flutet ihre Blutbahnen. Sie würde jetzt am liebsten laut schreien, um sich Luft zu machen. Oder davonrennen, doch das verbietet sich selbstverständlich.
Ihrer Therapeutin hat Nora den Gefühlszustand nach einem Beutezug im Drogeriemarkt einmal beschrieben wie die Augenblicke vor und nach dem Orgasmus: Auf heftigste Erregung folgt tiefste Befriedigung. Seelenruhe. Und, im Gegensatz zum Sex, eine Hucke voll mit schlechtem Gewissen, als Zeichen, dass sie noch nicht völlig abgestumpft ist.
Sie zwingt sich, in Richtung Seestraße zu bummeln, checkt dabei das Handy: eine Nachricht von Enes.
Ungelesen löschen.
An der U-Bahnstation ist ein Großteil ihrer Erregung bereits verflogen. Bevor sie in den Untergrund abtaucht, übergibt sie die gestohlenen Schminksachen einem Mülleimer.
2
Als sie zu Hause ankommt, geht es ihr besser.
Der Anrufbeantworter blinkt nervös. Vier Anrufe. Alle von der gleichen, unbekannten Festnetznummer.
Nicht Enes.
Sie setzt sich an den Küchentisch, nimmt Kugelschreiber und Papier zur Hand und beginnt, einen neuen Brief zu schreiben. Einen von dutzenden, die sie in den vergangenen drei Jahren verfasst hat, immer in der Hoffnung, dass der Adressat eines schönen Tages Erbarmen mit ihr haben und antworten wird. Doch er schickt alle Briefe ungeöffnet zurück.
Wortreich formuliert sie ihre Botschaft – so wie immer. Dabei ließe sich die verklausulierte Nachricht in zwei simple Sätze pressen:
Es tut mir leid. Bitte melde dich.
Doch so leicht macht sich Nora die Sache nicht. Es gab Zeiten, da schrieb sie monatelang keinen solchen Brief, weil sie den Glauben verloren hatte, jemals eine Antwort zu bekommen. Doch irgendwann griff sie dann doch wieder zum Stift. Sie ist noch nicht so weit, um aufzugeben.
Nachdem sie die vier eng beschriebenen Seiten eingetütet und frankiert hat, hört sie den Anrufbeantworter ab.
»Ruf mich bitte zurück! Es ist wichtig.«
Henryk Simons, welche Ehre!
»Ist heute Welttag der Blödiane?«, murmelt sie.
Es ist lange her, dass sie ihn zum letzten Mal gesehen oder gehört hat.
Sie sind im Unfrieden auseinandergegangen.
Es kann ihr egal sein, was er will.
Statt ihn anzurufen, lässt sie sich eine Tasse Kaffee aus der Maschine und setzt sich auf den winzigen Balkon.
Sie muss ihr Leben neu ordnen. Einen Plan machen, wie sie die Rechnungen bezahlen will, die sich in der Besteckschublade angesammelt haben. Das lausige Honorar von Helena Krügers Agentur wird dafür nicht ansatzweise reichen. Dabei war es das höchste seit Langem.
Nora gähnt, lässt die halb ausgetrunkene Tasse auf dem Balkon stehen, geht ins Bad, zieht sich aus und stellt sich vor den Spiegel. Ihr schmales Gesicht sieht müde aus, fast so, als gehöre es einer Fünfzigjährigen. Doch ihre halblangen, stark gelockten Haare zeigen keine Spur von Grau und ihr Körper ist ebenfalls noch sehr gut durchtrainiert.
In der Dusche streichelt das warme Wasser ihren Körper, während ihr Kopf – dieser elende Verräter – wieder an Enes denkt. Den Vollpfosten.
Der Anblick seiner gefesselten Gespielin kommt Nora in den Sinn.
Sie beginnt sich selbst zu befriedigen. Erst halb unbewusst und sanft, dann immer intensiver, bis es ihr heftig kommt.
Kaum hat sie sich abgetrocknet, klingelt wieder das Telefon. Der Vollpfosten würde nicht anrufen und versuchen, sich zu entschuldigen, oder?
»Ja?«
»ATENTA Security Service, Henryk Simons am Apparat. Hi, Nora. Lange nichts von dir gehört! Bist schwer zu erreichen dieser Tage.«
Befremdet registriert Nora Enttäuschung darüber, dass es nicht Enes ist, der am anderen Ende spricht.
»Spar dir die Freundlichkeiten für jemand anderen auf. Was willst du? Ich bin erst heute Morgen nach Hause gekommen. Und die Sprechstunde für Armleuchter ist erst morgen wieder.«
»Na, na! Begrüßt man so einen alten Freund?«
»Was willst du?«
»Wie war die Tournee?«
Er weiß offenbar gut über Noras Leben Bescheid.
»Helena Krüger soll anstrengend sein.« Sie kann hören, wie er bei diesen Worten grinst.
»Lass die Spielchen!«
»Na komm schon! Wie ist die Krüger so? Stimmt es, was man munkelt? Dass sie eine selbstverliebte Zicke ist?«
Nichts liegt Nora ferner, als in seine rhetorische Falle zu tappen und mit ihm über ihre Klientin herzuziehen.
»Ich wüsste zwar nicht, was dich das angeht, aber die Tournee war großartig.« Es ist nicht die größte Lüge des heutigen Tages. In Wahrheit war die Konzertreise kräftezehrender als die Besteigung des Mount Everest – und nicht halb so vergnüglich.
»Das kannst du deinem Toaster erzählen! Was soll an einer Klassenfahrt durch die deutsche Provinz großartig sein? Noch dazu an der Seite eines C-Promis, der dich als Personenschützerin lediglich engagiert, um wichtiger zu erscheinen als er ist.«
»Sie hat bei ›Deutschland sucht den Superstar‹ gewonnen!«, verteidigt sich Nora. Wie ist es ihm gelungen, sie in eine Defensivposition zu zwingen?
»Ja, sicher. Vor vier Jahren. Das ist eine Ewigkeit in diesem Geschäft.«
»Die Säle waren ausverkauft.«
»Klar. Die Mehrzweckhalle in Gundelsheim und das Bierzelt in Poppendorf kriegt auch mein hässlicher Schwager mit seiner Umptata-Musik voll. Und der Rest der Krüger-Tour war halbleer. Ich kann auch googeln, Nora. Die Tournee war der Flop des Jahrhunderts.«
»Und wenn schon! Wüsste nicht, was dich meine Jobs angehen. Was willst du?«
»Richtig. Lass uns nicht länger um den heißen Brei herumreden: Ich brauche eine Frau mit Erfahrung für einen sehr, sehr gut bezahlten, gemütlichen Auftrag.«
»Und da denkst du an mich? No way!«
Es tut gut, ihn so abblitzen zu lassen.
»Willst du mich nicht erst einmal erklären lassen, worum es eigentlich geht?«
»Nein. Ich arbeite nicht für dich! Du hast mich höchstpersönlich rausgeschmissen, schon vergessen?«
»Ich konnte nicht anders.«
»Blödsinn. Es war nicht meine Schuld, dass zu wenig Security in der Halle war. Du warst für das Sicherheitskonzept verantwortlich, trotzdem wurde ich gefeuert. Obwohl ich unter diesen Umständen den Minister unmöglich vernünftig schützen konnte. Ich war dein Bauernopfer. Dabei hätte dein Kopf rollen müssen. Während ich mich mit abgehalfterten Popsternchen herumschlage, bist du bei der ATENTA auf der Karriereleiter nach oben gestolpert.«
»Deshalb rufe ich ja an.«
»Um dich zu entschuldigen? Pah! Richte Margot Grüße von mir aus. Wiedersehen!«
Sie drückt die Taste zum Beenden der Verbindung.
Sofort klingelt das Telefon wieder.
»Verpiss dich endlich, Henryk!«
»Es geht um Kim Bergström.«
»Peter Bergströms Tochter?«
»Ja. Kennst du sie?«
»Nein, nicht direkt. Ich hatte mal kurz mit ihrem Vater zu tun. Aber darüber bist du sicher längst im Bilde.«
»Nein, wusste ich nicht. Es spielt auch keine Rolle. Du weißt, dass er erschossen wurde? Peter Bergström?«
Den ungeklärten Mord an dem Magnaten konnten selbst die hermetisch abgeschirmten Bergströms nicht vor der Öffentlichkeit verheimlichen.
»Mhm.«
»Wusstest du, dass ihre Mutter auch tot ist?«
Noras Zunge fühlt sich plötzlich zu dick und schwer für ihren Mund an.
»Ist das so?«, presst sie zwischen den Zähnen heraus. Schmerzhafte Erinnerungen torpedieren ihr Bewusstsein. Ein Gemisch aus Schuld, Trauer und Hilflosigkeit.
»Ja, schon lange.«
»Was hat das mit mir zu tun?«
Ihr Innerstes kennt die Antwort: Der Auftrag wäre die Chance, es wiedergutzumachen.
»Ganz einfach«, sagt Henryk. »Kim Bergströms Großcousin ist leicht exzentrisch. Er ist der Geschäftsführer der Firma, außerdem scheint er ein Sicherheitsfanatiker zu sein. Er will für seine junge Verwandte eine Personenschützerin engagieren, die sie bei einem Urlaub in den Bergen rund um die Uhr begleitet. Frag mich nicht, wovor er Schiss hat, er macht ein großes Geheimnis daraus. Das müsstest du vor Ort mit ihm klären.«
»Vergiss es!«, sagt Nora schroff, obwohl sie der Auftrag interessiert. Doch das wird sie ihm nicht auf die Nase binden. Sie hat einst beschlossen, nie wieder einen Finger für Henryk Simons krumm zu machen. Und das gilt.
»Warum nicht?«
»Das weißt du ganz genau.«
»Du tust es ja nicht für mich. Sondern für Bergström! Ich bin nur der Vermittler.«
»Nein!«
»Hast du mir überhaupt zugehört?« Henryks gespielte Freundlichkeit schwindet. »Der Job rechnet sich und das Geld ist fast geschenkt. Du musst einfach ein paar Wochen mit einer reichen Göre Bergwandern gehen. Das ist doch ein Kinderspiel für dich.«
»Warum gerade ich?«
»Die Kleine akzeptiert keinen männlichen Personenschützer. Die sind ihr zu unsensibel. Gute weibliche Exemplare sind dünn gesät, und von denen bist du mit Abstand die Beste.«
Das merkt die Blitzbirne jetzt? Nachdem er sie hochkant rausgeschmissen hat?
»Erde an Henryk: Ich sagte nein!«
»Bitte, Nora.«
Er fleht. Wie putzig.
»Es ist wirklich wichtig«, barmt er. »Siegmar Kling und seine Firma sind bedeutende Kunden, die man nicht ungestraft enttäuscht.«
»Dein Problem, mein Lieber.« Es gefällt Nora, ihn verhungern zu lassen. Hat er tausendfach verdient.
»Okay ... du willst es nicht anders. Ich wollte uns das ersparen, aber du lässt mir keine andere Wahl«, sagt er eisig. »Es gibt da ein hübsches Video von dir, das einen gewissen Drogeriemarkt brennend interessieren dürfte.«
»Wie bitte?«
»Jep. Ganz frisch. Von heute Morgen. Zwei Dosen Puder und ein Lippenstift. Ich kann dir das Werk gerne schicken. Bist bombig getroffen. Schön scharf, in HD.«
Nora erinnert sich an die komische Frau am Kondomregal in der Drogerie.
»Du hast mich ausspionieren lassen?«
»Nicht doch ...«
»Und jetzt willst du mich erpressen? Nur damit ich für dich einen läppischen Job übernehme? Spinnst du eigentlich total?«
»So würde ich das nicht nennen. Außerdem ist der Job alles andere als albern. Und ich weiß einfach, dass man dich zu deinem Glück zwingen muss.«
»Darauf gehe ich nicht ein! Kein Richter auf diesem Planeten akzeptiert so ein Video als Beweismittel für irgendwas! Wenn es überhaupt existiert!«
»Willst du es darauf ankommen lassen?«
»Du machst mir keine Angst!«
»Das liegt mir auch fern. Falls du wegen deiner kleinen Vorliebe aber verurteilt wirst, kannst du künftig als Putzfrau gehen.«
Sie weiß, dass er Recht hat. Klienten, die sich eine Personenschützerin leisten, durchleuchten die Bewerber gründlich, polizeiliches Führungszeugnis gemäß § 32 Bundeszentralregistergesetz inklusive. Und eine vorbestrafte Diebin? Lässt man eher nicht in seine Nähe ...
Aber Nora liebt ihren Beruf.
»Okay, du Arschloch«, presst sie heraus. »Ich werde mir das Bergström-Mädchen ansehen.«
»Sie ist fabelhaft, ihr werdet euch mögen.« Henryk kehrt zu seiner widerlichen Fröhlichkeit zurück. »Der Job könnte übrigens deine Eintrittskarte zurück zur ATENTA sein. Bergström ist, wie gesagt, ein sehr einflussreicher Kunde.«
»Spar dir das Gesülze. Schick mir einfach das Dossier. Eins muss dir allerdings klar sein: Wenn ich diesen Job übernehme, wird das teuer. Ich will Zehntausend als Vorschuss und weitere Fünftausend je angebrochener Woche. Die Zeiten sind vorbei, in denen ich für lau die Kohlen für dich aus dem Feuer geholt habe.«
»Verlang, was immer du willst. Spesen in unbegrenzter Höhe obendrauf. Bergström zahlt.« Er legt auf.
Nora fröstelt. Sie hat das Gespräch im Stehen geführt, nur mit einem feuchten Handtuch bekleidet.
Henryk hat sie soeben skrupellos erpresst, ein Mädchen zu bewachen, dessen Name jedem Kind ein Begriff ist: Bergström Snörronil® – mit Husten leichtes Spiel. Aber auch Kinderlose dürften ein Bergström-Produkt in ihrer Hausapotheke finden. Sei es nur das allgegenwärtige Minudol®, das auch Nora nimmt, wenn ihre Regelschmerzen unerträglich werden.
Die Macher hinter den beiden Medikamenten bezeichnen ihr millionenschweres Unternehmen als Familienbetrieb. Sie scheuen die Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwasser, und im Vergleich zu Abbildungen von Mitgliedern der Bergström-Sippe sind Originalfotos des Yetis Massenware.
Von allen erdenklichen Klientinnen ist Kim Bergström diejenige, die Nora sich zuallerletzt ausgewählt hätte. Nicht weil sie die junge Frau nicht mag – sie kennt sie ja gar nicht. Und dennoch fürchtet sie sich vor ihr. Denn sie glaubt, ihr etwas zu schulden, das durch kein Gut der Welt aufzuwiegen ist.
Das Leben ihres Vaters.
3
Nur wenige Kilometer von Nora Dahns Wohnung entfernt steuert Karsten von Hallstein einen senfgelben Opel Corsa in eine schmale Straße in Berlin-Charlottenburg. Im Wagen riecht es nach Zigarettenrauch. Karsten hat den schmuddeligen Sitz ganz nach hinten geschoben, kauert aufgrund seiner Größe aber dennoch beengt hinter dem Steuer.
Sein Beifahrer heißt Muhammad und ist ein dunkelhäutiger Mann, dessen üppige Leibesmitte nicht zu seinem schmalen, mit einem löchrigen Bart bedeckten Gesicht passt. Muhammad ist deutlich jünger als Karsten und aus Syrien. Acht unerträgliche Jahre musste er dort Krieg über sich ergehen lassen. Die grausamen Bilder, die sich in sein Gehirn einbrannten, von Zerstörung, Brutalität und Tod, spiegeln sich im melancholischen Blick seiner schwarzen Augen. Kein Wunder. Musste er doch dabei zusehen, wie eine Granate des Diktators Assad seine junge Frau und seine wunderschöne zweijährige Tochter in Stücke riss.
Karsten von Hallstein schauderte bei Muhammads Bericht. Er dachte an Liesbeth und die beiden Töchter. Solche Zustände durften in Deutschland niemals herrschen. Ausgelöst durch religiöse Fanatiker.
Die Schuldigen für dein Leid leben in dem Land, das dich so großzügig aufgenommen hat, erklärte Karsten dem Syrer. Hier werden Waffen gebaut – auch Granaten, ergänzte er vielsagend. Außerdem gab Karsten ihm ein Mittel gegen seine Traurigkeit.
Und es wirkte.
Mittlerweile ist der Syrer komplett von Karstens Sicht der Dinge überzeugt und bereit, sich an seiner guten Sache zu beteiligen.
Karsten steuert den Wagen auf den Parkplatz eines Supermarktes und stellt den Motor ab. Ein paar südländisch aussehende Jugendliche mit albern aufgesetzten Baseballkappen und viel zu weiten Hosen hängen hier ab. Sie umringen einen aufgemotzten Mercedes, einer trägt ein Hoodie mit der Aufschrift »Ghetto Boy«. Sie interessieren sich nicht für das ungleiche Paar, das keine Anstalten macht, aus dem Corsa auszusteigen.
Nicht, was ihr denkt. Karsten unterdrückt ein Grinsen. Ganz im Gegenteil. Um unnütze Tagediebe wie diese Knaben wird er sich später kümmern.
Die beiden Männer im Auto warten schweigend.
Der junge Syrer weiß nicht, wer die Menschen sind, die jetzt in eine Kirche tröpfeln, hinter dem Zaun, der den Supermarkt umgrenzt. Das Gotteshaus ist ein großer Bau aus roten Klinkersteinen, der eingeklemmt wirkt zwischen der restlichen Bebauung aus Wohnblöcken und Gewerbebauten.
Mit einer sparsamen Geste, die der Syrer nur aus den Augenwinkeln wahrnimmt, zeigt Karsten von Hallstein auf die Männer, Frauen und Kinder, die in die Kirche gehen.
Muhammad nickt. Granatenbauer. Christen.
Karsten gibt ihm die letzte Pille gegen seine Traurigkeit. Muhammad brennt darauf, seinen Auftrag auszuführen. Will schon aussteigen und hinübergehen zur Kirche, doch sein Begleiter hält ihn zurück.
»Not yet.«
Sie beobachten, wie weitere Gläubige in dem neugotischen Bauwerk verschwinden. Einige einzeln, manche in Gruppen, zu zweit oder zu dritt. Es dürften sich jetzt etwa vierzig Menschen in der Kirche aufhalten.
Karsten sieht auf seine Armbanduhr.
Kurz nach sechs. Die Andacht beginnt.
»Now.«
Muhammad nickt und steigt aus.
Kein Abschiedswort.
Als er hinübergeht zur Kirche, spricht ihn Ghetto Boy an. Er lässt ihn hinter sich, ist ganz auf seinen Auftrag fixiert. Leise öffnet er das Portal des Gotteshauses der Ungläubigen. Herrliche Orgelmusik weht ihm entgegen. Eine traurige Melodie, um den falschen Gott zu preisen.
Karsten dreht den Zündschlüssel um und fährt vom Parkplatz. Er kommt nur wenige hundert Meter weit, bevor die Explosion des Sprengstoffgürtels durch die Straße donnert und die Seitenscheiben des Opels erzittern lässt.
Er nickt zufrieden. Der junge Syrer ist seinen Liebsten nachgefolgt, ebenfalls in Einzelteilen. Und die Herz-Jesu-Kirche in Berlin-Charlottenburg ist stark renovierungsbedürftig.
4
Montag, 10. Juli
Im Autoradio läuft Mariah Carey. Always be my baby. Genervt würgt Nora das Gedudel ab. Sie hat sich auf dem Weg zum von Henryk beschriebenen See zweimal verfahren, weil das Navi des auf Kosten der ATENTA gemieteten Mercedes-Cabrios nicht alle Gebirgssträßchen des Oberallgäus auf dem Schirm hat. Erst der Hinweis von zwei Wanderern in grellen Outdoorklamotten hat sie zurück zu einer unübersichtlichen Abzweigung gebracht, die sie zuvor bereits achtlos passiert hat. Kies knirscht unter den Reifen, als sie abbiegt und eine wagemutig aus dem Fels gehauene Trasse befährt, die durch eine enge Schlucht hinauf zu dem See führen soll.
Nora durchquert ein Waldstück, passiert mehrere schmale Tunnels und einen Wasserfall, der unweit der Fahrbahn in die Tiefe stürzt. Nach einigen weiteren Kehren öffnet sich ein breites Hochtal, in dem wie ein grünes Auge der Todtsee liegt. Sein Inhalt speist über einen unscheinbaren Bach den Wasserfall. An seinem Südufer reichen steile, bewaldete Berghänge direkt bis ans Wasser. Am von der Morgensonne beschienenen Nordufer breitet sich eine sanft ansteigende, hügelige Weide aus. In ihrer Mitte steht ein einzelnes Gebäude, von einem Garten umgeben, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, leicht erhöht über der Wasserfläche.
»Immerhin wachsen auch am Arsch der Welt Blumen.« Nora parkt den silbernen Benz neben einem obszön großen Range Rover. Die Scheiben des mächtigen weißen Monstrums sind mit Morgentau benetzt. Sie geht am See entlang auf das grüne Holzhaus mit den weißen Sprossenfenstern zu.
Der von einem mannshohen Zaun umgebene, parkähnliche Garten wirkt ungepflegt, doch Nora erkennt, dass jemand einst viel Mühe darauf verwendet haben muss, ihn anzulegen.
Die Pforte steht offen, also durchquert sie die Wildnis und steigt die wenigen Stufen zur Veranda empor, die drei Seiten des Hauses umläuft. Über der Tür hängt ein weißes Schild, auf dem in großen handgemalten Lettern die Worte »Grüne Villa« stehen.
Da Nora keine Glocke entdeckt, klopft sie an.
Als vorsichtig geöffnet wird, tritt sie unwillkürlich einen Schritt zurück.
Kim Bergström dürfte etwa zwanzig sein, und sie ähnelt ihrem Vater auf frappierende Weise. Einerseits.
Sie hat die gleichen hohen Wangenknochen und den gleichen vollen, wohlgeformten Mund, der ihrem Vater seinen faszinierenden, androgynen Zug verlieh. Die gleichen grüngrauen Augen, deren obere Lider zwei perfekte Bögen bilden. Kim hat eine dicke Maske aus Schminke und Puder aufgelegt, und im Gegensatz zu den Augen ihres Vaters wirken ihre Augen so dumpf und ermattet wie die einer Neunzigjährigen.
Ein Zombie. Kim Bergströms düstere Aura jagt Nora einen Schauer über den Rücken. Sie hat die junge Frau früher schon einmal flüchtig gesehen – vor zwei bis drei Jahren, als sie Peter Bergström abholte, um ihn zu einem Geschäftstermin zu begleiten. Von dieser Begegnung ist ihr ein unbeschwerter Teenager mit langen, blonden Haaren in Erinnerung geblieben, der seinem Vater fröhlich nachwinkte.
»Ist sie das?«, ruft eine weibliche Stimme hinter Kim, vermutlich die Fahrerin des weißen SUV.
»Ich habe die falsche Abzweigung genommen«, sagt Nora laut. »Dumm von mir.«
Sie versucht so locker wie möglich zu klingen, während das geisterhafte Wesen mit seinen steinalten Augen durch sie hindurch starrt.
Ob sie weiß, wer Nora ist?
Kim ist dürr. So ausgemergelt, wie Nora es bisher nur bei einer magersüchtigen Schulfreundin erlebt hat. Sie trägt ihre schwarz gefärbten Haare an den Seiten kurz rasiert, lediglich ein langer Pony reicht über die linke Gesichtshälfte bis zu ihrem Kinn. Unter ihrem schlichten Shirt zeichnet sich nichts ab, was guten Gewissens Brust genannt werden könnte.
»Und bin zweimal in einem alten Steinbruch gelandet«, ergänzt Nora, um irgendetwas in die gähnende Stille zu sagen.
»Warum bittest du Frau Dahn denn nicht herein?«, sagt die Stimme aus dem Inneren. Es ist ein klangvoller Alt.
Ohne eine weitere Regung zu zeigen, gibt Kim Bergström den Weg frei.
Im Vorbeigehen nimmt Nora den dezenten Duft eines edlen Parfums wahr, von der Sorte, die sie sich mit ziemlicher Sicherheit selbst niemals leisten können wird.
Im Haus riecht es nach gebeiztem Holz. Die Frau mit dem Alt steht im engen Flur und streckt ihr eine Hand entgegen.
»Ich bin Heide-Marie Wörner.«
Sie ist schlank, mag Ende dreißig sein. Ihre schlammblonden Haare hat sie zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden, die Kleidung wirkt, als käme sie vom Mauerblümchen-Spezialversand. Alles in allem macht sie einen schüchternen Eindruck.
»Kommen Sie bitte?«, sagt sie und geleitet Nora durch den kurzen, vertäfelten Gang in eine holzüberladene Bauernstube, deren Fenster sowohl Ausblick auf den See als auch über die Wiesen bieten. Nora nimmt auf einer Eckbank Platz.
Heide setzt sich ebenfalls. Kim lehnt sich an eine rustikale Kommode, zieht ein Handy aus der Tasche ihrer zerschlissenen Stretch-Jeans und beginnt geistesabwesend, damit herumzuspielen.
Abgesehen davon, dass Kim ihrem toten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, wirkt sie nicht annähernd so, wie Henryk sie in seinem Dossier beschrieben hat. Dort ist von einem überdrehten Teenager die Rede, einer vor Selbstbewusstsein strotzenden Göre. Doch diese entrückte Erscheinung mit den greisenhaften Augen ist das krasse Gegenstück. Ein vernachlässigtes Schmuckstück, das sich hinter Panzerglas dem Zugriff forscher Betrachter entzieht.
Heide-Marie Wörner wirft Kim einen gespielt verzweifelten Blick zu. Streicht ihr mit dem Zeigefinger über die Hand, wie um sie in ihre Welt herüberzuholen.
Es gelingt nicht. Die offenkundige Ablehnung der jungen Frau hängt wie der Gestank eines fauligen Kadavers im Raum.
»Dürfte ich auch erfahren, wer Sie sind?«, fragt Nora.
Heide sieht sie erstaunt an.
»Hat Ihnen Siegmar das gar nicht ...? Oh, verzeihen Sie! Ich bin eine Freundin von Siegmar Kling … und von Kim, natürlich«, sagt Heide Wörner schnell.
Die junge Frau zeigt keine Regung.
»Kim fand unsere Idee anfangs nicht besonders prickelnd, hier mit mir einen Urlaub zu verbringen«, sagt die Freundin der Familie. Sie wendet sich wieder Kim zu, fasst sie an beiden Handgelenken und zieht mit sanfter Gewalt ihre Hände, und damit auch das Smartphone, aus ihrem Blickfeld.
»Aber jetzt ist es okay für dich, nicht wahr?«
Kim Bergström würdigt sie weiterhin keines Blickes. Schweigt.
»So richtig okay ist es für Sie nicht, oder?«, sagt Nora ein wenig irritiert.
Die junge Frau verschränkt die Arme, zuckt kaum merklich mit der Schulter.
Nora widersteht dem Bauchgefühl, aufzustehen und sich wieder zu verabschieden. Das wunderliche Geschöpf verunsichert sie gehörig, aber es fordert auch ihre Neugier heraus.
»Siegmar – Herr Kling – ist in den kommenden Wochen geschäftlich viel auf Achse«, erläutert Heide mit leiser Stimme. »Ursprünglich sollten wir ihn begleiten, es sind ja Semesterferien, aber diesen Plan haben wir wieder verworfen. Ist ohnehin viel schöner hier, nicht, Kim? Als in Großstadthotels abzuhängen?«
Nora mustert Kim Bergström, sucht in dem verschlossenen Gesicht vergeblich nach einer Regung.
»Sie studieren? Welches Fach?«
Als Kim nicht reagiert, antwortet Heide für sie: »Betriebswirtschaft.«
»Hm. Sicher nötig, wenn man in so eine Unternehmerfamilie geboren wird. Schön. Und wozu brauchen Sie mich jetzt genau? Hier, in der Einsamkeit?«
»Ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Sie glauben gar nicht, wie viele Irre da draußen rumlaufen. Und die sollen Sie uns bitte vom Leib halten.«
»Das krieg ich hin.«
»Gut, dann sind wir uns einig?«
»Na ja ...« Nora sieht Kim an. »Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich kann nur für Ihre Sicherheit garantieren, wenn Sie beide mitspielen.« Und die da wirkt so, als hätte sie dazu keine besonders große Lust.
»Was sagst du, Kim?«, fragt Heide. Es klingt ein bisschen wie: Magst du die Tante?
Die junge Frau sieht endlich von ihrem Smartphone auf, in Richtung Nora, ohne ihr in die Augen zu sehen.
»Die Ohrringe ... sind die von Cartier?«
Nora kann nicht glauben, dass das die ersten Worte sind, die Kim an sie richtet.
»Wie bitte?«
»Ihre Ohrstecker. Die sind schön. Sind die von Cartier?« Sie sieht knapp an Nora vorbei, fixiert den linken Ohrring.
Nora sucht nach einem Grinsen, einem Anzeichen von Spott oder Bösartigkeit. Da ist nichts dergleichen. Immer noch dieselbe, todmüde Maske.
Nora kämpft den aufflammenden Ärger nieder. »Nö, die sind von Kar-stadt«, sagt sie. »Was soll die Frage?«
Heide ergreift Kims Hand.
»Du musst sagen, ob du dir vorstellen kannst, mit Frau Dahn zu ... ob sie unsere ... ob sie unser Schutzengel sein soll.«
Kim zuckt die Schulter.
»Karstadt? Is ja doof.«
Nora kann nicht mehr an sich halten: »Wir sollten diesen Bullshit beenden. Der Job und die zu schützende Person sind mir völlig falsch beschrieben worden. Ich bin hierhergekommen, weil ein alter Kumpel gesagt hat, dass jemand Hilfe braucht. Aber so nicht!«
Sie steht auf.
»Ich kann mir was Besseres vorstellen, als mir hier für ein paar Kröten den Hintern platt zu sitzen, um für eine übernächtigte Tussi die Nanny zu spielen. Noch dazu, wenn sie mich verspottet, weil ich nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen bin.«
Heides Mund bleibt entgeistert offen stehen.
Kim richtet sich auf. Zum ersten Mal flackert ein Funken Interesse in ihren Augen.
»Aber ...«, setzt Heide an.
Nora wehrt ab. »Informieren Sie bitte Henryk Simons, dass Sie mich nicht engagieren wollen? Damit wäre mir sehr geholfen.«
5
Vierzig Minuten später lenkt Nora den Mercedes auf den von hübschen Renaissancehäusern gesäumten Marktplatz der kleinen Stadt Holzach.
Ein bulliger Mann mit Bauarbeiterhelm versperrt ihr den Weg.
Sie lässt die Scheibe herunter.
»Se könnet do net parke. Der Platz isch ab heut g‘schperrt«, sagt er in breitem Schwäbisch.
Nora versteht nur die Hälfte, kann sich aber zusammenreimen, was er will. Hinter ihm sind weitere Helmträger damit beschäftigt, mit einem Gabelstapler Metallteile von einem Laster zu laden.
»Fünf Minuten? Ich muss nur schnell meinen Koffer aus dem Gasthof dort holen.«
Er schüttelt den Kopf. »Mir bauet’s Fescht auf.«
Nora kann mit der wortkargen Begründung wenig anfangen, auch nicht, als er auf ein hässliches Reiterstandbild deutet, das die Mitte des Platzes verunziert.
Sie ist absolut nicht in der Stimmung für Hickhack, also fügt sie sich in das Unvermeidliche, wendet den Wagen und parkt ihn in einer Seitenstraße direkt unter einem Halteverbotsschild.
Dann macht sie sich auf den Fußweg zurück zum »Gasthof Schwarzer Adler«.
Das strahlende Sommerwetter, das die engen Gassen Holzachs in goldenes Licht taucht, passt nicht zu ihrer gedrückten Stimmung. Sie hat Heide-Marie Wörner eine Absage erteilt, obwohl sie das Geld für den Auftrag gut hätte gebrauchen können.
Frau Wörner bedauerte die Entscheidung zwar und versuchte Nora noch ein Weilchen zu überreden, schien die Beweggründe aber letztendlich zu verstehen. Sie versicherte, Henryk Simons die Wahrheit mitzuteilen: dass Kim Bergström nicht den Eindruck erweckte, in ausreichendem Maße mit der Personenschützerin kooperieren zu wollen.
Nora holt sich an der Rezeption ihren Schlüssel und geht nach oben in ihr Zimmer, wo sie der seifige Charme der Siebziger umfängt.
Sie packt ihre wenigen Habseligkeiten in den Koffer: Waschzeug, Unterwäsche, Hosen und Shirts.
Das verdammte Video von ihrem Ladendiebstahl ist immer noch in der Welt, und keiner weiß, was Henryk Simons als Nächstes damit einfällt.
Die seltsame junge Frau geht Nora ebenfalls nicht aus dem Sinn. Sie fühlt sich durch Kim auf eigenartige Weise an ihre eigene Jugend erinnert, an die Zeit, als bei ihr der Drang übermächtig wurde, wertloses Zeug aus Geschäften zu stehlen. Als sie begann, Autowerkstätten zu meiden wie die Pest und lieber Hosen als Kleider trug. Damals war niemand an ihrer Seite, der ihr half, mit ihrem Leben klarzukommen. Mit allem, was damals geschah.
Sie beschließt, das zu tun, was sie schon vor ihrer Anreise hätte tun sollen: genauere Informationen über Kim Bergström einzuholen. Sie fummelt ihr Handy aus der Hosentasche und durchsucht das Telefonbuch. Es besteht zur Hälfte aus Kontaktdaten von Verflossenen. Nora denkt darüber nach, sie alle zu löschen, nimmt aber immer wieder Abstand davon. Man weiß ja nie.
Sie wählt die Nummer von Niklas Schäfer, einem ihrer wenigen Ex-Freunde, mit dem sie tatsächlich noch in unregelmäßigen Abständen telefoniert. Als Rechercheur bei einem großen Boulevardblatt verfügt er über Zugang zu einem gigantischen Archiv. Er ist zwar verheiratet, aber immer noch der alte Macho, der sich nach wenigen, einleitenden Sätzen schalkhaft erkundigt, ob sie nicht mal wieder miteinander schlafen sollten – ganz unverbindlich, natürlich.
Nora verspricht lachend, darüber nachzudenken.
»Könntest du mir vorher noch einen Gefallen tun? Ich bräuchte alles, was du kriegen kannst, über die Familie Bergström. Speziell Kim Bergström.«
»Die Tochter des Industriellen?«
»Genau.«
Niklas verspricht, sein Möglichstes zu tun, selbstverständlich nicht ohne vorher abermals über eine sexuelle Vergütung zu verhandeln.
»Kann ein wenig dauern«, sagt er am Ende. »Aber wie du weißt, stehe ich meinen Mann.«
Kein Problem. Nora hat keine Eile. Nicht mehr.
Das Smartphone vibriert in ihrer Hand, kurz nachdem sie das Gespräch beendet hat.
Unbekannt.
»Ja?«
»Ich bin‘s.«
»Wer ist ich?«
»Kim Bergström.« Schüchtern. Fast verschämt.
Vor lauter Überraschung fragt Nora nicht, woher die junge Frau ihre Nummer hat.
»Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen.«
»Hat sie Sie überredet? Die Freundin der Familie?«
»Sie weiß nicht, dass ich Sie anrufe. Ich wollte Sie bitten, ich meine … können Sie es sich noch einmal überlegen?«
»Eigentlich habe ich ...«
»Bitte, Frau Dahn. Es ist wegen ihr.«
»Wegen wem?«
»Heide. Ich möchte nicht mit ihr allein sein.«
Ausrufezeichen.
»Hm. Klingt komisch in meinen Ohren. Darf ich fragen, warum?«
»Sie ist … ich weiß nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Sie macht mir Angst, in letzter Zeit.«
»Na ja ...« Heide-Marie Wörner wirkte völlig normal auf Nora, vielleicht ein wenig gehemmt, sicher nicht bedrohlich.
»Etwas stimmt mit ihr nicht!«
»Hm. Ich ...«
»Ich bitte Sie, Frau Dahn!« Pure, echte Verzweiflung. Oder ein perfides Spiel? So wie das mit den Ohrringen?
Lass die Finger davon und fahr zurück nach Berlin!
Doch was soll Nora dort, wo nichts auf sie wartet als der traurige Inhalt des Besteckfachs? Sie kann das großzügige Honorar gut gebrauchen, ganz ohne Zweifel. Und etwas in ihr liebt das Risiko, sonst wäre sie Buchhalterin geworden.
»Gut. Ich mach‘s«, hört sie sich sagen.
6
Der Rittersaal des Wasserschlosses derer von Hallstein ist festlich erleuchtet. Dutzende Rüstungen stehen Spalier an den hohen Wänden. Über ihnen sind unzählige Schwerter und Spieße angebracht, kreisförmig sich an den Griffen beinahe berührend und mit den Klingen nach außen weisend wie vielstrahlige Sterne. In der großen Feuerstelle an der Ostseite der beeindruckenden Halle lodert ein mannshohes Feuer.
Nummer eins hat zur Versammlung gerufen, und seine neunundzwanzig Mitstreiter sind beinahe vollzählig erschienen. Nummer dreizehn, ein schmaler Mann mit dickrandiger Nerdbrille und Hakennase, ist sogar extra aus Argentinien eingeflogen.
Nur ein Platz an der großen, runden Tafel ist verwaist: Nummer sechzehn ist durch ihre schwere Krankheit ans Bett gefesselt, hat aber auf dem geheimen Kanal eine aufmunternde Grußbotschaft geschickt. Weiter so.
»Das sind in der Tat beeindruckende Ergebnisse, Achtzehn«, lobt Nummer eins. »Besonders die Operation in Charlottenburg war – wie soll ich sagen – von durchschlagendem Erfolg.«
Einige Anwesende kichern und sehen sich vielsagend an. Andere murmeln zustimmend. Denn durchschlagend war diese Operation wahrhaftig.
Der Sprenggürtel des jungen Syrers hat die Herz-Jesu-Kirche pulverisiert, das Gotteshaus wurde durch die Explosion stellenweise bis auf die Grundmauern abgetragen. Selbst auf dem kleinen Fernsehbildschirm wirkte die Verwüstung kolossal. Durchschlagend also, in der Tat.
»Wir alle haben zum Erfolg der vierzehn Einzeloperationen beigetragen«, sagt der Hausherr bescheiden. Im Innersten ist Karsten von Hallstein allerdings davon überzeugt, dass die Bestrebungen der Dreißig ohne seine genialen Ideen zum Scheitern verurteilt wären. Sie sitzen zwar allesamt an wichtigen Schaltstellen der Gesellschaft, aber nur er hat Zugang zu dem Stoff, der ihre Verschwörung mit Erfolg krönen wird – und ihn schlussendlich zum Anführer. Aber die Versammelten ahnen natürlich nichts.
»Die öffentliche Meinung hat sich durch die Aktionen allerdings nur geringfügig gedreht«, bemängelt die Zwölf vorsichtig. »Ich hatte mir mehr erwartet.«
Karsten beobachtet die Reaktion von Nummer eins. Sie nickt beifällig.
»Das muss ich zugeben«, sagt Karsten schnell. »Deshalb habe ich einen weiteren Coup ausgearbeitet, der das deutsche Volk endgültig wachrütteln wird.«
Er erläutert seine Absichten. Von Satz zu Satz werden die Augen der Mitverschwörer größer, einige nicken beifällig. Als Karsten die dämonischen Details seines Vorhabens darstellt, leckt sich Nummer dreiundzwanzig, ein dicker, schwitzender Glatzkopf, geil über seine wulstigen Lippen und reibt sich gierig die Hände. »Bravo«, ruft er und springt auf. »Bravissimo!«
Allgemeiner Beifall folgt.
Nur die Elf bleibt unbeeindruckt. Sie hebt die Hand, deren Ringfinger ein goldener Siegelring schmückt, in welchen ein Adler graviert ist.
»Wirst du genug von der Substanz beschaffen können – von diesem, wie nennst du es?«
»Permissin.«
»Ja, kannst du genügend von diesem Permissin herstellen, um den Plan in die Tat umzusetzen?«
Die fette, alte Kuh war von Beginn an kritisch, was Karstens Ideen anging, wurde zum Glück aber haushoch von den anderen überstimmt. Jetzt scheint sie abermals nicht sehr überzeugt zu sein.
»Sicher. Kein Problem«, erwidert Karsten fest. Er fixiert dabei aber nicht sie, sondern die Eins. Seine eigenen Bedenken kaschiert er durch besonders selbstbewusstes Auftreten.
»Ich kann massenhaft davon herstellen lassen, wenn es sein muss.« Und im Brustton der Überzeugung: »Ich habe den richtigen Mann dafür.«
»Bist du sicher, dass du ihm vertrauen kannst? Sagtest du nicht, der chemische Prozess sei schwierig und langwierig?«, bohrt Nummer elf nach und zeigt mit ihrem wulstigen Finger auf ihn.
Die Zecke. Sie kann es einfach nicht ertragen, eine Niederlage einzustecken. Aber da sie in der Rangordnung der Dreißig über ihm steht, muss Karsten gute Miene zum bösen Spiel machen. Noch.
»Ja, die Herstellung ist aufwändig, das ist richtig«, gibt er zu. »Aber, mit Verlaub, du scheinst zu vergessen, für welches Unternehmen ich arbeite. Die Firma eröffnet mir alle Möglichkeiten, schließlich bin ich dort nicht der Hausmeister.«
»Ist das so?«, fragt Elf spöttisch.
»Und wie gedenkst du mit der jungen Erbin umzugehen, die sich anschickt, dein famoses Unternehmen umzukrempeln?«, fährt sie fort.» Soweit ich informiert bin, wird sie demnächst dort ein wichtiges Wort mitreden. Wie man hört, ist sie intelligent und wird deinen Machenschaften schneller auf die Schliche kommen, als uns lieb ist. Und was dann?« Sie steht herausfordernd auf.
Karsten ist nicht schlagfertig genug, um ihren Ausbruch zu kontern.
»Dann sind wir alle in Gefahr!«, bellt sie und schlägt mit der beringten Hand auf den Tisch, dass der Saal widerhallt.
Elf hat gut recherchiert, was die Verhältnisse im Unternehmen angeht, das muss Karsten der blöden Gans lassen. Ist ja auch ihr Job.
Kühl lächelt er die Zweifel weg, die ihn wegen der zu erwartenden Neuerungen im Unternehmen ebenfalls plagen. Dann wendet er sich wieder bewusst an Nummer eins, um seine Antwort zu geben:
»Kim Bergström wird mir nicht in die Quere kommen, dafür ist gesorgt.«
7
Das erste Abendessen verläuft schweigsam. Nora grübelt, wie sie ihrer verwöhnten Auftraggeberin beibringen soll, dass sie ihre Freiheiten in der Grünen Villa einschränken muss, um sie zu schützen.
Heide Wörner und Kim Bergström schweigen ebenso, vielleicht aus Erschöpfung. Sie haben den Nachmittag damit verbracht, im Schweiße ihres Angesichts das Notwendige für einen längeren Aufenthalt in die spärlich ausgestattete Hütte zu schleppen: Proviant für mehrere Wochen, Kleidung und jede Menge anderen Krimskrams, darunter Küchengeschirr und zwei schwere, rote Propangasflaschen. Obwohl das Haus mit Strom- und Telefon versorgt ist, hat offenbar niemand es für nötig gehalten, einen Elektroherd zu installieren. Geheizt wird mit einem Kachelofen, für den bereits Holzscheite in einem kleinen, von der Straßenseite abgewandten Schuppen lagern.
Kim hat auf eigenen Wunsch eine Kammer unter dem Dach bezogen, die vom ersten Stock aus nur über eine einziehbare Leiter zu erreichen ist. Heide Wörner und Nora richteten sich häuslich in je einer der beiden Kammern im darunter liegenden Obergeschoss ein, wo Heide, kaum dass sie die Tür hinter sich verschlossen hatte, angelegentlich zu telefonieren begann.
Nora schluckt den letzten Bissen ihres Schinkenbrotes hinunter und legt das Messer quer über den Teller. Sieht ihre neuen Hausgenossinnen abwechselnd an.
»Wir müssen ein paar Regeln absprechen«, sagt sie.