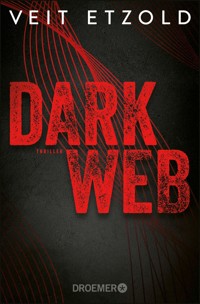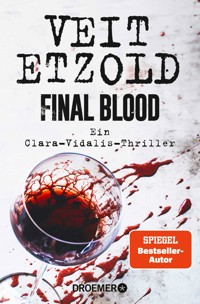9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Clara-Vidalis-Reihe
- Sprache: Deutsch
Band fünf der Bestseller-Serie von Veit Etzold: Top-Autor Veit Etzold ist mit seiner Hauptkommissarin Clara Vidalis, Expertin für Pathopsychologie am LKA Berlin, regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Kaum ein deutscher Thriller-Autor beherrscht die Klaviatur harter, realistischer Spannung so wie er. Ihr fünfter Fall bringt Clara auch persönlich an ihre Grenzen: Ein Serienkiller entführt 18-jährige Mädchen und lässt den Eltern Leichenteile zukommen. Die Ermittler schickt er ein ums andere Mal auf eine falsche Spur. Und vor Jahren fiel Claras kleine Schwester einem ganz ähnlich agierenden Wahnsinnigen zum Opfer, der nie gefasst werden konnte … Harte Fälle, schnelle Action – deutsches Setting!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Veit Etzold
Tränenbringer
Ein Clara-Vidalis-Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Band fünf der Bestseller-Serie von Veit Etzold: Top-Autor Veit Etzold ist mit seiner Hauptkommissarin Clara Vidalis, Expertin für Pathopsychologie am LKA Berlin, regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Kaum ein deutscher Thriller-Autor beherrscht die Klaviatur harter, realistischer Spannung so wie er. Ihr fünfter Fall bringt Clara auch persönlich an ihre Grenzen: Ein Serienkiller entführt 18-jährige Mädchen und lässt den Eltern Leichenteile zukommen. Die Ermittler schickt er ein ums andere Mal auf eine falsche Spur. Und vor Jahren fiel Claras kleine Schwester einem ganz ähnlich agierenden Wahnsinnigen zum Opfer, der nie gefasst werden konnte … Harte Fälle, schnelle Action – deutsches Setting!
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Buch 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Buch 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Buch 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Dankwort
Für Michaela Kenklies und Steffen Haselbach und das Team von Droemer Knaur für das freundliche Willkommen von Clara Vidalis
… und natürlich für Saskia
Diejenigen, die keine Angst vor dem Töten haben, haben die Kontrolle über das Leben selbst.
Richard Ramirez, The Night Stalker
Prolog
Erst habe ich sie ausgezogen. Dann habe ich sie erwürgt. Dann in kleine Teile zerschnitten. Dann gekocht. Und gegessen. Es hat neun Tage gedauert, bis ich sie ganz gegessen hatte.
Ich habe sie nicht missbraucht, auch wenn ich es gekonnt hätte.
Sie ist als Jungfrau gestorben.
Brief des Serienkillers Albert Fish an die Eltern des Opfers1
<BODYCOUNT>: bist du geil?
<ANGELDUST666>: bin ich immer. ich brauch es hart. und oft
<BODYCOUNT>: extrem?
<ANGELDUST666>: yep. nur keine bleibenden schäden
<BODYCOUNT>: titten echt so groß wie auf pic?
<ANGELDUST666>: ja. natur. 80dd
<BODYCOUNT>: geil!
<ANGELDUST666>: freut mich ☺
<BODYCOUNT>: NS, KV?
<ANGELDUST666>: mag kein dirty. gewalt o.k.
<BODYCOUNT>: messer?
<ANGELDUST666>: ja, aber schneid entlang der narben. da, wo schon welche sind. wohne noch bei eltern
<BODYCOUNT>: ritzt du dich selbst?
<ANGELDUST666>: ja
<BODYCOUNT>: machst du es auch für mich?
<ANGELDUST666>: klar
<BODYCOUNT>: filmen?
<ANGELDUST666>: ja, aber nur maske. auch wegen eltern
<BODYCOUNT>: kill your parents
<ANGELDUST666>: gute idee
<BODYCOUNT>: wann sehen wir uns?
<ANGELDUST666>: nachmittags. bei dir. nach der schule. bis abends. mum darf nichts merken
<BODYCOUNT>: diesen donnerstag? 15 uhr?
<ANGELDUST666>: wo?
<BODYCOUNT>: schicke ich separat
<ANGELDUST666>: geil. freu mich schon
<BODYCOUNT>: gewalt o.k.?
<ANGELDUST666>: ja. hab ich doch gesagt
<BODYCOUNT>: titten 80dd?
<ANGELDUST666>: yep
<BODYCOUNT>: eine sache will ich dann rausfinden
<ANGELDUST666>: was denn?
<BODYCOUNT>: wie deine titten … von innen aussehen
<ANGELDUST666> HATDENCHATVERLASSEN
Doch BodyCount wusste bereits, wer Angeldust war.
Und wo er sie finden würde.
Buch 1
Ich erinnere mich an jedes Detail von jedem einzelnen Verbrechen, so wie sich andere Menschen an ihren Lieblingsfilm erinnern.
Und ich lasse sie immer wieder vor meinem inneren Auge ablaufen.
Interview mit dem Serienkiller Dennis Rader, dem »BTK-Mörder«2
Kapitel 1
Berlin, 2016
Es war Ende Oktober und begann, dunkel zu werden.
Thomas Spiering war gerade dabei, den Rückspiegel richtig einzustellen, als er den Mann sah.
Westberlin. Kurfürstenstraße, Ecke Keithstraße. »Kurfürstenstraße« klang edel, war aber in Wirklichkeit der größte Freilichtpuff Deutschlands. Kinder sahen vom Sandkasten aus, wie Prostituierte mit ihren Freiern im nahen Gebüsch verschwanden. Und dann die Kondome in den Sand des Spielplatzes warfen. Entsprechend zügig fuhr Thomas Spiering. Bloß schnell vorbei hier. Bis er den Mann sah, der einfach über die Straße schwankte. Der Mann kam aus der Keithstraße. Von Süden.
Vorne links war das Hotel mit seiner roten Klinkerfassade. Roter Klinker. Wie Fliesen. Die Fliesen einer Schlachterei. Auf der anderen Seite der Kaminshop. Dahinter der Asiate. All das sah Thomas Spiering.
Und dann kam dieser Mann.
Tauchte direkt vor seinem Auto auf. Lief mit torkelnden Schritten vor ihm über die Straße. Stand plötzlich direkt vor Spierings Wagen, der sich mit fünfzig Stundenkilometern näherte. Für einen Moment schien die Zeit eingefroren. Der Mann auf der Straße schaute Spiering in die Augen. Es waren Augen wie Plaketten. Augen, die keine Tiefe hatten. Der Mund geöffnet. Ein langer Speichelfaden. Mit beiden Händen hielt der Mann einen Karton umklammert, wie einen seltsamen Schatz. Taumelte, so als müsste er sich eigentlich abstützen. Konnte es aber nicht, weil er den Karton trug. An den Händen – irgendwie waren Thomas Spiering sofort die Hände aufgefallen – trug er Gummihandschuhe. Gummihandschuhe, die seltsam fleckig waren. An denen … etwas war. Etwas Braun-Rotes. Ja, irgendetwas Braun-Rotes.
Es war dieses Bild, das sich Thomas Spiering in die Pupillen brannte, als er wie ein Verrückter auf die Bremse stieg. Gerade noch rechtzeitig kam der Wagen zum Stehen. Der Mann stand vor ihm, schaute auf ihn herunter durch die Windschutzscheibe. Hob dann den Blick zum Himmel. Und setzte sich, irgendwie roboterhaft, wieder in Bewegung.
»Idiot«, rief Spiering. Obwohl der andere ihn kaum hören konnte. Hinter ihm hupten Autos. Sahen diese Idioten denn nicht, warum er bremsen musste? Dass er den Typen sonst überfahren hätte?
Spiering wollte ihn zur Rede stellen, wollte diesen Volltrottel fragen, was ihm einfiel, einfach so über die Straße zu laufen. Ohne Ampel und ohne Zebrastreifen.
Doch das Hupen wurde lauter.
Der Mann schaute ihn ein letztes Mal mit seinen Plaketten-Augen durch die Scheibe an. Ging dann weiter. Ging mit ruckartigen Bewegungen weiter über die Straße, wie ein schlecht programmierter Roboter.
Spiering fuhr weiter.
Sah aus den Augenwinkeln einen Lkw auf der anderen Straßenseite.
Beschleunigte.
Es lag nicht nur an dem ungeduldigen Hupen der Autos hinter ihm, dass er weiterfuhr.
Es lag nicht nur daran, dass er es eilig hatte und eigentlich schon längst zu Hause sein sollte. Bei seiner Frau. Die zuletzt mit dem Wagen gefahren war und den Rückspiegel anders eingestellt hatte.
Es lag auch daran, dass der Mann ihn angeschaut hatte.
Und wie er ihn angeschaut hatte.
Das hatte Thomas Spiering gereicht.
Als er etwa fünfzig Meter gefahren war, hörte er den Knall.
Kapitel 2
Berlin, 2016
»Dämliches Datenschutzgequatsche«, sagte Kriminaldirektor Winterfeld, während sie die Treppe hinunterliefen. Draußen vor dem Hauptquartier des LKA1 in der Keithstraße zündete er sich einen Zigarillo an und paffte in die dämmerige Herbstluft. Clara Vidalis, Hauptkommissarin am LKA113 und Expertin für Forensik und Pathopsychologie, folgte ihm. Hermann ebenfalls. Das LKA1 war zuständig für Delikte am Menschen. Ebenso Kinder- und Jugendpornografie. Zweihundertsechzig Beamte, die nichts anderes machten, als den schlimmsten Abschaum der Gesellschaft zu jagen. Und die, wenn selbst sie nicht mehr weiterwussten, die Mordkommission 113 anriefen. Die Mordkommission 113, die am Tempelhofer Damm saß. Winterfelds Truppe, zu der auch Clara gehörte und die eng mit dem LKA1 zusammenarbeitete.
Joost Boonstra kam ihnen schnaufend hinterher. Boonstra, mit rotblonden Haaren und einem, trotz seiner fünfundfünfzig Jahre, jungenhaften Gesicht, war auf Dauerdiät und deshalb bei dauerhaft schlechter Laune. Morgens nahm er nur sein sogenanntes »Singlefrühstück« zu sich, schwarzer Kaffee und Zigarette. Dünner wurde er dadurch trotzdem nicht, vielleicht weil gerade das Frühstück die Mahlzeit war, an der man am wenigsten sparen sollte, selbst wenn man das Ziel hatte, Gewicht zu verlieren. Er zupfte sich das Hemd zurecht, das sich über seinen Bauch spannte, und zündete sich eine Zigarette an.
»Probier mal die Marine-Diät«, hatte Winterfeld ihm vorhin gesagt und auf seinen Bauch geklopft. Boonstra hatte ihn irritiert angeschaut. »Einfach die nächste Uniform eine Nummer größer bestellen.« Boonstra hatte das nicht witzig gefunden.
»Sie sind mal wieder am Nichtrauchen?«, fragte Winterfeld und wandte sich an Clara.
Clara nickte. »Im Moment ja. Irgendwas muss ich auch mal richtig machen.«
»Dir gefällt der Datenschutz nicht?«, fragte Boonstra und deutete einen Ellbogenschlag in Winterfelds Seite an. Boonstra war Holländer und arbeitete eigentlich bei Europol in Den Haag, hatte aber für das LKA einige Computerschulungen übernommen, so wie diese Datenschutzschulung, die heute in der Keithstraße stattfand. Auch in Sachen Cyberspionage war er ein Crack.
Die Flitterwochen mit seiner Frau Femke waren dafür schon seit geraumer Zeit vorbei, sodass es ihm nichts ausmachte, wenn er lange arbeitete. Was ein Teufelskreis war. Denn weil er so viel arbeitete, hatte seine Frau sich eine Therapeutin gesucht, die ihr als Erstes gesagt hatte, dass sie mehr auf sich achten müsse. Femke hatte nach dem Studium ihren Job aufgegeben, um sich um die zwei gemeinsamen Kinder kümmern zu können. Die Therapeutin hatte ihr gesagt, dass sie ihren Mann zwingen müsse, sie stärker wahrzunehmen. Ihn dazu bringen müsse, endlich wahrzunehmen, was für Lücken durch seine viele Arbeit in ihrem Leben entstanden. Das Beste wäre, so die Therapeutin, wenn Joost noch einmal richtig um sie werben würde. So als würde er sich noch einmal in sie verlieben. Boonstra hatte das verstanden, aber mit dem Verlieben wollte es nicht so recht klappen.
Ich möchte gesehen werden. Wahrgenommen werden, hatte sie Boonstra und all ihren Freundinnen gesagt. Mach dir mal keine Gedanken, hatte Boonstra geantwortet, dich übersieht schon keiner. Denn sie hatte ähnlich an Gewicht gewonnen wie Boonstra und war auch noch zickig und drachenartig geworden. Dass Boonstras Konter die Ehe nicht gerade gerettet hatte, verstand sich von selbst. Derzeit lebte er in Trennung auf Probe, was darauf hinauslief, dass seine Frau das gemeinsame Haus bewohnte und sich mit Selbstfindung, magischen Steinen und Hot Yoga befasste und er im Keller lebte, was seine Laune auch nicht gerade verbesserte. Umso glücklicher war er, dass er zwei Wochen in Berlin sein konnte. In einem schönen Hotel, wo er nicht stundenlang dankbar sein musste, weil jemand die Handtücher im Bad wechselte.
Du wohnst im Keller? Ist ja fast wie bei Schweigen der Lämmer, hatte Winterfeld gesagt, da sind die Ermittler doch auch im Keller der FBI Academy. Jack Crawford, Clarice Starling und so weiter … Boonstra fand auch das nur bedingt witzig. Genauso wie den Tipp mit der Marine-Diät. Er fand ohnehin wenig witzig. Doch seine schlechte Laune hatte ihm schon häufig geholfen, wenn es darum ging, hart durchzugreifen. Bei Europol hatte er in der internationalen Abteilung kräftig aufgeräumt und zwei Dutzend Leute gefeuert. Diese McKinsey-artigen Qualitäten hatten ihm bei den englischsprachigen Kollegen von Europol den Spitznamen Boonstra the Butcher – Boonstra der Schlachter eingebracht. Ein Name, der, wie Clara fand, auch gut zu ihrem Job passte.
Winterfeld schaute die prächtige Fassade des klassizistischen LKA1-Gebäudes in der Keithstraße hinauf und qualmte. Polizei stand auf dem Schild neben der Tür. Immerhin beruhigend, dachte Clara, dass die Polizei noch Polizei hieß in Zeiten, wo die Arbeitsämter Jobcenter und die Informationsschalter der Bahn ServicePoints genannt wurden. Aber wahrscheinlich würde auch der Name Polizei bald abgeschafft werden und hieß dann Bürgercenter oder HelpPoint oder auch Rescue-Team.
»Datenschutz«, knurrte Winterfeld, »das heißt doch in erster Linie Täterschutz. Terroristen kommunizieren über XBoxes oder andere Spielkonsolen miteinander, und wir dürfen nicht mal Handydaten speichern. Mit Telekommunikationsgesetzen aus den Fünfzigern!«
Boonstra grinste. »Ich helf euch immerhin, ein paar Tricks zu lernen.«
»Ja«, sagte Hermann, der in einem schwarzen Kapuzenpulli, die Hände in den Taschen, zwischen Boonstra und Winterfeld stand. Clara stand ihm gegenüber. »Aber nur, weil du von der Agenda abweichst. Lernen sollen wir das hier nicht.«
»Wie geht’s eurem Hund?«, fragte Clara Hermann.
Der zuckte die Schultern. »Pennt den ganzen Tag.« Hermann und seine Freundin hatten sich, nachdem es mit dem Kinderkriegen leider überhaupt nicht geklappt hatte, eine französische Bulldogge gekauft, blaugrau und noch ein Welpe. Frenchie nannte man diese kleinen, kompakten und lebenslustigen Tiere auch. Hermanns Frenchie war erst ein paar Wochen alt, hatte aber schon ziemlich große Ohren, die er senkrecht aufrichtete, wenn er ein unbekanntes Geräusch hörte. »Sonst sorgt der aber für Frohsinn. Es gibt da eine Studie, in der Männer Rechenaufgaben lösen mussten. Am besten waren die mit einem Hund dabei, am zweitbesten die, die allein rechneten, und am schlechtesten die, wo Frau oder Freundin daneben saßen.«
»Das glaube ich aufs Wort«, knurrte Boonstra. »Wie läuft denn Riskid?«, fragte er dann. Riskid war ein Programm, das das Ärztehopping von Eltern, die ihre Kinder misshandelten, verhindern sollte. Wurde ein Kinderarzt misstrauisch, weil das Kind immer stärker malträtiert war, gingen die Eltern einfach zu einem anderen Arzt. Bei Riskid konnten sich Kinderärzte geschützt austauschen. Dadurch fiel es viel leichter auf, wenn Eltern ihre verletzten Kinder einem neuen Arzt vorstellten, weil der alte Kinderarzt angefangen hatte, zu viele Fragen zu stellen.
Winterfeld zuckte die Schultern. »Ganz gut. Aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. In den meisten Fällen bleibt doch alles, wie es ist. Und jeder Kindermörder kriegt deutlich weniger aufgebrummt als irgendein Eierdieb oder Falschparker.«
Er schaute Hermann an. »Warst du nicht bei dem Fall in Wedding dabei? Müllerstraße?«
»Der mit der Mikrowelle?«, fragte Hermann.
»Ja.« Winterfeld zog an seinem Zigarillo, halb genießerisch, halb angeekelt, wie Clara fand. Vielleicht stimmte es, dass Winterfeld nicht rauchte, weil er es wollte, sondern weil er es musste. Auch wenn er das nie zugeben würde.
»Was war da los?«, fragte Boonstra. Clara kannte die Geschichte.
»Da hat so ein Typ sein Kind halb totgeschlagen und dann mit dem Kopf in die Mikrowelle gesteckt.«
»Und?«, fragte Boonstra. »Die Mikrowelle geht doch erst an, wenn die Tür zu ist.«
»Das hat er extra manipuliert«, sagte Hermann. »Der Typ war wohl mal Elektriker und hat sich auch noch schlaugemacht, damit die Strahlung auch bei offener Tür rauskam.«
Selbst Boonstras Augen weiteten sich. »Und der Kopf des Kindes?«
Winterfeld machte ein gequältes Gesicht. »Ist explodiert. War ’ne totale Sauerei.«
»Mein Gott.« Boonstra schüttelte den Kopf. »Und was kriegt der Täter?«
Winterfeld zuckte die Schultern. »In Deutschland? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Verwarnung wegen Sachbeschädigung. Oder Rüge wegen unsachgemäßer Behandlung von technischen Geräten.«
»Herr Kollege, Sie übertreiben«, sagte Clara.
»Wär in Holland auch nicht anders«, knurrte Boonstra.
»Wenn, dann übertreibe ich nur ein bisschen«, sagte Winterfeld. »Die meisten Sachen fallen eh unter den Tisch, weil sie keiner merkt. Da ist das bei den Amis anders. Die haben ViCAP. Da kann jeder Polizist drauf zugreifen. Was haben wir? POLIKS, INPOL, POLAS, in jedem Bundesland ein anderes. Kleinstaaterei wie zu Kaisers Zeiten! Das schützt die Opfer genauso effektiv wie das Jugendamt das Kind in der Mikrowelle.«
Boonstra hob die Augenbrauen. »Klingt ja so, als wäre Deutschland auf dem Weg in einen failed state.«
Winterfeld nickte. »Das klingt nicht nur so.«
Clara kannte ihren Chef. Heute hatte er offenbar mal wieder einen seiner pessimistisch-fatalistischen Tage, wo er sich alles in maximal düsteren Farben ausmalte. Wo er selbst den Vergleich mit einem Staat, der auf dem Weg in den Abgrund war, wie Libyen, Syrien oder Irak, nicht für abwegig hielt.
Winterfeld sprach weiter, doch Clara merkte, wie sie nur Teile von dem mitbekam, was er sagte, und ihre Gedanken woandershin abwanderten.
»Richtig kalt wird es hier auch nicht mehr«, sagte Winterfeld, blickte zum Himmel, klemmte sich den Zigarillo zwischen die Zähne und steckte die Hände in die Taschen. »Wir haben Ende Oktober und können hier noch draußen stehen. Mit weißen Weihnachten wird das nichts.«
»Wusste gar nicht, dass du so scharf auf Winter bist«, sagte Hermann.
»Er heißt doch Winterfeld«, warf Boonstra ein. »Nomen est omen.« Die Worte zogen an Claras Geist vorbei wie Wolken, die man nicht festhalten konnte.
»Trotzdem«, sagte Hermann. »Letztes Jahr hast du noch über die Heizkosten gemotzt. Obwohl, hast du nicht diesen Kaminofen?«
»Ja, aber da muss ich Holz schleppen. Das ist nicht gut für meinen Rücken.« Winterfeld stippte die Asche auf den Boden.
»Immerhin musst du es nicht hacken.«
»Nein, da könnten wir einige unserer Serienkiller für nehmen. Die zerhacken gerne Dinge. Lebende und tote. Wie hieß dieser Verrückte noch, der die Frauen zerhackt hat?« Clara merkte, dass er sich an sie gewandt hatte. Sie war augenblicklich wieder im Hier und Jetzt. »Bernhard Trebcken«, sagte sie. »Der Werwolf.«
Clara erinnerte sich gut an ihn. Der Werwolf hatte in Berlin sieben Frauen auf bestialische Weise getötet. Manche der Frauen hatte er vor und nach dem Tod vergewaltigt. Und er hatte sie mit einer Axt zerhackt und dabei so blindwütig auf die Leichen eingeschlagen, dass einige der Axthiebe nicht nur die Gliedmaßen durchtrennt, sondern den Matratzenkern des Bettes durchschlagen und das Parkett darunter zerstört hatten. Einigen Frauen hatte er den Darm aufgeschnitten und sie mit ihren eigenen Fäkalien eingeschmiert. Totale Dominanz und Unterwerfung. Clara erinnerte sich an all das. Besonders erinnerte sie sich daran, weil sie selbst Bernhard Trebcken, den Werwolf, erschossen hatte. MacDeath hatte sie über das Täterprofil zu der richtigen Adresse gelotst. Der Werwolf war ein brutaler, exploitativer Vergewaltiger, aber er wollte auch ein toller Hecht sein. Darum fuhr er eine Corvette. Und durch die Adresse des Autohalters bei der Zulassungsstelle waren sie an die Adresse von Trebcken gekommen. A corvette makes them wet, hatte MacDeath den schlüpfrigen, inoffiziellen Werbespruch zitiert, der die scheinbare Wirkung von Corvettes auf Frauen zusammenfasste. Und so cool wollte Trebcken, der Werwolf, auch sein. MacDeath hatte richtig gelegen.
Mein Gott, dachte Clara, wie lange war das her? Zwei Jahre? Drei?
MacDeath und sie kannten sich damals noch gar nicht. Doch am Ende war es Clara, die dem Bösen einmal wieder ins Auge geschaut und Bernhard Trebckens Kopf mit der Heckler & Koch eines SEK-Beamten in eine blutige Ruine und die Wand dahinter in ein Kunstwerk im Stil von Jackson Pollock verwandelt hatte.
MacDeath … Und wieder musste sie an ihn denken. An ihn. An sich. An sie beide.
Kapitel 3
In der Hölle
BodyCount war in den Chatrooms unterwegs. Dort, wo es keine Gesetze gab. Dort, wo er alle treffen konnte. Und ihnen zeigen konnte, was er machte.
Sie sollten zuschauen.
<BODYCOUNT>: What are u up to?
<SNUFFXXX>: dunno
<BODYCOUNT>: shall i do something 4 you?
<SNUFFXXX>: do what?
<BODYCOUNT>: do mean …3
<BODYCOUNT>: was willst du tun?
<SNUFFXXX>: ich weiß es nicht
<BODYCOUNT>: soll ich was für dich tun?
<SNUFFXXX>: was tun?
<BODYCOUNT>: böses tun …
Irgendwann hatte er genug Leute zusammen. Die alles sehen wollten. Die dafür zahlen würden.
Und er hatte ANGELDUST666.
Er machte noch einen Post.
<BODYCOUNT>: angeldust ready 4 slaughter
<BODYCOUNT>: angeldust ist zur schlachtung freigegeben
Sah, wie sich die Zuschauer anmeldeten.
Sah, dass sie viel bezahlen würden.
Und beides erregte ihn.
Kapitel 4
Berlin, 2016
MacDeath …
Clara merkte, wie ihre Gedanken wieder abschweiften. Was war da jetzt mit Martin Friedrich, ihrem Kollegen, den alle nur MacDeath nannten, wegen seiner Liebe zu Whisky, Schottland und Shakespeare? Waren sie zusammen? Im Moment waren sie nicht zusammen, da Datenschutz nicht sein Thema war und er im Moment eine Vorlesung an der Humboldt-Uni hielt. Aber sonst? Ja, zusammen waren sie wohl. Sie überlegten sogar, zusammenzuziehen. MacDeath hatte die größere Wohnung, und da wäre es einfacher, zu ihm zu ziehen, als sich zu zweit etwas komplett Neues zu suchen. Hatten sie überlegt. Sie kannte die Wohnung gut, da sie dort ohnehin schon halb eingezogen war und viele Wochenenden und auch sonstige Abende verbracht hatte. Und sie mochte die Wohnung auch. Irgendwie freute sie sich darauf, aber sie merkte, dass sie auch Angst hatte. Angst, sich zu binden. Angst, etwas zu besitzen. Denn alles, was man besaß, konnte einem auch wieder weggenommen werden.
Doch das war nicht alles. Mittlerweile drängte MacDeath immer mehr darauf, dass Clara und er, wenn sie schon mehr oder weniger zusammenlebten und sich auch so gut verstünden, doch eigentlich auch heiraten könnten. Clara schreckte davor noch mehr zurück als vor dem Zusammenziehen, denn es war klar, dass sie bei aller Behaglichkeit, die daraus entstehen konnte, doch auch ein wenig Freiheit aufgeben müsste. Und was hieß ein wenig? Eigentlich eine ganze Menge! Sie hatte oft mit MacDeath darüber gesprochen und sich einerseits gewundert, dass ein Freigeist wie MacDeath unbedingt heiraten wollte. Andererseits war MacDeath ja bereits einmal in den USA verheiratet gewesen. Seine Frau Caren war damals gestorben und er hatte Clara gesagt, dass ihm Rituale wichtig seien in einer Welt, die vollkommen aus den Fugen geraten sei. Und Heiraten war ein solches Ritual. »Den Serienkillern, besonders den Ritualmördern sind Rituale wichtig«, hatte er gesagt, »und mir, der die Seele dieser Monster analysiert, sind Rituale auch wichtig.«
Die Begründung fand Clara etwas schräg, aber irgendwie passte sie auch zu MacDeath.
Sie war zurück in der Wirklichkeit angelangt und schaute Winterfeld an, der gestikulierend und rauchend mit Boonstra und Hermann sprach.
Wenn sie ihren Kollegen heiraten wollte, müsste Winterfeld sein Okay geben, da sie beide in einer Abteilung arbeiteten. Aber das würde schon irgendwie hinhauen. Dennoch: Heiraten? Sich einem Menschen gegenüber komplett verpflichtet fühlen? Das war schon eine harte Nummer. Was man besaß, machte einen verletzlich. Und irgendwie kam ihr wieder der Song von Iron Maiden in den Sinn, dessen Text sie aus irgendwelchen Gründen seit ihrer Jugend auswendig konnte.
If you asked me a question, would I tell you the truth
Now there’s nothing to bet on, you’ve got nothing to loose
»Lass uns mal wieder reingehen«, hörte sie Boonstras Stimme. »Wir machen weiter.«
Winterfeld nickte grummelnd und warf den Zigarillostummel auf den Boden. »Wird jetzt doch etwas kälter«, knurrte er.
»Ich dachte, es gibt keinen Winter mehr?«, meinte Hermann.
»Gibt es ja auch nicht«, sagte Winterfeld. »Ein bisschen kalt ist kein Winter. Und noch ist ja eh Herbst.«
»Hat das auch was mit dem Untergang Deutschlands zu tun?« Hermann wollte offenbar Winterfelds pessimistische Kulturtheorie auf ihre Konsistenz hin prüfen.
»Klar«, sagte der. »Deutschland wird ein Dritte-Welt-Land. Und in den meisten Dritte-Welt-Ländern gibt es auch keinen Winter.«
Hermann grinste. »Punkt für dich.«
»Winter ist wichtig«, knurrte Boonstra, »Europa ist deswegen so reich geworden, weil hier im Winter alle Bakterien getötet werden und alle Erreger. Darum gibt es hier keine Malaria oder so einen Scheiß. Darum ist Europa Weltmacht geworden.«
»Du als seefahrender Holländer musst es ja wissen«, sagte Winterfeld und kniff ein Auge zu.
Sie wollten soeben gemeinsam wieder ins Haus gehen, als sie das Krachen hörten.
Wie eine Explosion.
Laut.
Keine fünfzig Meter entfernt.
Kapitel 5
Berlin, in den Achtzigern
»Weißt du, wie spät es ist?«, fragte Mama. »Haben wir nicht gesagt, dass du um 6 Uhr deine Spielsachen vom Tisch räumst?«
Sie sprach das »S« in Spielsachen so spitz wie nur möglich aus. Und das »s« in »sechs« auch. Obwohl es eigentlich nicht 6 Uhr, sondern 18 Uhr war. »S«. Das Zischen einer Schlange. Und es waren keine »Spielsachen«, es war sein Modellbaukasten. Er war nämlich kein Kind mehr.
Weißt du, wie spät es ist?
Torsten wusste, dass dies eine rhetorische Frage war. Natürlich wusste Mama selbst, wie spät es war. Schließlich war sie an der hässlichen Uhr im Flur vorbeigegangen. Trotzdem fragte sie ihn. Vielleicht genoss sie seine Unsicherheit. Und sie genoss es zu sehen, wie Torsten hastig seinen Modellbaukasten zusammenpackte, wie er, dick, ungelenk und mit farblos blondem Haar, seine Mutter durch seine randlose Brille aufmerksam und ängstlich betrachtete.
Mutter liebt mich nicht.
Papa liebt sie auch nicht.
Ich weiß nicht einmal, ob sie sich selbst liebt.
Sie waren gerade aus dem Märkischen Viertel in ein windschiefes Häuschen am Eichborndamm gezogen. Es war etwas größer als das Loch im Märkischen Viertel, aber war es besser? Jedenfalls musste Papa für das Märkische Viertel nicht drei Lebensversicherungen verpfänden, um den Eigenanteil für die Hausfinanzierung aufzunehmen. Hierfür musste er es.
Der Eichborndamm. Nahe dem Flughafen. Das Einzige, was er von Tegel mitbekam, war der Lärm. Denn geflogen war er noch nie. Obwohl er ständig diese Sehnsucht hatte, wegzufliegen. Weit, weit wegfliegen. Aber wohin überhaupt? Davon hatte er keine Vorstellung. Er wollte weg, aber er wusste nicht, wohin. Es war eher eine Frage des »weg« als eine Frage des »wohin«.
Er räumte seine Modellsachen vom Tisch.
»Beeil dich ein bisschen«, sagte sie schnippisch. »Und dann kannst du den Tisch decken.«
Sie würde ihn immer herumkommandieren, dachte er. Nein, das dachte er nicht, das wusste er. Sie würde ihn immer herumkommandieren, bis …
»… bis was?«, fragte Mutter.
O Gott, konnte sie seine Gedanken lesen?
»Was meinst du mit bis was?«, fragte er.
»Ich habe nichts gesagt«, sagte Mutter.
Sie hatte mit Sicherheit etwas gesagt. Sie sagte immer etwas.
Sein Vater war es, der nichts sagte.
Der nur dastand und alles ertrug.
Ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Jeden Tag aufs Neue.
Papa hat sowieso nichts zu melden.
Er ist Busfahrer. Fährt die 222. Reinickendorf. Später die 213.
Hin und zurück.
Wie ein Pendel, das so lange pendelt, bis es reißt. Und fällt.
Den Bus hat er unter Kontrolle.
Und sonst nichts.
Mutter war dominant.
Mutter hatte andere Männer.
Mutter lud auch andere Frauen ein. Dann tranken sie Likör.
Und wenn sie am nächsten Morgen einen Kater hatte, verprügelte sie Torsten.
Und manchmal auch Papa.
Ja, Mutter verprügelte sie beide.
So war sie.
Und gleichzeitig war sie immer so gläubig.
Aber vielleicht war das nur gespielt?
»Wenn du masturbierst, dann tötet dich Gott«, sagte Mama.
Sie hatte neben seinem Bett im Dunkeln gestanden, als sie das gesagt hatte.
Er hatte tatsächlich masturbiert, nachts im Bett im dunklen Zimmer, unter seiner Decke. Er war in dem Alter, wo bereits etwas rauskam, deshalb hatte er sein Taschentuch irgendwie in Position gebracht.
Sie hatte die ganze Zeit dort gestanden. Im Dunkeln. Wie eine Statue. Er hatte sie nicht gesehen. Erst als der Höhepunkt kam, erst als er versuchte, möglichst viel von dem, was rausspritzte, in das Taschentuch zu befördern und nicht in die Bettdecke, erst da hatte sie sich bewegt.
Und als sein Orgasmus noch gar nicht vorbei war, während es noch aus ihm rausspritzte, da hatte sie die Worte gesagt:
»Wenn du masturbierst, dann tötet dich Gott.«
Perfektes Timing.
Sie hob die Hand, tat so, als wollte sie ihm die Bettdecke wegziehen.
Tat es dann aber doch nicht, sondern verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer.
Ließ Torsten unter der Decke mit seinem Ding in der Hand und dem glitschigen Taschentuch in der anderen liegen.
Mutter zeigte ihm, dass er schmutzig war.
Und vielleicht wollte er auch wirklich schmutzig sein.
Es war eine dieser Nächte, in der er wieder ins Bett machen würde.
Kapitel 6
Berlin, 2016
Jürgen Madsen konnte seinen Lkw nicht mehr schnell genug bremsen.
Er konnte nur noch ausweichen.
Der Mann mit dem Karton lief einfach weiter. Überquerte die Straße von Süden nach Norden, als ob es keine Autos gäbe.
Madsen hatte das Eos Cabrio gesehen. Er hatte das Kreischen der Bremse gehört. Er hatte schon geahnt, dass etwas schiefgehen könnte. Aber er hatte nicht geahnt, dass es derart schiefgehen würde.
Die Räder blockierten, während Madsen das riesige Lenkrad rechts zur Seite riss. Er sah den Mann mit dem Karton, sah kurz die Handschuhe (mein Gott, was war da an den Handschuhen?), sah die Augen, die ihn von unten unsicher und etwas blöde anstarrten, bevor der heruntergekommene Mann sie wieder auf die Straße richtete. Der blickte einfach nur auf die Straße! Als wäre da gar kein Lkw vor ihm! Was zum Teufel hätte er getan, wenn ich nicht so schnell gebremst hätte. Wenn …
Dann hörte Madsen ein dumpfes Krachen. Der Mann war verschwunden!
Hatte er ihn überfahren?
Doch er hatte keine Zeit mehr, darüber nachzudenken.
Kurz blitzte die rote Fassade des Hotels vor Madsens Windschutzscheibe auf. Rote Kacheln und eine riesige Glasscheibe, durch die der Fahrer in das Innere des Hotels sehen konnte. Die Rezeption. Tische, an denen Gäste saßen. Dahinter der Frühstücks- und Barbereich. Wie ein riesiger Guckkasten.
Madsen sah das alles in einem Bruchteil einer Sekunde. Dieselbe Sekunde, in der das Rot der Kacheln auf den Lkw zuraste, als wäre die ganze Welt in Blut getaucht.
Dieselbe Sekunde, als die Menschen hinter der Scheibe panisch aufsprangen.
Dieselbe Sekunde, in der der Mann vor dem Lkw plötzlich verschwunden war.
Er sah all das und hörte das Krachen, das Klirren von Glas und das Schreien von Menschen. Sah Gäste aufspringen und sich in Sicherheit bringen. Tische und Stühle fielen um, Menschen stolperten ins Innere.
Es war die Sekunde, in der der Lkw sich in die Frontscheibe des Hotels bohrte.
Kapitel 7
In der Hölle
Sie war in einem Red Room.
Auch wenn sie es noch nicht wusste.
Aber der Mann wusste es.
Red Rooms.
Red Rooms waren so ähnlich wie Snuff-Movies. Nur noch viel schlimmer.
Snuff-Movies waren Filme, in denen Menschen vor laufender Kamera gefoltert und getötet wurden. Gefoltert und getötet, um perversen und gleichzeitig gut zahlenden Kunden einen Kick zu verschaffen, den sie so sonst nicht bekamen.
Snuff-Movies tauchten Ende der Sechzigerjahre auf, wie eine von fauligen Gasen aufgeblähte Wasserleiche, die in einem warmen, von Algen verseuchten Sommertümpel plötzlich an die Wasseroberfläche hinauftreibt. Manche sagten, dass das erste Snuff-Movie 1969 entstand, als die Manson Family das Bel-Air-Massaker anrichtete. Sharon Tate, die schwangere Frau von Roman Polanski, war von der Manson Family ermordet worden. Manche sagten, dass die Manson Family das Massaker gefilmt hatte. Und manche sagten, dass die Killer ihr das Kind aus dem Leib herausgeschnitten hätten. Auch wenn dies nie bestätigt wurde.
»Red Rooms sind Snuff-Movies 2.0«, hörte sie die Stimme. »Web 1.0 war nur statisch. Das Web 2.0 ist interaktiv. Zum Mitmachen. Und das sind Red Rooms auch!« Die Stimme zögerte kurz. Der Mann sprach weiter. »Heute würde man sagen: innovativ!«
Die Stimme klang, als ob der Sprecher ein Tuch vor seinem Mund hatte. Irgendwie gedämpft.
Sie saß gefesselt auf dem Stuhl.
Die Kamera vor ihr.
Der Mann ebenfalls.
Der Mann, der die Totenkopfmaske trug.
Neben ihm ein Laptop. Bleiches Licht, das den Raum erfüllte.
»Das ist hier so wie eine Live Cam«, sagte er. »Live Jasmin und wie diese ganzen Plattformen heißen. Die mit den nackten Schlampen. Du weißt, was ich meine?«
Das Mädchen würgte, Angst schnürte ihr die Kehle zu. Magensäure schoss ihr die Speiseröhre nach oben. Sie schluckte angeekelt, konnte nichts sagen.
»Die Schlampe zieht immer mehr von ihren Sachen aus, je mehr die Nutzer zahlen«, sagte der Mann, und seine Stimme hallte blechern unter der Maske wider. »Und sie macht irgendwelche Sachen. Streichelt sich, fasst sich an, was auch immer.« Er tippte etwas in seinen Rechner ein. »Kennst du den Film Hostel?«
Sie antwortete nicht.
»Ich rede mit dir!«
Sie nickte nur. Mechanisch. Wie ferngesteuert.
Ja, sie kannte den Film. In Hostel ging es um einige Rucksacktouristen, die in Osteuropa in die Hände einer furchtbaren Mafia gerieten, die das »Hostel« betrieb. Einen Ort, an dem reiche, gelangweilte und perverse Geschäftsleute diese Touristen gegen Geld foltern und töten konnten. Sie hatte den Film gesehen. Und sich damals fast in die Hose gemacht. Aber das war kein Vergleich zu …
»Red Rooms sind Hostels mit einer Webcam«, sagte der Mann knapp. »Wie eine von diesen Online-Peepshows. Nur viel … brutaler. Ich mache … etwas mit dir. Und die Leute bezahlen. Und je schlimmer das ist, was ich mache, desto mehr bezahlen sie.« Er hielt kurz inne, als würde er erneut nachdenken.
Sie schaute ihn irritiert an. Warum die Pause? Besann er sich gerade eines Besseren? Hoffnung blitzte in ihren Augen auf. Hieß das, dass sie vielleicht befreit wurde? Hieß das, dass er sie nur einschüchtern wollte. Hieß das …
»Ich habe übrigens zwei Nachrichten für dich.« Seine Stimme durchschnitt wieder ihre Gedanken. Er schaute nach hinten. Das Mädchen folgte seinem Blick. Und schaute gleich wieder weg. Sie hatte gesehen, was dort hinten lag. Hinten lagen auf einem Tisch die Werkzeuge, die der Mann gleich einsetzen würde. Gleich, wenn die Kamera lief und die ersten Gebote kamen.
»Die gute Nachricht: Du wirst nicht mehr leben, wenn es wirklich schlimm wird.«
Er ging zum Tisch und holte ein Instrument, das er in die Kamera hielt. »Das richtige Leben«, es war ihr, als würde sie ein Grinsen hinter seiner Totenkopfmaske sehen, »findet hier nach dem Tod statt. Einfach deshalb, weil ich so nett bin. Vielleicht auch deswegen, weil du dann stillhältst.« Er hielt wieder inne.
»Die schlechte …«, und damit schien er ihr direkt in die Augen zu schauen. Und sie schaute wieder in die schwarzen Augenhöhlen der Totenkopfmaske. Sah dort nichts als Schwärze. Sah auch nicht das Grinsen hinter der Maske. »Du wirst danach nicht mehr so schön sein, wie du es jetzt bist.«
Er legte den Gegenstand auf den Tisch und schaute sich auf dem Laptop die Vorschläge und die Gebote der Zuschauer an. Dann prüfte er noch einmal, ob die Kamera lief. Er schaute auf den Monitor und dann auf sie, so wie ein Maler, der überlegt, an welcher Stelle er den ersten Pinselstrich machen soll.
»Ich glaube, ich weiß, was ich als Erstes abschneide«, sagte er dann.
Kapitel 8
Berlin, 2016
Ein Rettungswagen war bereits vor Ort, ebenso zwei Kollegen von der Bereitschaftspolizei. Ein zweites Auto hielt mit quietschenden Reifen. Der Notarzt sprang mit seinem Rucksack aus dem Wagen.
Die Feuerwehr würde ebenfalls jeden Moment kommen.
Clara, Hermann und Winterfeld schauten ehrfürchtig auf die Zerstörung, die der Lkw angerichtet hatte. Die Fahrerkabine hatte sich zu drei Vierteln in die Vorderfassade des Hotels gebohrt. Die gesamte Frontscheibe war zerstört, ebenso Teile der gekachelten Wand, von der sich ein Teil grotesk nach unten bog. Tisch, Stühle, Infokästen und ein Schirmständer mit etwa fünf verbogenen Regenschirmen lagen zerquetscht unter den riesigen Reifen des Lastwagens. Glasscherben waren bis zu dreißig Metern entfernt um die Unfallstelle herum verstreut und glitzerten im Licht der Straßenlaternen. Der Mann in der Fahrerkabine schien gerade aus seiner Schockstarre zu erwachen und schaute ungläubig nach unten.
Ebenso ungläubig schauten auch Clara, Hermann und Winterfeld, denn so laut der Knall gewesen war, der sie hierhergelockt hatte, es gab scheinbar keinen Verletzten. Jedenfalls nicht im Hotel. Offenbar waren die Gäste allesamt schnell genug aufgesprungen, als das riesige Metallmonster sich in die Vorderfront gebohrt hatte.
Zwei Polizisten und der Notarzt halfen dem Lkw-Fahrer aus der Fahrerkabine.
Sind Sie verletzt?
Nein, überhaupt nicht, was soll mir da oben schon passieren?
Können Sie selbst herunterklettern?
Klar.
Aber wir stützen Sie.
Der Lkw-Fahrer stieg unsicher die Stufen hinunter. Dann fiel er nach vorne. Die beiden Ärzte fingen ihn gerade noch auf. »Den nehmen wir schon mal besser mit«, sagte einer der Sanitäter. »So gut scheint er’s doch nicht verkraftet zu haben.«
»Schock«, sagte der andere. »Wir lassen ihn einen Tag stationär beobachten. Zugang mit NaCl legen. Und ruft seine Firma an, dass sie den Lkw holen, wenn die Kripo hier fertig ist.«
Clara, Hermann und Winterfeld konnten es weiterhin kaum fassen, dass im Hotel tatsächlich niemand verletzt worden war. Einige der Gäste hatten sich, wie sie hörten, mit wahren Hechtsprüngen in Sicherheit gebracht. Auch wenn der Lkw-Fahrer so schnell wie möglich gebremst hatte, grenzte es an ein Wunder, dass hier niemand zu Schaden gekommen war. Jedenfalls nicht körperlich.
Der Einzige, der offenbar verletzt war, war der Mann, der auf der Straße lag. Seine Kleidung war schmutzig und verwahrlost, den Gestank roch man über fünf Meter hinweg, und ein wenig Blut sickerte aus einer Kopfwunde. Der Notarzt war sofort bei ihm. Zwei der Sanitäter legten ihn auf Rettungsbretter. »Wirbelsäule scheint in Ordnung zu sein, aber man weiß ja nie«, murmelte der Notarzt. Einer der Sanitäter befestigte einen Stiffneck an seinem Hals.
»Hübsch«, sagte Winterfeld. »Sieht jetzt ein bisschen aus wie Philipp II.«
Clara wusste, dass Winterfeld im Sommer mit seiner Tochter in Madrid gewesen war. Im El-Escorial-Palast hatten sie Bilder von König Philipp II. mit den klassischen Halskrausen gesehen. So geschmacklos der Vergleich von Winterfeld war, so passend war er. Der Mann ließ sich den Stiffneck anlegen, ohne aufzusehen.
»Macht den Hals steif«, murmelte der Notarzt. »Wir wissen ja nicht, ob er eine Wirbelsäulenverletzung hat.«
»Gibt’s das auch für andere Körperteile?«, fragte Winterfeld, der mit seinen dummen Witzen noch nicht am Ende war. »Könnte eine Marktlücke sein.« Clara sah ihn strafend an und schüttelte den Kopf.
Der Mann ließ alles mit sich geschehen, ohne von alldem auch nur die geringste Notiz zu nehmen, und blinzelte lediglich blöde in die Gegend. Er schien das Bewusstsein verloren zu haben und hatte dennoch einen Pappkarton derart fest umklammert, als würde sein Leben davon abhängen. Einen Pappkarton, der doppelt und dreifach mit Isolierklebeband umwickelt war.
»Ist der vor den Lkw gerannt?«, fragte Winterfeld.
»Nicht nur vor den Lkw«, sagte in dem Moment eine Stimme. Ein Mann in Adidas-Jacke stand hinter ihm.
»Thomas Spiering mein Name«, sagte der Mann. »Mir wäre der Typ«, er zeigte nach unten, »auch fast vors Auto gelaufen. Ich war auf der anderen Fahrbahn. Konnte gerade noch ausweichen. Als ich das Krachen gehört hab, habe ich sofort den Notarzt gerufen.«
»Gut gemacht«, sagte Winterfeld, »da sind die anderen Typen ja nicht draufgekommen.« Er zeigte auf die Hotelgäste, die noch immer hinter der zerstörten Fensterfront standen und einfach nur dumpf auf die Straße gafften. Einige hatten den Schock offenbar schon überwunden, was sich darin zeigte, dass sie ihre Handys hervorholten und begannen, die Szene zu filmen. Ansonsten taten sie nichts.
Clara beugte sich neben dem Notarzt über den verwahrlosten Mann, der auf der Straße lag, den Karton noch immer fest umklammert.
Sein Haar war fettig und roch faulig, die Haut gelblich grau, so als hätte er einen Leberschaden in Kombination mit Hepatitis. Der Notarzt hatte bereits Gummihandschuhe angezogen. Gummihandschuhe, wie sie dieser Mann auch trug. Clara fielen die rotbraunen Spritzer an den Handschuhen sofort auf. »Sieht wie Blut aus.«
Winterfeld kniete sich neben sie und nickte. Die Polizisten nahmen bereits die Personalien der Umstehenden auf, während Hermann mit dem Lkw-Fahrer sprach.
»Scheint ein Junkie zu sein«, sagte Clara.
»Ja, wie Dr. Feelgood oder ein Californian Dreamboy sieht er nicht aus«, knurrte Winterfeld. »Könnte auch bei The Walking Dead mitspielen. Würde sogar billiger, weil sie keine Maske brauchen.«
Clara schüttelte kurz den Kopf, aber ihr Chef hatte recht. Der Kerl war Junkie, und er war vollkommen heruntergekommen. Die Ärmel von seinem stockfleckigen Hemd von undefinierbarer Farbe waren hochgekrempelt und zeigten Dutzende von Einstichen in beiden Armen. Spritzenstraßen, wie man sie im Drogendezernat nannte. Die Lippen waren trocken und rissig, Blut klebte daran, die Zähne nichts als schwarze, abgebrochene Stümpfe, der Atem faulig und fast noch schlimmer als der Körpergeruch des Mannes.
Es war ein Mann, der sich komplett aufgegeben hatte. Die Feuerwehr hatte vor kurzem einen Mann in vergleichbarem Zustand aus seiner Wohnung geholt. Er war dermaßen abgefüllt gewesen, dass er selbst seine Körperfunktionen nicht mehr unter Kontrolle hatte und die Feuerwehr den ganzen Einsatzwagen reinigen lassen musste, nachdem der Mann auf der Liege Kot und Urin hinterlassen hatte.
»Können Sie mich hören?«, fragte der Notarzt. Er hatte zusätzlich eine Kompresse an der Stirn des Mannes befestigt. Das war eher zur Vorsicht geschehen, denn die kleine Wunde am Kopf blutete kaum mehr.
Der Mann bewegte sich leicht, tastete um sich, wie jemand, der im Halbschlaf nach seinem Kissen sucht. Er fühlte den Karton. Schien erleichtert zu sein. Plötzlich öffnete er die Augen. Sein Kopf schoss nach vorne. Seine Kiefer schnappten zu. Und schon hatte er dem Notarzt in die Hand gebissen.
»Au, mein Gott!« Der Arzt zog die Hand zurück.
Einer der Polizisten beugte sich über den Mann, um ihn zu beruhigen. Doch der Kopf des Mannes zuckte noch einmal nach oben. Seine Stirn erwischte die Nase des Polizisten. Es gab ein trockenes Knacken. Blut schoss dem Beamten aus der Nase. »Verdammt«, rief er. Zwei weitere Beamte waren zur Stelle und hielten den Mann fest. »Wirbelsäulenfraktur«, knurrte einer, »von wegen. Der hüpft hier rum wie ein junges Reh!«
Der Junkie schien tatsächlich kaum verletzt zu sein. »Ich habe sie gebissen, gebissen«, schrie er plötzlich und ließ die Kiefer klappernd aufeinanderknallen. »Gebissen, damit ich einschlafen kann!«
»Da ist tatsächlich Blut an seinen Lippen«, sagte Winterfeld.
Der Notarzt betrachtete seine Hand, in die der Irre ihn gebissen hatte. »Von mir ist es zum Glück nicht.«
»Kann aber auch sein«, sagte Clara, »dass er sich in die Lippen gebissen hat.«
»Wo ist mein … mein …« Er fuchtelte mit den Armen, ertastete den Karton und wollte ihn festhalten. »Ahhhh, hier!«
»Was ist da eigentlich an Ihren Handschuhen?«, fragte Winterfeld.
»Blut«, krächzte der Mann, und seine Stimme überschlug sich. »Das Blut der Lebenden! Ich habe es ihnen genommen. Ich werde ihnen noch anderes nehmen! Noch meeeehr!«
Clara und Winterfeld sahen sich an.
»Wollen Sie den mitnehmen?«, fragte Winterfeld den Notarzt. Der schüttelte den Kopf. »Nein, er scheint keine Wirbelsäulenverletzungen zu haben. Wie es aussieht, wurde er von dem Lkw gar nicht erwischt. Abgesehen von seiner Bissigkeit scheint er okay.« Der Mann zuckte die Schultern. »Und Tollwut können wir eh nicht heilen.« Clara verdrehte die Augen. Winterfeld nickte und wählte die Nummer des Bereitschaftsarztes der Gefangenensammelstelle, der GeSa im LKA1 der Keithstraße. Irgendetwas mit diesem Typen stimmte nicht.
»Hat der gerade einen Trip?«, fragte Clara den Notarzt.
Der zuckte die Schultern. »Schon möglich. Könnte LSD sein. Oder schlechte Pilze aus Osteuropa. Einer der Typen, die sich am Kotti dieses üble chemische Zeug geholt haben, das die in irgendwelchen Laboren in der Ukraine zusammenmischen.
Die lösen Trips aus, von denen man nicht mehr runterkommt. Drogeninduzierte Psychose.«
»Trip«, brabbelte der Mann, »Trip? Nein, es ist alles wahr!«
»Was ist wahr?«, fragte Clara.
»… und dann reden sie alle von der Legalisierung harter Drogen«, murmelte Winterfeld. »Bei dem Zeug befördert dich der erste Kontakt aus dem Leben. Ohne dass er dich tötet.«
In dem Moment wurde der Mann unter ihnen plötzlich munter. Er riss die Augen auf, wahrhaftig wie ein Zombie. »Ich habe sie gepfählt! Sie alle … gepfählt!! Auf einem Holzpfahl! Für alle zu sehen! Man muss das Fleisch wegschneiden. Die Verbindung. Zwischen Anus und Vagina. Dann passt der Pfahl durch. Und dann sitzen sie … auf dem Pfahl! Und rutschen langsam runter. Man kann dabeisitzen und die Zeit stoppen … Zeit stoppen, bis der Pfahl oben aus dem Kopf kommt!« Er schaute Winterfeld, Clara und den Notarzt begeistert mit aufgerissenen, irren Augen an, während die Polizisten die Gaffer zurückhielten.
»Verdammt«, sagte Winterfeld, »von was reden Sie da?«
»Von dem, der da ist! Und der all das tut!«
»Der all das tut?« Clara zog die Brauen zusammen.
»Der … Tränenbringer!« Der Mann richtete die Augen zum Himmel, als würde er auf eine göttliche Offenbarung warten. »Und der Tränenbringer weiß, dass noch viel mehr sterben werden!«
»Tränenbringer?«, fragte Winterfeld.
Doch in dem Moment hielt sich der Mann die Hand vor den Mund, so als würde nie wieder ein Wort über seine Lippen kommen.
»Wer ist der Tränenbringer?«, fragte Winterfeld. »Und was hat das mit dem Pfählen auf sich? Hängt das mit dem Blut an Ihren Händen zusammen?«
Der Mann schüttelte nur noch mechanisch den Kopf und starrte mit reglosen Knopfaugen zum Himmel.
»Nein, nein … nein«, winselte er.
Winterfeld stand auf. »Nun gut, Freundchen, wir werden uns mal in aller Ruhe unterhalten!« Er gab den Bereitschaftspolizisten ein Zeichen. »In die Gefangenensammelstelle mit ihm! Und dann werden wir«, er schaute Clara und Hermann an, »ein ernstes Wort mit ihm reden. Die Handschuhe müssen ins Labor, und ich will wissen, was in diesem verdammten Karton ist, der ihm so heilig ist. Muss Boonstra seine Schulung halt ohne uns machen.«
»Ich hole MacDeath«, sagte Clara. »Er ist noch an der Humboldt-Uni.«
»Gut«, sagte Winterfeld. »Treffen ist in dreißig Minuten wieder hier.«
»Dreißig Minuten …« Die Stimme des Junkies ertönte hinter ihnen. Wie aus einem Grab. Alle drehten sich um.
»In dreißig Minuten«, sein schiefer Mund mit den zerbrochenen Zähnen und den blutigen, aufgeplatzten Lippen war zu einem diabolischen Grinsen verzerrt. »In dreißig Minuten kann schon wieder einer sterben. Oder … eine!«
Kapitel 9
Berlin, 2016
Es war 17:30 Uhr.
Wolfgang Neumann hörte das Klingeln an der Tür.
Er war gerade von der Arbeit gekommen. In der Kastanienallee einen Parkplatz zu finden war immer schwer, heute hatte er allerdings mit dem Auto fahren müssen. Parken in Prenzlauer Berg hatte ihm schon öfter einen Wutanfall beschert. So auch heute, als er kurz davor gewesen war, in ein besonders bescheuert geparktes Auto, einen Opel, einfach mit Karacho hineinzufahren. Oder einfach den Wagen auf der Straße stehen zu lassen, so wie Michael Douglas in Falling Down. Getan hatte er es natürlich nicht und stattdessen ganze fünfzehn Minuten nach einem Parkplatz gesucht.
Dafür war die Wohnung, die sie hatten, wunderschön. Mit einem Garten hinter dem Mehrfamilienhaus. Stadtnah, zentral, und dennoch etwas grün. Es war der Prenzlauer Berg, wo die Gentrifizierung voll zugeschlagen hatte und die Fruchtbarkeit eine der höchsten im kinderarmen Deutschland war, sodass man schon von Pregnancy Hill sprach, wenn man Prenzlauer Berg meinte. Auch die Neumanns hatten eine Tochter.
Er drückte auf den Summer und sprach in die Gegensprechanlage.
»Ja bitte?« Wahrscheinlich ein verspäteter Postzusteller von DHL. Seine Tochter Lisa kaufte regelmäßig von ihrem Taschengeld sämtliche Online-Modeanbieter leer. Schrei vor Glück. Und schick’s zurück. Das war auch das Motto von Lisa.
»Ja bitte?«, fragte er noch einmal. Er wollte, dass der Post-Typ wusste, in welche Etage er musste, und nicht ewig durch das Haus irrte. Zuhören war nicht gerade die Stärke einiger Zusteller. Und Wolfgang Neumann musste dann immer ewig warten, bis sich die Postboten noch einmal meldeten. »Vierter Stock«, rief er noch einmal in die Gegensprechanlage.
Doch am anderen Ende hörte er nur Rauschen.
Er ließ die Tür einen Spalt offen und sortierte den Inhalt seiner Aktentasche. Seinen Laptop, die Zeitung, die er heute Morgen eingepackt und mitgenommen und noch gar nicht gelesen hatte, die langweilige Präsentation von heute Vormittag, die der eifrige Praktikant extra farbig für alle ausgedruckt hatte. Schöne Verschwendung von Papier und Geld.
Er lauschte mit einem Ohr, ob der Postbote schon an der Tür war. Er hörte Schritte. Dann war es still. Dann wieder Schritte. Schritte, die sich schnell entfernten. Waren sie auf der Treppe? Oder gurrte der Aufzug?
Was war da los? War das ein Streich der Nachbarkinder?
Er ging zur Wohnungstür, die weiterhin einen Spalt offen stand.
Öffnete die Tür vollständig.
Dort lag das Paket. Irgendeiner hatte es dort hingelegt.
Aber niemand hatte ihn gebeten, eine Empfangsbestätigung zu unterschreiben. Und das Paket war auch nicht frankiert.
Das Paket lag einfach da.
Drohend. Kauernd.
Irgendwie nicht so, wie es sein sollte.
Er setzte seine Brille auf.
Blinzelte auf die Oberfläche.
Doch da stand kein Absender. Und keine Adresse.
Dafür war auf dem Paket ein großer Umschlag mit Klebeband befestigt.
Er bückte sich und öffnete den Umschlag.
Obwohl ihm eine innere Stimme sagte, dass er das nicht tun sollte.
Dann hatte er den Umschlag in der Hand.
Riss ihn auf. Merkte, dass er stoßweise atmete.
In dem Umschlag war irgendetwas aus Stoff. Und dazu ein Handy. Ein Handy mit aufgesetzter rosa Hasenohrendekoration aus Gummi. So wie sie die Mädchen in Asien gern trugen.
Er wusste nicht, was genau das zu bedeuten hatte. Er wusste nur, dass es nichts Gutes bedeutete.
Nach einer Sekunde begriff Wolfgang Neumann, dass es das Handy seiner Tochter Lisa war.
Nach zwei Sekunden klingelte es.
Kapitel 10
Berlin, in den Achtzigern
Mama hatte gesehen, wie er es getan hatte.
Er hatte dann das Taschentuch ins Klo geworfen.
Wenn du masturbierst, dann tötet dich Gott.
Das hatte sie gesagt.
Sie hatte nicht gesagt wenn du deinen Schwanz anfasst, tötet dich Gott.
Sie hatte den wissenschaftlichen Begriff benutzt. So als wollte sie alles ganz klar benennen. Wie ein Arzt, der eine Krankheit feststellt.
Du bist krank.
Ja, Torsten Rippken. Du bist krank.
Du hast keinen Schnupfen. Keinen Krebs. Kein Fieber.
Aber du bist trotzdem krank.
Und wenn du masturbierst, dann tötet dich Gott.
Nachts hatte er ins Bett gemacht.
Er war aufgewacht. Es war 3:30 Uhr.
Alles war nass.
Er sah den Schatten.
Seine Mama stand schon wieder da.
Holte ihn aus dem nassen Bett.
Griff hart zu.
Wie alt bist du?
Vierzehn.
Glaubst du, andere Kinder pissen auch mit vierzehn noch ins Bett?
Sie zerrte ihn ins Bad.
Wusch ihn.
Wusch auch … sein Ding.
Und sein Ding wurde hart.
Sie schaute an ihm herunter.
»Was ist das?«, fragte sie.
Torsten sagte nichts.
»Dreckiges Schwein!«
Und sie wusch sein Ding weiter.
Ich wusste niemals, ob ich sie wirklich ganz hasste.
Vielleicht war da noch etwas anderes.
Nun werde ich es nie mehr erfahren.
Als er wieder im Bett lag, war sein Ding noch immer hart.
Er hatte ein neues Taschentuch dabei.
Und er machte es noch einmal.
Und dachte an die Hände von Mama.
Dachte daran, wie sie mit Wasser und Seife sein Ding sauber machte.
Sah das Bild. Wieder und wieder.
Sah die Hände seiner Mama, bevor er fertig war.
Und sah noch ein anderes Bild.
Erst verschwommen und diffus, aber dann immer klarer.
Er sah das Gesicht seiner Mutter.
Und ihren Kopf.
Nur ihren Kopf.
Ihren Kopf auf einem Speer.
Kapitel 11
Berlin, 2016
Clara parkte ihren Wagen im Parkverbot an der Georgenstraße und ging mit schnellen Schritten zum Haupteingang des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität. Die Brüder Grimm, dachte sie. Nach denen könnten sie auch das Rathaus benennen. Und das Abgeordnetenhaus. Bei all den Märchen, die die Politiker dort den Bürgern auftischten. Gegenüber lag das Restaurant Da Vinci unter den S-Bahn-Bögen, und der dicke Italiener, der immer vorbeigehende Passanten ansprach, stand wie so oft vor der Tür und nickte Clara zu. Clara hatte dort schon öfter nach Dienstschluss auf dem Heimweg gegessen, und besonders die Pizza Diavolo hatte es ihr angetan.
Vor dem Hörsaal war auf einem kleinen Bildschirm der Titel der Vorlesung angekündigt. Die Inszenierung von Tod und Angst im Spiegel der Jahrhunderte.
Im Inneren des Hörsaals war ein großes Bild der Laokoon-Gruppe an die Wand geworfen, einer antiken Skulpturengruppe, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Rom ausgegraben worden war. Der Saal war abgedunkelt, und das Licht des Stehpults und des Beamers beleuchtete die einzelne Figur, die am Fuße der großen Leinwand stand. MacDeath trug einen Wollanzug mit Weste und grüner Krawatte. Auch wenn seine Farbauswahl manchmal etwas schrill war, musste Clara ihm lassen, dass er von seinem Stilempfinden her ziemlich treffsicher war. Eine Seltenheit für einen Mann, der allein lebte. Noch allein lebte, verbesserte sich Clara dann. Wobei MacDeath ja auch schon verheiratet gewesen war, was sich sicher förderlich auf sein Stilempfinden ausgewirkt hatte.
Clara blickte auf das Bild der Laokoon-Gruppe auf der Leinwand. Die antike Darstellung galt damals, als Renaissance-Archäologen sie ausgruben, als eines der Beispiele antiker Bildhauerei. Das Bild zeigte den Priester Laokoon, der gerade von Wasserschlangen ins Meer gezogen wurde.
»Laokoon«, sagte MacDeath, »war bei der Belagerung von Troja der Einzige gewesen, der erkannt hatte, dass das Trojanische Pferd eben nicht das war, was es schien – ein Geschenk –, sondern das, was es wirklich war: ein, na ja, Trojanisches Pferd.« Clara setzte sich, wie schon öfter, in eine der hinteren Reihen, während sie MacDeath’ Vortrag lauschte. »Laokoon hatte vorher mit seinem Speer an das Pferd geklopft und festgestellt, dass es innen hohl war. Logischerweise, denn es musste ja all den griechischen Kriegern Platz bieten. Die Göttin Athene allerdings wollte, dass Troja unterging und musste Laokoon irgendwie ruhigstellen, damit er die Warnung, die durchaus berechtigt war, nicht noch weiter hinausposaunte. Am besten für immer. Darum schickte sie zwei riesige Meeresschlangen, die Laokoon ins Wasser zogen. Eigentlich eine unangenehme Sache, oder?«
MacDeath schritt die erste Reihe der Studierenden ab. »Was würden Sie in diesem Fall tun?«
»Schreien?«, fragte eine Studentin in der zweiten Reihe.
»Wahrscheinlich. Und schreit die Skulptur?«
»Nein.«
»Manche sagen«, fuhr MacDeath fort, »dass der Bildhauer die fatalistische Ruhe Laokoons zeigen wollte, der seinem Tod stumm ins Auge sieht. Die Trojaner waren dabei übrigens noch so blöd zu glauben, dass er nicht für die Warnung bestraft wurde, es handele sich bei dem Trojanischen Pferd um eine Kriegslist, sondern dafür, dass er mit seinem Speer das griechische Geschenk beschädigt hatte. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich Ihnen diese Skulptur zeige.« Er machte eine kurze Pause, wie man es bei Reden tun sollte. Bei jeder Pause bis drei zählen. Clara zählte selbst mit. 21, 22, 23. MacDeath sprach weiter. »Es gibt noch ein paar andere Gründe, die wir auch heutzutage in der Kriminologie häufig finden: Gewalt gegen Schwächere, wie sie hier die Göttin gegen einen sterblichen Priester anwendet. Außerdem kann sich der Betrachter am Leid eines anderen weiden, wobei der Betrachter selbst in Sicherheit ist. Auch das geschieht hier. Und zuletzt geben sich die Künstler alle Mühe, den Schrecken so perfekt wie möglich zu inszenieren. Fast wie im heutigen Horrorfilm.«
Eine Studentin meldete sich. »Und wie ist es medizinisch? Mit dem Schreien?«
»Medizinisch gesehen hat der Bildhauer recht: Beim Tod durch Ersticken oder Ertrinken gibt es, bedingt durch die Krämpfe, keine Äußerungen der Stimme mehr. Laokoon schreit deshalb nicht, weil er nicht mehr schreien kann.«
Er klickte zu einem nächsten Bild, das den Philosophen Seneca zeigte, gemalt von Peter Paul Rubens, wie er sich in seiner Badewanne stehend die Pulsadern von seinem Diener aufschneiden ließ. »Der Tod«, sagte MacDeath, »war in der Antike, anders als heute, kein schreckliches Finale, vor dem wir so lange wie möglich davonlaufen, sondern eine logische Kulmination des Lebens, genau genommen sein Höhepunkt. Bei den antiken Skythen galten alte Menschen als Last, da sie nichts mehr für die Gesellschaft beitragen konnten. Von ihnen wurde erwartet, dass sie sich irgendwann selbst umbrachten, so wie Seneca.«
»Hat das nicht sein Diener gemacht?«, fragte eine junge Dame in der dritten Reihe, die ein altes Stofftiermaskottchen auf dem Pult stehen hatte.
»Vollkommen richtig. Die Leute hatten damals für alles ihre Dienerschaft. Selbst der Selbstmord wurde ausgelagert.« MacDeath betrachtete sich kurz in der Glastür und zog seine Krawatte zurecht. »Im Bett zu sterben, war verpönt. Wer ein Mann war, starb in der Schlacht, und wem diese Premiumversion nicht gelang, der sollte dann doch wenigstens von eigener Hand sterben. Erst das Christentum schob dem einen Riegel vor. Jahrhunderte lang galten Selbstmörder als sichere Kandidaten für das ewige Höllenfeuer.«
Ein Student meldete sich. »Ist unsere Gesellschaft dann abgestumpfter oder ist sie verweichlichter als die früheren Gesellschaften?«
MacDeath nahm seine Brille ab und putzte sie an seiner Krawatte. »Das ist schwer zu sagen. Fakt ist, dass heute, bedingt durch all diese Internet-Pornokanäle, jeder Teenager mehr über sexuelle Varianten und Perversionen weiß, als die schlimmsten Mogulen und Wüstlinge der Antike. Wahrscheinlich kennt sogar jeder Zehnjährige mehr Stellungen als Kaiser Nero. Andererseits wurden früher Menschen öffentlich auf dem Marktplatz hingerichtet. Selbst Kinder sahen damals dabei zu. Heute sehen wir so etwas, gottlob, nicht mehr, es sei denn, wir schauen uns irgendwelche Hinrichtungsvideos an, die es ja seit kurzem in genügend großer Zahl gibt. Aber gerade die Beliebtheit von Horrorfilmen zeigt, dass wir diesen Schrecken irgendwie brauchen.« Er holte ein Buch hervor und las daraus hervor. »Die stärkste und älteste Empfindung ist die Angst, und die stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten, sagte schon der Horror-Großmeister H.P. Lovecraft vor über hundert Jahren.«
Clara schaute auf ihr Handy. Noch keine Neuigkeiten von der GeSa oder vom LKA. Dennoch würde sie es begrüßen, wenn MacDeath langsam zum Ende käme. Doch der redete weiter. »Wenn wir einen Horrorfilm schauen, passiert das Gleiche, wie wenn wir wirklich in Gefahr sind. Die Herzfrequenz erhöht sich, die Blutgefäße verengen sich, die Bronchien weiten sich, wir atmen schneller, um uns besser mit Sauerstoff versorgen zu können. Auch unser Blut wird dicker, um bei möglichen Verletzungen vorbereitet zu sein und weniger rasch zu fließen. Wir verlieren den Appetit, die Körpertemperatur steigt und kalter Schweiß bricht aus. Gleichzeitig spannen sich die Muskeln. Dies sind die Funktionen des sympathischen Systems im Gehirn, des Sympathikus. Situative Reaktionen auf Gefahren, die uns drohen könnten.«
»Fight, Flight, Fright?«, fragte einer der Studenten.
»Richtig. Kampf oder Flucht oder sich tot stellen. Bei langweiligen Vorträgen bleibt uns meist nur ›Fright‹ übrig, also: sich tot stellen.«
Einige lachten.
»Dann«, sagte MacDeath, »gibt es das parasympathische System. Rest and digest. Ruhen und verdauen. Das ist sozusagen der Autopilot. Senkt den Herzschlag und den Blutdruck und verringert das Lungenvolumen. Das sorgt dafür, dass manche von uns in den Morgenstunden Asthmaanfälle haben.«
»Warum das?«
»Die Schleimproduktion wird erhöht. Gleichzeitig werden die Atemwege enger, weil wir nicht so viel Lungenvolumen benötigen. Der Sympathikus öffnet die Bronchien, der Parasympathikus schließt sie wieder. Dadurch müssen wir husten.«
»Oder Asthmaspray nehmen«, sagte die Studentin mit dem Maskottchen. Und hielt einen Aspirator hoch.
»Und?«, fragte MacDeath, »wie sind die Nebenwirkungen?«
»Manchmal Zittern und Herzrasen.«
MacDeath nickte. »Das liegt am Adrenalin. Das Zeug, was uns in den Angriffsmodus versetzt.«
»Das ist im Asthmaspray?«
»Ja. Das Problem von Asthma sind enge Atemwege. Rest and digest. Wenn wir unseren Organismus wieder in den Angriffsmodus bringen, erweitern sich die Atemwege. Schließlich brauchen wir Sauerstoff. Und das geht mit Adrenalin.« Er sah sich um. »Erst die Aufregung. Und dann die Ruhe!«
»Das heißt, wir sind am Ende glücklich?«, fragte eine andere Studentin. »Auch wenn es vorher schlimm war, wenn es am Ende gut ausgeht, sind wir glücklich?«
MacDeath nickte. »So ist es auch im Thriller.« In dem Moment wusste Clara, dass er sie gesehen hatte. »Und so funktioniert unser Gehirn. Die Glückgefühle sind umso stärker, je mehr wir vorher Angst hatten. Es ist wie bei Halloween: Auf den Schrecken folgen die Süßigkeiten.«
Kapitel 12
Berlin, 2016
Im Auto erklärte Clara MacDeath den Sachverhalt mit knappen Worten. MacDeath putzte noch einmal seine Brille an seiner Krawatte und hörte aufmerksam zu, während er abwechselnd Clara, die Brille und die Straße anblickte.
»Blutige Handschuhe, dann irgendwelche Gewaltfantasien. Und einen seltsamen Karton hatte er dabei?«, fasste MacDeath zusammen.
»Ja, der Typ stand total neben sich. Ist einfach so, ohne zu gucken, über eine vierspurige Straße gelaufen. Und hat damit noch einen ziemlich schweren Unfall verursacht.«
»Echt schmerzfrei, der Typ«, sagte MacDeath und schüttelte den Kopf. »Kurfürstenstraße?«
»Ja, die hat er einfach von Süden nach Norden überquert, Richtung Keithstraße. Im Berufsverkehr, ohne Ampel und Zebrastreifen. So, als ob es gar keinen Autoverkehr gäbe.« Sie bogen in die Friedrichstraße nach Süden ein.
»Erinnert mich an die Touristen in Berlin.«
Clara überhörte den Einwurf. »Ein Lkw musste ausweichen und ist deswegen in die Front von diesem Hotel an der Ecke Keithstraße, Kurfürstenstraße gerast. Zum Glück wurde niemand verletzt.«
»Und wie geht es dem Kerl jetzt?«, fragte MacDeath.
»Er hat eine leichte Kopfwunde. Und ist ziemlich benommen. Wobei ich glaube, dass das eher etwas mit den Drogen zu tun hat, die er eingeschmissen hat.«
»Na schön«, sagte MacDeath, »dann schauen wir uns den Knaben doch mal an.«