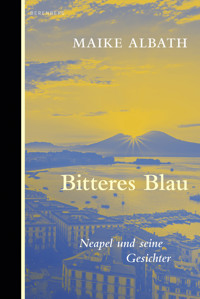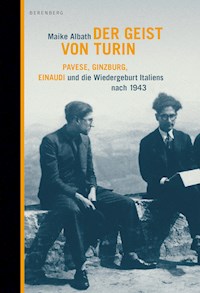Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sizilien, die magische Insel, ihre Literatur, ihre brodelnde politische Gegenwart – all das wird zum Thema in diesem dritten großen Italienbuch von Maike Albath, die mit Land, Literatur und Bewohnern vertraut ist wie nur wenige. Der Horizont reicht von Lampedusas Leopard, mit dem die Insel die Bühne der Weltliteratur betritt, über Leonardo Sciascia bis zu Andrea Camilleri und seinen international erfolgreichen Montalbano-Krimis. Ein verführerischer Streifzug durch die Geschichte, durch Landschaften und die Straßen von Palermo und Catania, wo sich bis heute eine kulturelle und literarische Vielfalt erhalten hat, die einmalig ist in Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAIKE ALBATH
Trauer und Licht
Lampedusa, Sciascia, Camilleriund die Literatur Siziliens
ANKUNFT
IM BALLSAAL
Angelica betritt das Parkett
DER GLANZ VON PALERMO
Im Palast des Leoparden
FAMILIENROMAN
Der Neffe der Fürstin
JUNGE DICHTER IM THERMALBAD
DER MÜSSIGGÄNGER AUF ABWEGEN
DER LEOPARD
Wer hat in Sizilien die Macht?
IRRLÄUFE EINES MANUSKRIPTS
Der Fürst tritt ab
VISCONTI UND DIE OPULENZ
ELEFANTEN IN CATANIA
Die Wahrheitssucher
MÜTTER UND SÖHNE
Der sizilianische Mann
IM MUTTERBAUCH
Vitaliano Brancati
EINER, KEINER ODER DOCH HUNDERTTAUSEND?
Luigi Pirandello
DAS GLEISSENDE LICHT DER VERNUNFT
Leonardo Sciascia
DIE WAHRHEIT DES FÄLSCHERS
Sciascia und die Geschichte
VIELE GESICHTER
Auf dem Ballarò
DER IDEENSCHMUGGLER
Andrea Camilleri
»ES WAR NICHTS PASSIERT.«
Die Mafia
TRAUER UND LICHT
Stefano D’Arrigo, Letizia Battaglia und Elvira Sellerio
BIBLIOGRAFIE
ÜBER DIE AUTORIN
Impressum
ANKUNFT
Der Busfahrer in Reggio Calabria zeigt eine abschüssige Straße hinunter und wedelt mit dem Arm. Dort hinten sei der Hafen, wo sich auch die Anlegestelle der Fähre nach Messina befinde. Es ist ein heißer Spätnachmittag im September, ein Montag. Die Gegend ist abgelegen. Baustellen säumen den Bürgersteig, Müll liegt herum, kaum jemand ist unterwegs. Ob es stimmt? Doch dann kommt man an ein großes Eisentor und blickt auf den Kai. Auf einem Betonklotz prangt das blaue Emblem der Schifffahrtsgesellschaft: Liberty Lines – Aliscafo. In der Schalterhalle hängt der Fahrplan, alle halbe Stunde gibt es eine Verbindung. 25 Minuten soll die Überfahrt dauern. Der Wartesaal füllt sich, kalabresische und sizilianische Familien stehen herum. Das Tragflügelboot, das seit 1958 verkehrt, wird benutzt wie ein Linienbus. Als es anlegt, eilen Pendler zum Ausgang, ein paar Herren, die wie Rechtsanwälte aussehen und sich über einen Kaufvertrag unterhalten, alte Leute auf Verwandtenbesuch. Unter den Einsteigenden sind junge Männer mit Sporttaschen, Studenten, Mütter mit Kindern, zwei Mädchen, die sich hinter ihren Sonnenbrillen verschanzen und Stöpsel im Ohr tragen. Jemand telefoniert auf dem Handy. Dunst liegt über der bergigen Küste von Sizilien; auf dem Schiff ist man einen Moment lang verwirrt: Welche Seite ist jetzt welche? Aus der Ferne erkenne ich Villa San Giovanni, den Hafen für den Bahnübergang, dort wird der Zug aus Neapel auf die neuen großen Fähren von Trenitalia verfrachtet. Aus der Brücke über die Meerenge, die Milliarden verschlang und vielen Sizilianern und Kalabresen seit 1981 einen festen Arbeitsplatz in verschiedenen Planungsbüros verschaffte, ist bis heute nichts geworden. Stattdessen fährt der Zug immer noch in den Bauch der Fähre hinein und auf der anderen Seite wieder heraus und dann die Küste hinunter, bis nach Syrakus. Man sieht die mächtigen Schiffe gemächlich über die Meerenge kreuzen. Es ist ein hochliterarisches Terrain.
Der Ich-Erzähler in Elio Vittorinis Ende der dreißiger Jahre erschienenem Roman Gespräch in Sizilien nimmt an Deck der Fähre über das winterliche Meer sein Frühstück ein und verzehrt mit großem Appetit sizilianischen Käse. Seine Reisegenossen erkennen in dem Mann, der in Mailand als Setzer arbeitet, sofort einen Auswanderer – denn ein Sizilianer würde am Morgen niemals etwas essen. Damals dauerte die Reise zwei Tage: Abfahrt in Mailand, Umstieg um Mitternacht in Florenz, am nächsten Morgen Ankunft in Rom, von dort bis nach Neapel und ab mittags die Küste hinunter. »Dann fuhr ich mit dem Zug durch Kalabrien, es begann wieder zu regnen, Nacht zu werden, und ich erkannte die Fahrt wieder, mich als Kind auf meinen zehn Fluchtversuchen von zu Hause und von Sizilien, hin und her durch dieses Land voll Rauch und Tunnels und unbeschreiblichen Pfiffen des Zuges, der nachts im Schlund eines Berges hält, am Meer, mit Namen aus uralten Träumen, Amantea, Maratea, Gioa Tauro. […] Ich schlief ein, ich erwachte und schlief wieder ein, um aufs Neue zu erwachen, bis ich schließlich an Bord des Fährbootes nach Sizilien war.« Vittorini, 1908 in Syrakus geboren, war der Sohn eines Eisenbahners und wurde in Mailand zu einem herausragenden italienischen Intellektuellen. Er war Schriftsteller, Zeitschriftenherausgeber und Verlagslektor. Nach Sizilien kehrte er kaum je zurück. Sein Roman prägte eine ganze Generation und gilt als eines der großen Werke des Neorealismus. Sizilien scheint als ein mythischer Raum auf, wo das Ich zu sich selbst findet, durch die Begegnung mit der Mutter von seiner Unruhe und zerstörerischen Wut kuriert wird und wieder aufbrechen kann, um sich den Anforderungen der Gegenwart zu stellen – dem Kampf um ein anderes Italien. Die Insel ist ein Hort von etwas Ursprünglichem, ein heilsames Terrain.
Giuseppe Tomasi di Lampedusas imposanter Held Don Fabrizio, der Fürst aus dem Leoparden, nimmt 1883 denselben Weg wie Vittorinis Protagonist, aber er kehrt nach der Konsultation eines Arztes in Neapel zum Sterben nach Sizilien zurück. Sechsunddreißig Stunden sei er »in einem glühenden Kasten eingesperrt« gewesen, vom Rauch der Tunnels fast erstickt. »Sie fuhren durch ungesunde Gegenden, über unheimliche Gebirgszüge, über malariaverseuchte, wie erstarrte Ebenen – Ausblicke in Kalabrien und der Basilicata, die ihm barbarisch vorkamen, während sie doch denen in Sizilien ganz ähnlich waren. Die Eisenbahnlinie war noch nicht ganz fertig: In ihrem letzten Stück bei Reggio machte sie einen weiten Bogen nach Metaponto durch Mondlandschaften, die rein zum Hohn so athletische und wollüstige Namen trugen wie Crotone und Sibari.« Mit dem einstigen Glanz seines adligen Geschlechts hat diese Rückkehr nichts zu tun; das stolze Familienoberhaupt ist krank und zerrüttet. Der Leopard erzählt vom Niedergang einer Sippe und dem Epochenbruch nach der italienischen Einigung von 1860. Ironischerweise war es ausgerechnet Vittorini, der in seiner Funktion als Verlagslektor Tomasi di Lampedusas Roman ablehnte. Der Absagebrief erreichte den Fürsten auf dem Sterbebett. Erst nach seinem Tod wurde Tomasi zum berühmtesten Schriftsteller der Insel überhaupt. Sein Roman trifft das sizilianische Dilemma im Kern, und sein Werdegang gehört zu den verblüffendsten unter den sizilianischen Schriftstellern. 1957 passierte der schwer an Lungenkrebs erkrankte Fürst Tomasi di Lampedusa zum letzten Mal die Meerenge von Messina und reiste nach Rom, wie sein Held auf der Suche nach ärztlichem Beistand. Sein Leichnam wurde wenige Monate später von der Hauptstadt nach Sizilien überführt.
Der Übergang vom Festland nach Sizilien wirkt wie eine Schranke. Wer von dort kommt, scheint es selbst so zu empfinden – die Insel liegt eben nicht in Italien und bleibt unvergleichlich; selbst auf Italiener wirkt sie bis heute exotisch. An derselben kalabresischen Küste, von der Tomasi und Vittorini erzählen, sucht der Held ‘Ndrja Cambrìa in Stefano D’Arrigos 1500-seitigem sprachtrunkenem Epos Horcynus Orca (1975) mitten in den Wirren der Kapitulation von 1943 nach einem Boot zum Übersetzen. Der junge Marinesoldat ist desertiert und hat sich bis in das Dorf der Feminotinnen durchgeschlagen, wo die Frauen aus schierem Hunger ungenießbares Delfinfleisch einkochen. Der Gestank macht die Luft schwer. ‘Ndrja stolpert über Halden weißer Fischknochen; auch das Meer, längst von den Alliierten beherrscht, ist angesteckt von dem Gärungsprozess: »Da machte er sich in dem tiefen Dunkel blindlings wieder auf und fand unerwartet, nach wenigen Schritten, schließlich eine Öffnung zum Meeresufer: Auf seiner Haut spürte er einen Lufthauch, die Dunkelheit vor ihm war frei von Häusern, und der Atem des Riesentieres, des Meeres, blies ihm ans Ohr und schlang sich um ihn wie ein dünner Faden, in unendlichen Umschlingungen von Speichelfäden, die versteinerten, wie die Fäden einer Muschel, die mit den Echos ihrer geheimnisvollen, unermesslichen Belebung kamen und gingen.« D’Arrigo, 1919 in Alì Marina bei Messina geboren und in Rom zuhause, lässt seinen Helden auf eine Fischersfrau treffen, die ihn durch das Gewässer hinüberrudert. »›Schöner Bursche‹, sagte sie und senkte ihre Finger in sein Haar. ›Wir sind auf der anderen Seite, und Ihr schlaft? Scheint Euch das der geeignete Augenblick zu sein?‹ ›Was ist mir da passiert? Was für ein Schlaf war das?‹ ›Was kümmert Euch das? Eure Reise ist zu Ende. Hier ist sie zu Ende.‹ ›Hier wo?‹ ›Hier, auf der Insel, oder? Wart Ihr nicht völlig verrückt danach, nur ja nach Sizilien zu kommen?‹«
Die Rückkehr, der nóstos – das treibt alle sizilianischen Schriftsteller um. Aber Rückkehr wohin, was hat es mit der Insel auf sich? Um ein Gespür für die Geographie des äußersten Südens von Italien zu bekommen, muss man mit Zügen und dem Schiff reisen; anders erschließen sich die Distanzen nicht. Von Reggio Calabria aus liegt Sizilien wie ein Dreieck da, das vor der Stiefelspitze Italiens aus dem Meer ragt. Messina bildet die obere Ecke, Capo Passero die untere. Catania liegt auf der Hälfte der kürzeren Seite, Syrakus etwas weiter unten an einer kleinen Ausbuchtung. Marsala und Trapani markieren die gegenüberliegende Ecke des Dreiecks. An den langgezogenen Seiten bilden Palermo an der oberen und Agrigent mit Porto Empedocle an der unteren Küste Orientierungspunkte. Bis heute sind Reisen im Vergleich zum Rest von Italien eher mühsam, die Bahnlinien führen zwar durch liebliche Küstenlandschaften mit Palmen, Hibiskus, Oleander, Eukalyptus und Orangen- und Zitronenbäumen, aber sie nehmen weite Umwege. Nach Enna, Ragusa, Modica oder Noto gelangt man nur mit dem Auto oder mit Bussen. In Richtung Noto sind die Olivenanpflanzungen von Trockenmauern umgeben, ab und zu gibt es ein Gehöft, man kommt am Schloss von Donnafugata vorbei, dessen Name Tomasi di Lampedusa sich für seinen halb fiktiven, halb realen Sommersitz in seinem Roman borgte. Aber zwischen Catania und Palermo wirkt Sizilien über viele Kilometer hinweg unbewohnt. Noch 1850 fuhr man selbst von Palermo nach Marsala eher mit dem Schiff, weil es schneller ging als über den Landweg. Die aufwendigen Reisen, Rückkehr und Abschied, Verwurzelung und Trennung – stärker als in anderen Regionen prägt dieser Rhythmus von Nähe und Distanz die sizilianischen Schriftsteller. Gerade das spezifische Verhältnis zur eigenen Herkunft und der geschärfte Blick für Italien könnten der Grund für den verblüffenden Reichtum der sizilianischen Literatur sein. Von hier kamen die entscheidenden Impulse. Um 1900 waren es Giovanni Verga, Luigi Capuana und Federico De Roberto aus Catania, die alle drei viele Jahre in Mailand und anderswo verbrachten, mit dem Verismus eine italienische Spielart des Naturalismus erfanden, dann aber wieder in ihrer Heimat Quartier nahmen. Der Nobelpreisträger Luigi Pirandello, 1867 geboren, stammte aus Agrigent und ging nach Rom; die zersplitterte sizilianische Identität antizipierte eine Erfahrung der Moderne und wurde zum Angelpunkt seiner Dramen und Romane. Für Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Jahrgang 1896, waren Frankreich und England die literarischen Echoräume, er war ein großer Reisender, blieb aber Palermitaner. Vitaliano Brancati, 1907 geboren und in Catania aufgewachsen, Verfasser gleißender satirischer Romane über die Geschlechterverhältnisse, verbrachte seine späten Jahre in Rom, doch seine Figuren kehren allesamt nach Sizilien zurück. Der ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Dichter Salvatore Quasimodo aus Modica, wo er 1901 geboren wurde, schrieb über die südliche Vegetation und das Licht und war in Mailand zuhause. Vittorini lebte in Mailand, D’Arrigo in Rom. Andrea Camilleri aus Porto Empedocle ging als Dreiundzwanzigjähriger 1949 nach Rom und kehrt bis heute nur für die Sommermonate nach Porto Empedocle zurück, aber die Insel ist Schauplatz seiner Bücher. Sein großer Förderer, der pessimistische Leonardo Sciascia mit seinen aufklärerischen Romanen, Jahrgang 1921, war durch und durch ein Mann aus dem Landesinneren der Insel und verbrachte die längste Zeit seines Lebens in Palermo, obwohl er sich als Abgeordneter zumindest zeitweise außerhalb von Sizilien aufhielt. Mit seiner Metapher der sich immer weiter in den Norden verlagernden »Palmenlinie« prognostizierte er eine Sizilianisierung ganz Italiens. Alle setzen sich mit dem auseinander, was Sciascia die sicilianità nannte – die Sizilianität.
Noch eine Eigenart bindet die sizilianischen Schriftsteller aneinander: Sie beziehen sich fortwährend auf die Werke der anderen Sizilianer. Jeder liest jeden, man kommentiert sich, auch über die Distanz von Jahrhunderten hinweg. Als ein Umschlagpunkt gilt vielen die Einigung von 1860. Sie erzählen Geschichten von Niedergang und Dekadenz und davon, wie sich eine erschöpfte Elite von den Nöten der eigenen Region abwendet. Die überkommene, hochverfeinerte Kultur entfaltet starke Fliehkräfte. Eines ist allen gemeinsam: Sizilien, am äußersten Rand von Europa gelegen, bildet das vitale Zentrum.
IM BALLSAAL
Angelica betritt das Parkett
Sie ist höchstens siebzehn Jahre alt und bewegt sich mit großer Selbstverständlichkeit zwischen den kostbaren Möbeln im Palazzo Ponteleone in Palermo, umringt von jungen Fürsten, die um eine Mazurka, eine Polka, einen Walzer betteln, aber ihr Carnet ist längst gefüllt, jeder Tanz vergeben. Die dunkelhaarige Angelica, von florentinischen Nonnen erzogen und von ihrem Verlobten Tancredi mit dem letzten Schliff versehen, zieht mit ihrer rosafarbenen Robe, den prächtigen weißen Schultern, dem zarten Hals, dem »Strahlenglanz ihrer Augen« und dem »Erdbeermund« alle Blicke auf sich. Giuseppe Tomasi di Lampedusa bringt seine Heldin in Stellung, schließlich steht ihr Großes bevor. Tancredis Onkel Don Fabrizio Salina nutzt den wichtigsten Ball der Wintersaison 1862, um seine zukünftige Nichte in die Gesellschaft einzuführen. Das ist nicht ohne Risiko, denn Angelica kommt aus einer Familie, die mitnichten der Heiratspolitik sizilianischer Adliger entspricht: Zwar ist sie die Tochter des unermesslich reichen Don Calogero Sedára aus dem Landesinneren von Don Fabrizios Lehnsbesitz Donnafugata. Aber ihr Großvater trug noch den Spitznamen Peppe ’Mmerda, Scheiß-Peppe, so ungehobelt war er. Und ihre Mutter kann weder lesen noch schreiben. Doch das florentinische Pensionat hat bei Angelica vieles wettgemacht. Den Rest erledigt ihre ehrfurchtgebietende Schönheit. Als Angelica den Onkel zu einem Tanz überredet und der groß gewachsene Fürst mit ihr das Parkett betritt und sie in einem Walzer durch den Saal schwenkt, halten alle anderen Gäste inne.
Die Ballszene ist nur einer der vielen Höhepunkte des posthum erschienenen Romans Der Leopard, in dem es um den sozialen Aufstieg einer neuen gesellschaftlichen Klasse und den Niedergang der alten Elite geht. Und darum, wie der junge Tancredi inmitten des Umbruchs die sich ändernden Machtverhältnisse für sich nutzt. Don Fabrizio, der sich auf Sternenkonstellationen versteht und astronomische Studien betreibt, befördert zwar die Verlobung seines Neffen, will aber den politischen Wandel nach der Einigung von 1860 nicht mitgestalten. Tomasi bietet alle erzählerischen Mittel auf, um den Lebensstil der Aristokratie angemessen in Szene zu setzen. Weil das exorbitante Fest im Palazzo Ponteleone in der Verfilmung von Luchino Visconti dreißig Minuten dauert und den Schlussakkord bildet, wurde es für viele zur Signatur der Familiengeschichte. Noch berühmter ist allerdings Tancredis nüchterne Feststellung »Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann muss sich alles ändern« – man spricht vom gattopardismo, meint damit das passive Beharren auf den Gegebenheiten bei oberflächlichem Aktionismus, zitiert den Satz allenthalben, wenn es um Italien geht, ohne allerdings den Zusammenhang zu bedenken. Auch Giuseppe Tomasi di Lampedusas Charakterisierung des nassforschen jungen Mannes wird außer Acht gelassen; häufig schreibt man die Äußerung sogar dem Fürsten selbst zu. Der Roman, der auf abenteuerliche Weise in die italienische Öffentlichkeit gelangte, kam im November 1958 heraus und wurde zu einem literarischen Ereignis. Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen, dass ausgerechnet dieser schüchterne Müßiggänger ein Buch schreiben würde. Sein Familienhintergrund ließ alles andere vermuten als künstlerische Ambitionen. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Herzog von Palma, Baron von Montechiaro, Baron von Falconieri, wohnhaft in der Via Butera in einem baufälligen Palazzo – ein Schriftsteller? Seinen Erfolg hat er nicht mehr erlebt. Zwölf Auflagen im ersten Jahr, 70.000 verkaufte Exemplare, eine Fülle von Auslandslizenzen. Ein Komet, aber mit seinem Stil ein Fremdkörper im Panorama der Nachkriegsliteratur, die noch mit der Aufarbeitung des Faschismus, den Partisanenkämpfen und der Industrialisierung befasst war und mit spröden, knappen Erzählformen operierte. Als viel zu traditionalistisch und opulent war das Manuskript von dem Turiner Verlagshaus Einaudi abgelehnt worden, und nun galt der Roman nach wenigen Monaten als ein Werk von Weltrang. Wie schon im 19. Jahrhundert probierte man ausgerechnet in Sizilien eine andere Art der Wirklichkeitsbetrachtung aus.
DER GLANZ VON PALERMO
Im Palast des Leoparden
In seiner Mitte wirkt Palermo geordnet und voller Licht. Geschwungene und gerade Linien im Wechsel, sizilianischer Barock, am Ende der Straßenfluchten sieht man den blauen Schattenriss des Monte Pellegrino. Teatro del sole wird der achteckige Platz Quattro Canti in Stadtchroniken auch genannt. Tatsächlich hat der Sonneneinfall den Effekt eines Bühnenscheinwerfers: Den ganzen Tag über liegt eines der vier symmetrischen Eckgebäude im Licht. Ein Brautpaar posiert mit konzentriertem Lächeln vor den Rosetten und Girlanden der halbrunden gelblichen Fassaden, die mit Springbrunnen, Säulen, Statuen und Wappen bestückt sind. Das bauschige Kleid setzt die Ornamente fort und sieht ein paar Sekunden lang aus wie aus Stein. Von den Brunnen und Häusern blicken allegorische Figuren der vier Jahreszeiten auf die Piazza, in der Etage darüber stehen die spanischen Könige in einer Nische und zuoberst die Schutzheiligen der Stadtviertel. Man fühlt sich gut bewacht. Die Quattro Canti sind ein Knotenpunkt. Hier kreuzen sich die alte Straße Kassaro, die längst Via Vittorio Emanuele heißt und vom Meer bis zum Normannenpalast führt, und die Via Maqueda, hinter deren einem Ende sich der Markt Ballarò befindet, während am anderen Ende das Teatro Massimo liegt. Die Palermitaner mögen Prunk; das Vorbild für die Quattro Canti, die zwischen 1608 und 1620 von einem florentinischen Architekten erbaut wurden, war der römische Platz Quattro Fontane, aber Palermo übertraf das Original. Bis vor wenigen Jahren bekam man hier nach fünf Minuten wegen des Verkehrs einen Hustenreiz und flüchtete sich in die Buchhandlung Dante, die heute ein Restaurant beherbergt, oder kaufte eine Krawatte bei dem alteingesessenen Herrenausstatter schräg gegenüber. Oder man ging gleich weiter zur Piazza Pretoria, den alle nur unter dem Namen Piazza della vergogna kennen, den Platz der Scham, wegen der vielen nackten Marmorstatuen rund um den Brunnen so genannt. Ursprünglich 1554 für den Garten eines Privatmannes in Florenz entstanden, wurde das Bauwerk an die Stadt Palermo verscherbelt. Goethe konnte den Brunnen mit seinen 48 Skulpturen, inklusive Pferdekopf, Ochse und Schwan, gar nicht leiden, viel zu verspielt und verrückt, Eigenschaften, die er den Sizilianern mehrfach unterschob. Es gibt einen Durchgang zur Piazza Bellini mit ihren Kirchen: die Theatinerkirche, gegenüber die rotbemützte San Cataldo und daneben La Martorana, Schichtungen von normannischarabisch-byzantinisch-christlichen Einflüssen. Palmen ragen neben dem Kirchturm in die Höhe, und plötzlich ist Afrika gar nicht weit weg. Jeden Donnerstag treffen sich neuerdings Volkstanzgruppen auf dem Platz. Gegen 22 Uhr stellen sie einen kleinen Lautsprecher auf oder bringen Instrumente mit, und dann drehen sich mit einem Mal fünfzehn oder zwanzig Paare im Kreis. Wie weggewischt ist die bedrückende Atmosphäre aus den achtziger und neunziger Jahren, als sich an den Quattro Canti die beiden Hauptverkehrsachsen kreuzten und abends kaum jemand auf den Straßen unterwegs war. Die Mafiamorde, die zerborstenen Autos, die Blutlachen und die Leichname, von weißen Laken notdürftig abgedeckt. Jetzt ist die Piazza Sant’Anna gleich hinter der Piazza Bellini jeden Abend von Studenten und Schülern bevölkert, Lokal reiht sich an Lokal. Die Schließung der Kreuzung an den Quattro Canti wurde 2014 vom Gemeinderat angeordnet. Es ist viel passiert. Die normannisch-arabischen Bauwerke gehören seit 2015 zum Unesco-Weltkulturerbe, die Touristen haben sich vervielfacht und drohen das Wilde der Stadt zu verdrängen. Palermo schwankt zwischen Bewahrung der Kulturdenkmäler, Disneyfizierung und einem Zug ins Urtümliche, der allen globalisierenden Tendenzen widersteht und den man vor allem in Stadtvierteln wie der Zisa, der Kalsa und auf dem Ballarò spürt.
In der Kalsa, nicht weit vom Meer, liegt die Via Butera. Man hört Möwengeschrei und den Verkehr vom nahegelegenen Boulevard Foro Italico. Die Mittagshitze staut sich noch in der schmalen Straße hinter der Porta Felice, als ich gegen drei Uhr an der Nummer 28 klingle. Das riesige Eingangstor stammt aus der Zeit der großen Bälle und Empfänge, es ist geeignet für Kutschen oder zumindest Großfamilien, die alle gleichzeitig eintreten. Ohne Begleitung davor zu stehen hat fast etwas Unhöfliches. Vom Palazzo Butera, zwei Häuser weiter, schallen Baugeräusche hinüber, dort sind Stuckateure zugange, sie hämmern, sägen und schleifen, Elektriker und Anstreicher rufen sich Anweisungen zu. Der Palazzo Butera mit seiner prächtigen Innenausstattung, jahrhundertelang Sitz der Fürsten von Trabia und Butera, ist das berühmteste Gebäude der Straße. Johann Wolfgang Goethe war dort zu Gast, ebenso wie Wilhelm II. Jetzt gehört es dem Mailänder Galleristen Massimo Valsecchi, der es in einen Ausstellungsort und ein europäisches Laboratorium umwandeln will. Die Sanierung geht voran; im Sommer 2018 ist der Palazzo Butera Teil der Kunstausstellung Manifesta, auch die Baustelle steht für Besichtigungen offen. Die Nummer 28 ist nicht ganz so pompös, Palazzo Lanza Tomasi heißt dieser Bau heute, benannt nach seinem Besitzer, dem Cousin und Adoptivsohn des Fürsten Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der das Haus kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eher aus Verzweiflung erwarb. Sein Elternhaus Palazzo Lampedusa war von amerikanischen Bomben zerstört, und irgendwo musste er schließlich unterkommen, auch seine Ehefrau, die Fürstin Licy Wolff von Stomersee, Psychoanalytikerin von Beruf, brauchte einen Ort für ihre Couch. Dann besser hier, wo achtzig Jahre zuvor immerhin sein Urgroßvater eine Zeitlang gewohnt hatte.
Aus der Sprechanlage tönt eine Stimme: Die Treppe rechts hinauf in den ersten Stock, dort werde man mich in Empfang nehmen. Der Hausherr wieselt mir entgegen, ein wendiger Mann von 84 Jahren mit lebhaften kleinen Augen, einem Bürstenhaarschnitt und einem sardonischen Lachen, in das er regelmäßig ausbricht. Wir kennen uns noch aus Neapel, wo Gioacchino Lanza Tomasi Intendant des Opernhauses San Carlo war. Nach Jahrzehnten in Japan, New York, Rom und Neapel ist der Musikwissenschaftler nach Palermo zurückgekehrt. Den Palazzo hatte er immer behalten, auch wenn er nur die Sommermonate hier verbrachte. Nach und nach wurde das Haus umgebaut. Heute bewohnt er mit seiner Familie den ersten Stock, während die obere Etage mit Möbeln, Porzellan und Gemälden aus dem Besitz der Lanzas ausgestattet ist. Die Bibliothek seines Großvaters steht dort, genau wie die von Tomasi, außerdem wenige Erbstücke vom Landsitz Santa Margherita. Don Gioacchino führt mich ins Wohnzimmer. Auf dem Flügel stapeln sich Partituren, von der Decke baumelt eine steinerne Meerjungfrau, die Arbeit einer französischen Bildhauerin, wie er mir erklärt. Wir nehmen auf Polstermöbeln Platz. Die Fenster gehen auf die Terrasse, wo Oleanderbäume blühen, dahinter blitzt das Meer. Gioacchino beginnt zu erzählen. Tomasi habe die Räume auf derselben Etage nebenan bewohnt. Damals war es ein unbequemes Haus, zugig und feucht, ohne vernünftige Heizung. Es gab nur einen fauchenden Gasofen, mit dem sich der Fürst mehrfach beinahe in die Luft gejagt habe. Und vor der Terrasse lagen Berge von Trümmern – die Überreste der bombardierten Palazzi wurden kurzerhand hier aufgeschüttet, was den Abstand zum Lungomare enorm vergrößerte. Der Musikwissenschaftler breitet die Ahnentafel vor mir aus und schildert die blutrünstigen Gepflogenheiten der Tomasi-Sippe: Dass Rivalen vergiftet oder erdolcht wurden, war an der Tagesordnung, erst recht, als im 16. Jahrhundert die junge Ehefrau eines Tomasi dem Vizekönig gefiel. Gioacchino zerkaut die Silben regelrecht, sein »r« klingt wie ein »w«, und zwischendurch verfällt er in ein passables Deutsch, das er, wie oft im sizilianischen Adel, als Kind von einer deutschen Gouvernante gelernt hat, einer sogenannten »Schwester«.
»Wie viele süditalienische Familien war auch meine eher verrückt. Sie verließ Sizilien 1911. Palermo besaß zwei Leuchttürme der mondänen Haushaltsführung, beide aus der Lanza-Sippe, einer war mein Großvater, der Fürst von Trabia. Kolossale Paläste, große Bälle. Mein Großvater hatte aber eine Neapolitanerin geheiratet, und meine Großmutter empfand Sizilien als provinziell, wo es einfach nicht auszuhalten war, also zog die Familie nach dem Tod ihrer Schwiegermutter nach Rom. Meine Großmutter lebte dort im Grand-Hotel, wo sie Gäste empfing und einen Salon hatte. Meine Eltern gehörten zu den adligen Kreisen um die Königsfamilie«, erklärt Gioacchino. »Nach dem Zweiten Weltkrieg war das große Vermögen der Familie sehr zusammengeschmolzen. Mein Vater hatte immer den Traum gehabt, nach Sizilien zurückzukehren. Also kamen wir 1945 hierher, ich war elf Jahre alt. Im Haus meines Großvaters, das 34 Jahre lang im Dornröschenschlaf gelegen hatte, gab es noch ungeöffnete Postsendungen aus London mit gestärkten Frackhemden. Es wurde alles renoviert, und meine Eltern begannen, ein glanzvolles Gesellschaftsleben zu führen. Sie gaben Cocktails für zweihundert Gäste, zu denen auch Tomasi di Lampedusa und seine Frau kamen. Tomasi war ein entfernter Cousin meines Vaters. Er fiel mir schon damals auf, weil er diese imposante, sehr korpulente Ehefrau hatte. Später habe ich ihn dann näher kennengelernt. Wir lästerten gern über unsere Familien und waren beide ziemlich gehässig.«
Um mir einen Eindruck von der typischen Ausstattung eines Palazzos zu verschaffen, führt mich Don Gioacchino in die obere Etage, öffnet Türen und knarrende Fensterläden. Empfangsräume, Damensalons und Herrenzimmer reihen sich aneinander. Es gibt eine komplett eingerichtete Küche, polierte Messingtöpfe und Pfannen hängen an der Wand, behutsam ergänzt durch moderne Gerätschaften. Gioacchinos Ehefrau Nicoletta hält hier regelmäßig Kurse ab, sogar auf Englisch: »Cooking with the duchess« – Amerikaner lieben das. Größere Gruppen aus den USA buchen mit Vorliebe das Arrangement »Drinks im historischen Ambiente«, Einführung in den Leoparden inklusive, wer will, kann auch noch das Buch kaufen. Die Räume sind zweifellos für derartige Zusammenkünfte gedacht. Wir betreten das Esszimmer, das eher ein Saal ist, in den Schränken stapeln sich Tischwäsche und Geschirr für 280 Personen. Ende des 19. Jahrhunderts übertrafen sich die palermitanischen Familien mit ihren Inneneinrichtungen und wurden von einer regelrechten Sammelwut ergriffen: vor allem Porzellan, Silber, Leuchter, Lampen, Tischtücher mit kompliziertesten Stickereien, Sonderanfertigungen sizilianischer Handwerker. Ein palermitanischer Palazzo sei damals eine Theaterbühne gewesen, meint mein Gastgeber, eine Bühne, auf der sich die jeweilige Familie inszenierte und jedem Angehörigen eine klare Rolle zuwies. Schon im Jahrhundert zuvor hatte es für die Großgrundbesitzer Steuervorteile gegeben, wenn sie sich in Palermo niederließen. Die Latifundien verwahrlosten, an der Verwaltung der Besitztümer hatten die Adligen kein Interesse, das Geld wurde in die Stadtpaläste gesteckt. Und dort rezitierte man beständig dasselbe Stück, jedes der einflussreichen Häuser zelebrierte die eigene Herkunftsgeschichte. Allerdings waren viele Familien eigentlich zu arm für die aufwendigen Pflichten der Repräsentation; die Juwelen landeten beim Pfandleiher und wurden häufig nur für die großen Bälle ausgelöst. Der Geschäftsmann Vincenzo Florio (1799–1868), ein gebürtiger Kalabrese, klagte 1866: »Der Müßiggang frisst diese Gesellschaft auf, ihre materiellen Ambitionen ruinieren sie; der Luxus, die morbide Dringlichkeit, unbedingt eine Kutsche besitzen zu müssen – alles das steht in keinem Verhältnis zu ihren Mitteln. Es ist sehr schwierig, diese Leute zu Gewerbe oder aktivem Handel zu bewegen.« Tomasi blieb dem Glanz und den Inszenierungen der großen Familien vollkommen verhaftet, was sich an seiner Liebe zu Interieurs zeigt. Nicht nur im Leoparden, auch in seinen Kindheitserinnerungen beschwört er bis ins Detail emphatisch die Räume des Palazzo Lampedusa herauf. Dass dieses Haus einer amerikanischen Bombe zum Opfer fiel, war eine tiefe Demütigung. Es zog ihm buchstäblich den Boden unter den Füßen weg, denn seine Daseinsberechtigung schien mit dem konkreten Bau verknüpft, den er, wie er es ausdrückte, »mit absoluter Hingabe« geliebt habe.
Bis 1943 schlief er in dem Zimmer, in dem er am 23. Dezember 1896 geboren worden war, nur vier Meter entfernt von dem Bett, in dem seine Mutter in den Wehen gelegen hatte. Dass Tomasi in seinen Kindheitserinnerungen ausgerechnet über sein Schlafzimmer eine Verbindung zu seiner Mutter herstellt, ist verräterisch und deutet schon auf das besondere Verhältnis zwischen ihm und der für ihre Attraktivität berühmten Beatrice hin. »An keinem Ort der Erde, dessen bin ich sicher, hat sich der Himmel je in einem so wilden Blau ausgebreitet wie über unserer eingefriedeten Terrasse, niemals hat die Sonne ein weicheres Licht geworfen als das, welches durch die halb geschlossenen Fensterläden des Grünen Salons drang«, beschrieb Giuseppe Tomasi seine Eindrücke. Auch das Boudoir der Mutter hat sich ihm tief eingeprägt. »Seine Mutter Beatrice hat ihn vergöttert«, erzählt mir sein Adoptivsohn Gioacchino, während ich neben den großflächigen Gemälden flämischer Meister eine Bleistiftzeichnung von Picasso entdecke: Sie zeigt Lanzas flamboyante Großmutter und ist in Biarritz entstanden. Wir schlendern weiter durch die Zimmerfluchten.
»Giuseppe Tomasi war erst ein paar Tage alt, als seine Schwester Stefania mit drei Jahren an Diphtherie starb. Seine Mutter redete ihn von da an oft mit weiblichen Kosenamen an und verwendete feminine Pronomen. Die Geburt eines Sohnes, also eines Stammhalters, war für eine adlige Familie von enormer Bedeutung. Beatrice hatte damit ihre Hauptaufgabe erledigt. Giuseppe wurde unfassbar verwöhnt«, erklärt Gioacchino. Um ihn herum wimmelte es von willfährigen Hausangestellten und Verwandten. Sein Vater war eher harsch und streitbar, was Beatrice noch enger an ihren Sohn band. Das Kind wurde in weiße Kleidchen gesteckt, gehegt und gepflegt, geherzt und gefüttert. Auf einem Foto von 1898 steht er mit Puffärmeln, weißen Söckchen und rosettengeschmückten Schühchen an einen Rokokotisch gelehnt, im Arm eine Holzpuppe, und schaut etwas verdutzt in die Kamera. Als Sechsjähriger wird er dann doch eher wie ein Junge zurechtgemacht: Stirn an Stirn mit seiner Mutter, die ein tief dekolletiertes Kleid trägt, posiert er für den Fotografen. Beatrice Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, genannt Bice, erregte mit ihrer Garderobe immer wieder Aufsehen: viel zu freizügig für ihre bigotten Großtanten, die den größten Teil des Tages mit Rosenkränzen verbrachten. Außerdem fuhr sie Fahrrad, ein Skandal! Giuseppes Mutter war nicht nur modebewusst, sondern auch klug und belesen. Sie kam aus einer aufgeschlossenen Familie mit normannischen Vorfahren, was in der Erziehung etwas galt; gemeinsam mit ihren Schwestern hatte sie hervorragende Hauslehrer gehabt. Als 1958 der Leopard erschien, kursierten sogar Gerüchte, sie sei die tatsächliche Urheberin des Romans.
Staubkörner tanzen im Licht, als wir den Ballsaal betreten. Die Ausmaße sind enorm. Um 1900 riss Palermo mit seinen mondänen Gepflogenheiten und dem milden Winterklima die europäischen Adligen in einen Begeisterungstaumel. Manche richteten sich gleich für mehrere Monate ein. Die Einwohnerzahl war von knapp 222.000 im Jahr 1861 auf 330.000 gestiegen, und Palermo war zur fünftgrößten Stadt Italiens avanciert. Immerhin rund zwanzig Palazzi boten noch ein Gesellschaftsleben im alten Stil. Hundert Jahre zuvor hatten noch 200 Familien in der Stadt residiert, aber dem deutschen Kaiser Wilhelm II., Vittorio Emanuele von Savoyen, Eduard VII. von Großbritannien und der Zarin Alexandra reichte es zur Freizeitgestaltung, ebenso wie etlichen Königen aus Skandinavien und vom Balkan, und auch den Palermitanern selbst. Im Palazzo Butera nebenan war der Tisch sicherheitshalber immer für zwanzig Gäste gedeckt. Es gab Bälle, Empfänge, Theater und Opernaufführungen. Im Palazzo Rudinì wurde ein Kino eröffnet, das Beatrice Tomasi regelmäßig besuchte. In der Zeitschrift Torneo war von nichts anderem als adligen Familien die Rede, ihren Festen, den Diners für einen guten Zweck, den Saisoneröffnungen im Teatro Massimo und den Kleidern der Damen. Wer ging wohin und mit wem? Die Fürstin Tremoille Torremuzza veranstaltete jeden Donnerstag künstlerisch-literarische Abende, man aß im Hotel des Palmes zu Mittag, am nächsten Tag war jour fixe in einem anderen Palazzo, oft wurde bis zum Morgen getanzt. Alles, was Rang und Namen hatte, fand sich ein: die Marchese d’Avola, die Baronesse Chiaromonte Bordonaro Gardner, Signorina Trigona Bordonaro, Signorina Maria Cutò, Bianca Alliata di Pietratagliata, Emma Notarbartolo di Villarosa, die Fürstin und der Fürst Gonzaga, der Baron Raimone, der Graf di Sampieri, um nur einige zu nennen. Der ein oder andere Marineoffizier war auch dabei. Man fuhr ausschließlich Kutsche, und die Damen verließen ihre Kaleschen nie. Gingen sie einkaufen, brachte der Geschäftsinhaber alles Gewünschte zur Kutsche, wo es dann begutachtet wurde, geprüft und betastet. Eventuell ließ man es sich nach Hause schicken. Anschließend aß man Eis, und auch da blieben die Fürstinnen in der Kutsche sitzen. Auf dem Bürgersteig an einem Tisch – undenkbar, das war etwas für Dienstmädchen.
Auf die Besucher aus dem Ausland muss Palermo trotz vieler Neubauten liebenswert altmodisch und gemächlich gewirkt haben, denn von industrieller Revolution war hier wenig zu spüren. Zwar hatten sich im 19. Jahrhundert einige Unternehmerfamilien etabliert, der erfolgreichste war Vincenzo Florio. Meistens aber erkannten nur die Zugezogenen das geschäftliche Potenzial der Gegend. So gut man sich hier auf die Etikette verstand, Geldverdienen galt als unfein, auch für die Tomasis. Zuerst waren es die Engländer gewesen, die eher zufällig eine folgenreiche Entdeckung machten und den Marsala erfanden. Der Geschäftsmann Joseph Woodhouse hatte 1773 einer Ladung Wein, die aus Marsala nach Großbritannien unterwegs war, zu Konservierungszwecken für die einmonatige Verschiffung reinen Alkohol hinzugefügt: zwei Liter pro hundert Liter. Das aromatische Getränk fand reißenden Absatz, und zehn Jahre später hatte Woodhouse die Herstellung professionalisiert, sich in Spanien und Portugal über die Reifung belehren lassen und etliche Bauern unter Vertrag, die nun statt Oliven und Weizen Wein anpflanzten. Außerdem baute er in Marsala einen langen Schiffskai und pflasterte die Straße. Vor allem die großen Bestellungen von Admiral Nelson verliehen Woodhouse Reputation, aber bald lief ihm ein anderer Engländer den Rang ab. Benjamin Ingham wurde zum großen Marsala-Magnaten, etablierte Handelsbeziehungen mit den USA, schlug auch Zitrusfrüchte um. Sein Neffe Joseph Whitaker setzte die Dynastie fort.
Vincenzo Florio hatte in der Via Materassai die florierende Drogerie seines Vaters übernommen, war dann mit Ingham ebenfalls in den Marsala-Vertrieb eingestiegen und hatte später mit dem Partner ein Unternehmen für Schwefelhandel gegründet. Hinzu kamen Tuchmachereien, eine Gießerei und eine Thunfischfabrik, in der neue Konservierungsmethoden in Öl erprobt wurden. Florio war seiner Zeit weit voraus. Er verband kaufmännisches Geschick mit Risikobereitschaft und einem Gespür für neue Geschäftsfelder und hatte damit in Sizilien nur wenig Konkurrenz. Die nationale Einigung ließ seinen Einfluss noch steigen, 1864 wurde er zum Senator ernannt. Die Familie besaß eine Handelsflotte mit 99 Schiffen und bot auch Personenverkehr an. 1880 weihte der Sohn Ignazio Florio (1838–1891), ebenfalls Senator, den hochmodernen Ozeandampfer Vincenzo Florio ein, der – ohne jede staatliche Subvention – eine direkte Verbindung nach New York ermöglichte. Es waren die Jahre, in denen Sizilien wegen der mangelnden wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten von großen Auswanderungswellen erfasst wurde. Zwischen 1896 und 1900 verließen bei einer Einwohnerschaft von knapp dreieinhalb Millionen 107.000 Personen die Insel. Zwischen 1906 und 1910 steigerte sich die Anzahl auf 442.007 Emigranten. Die Bevölkerung wuchs bis 1911 auf über 3,8 Millionen an, die Armut nahm zu, da auch unter der gesamtitalienischen Regierung immer noch keine umfassende Bodenreform in Angriff genommen worden war. Dafür wurden die Unternehmer immer reicher. Der Umsatz mit den Schiffspassagen war enorm, aber auch in anderen Sparten knüpfte Ignazio Florio an den Erfolg seines Vaters an; das junge Italien brauchte Investoren. Eine Textilfabrik hatte er zu einem Musterunternehmen ausgebaut, mit Wohnungen für die 180 Arbeiterinnen, einem Kindergarten, Gratis-Abendschulen und einer Kreditanstalt. Ausgerechnet diese fortschrittliche Einrichtung musste er wegen der billigen Baumwolle aus Übersee 1878 wieder schließen. Sonst aber prosperierte das Florio-Imperium: die Marsala-Produktion, Schwefel, Thunfischfang – Ignazio hatte kurzerhand die ägadischen Inseln gekauft –, Fischkonservenfabriken, eine Porzellanfabrik kamen noch hinzu. Über sechstausend Arbeiter und Angestellte waren bei der Familie beschäftigt; Palermo wurde mitunter »Floriopoli« genannt. Um 1900 gehörten die Florios zu den wohlhabendsten Familien Italiens, ihr Reichtum war märchenhaft und wurde regelmäßig in den Gesellschaftsblättern Revue des Deux Mondes und Sicile Illustrée dokumentiert. Sie reisten in Begleitung von Personal und vielen Freunden wie den Tomasis in einem eigenen Eisenbahnwaggon, der wie eine Wohnung eingerichtet war, fuhren nach Wien, Sankt Moritz, Chamonix, Warschau und Sankt Petersburg, dann nach London, Madrid, Berlin, Budapest und immer wieder nach Paris, wo sie selbstverständlich ebenfalls ein großes Haus besaßen. Für Ignazio Florio junior war es ein Leichtes, das von seinem Großvater und Vater angehäufte Vermögen durchzubringen. Dies war die Atmosphäre, die Giuseppe Tomasi als Kind prägte.
Es gab aber auch eine andere Seite. Der Turiner Schriftsteller Edmondo De Amicis besuchte Palermo 1906 und hielt fest: »Palermo ist die Stadt von Sizilien, die nach 1860 [der nationalen Einigung, M. A.] eine wunderbare Entwicklung genommen hat. Die Sizilianer haben recht, stolz auf sie zu sein. Es handelt sich um eine große Stadt […] mit ausgedehnten, eleganten neuen Vierteln, weitläufigen, baumbestandenen Plätzen, herrlichen neuen öffentlichen Spazierwegen, tatsächlichen Orten des Vergnügens, Paris und London ebenbürtig. Aber es gibt ein Schauspiel gewaltiger Gegensätze in dieser Stadt der Sizilianischen Vesper und der Heiligen Rosalia. […] Von der Prachtstraße am Meer Foro Italico, einer fürstlichen Flaniermeile, auf der hunderte von aristokratischen Kutschen entlangfahren, kommt man in wenigen Schritten an den Uferweg der Kala, wo ein Heer von Barken, Segelschiffen, armseligen Barkassen jedweder Form aus Sizilien, Apulien, Neapel und Griechenland vor Anker liegt und einen Eindruck von der Armut und den Kalamitäten des abenteuerlichen und harten Fischerlebens der vergangenen Jahrhunderte vermittelt. Wenn man das riesige Labyrinth dunkler und heruntergekommener Gassen des Viertels Albergheria durchquert hat, wo eine bitterarme Einwohnerschaft in tausenden von stinkenden Behausungen ausharrt, die immer noch dieselben sind, in denen sich vor neunhundert Jahren, oder wie viele es auch sein mögen, die Araber herumdrängelten, dann steht man vor dem Teatro Massimo, dem größten und schönsten Theater von ganz Italien. […] Als man den Bauauftrag vergab, besaß die Stadt noch kein Krankenhaus für die dringendste Grundversorgung.«
Die verwahrlosten Straßen hinter dem Theater dürfte der damals zehnjährige Giuseppe Tomasi nie durchquert haben; es gab keine Berührungspunkte mit dieser Sphäre der Stadt. Seine Mutter Beatrice war eng mit Ignazio Florio Junior befreundet und nicht nur in Palermo, sondern auch in Rom, Paris und anderswo in den Häusern und Wohnungen der Florios zu Gast. Die Familie schickte ihr jede Saison ihren Hausschneider vorbei, sie solle sich anfertigen lassen, wonach ihr der Sinn stehe. Ignazio Florio, der seine Hemden angeblich in London bügeln ließ und als Intendant des Teatro Massimo 12 Millionen Lire in den Sand setzte, war mit der schönsten Frau Palermos verheiratet: Franca Notarbartolo, deren Eltern die Eheschließung mit einem bürgerlichen Unternehmer zunächst als Abstieg betrachteten. Der sagenhafte Reichtum hatte sie bald vom Gegenteil überzeugt. Donna Franca wurde zu einer Institution. »Groß, langgliedrig mit einem Lächeln, das an die Jungfrauen von Guidi erinnert, die Augen voller Güte und Poesie, bahnt sich die neue Beatrice [Anspielung auf Dantes Beatrice, M. A.] einen Weg durch die Leute und ruft überall Bewunderung und Respekt hervor. Sie liebt es, die prächtigen Säle ihres Hauses zu verlassen und in die feuchten, schimmligen Hütten zu gehen, wo Hunger herrscht, um dorthin Brot und warme Kleider für den Winter zu bringen«, vermerkte das Gesellschaftsblatt Torneo am 20. Februar 1896 respektvoll. Die halbe Stadt machte Franca den Hof, aber sie blieb standhaft, im Unterschied zu ihrem Ehemann, der für seine Eskapaden berühmt war. Am 17. März 1906 schrieb die spitzzüngige Tina Whitaker, Tochter des englischen Unternehmers, in ihr Tagebuch: »Effie hatte einen schlimmen Sturz vom Pferd. Ich habe sie heute besucht und mit ihrem Papagei im Arm im Bett vorgefunden. Es ist unfassbar, wie sehr Effie diesen Vogel vergöttert. Bice war auch dort, sie beklagte sich über Effies Dienstboten, die aus den Fenstern Unflätiges hinausschrien. Mir fiel auf, dass Bice das Armband trug, das ihr Ignazio Florio geschenkt hat. Die arme Franca!«
Wer allerdings keinen unternehmerischen Geist wie die Florios besaß und von mondänen Zerstreuungen nichts hielt, führte in Palermo ein eintöniges Leben. Von Giuseppes Großvater väterlicherseits existiert ein zehnbändiges Tagebuch: Außer Ausritten und Kirchgängen ist dort nichts verzeichnet. Die Haushaltsführung und der Palazzo Lampedusa ließen es nicht vermuten, aber die finanzielle Lage der Familie war schon um die Jahrhundertwende kompliziert: Der Urgroßvater Don Giulio, Jahrgang 1815, ein Freizeitastronom, das Vorbild für die Hauptfigur Tomasis, den Fürsten Don Fabrizio von Salina im Leoparden, war 1885 ohne Testament gestorben. Seine neun Kinder gerieten in Erbstreitigkeiten, die sich sechzig Jahre lang hinziehen sollten – die Familien durften die verschiedenen Häuser bewohnen, die Ländereien aber nicht bebauen, was deren Wert verminderte. Unterdessen multiplizierten sich die Erben und wuchsen bis 1938 auf 33 Personen an. In Giuseppes Jugend wurde bereits ein Flügel des Palazzo Lampedusa an die Gasgesellschaft von Palermo vermietet, aber sein Vater war in Geschäftsdingen wenig geschickt. Zum Glück stammte Beatrice aus einer vermögenden Familie, das half ein paar Jahrzehnte.
Die Erziehung Giuseppes verlief in vorgezeichneten Bahnen: Privatunterricht, an drei Tagen Bibellektüre, an drei Tagen Klassiker. »Giuseppe hat sich dann quer durch die Bibliothek geschmökert«, erklärt Gioacchino. »Zola, La Fontaine, Stendhal, Cervantes, später Chesterton, Swift, Sterne, was es eben so gab. Aber es war eine einsame Kindheit.« Im Palazzo Lampedusa hatte er nur seinen Hund als Spielkameraden, was seinen zurückgezogenen, schüchternen Charakter noch verstärkte. Abwechslung boten Besuche in Capo d’Orlando bei Beatrices Schwester Teresa, deren drei Kinder zu den wenigen Gleichaltrigen zählten, mit denen Giuseppe Umgang hatte. Die beiden Brüder Casimiro und Lucio wurden seine engsten Freunde. Der Jahresrhythmus war skandiert von der Sommerfrische in Santa Margherita, einem Anwesen siebzig Kilometer südwestlich von Palermo im Belice-Tal, das aus Beatrices Besitz stammte und auch von ihren Schwestern genutzt wurde. 1680 gebaut, war es 1810 von Beatrices Großvater geschickt restauriert worden und der zweite prägende Ort für Giuseppe. Das Haus wurde später zum Vorbild für den Palazzo von Donnafugata, dem Schauplatz des Leoparden, auch die langwierige Reise mit dem Zug und der Kutsche, inklusive Begrüßung durch die Blaskapelle, fand genauso, wie es dort erzählt wird, alljährlich statt. Gemeinsam mit seiner Cousine Clementina, einem Wildfang, erkundete Giuseppe die abgelegenen Räume des weitläufigen Hauses. 1968 wurde Santa Margherita von einem Erdbeben zerstört. Don Gioacchino führt mich in einen Salon, in dem die wenigen Möbelstücke versammelt sind, die von dort gerettet wurden: eine Standuhr, einige Sessel und kleine Tische.
Das Leben im Palazzo Lampedusa, in Santa Margherita und bei den Verwandten in Capo d’Orlando hatte den Anschein eines Jane-Austen-Romans, der aber im Dezember 1908 abrupt endete: In Messina gab es ein schweres Erdbeben mit 77.000 Toten, darunter Bices Schwester Lina und deren Mann, nur ihr Sohn Filippo überlebte. Ein Jahr später kam es zu einer weiteren Familientragödie. Es ging um Giulia Trigona, Bices mittlere Schwester, Hofdame und enge Vertraute von Königin Elena, von zierlicher Statur und mit dunklen Locken. Sie war schon mit achtzehn standesgemäß verheiratet worden, so dachte man jedenfalls. Ein spitzzüngiger Zeitgenosse schilderte die junge Adlige mit folgenden Worten: »Eine armselige, graziöse Kreatur, raffiniert und geistreich, eine von jenen frivolen und sprunghaften Frauen, die dazu neigen, Männer zur Verzweiflung zu treiben und in den Ruin zu stürzen, außer man führt sie mit harter Hand.« Dreizehn Jahre lang gab es selbst für den sauertöpfischen Beobachter nichts zu beanstanden, dann erkrankte Giulia. Der ungeduldige Gatte Graf Romualdo Trigona di Sant’Elia, gerade Bürgermeister von Palermo, zog sich kurzerhand eine Schauspielerin heran, wovon Giulia durch einen anonymen Brief in Kenntnis gesetzt wurde. Bei einem Empfang in der Villa Igiea der Florios lernte sie im Juni 1909 am Spieltisch einen schmucken Kavallerieoffizier kennen. Baron Vincenzo Paternò del Cugno, charmant, umschwärmt, zwei Jahre jünger als Giulia, machte ihr den Hof. Es entbrannte eine turbulente Liebesgeschichte, das Paar ging auf Reisen. Dann allerdings entpuppte sich der Baron als notorisch eifersüchtiger Spieler mit hohen Schulden und einer Neigung zu Gewalt. Er schwor Besserung, zeigte Reue, um im nächsten Moment wieder um zwanzigtausend Lire zu bitten. Bice warnte ihre Schwester, ohne Erfolg. Der Liebhaber legte sich sogar mit dem Fürsten von Lampedusa an, der seiner Frau beisprang. Die Affäre war Stadtgespräch in Palermo. Giulia verkaufte ihren Familienschmuck und dachte an Scheidung. Man fühlt sich an ein Theaterstück von August Strindberg in mediterranem Milieu erinnert, und es endete in einer vergleichbaren Katastrophe. Gemeinsam mit ihrem Mann reiste Giulia im Februar 1911 nach Rom, um sich von ihrer Aufgabe als Hofdame entbinden zu lassen. Königin Elena lehnte ab. Das Verhältnis des Ehepaares war zerrüttet, am 1. März unterschrieb Giulia eine Erklärung zur einvernehmlichen Trennung und regelte ihre Vermögensverhältnisse. Unterdessen war auch der spielsüchtige Offizier eingetroffen. Entschlossen, sich auch von ihrem unwürdigen Liebhaber endgültig zu lösen, willigte sie in ein Rendezvous ein und brachte seine mehr als hundert Briefe mit. Das Paar traf sich im Hotel Rebecchino, einem schmuddeligen Etablissement, nicht weit von der Stazione Termini, bezog Zimmer 8 und landete ein letztes Mal im Bett. Dann aber zückte der Baron ein Messer, stach auf Giulia ein und schoss sich in die Schläfe. Als die Polizei die Tür aufbrach, lag Giulia tot auf dem Bett, Paternò ächzte auf dem Fußboden, umgeben von seinen Briefen. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt. 1942 begnadigte ihn Mussolini. Paternò kehrte nach Palermo zurück und heiratete seine Hausangestellte.
In ganz Italien erregte damals kein Verbrechen mehr Aufsehen als dieser Mord, sämtliche Zeitungen brachten Reportagen, auch im Ausland fand der Fall Resonanz. Im Hause Tomasi di Lampedusa war man entsetzt und fürchtete um den Ruf der gesamten Familie. Die Florios gaben viel Geld für eine Pressekampagne aus und ließen Artikel schreiben, in denen Giulia als unschuldige Verführte dastand. Es nützte nichts. Allein die Überführung des Leichnams löste Massenaufläufe aus, halb Sizilien stand an den Bahngleisen. Tomasis Mutter Beatrice wurde als Zeugin zum Prozess geladen. Auch die Briefe des Liebespaares waren delikat und voller Details über das Leben am Hof. In Palermo war man durchaus schadenfroh: Bice und ihre Schwestern galten als viel zu modern erzogen, zu viele Bücher, zu wenig Kirche, Clementina, Giulias Tochter, wild wie ein Junge. Und nun das. Die Familie entschied, eine Zeitlang aus Palermo fortzugehen. Eine Cholera-Epidemie, so lautete der offizielle Vorwand. Nach dem Sommer in der Toskana ließen sich Giuseppes Eltern in Rom nieder, wo er den Herbst über zur Schule ging. Als sie Ende des Jahres nach Palermo zurückkehrten, war alles anders. Bälle, Abendessen, Wechsel der Garderobe zu jeder Mahlzeit, Gäste von morgens bis abends: vorbei. Beatrice führte kein Gesellschaftsleben mehr, nur Verwandte wurden noch empfangen.
Auf den damals fünfzehnjährigen Giuseppe Tomasi muss diese Affäre, so sehr sich seine Eltern Mühe gaben, ihn zu schonen, starken Eindruck gemacht haben. In Palermo ging er noch drei Jahre auf das humanistische Gymnasium Garibaldi, wo er 1914 Abitur machte. Seine große Leidenschaft waren Literatur und Geschichte, aber sein Vater votierte für Jura, das typische Fach der süditalienischen Adligen. Gearbeitet hatte in der Familie kaum jemand, das Einzige, was für einen Aristokraten überhaupt in Betracht kam, war der diplomatische Dienst. Dort war bereits Giuseppes Onkel Pietro beschäftigt, der Einzige in der Familie, der je einem Beruf nachging. »Was Giuseppe genau an der Universität getrieben hat, ist unklar«, lacht Gioacchino. »Irgendwann war er wohl für Jura eingeschrieben, vielleicht in Turin, dann auch in Rom. Prüfungen hat er nie gemacht. 1915 war es dann ohnehin vorbei. Giuseppe wurde zum Militärdienst eingezogen.« Auch da wurde er privilegiert behandelt, weil er sich die Zahlung von 1500 Lire leisten konnte, um in der Nähe seines Wohnorts bleiben zu können. Nur seine Mutter war entsetzt. Zuerst war er in Messina, später trat er in Turin die Ausbildung zum Reserveoffizier an, wurde zum Leutnant der Reserve befördert und kam im September 1917 an die Front nach Caporetto, wo er leicht verletzt wurde und in Kriegsgefangenschaft geriet. Auch das war keine schlimme Erfahrung, die außerdem durch regelmäßige Postsendungen aus Sizilien abgefedert wurde. Sogar eine komplette Tennisausrüstung traf ein. Seine Mutter schrieb ihm mehrmals die Woche. Ob er sich warm anziehe? Die Erkältung abgeklungen sei? Weshalb er nicht antworte? Immer noch pflegte sie die Angewohnheit, ihn mit weiblichen Kosenamen zu überhäufen: »Pony, meine Liebe und Gute«, »Ponuzza, meine Süße« und »Meine Schöne« begannen die Briefe an den Soldaten.
Zerfließende Zuneigung der Mutter auf der einen Seite, die Ermordung der Tante auf der anderen – für einen Zwanzigjährigen, der Frauen gerade erst entdeckte, nicht die besten Voraussetzungen. Ab 1920 glitt Giuseppe in eine tiefe Apathie, tat so, als studiere er weiter, vagabundierte in Wirklichkeit zwischen Rom, Genua und Turin hin und her, knapp bei Kasse und beschäftigungslos. Häufig verreiste er auch mit seiner Mutter. Auf Fotos sieht man einen teigigen Mann mit hervorstehenden Augen im Anzug, der trotz seiner Jugend etwas Ältliches ausstrahlt. Er litt unter Schlaflosigkeit und Albträumen, verbrachte ganze Monate im Bett. Was damals mit dem Begriff »nervöse Erschöpfung« bezeichnet wurde, war zweifellos eine handfeste Depression. Tatsächlich suchte er in Begleitung der Mutter Rat bei Professor Pescarolo in Turin, dessen Therapie darin bestand, möglichst viel zu essen. Am 22. September 1921 schreibt Bice an ihre Nichte Giovanna Piccolo: »Mein liebe Nichte, wir sind noch in Torre Pellice geblieben, weil es hier um diese Jahreszeit besonders schön wird. Obwohl wir drei Tage Nebel hatten, ist die Landschaft herrlich! […] Mein Giuseppe ist reichlich fett geworden, ich werde ihn noch einmal von Pescarolo untersuchen lassen, um zu erfahren, ob er nun weiterstudieren kann oder nicht. Ich habe auch anderthalb Kilo zugenommen. Pescarolo will, dass man dick ist, nur so könne es einem gut gehen, er weist an, sich vollzustopfen mit Roggenbrot und Butter. […] Giuseppe est aux petits soins mit einer herrlichen Turinerin. Liebste Küsse, Tante Beatrice«.
Man kann sich das Dilemma des jungen Mannes vorstellen: An der Universität gescheitert, die Mutter im Nacken, regelrecht gemästet, auch in Liebesdingen fortwährend unter Kuratel. Auf den Meldezetteln der Hotels vermerkte er als Beruf »Grundbesitzer«. Seine Familie war enttäuscht, denn für den einzigen Sohn der Lampedusas hätte sich zumindest ein Juraexamen plus Diplomatenposten gehört, wobei ihn sein Onkel Pietro hätte unterstützen können. Zuhause in Palermo, ließ Giuseppe Bälle und Empfänge an sich vorüberziehen, während er am Türpfosten lehnte. Kein Wunder, dass man ihn als »Säule des Herkules« titulierte. Sich nicht zu amüsieren und wenigstens pro forma einer der jungen Adligen den Hof zu machen war in Palermo eine Provokation. War er schwul? Impotent? Schlimmeres? »Später ging er jahrelang auf Reisen, besuchte seinen Onkel in London, hielt sich an verschiedenen Orten in Italien auf«, erzählt Gioacchino. »Seien wir ehrlich. Er tat nichts.« Wir durchqueren noch einmal den riesigen Ballsaal und betreten Tomasis Bibliothek. Bücherschränke aus Mahagoni reichen bis unter die Decke. »Es ist merkwürdig«, sagt Gioacchino Lanza. »Seine Beziehung zur äußeren Welt vermittelte sich über literarische Werke. Gleichzeitig war er vor allem interessiert an Klatsch. Er war eine Art Saint-Simon, er passte gar nicht mehr in die damalige Welt. In dieser Bibliothek hier gibt es Erinnerungen von Botschaftern, Briefwechsel von Königen mit ihren Geliebten, solche Sachen. Das faszinierte ihn unendlich.« Biographien waren seine große Leidenschaft, vielleicht, weil sein Leben selbst nur so verzögert an Schwung gewann. Giuseppe las aber auch vieles andere, möglichst in der Originalsprache: Thackeray, Yeats, Chesterton, Pepys und Carlyle, dann Paul Morand und Hugo. In einem Heft notierte er Zitate.
Ab 1925 erweiterte sich sein Radius: Er reiste nach Paris und ließ seine Cousins Casimiro und Lucio Piccolo regelmäßig an seinen Erlebnissen teilhaben. Il mostro lautete seine Unterschrift, das Monstrum, ein Spitzname, den ihm die beiden Brüder verpasst hatten, auf Italienisch aber auch eine Bezeichnung für außerordentlich gebildete Personen. Lucio und Casimiro, beide mindestens ebenso belesen wie Giuseppe, waren selbst spezielle Charaktere. Casimiro, eigentlich Maler, an der Kunstakademie von München ausgebildet und eine äußerst elegante Erscheinung, litt seit dem Tod seiner Verlobten durch Tuberkulose unter einem Waschzwang. Er hatte panische Angst vor Bakterien, desinfizierte sich nach jeder Begrüßung die Hände mit Alkohol, hielt im Salon meterweit Abstand, nahm die Mahlzeiten möglichst weit entfernt von seinen Tischgenossen am anderen Ende des Esszimmers ein und zog seinen Stuhl mithilfe der Füße heran, um ja nicht die Tischplatte oder den Stuhl mit den Händen zu berühren. Der Vater Giuseppe Piccolo di Calanovella war mit einer Schauspielerin verschwunden und hatte seine Familie im Stich gelassen. Vielleicht bestärkte das seine Söhne in ihrem Glauben an übersinnliche Phänomene. Casimiro malte ausschließlich Gespenster-Bilder. Und Lucio, klein und bemerkenswert hässlich, war von der Existenz von Elfen, Zwergen, Kobolden und Geistern überzeugt, vermutete ganze Heerscharen im Garten der Familienvilla und fütterte sie regelmäßig mit Süßigkeiten. Zwischen 1919 und 1924 hatte er sich sogar mit W. B. Yeats darüber ausgetauscht: Wie sich Elfen in Irland verhielten, was es mit der Sekte »Golden Dawn« auf sich habe. Lucio hielt regelmäßig spiritistische Sitzungen ab und trat mit den Seelen lange verstorbener Hunde in Verbindung. Nebenbei schrieb er Gedichte. Auch er war hochgebildet, Altgriechisch, Latein, Mathematik, Astronomie, alles war ihm geläufig. Ihm stand Giuseppe am nächsten, die beiden wetteiferten mit ihrem literarischen Wissen, deklamierten Keats im Original – mit sizilianischem Akzent, versteht sich – und schrieben sich Briefe voller Anspielungen. Als unersättlicher Leser der angelsächsischen Literatur war Giuseppe Tomasi berüchtigt für seine wicked jokes, scharfzüngige Witze, wie er sie von Laurence Sterne kannte. »In seinem Tagebuch schreibt er, wenn ich nicht jeden Tag einen wicked joke erfinde, was soll ich dann machen, mich erschießen?«, erzählt Gioacchino, der sich gut an Lampedusas Zweck-Fatalismus erinnert. »Als wir uns anfreundeten, war seine Lage verzweifelt. Er besaß gar nichts mehr, keine Lira, und konnte seine Kredite nicht mehr bedienen. He was broke.« In den Briefen an die Cousins aus den zwanziger Jahren haben seine Sprüche eher ranzigen Pennälercharakter. Casimiro und Lucio sollten niemals heiraten. Damit der Titel nicht verlorenging – immer die größte Sorge in diesen Familien – zeugte Lucio mit einer Bäuerin einen Nachkommen, den er anerkannte.