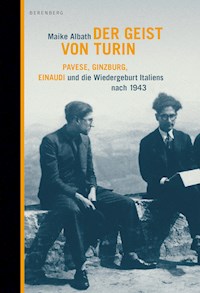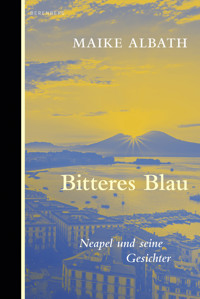
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neapel – vielleicht doch die allerschönste Stadt Europas ? Aber schon der große Neapolitaner Benedetto Croce warnte vor dem »von Teufeln bewohnten Paradies«. Maike Albath erkundet in ihrem neuen Italien-Buch – nach Turin, Rom und Sizilien – das Labyrinth der uralten Stadt am Golf und präsentiert die unvorstellbar bunte Vielfalt ihrer Bewohner. Furchtlos durchstreift sie die Stadtviertel, die schlimmen, die besseren, die Vorstädte, die Industrieruinen. Sie porträtiert Schriftsteller, Künstler, berühmte und namenlose, alte und neue, Elena Ferrante, Roberto Saviano, die Camorra und ihre Feinde, den Fußball und Maradona. Auf all das und vieles mehr dürfen sich nicht nur Italien-Freunde zum schon vierten Mal freuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAIKE ALBATH
Bitteres Blau
Neapel und seineGesichter
BERENBERG
Inhalt
Nostalgia
Schwarze Masken Eine Stadt feiert
Der Bauch der Cholera Die Sanità
Im Boxring Mario Martone und Ermanno Rea
Die durchlöcherte Stadt Don Antonio und die Katakomben
Der Vesuv in Menschengestalt Matilde Serao
Der zähe Schleim der Nusscreme Was der Tourismus zerstört
Der reichste Mann von Italien Benedetto Croce
Im Inneren einer Muschel Anna Maria Ortese
Der Geruch des Meeres Raffaele La Capria und Curzio Malaparte
Bitteres Blau Bagnoli, die Fabrik am Meer
»Da fiel kein Traum herab« Fabrizia Ramondino
Das Blut Neapels Roberto Saviano und die Camorra
Dystopie oder Aufbruch? Die Buch-Dealer von Scampia
Die wunderbaren Lügen der Schriftsteller Domenico Starnone
»Fische schließen nie die Augen« Erri De Luca
Wilde Weiblichkeit Elena Ferrante
Eine Buchhandlung am Ende der Straße Dante & Descartes
Bibliographie
Über die Autorin
Nostalgia
Ein Teller Nudeln, der zweite Gang Fisch, zum Nachtisch eine Birne, die sorgsam geschält wird. Das Mittagessen in der Via Sforza in Rom ist beendet. Antonio Fuscos Serviette landet mit einem Schwung auf dem Tisch. Gerade flogen noch Wörter hin und her, lange Sätze mit vielen Einschüben und Unterbrechungen, denn er erzählt gern und laut, und alle anderen auch. Jetzt fällt eine Formel. »Un caffè!« Kein unüblicher Wunsch, sogar erwartbar um diese Uhrzeit. Seine Ehefrau und die beiden Töchter wissen, was diese Formel bedeutet. Antonio Fusco ist gebürtiger Neapolitaner. Er kam zwar schon als Kind mit seinen Eltern aus Neapel nach Rom und wuchs in der Hauptstadt auf, aber er blieb, genau wie sein Vater und dessen Vater, Neapolitaner. Der Geschäftsmann, Firmeninhaber und leidenschaftliche Tennisspieler würde jetzt die Wohnung verlassen, in den Fahrstuhl steigen, hinabgleiten und auf die Straße treten. Nun muss er erst sein Auto suchen. Um diese Uhrzeit ist der Verkehr mäßig, die Innenstadt beinahe leer. Er steigt ein und fährt los. Nach Neapel, 226 Kilometer. Um Kaffee zu trinken. Einen richtigen Kaffee gibt es nämlich nur dort. Es ist das Wasser, der Härtegrad, es sind die Maschinen, die im Gambrinus an der Piazza del Plebiscito seit Jahrzehnten in Betrieb sind, es ist der Barista, der ihm wortlos das Richtige serviert. Er würde an der Theke stehen. »Un caffè.« Und dann, nachdem er sich jeden Schluck hat auf der Zunge zergehen lassen, würde er seinen Blick schweifen lassen, fünfhundert Lire auf die Theke legen und sich verabschieden. Und wieder nach Rom zurückkehren. Aber nicht ganz.
Schwarze MaskenEine Stadt feiert
Abends gegen acht Uhr bleibt die Stadt stehen. Es ist der 4. Mai 2023, und um Viertel vor neun beginnt die entscheidende Partie für Napoli, den mythischen Fußballclub. Am 33. Spieltag tritt die Mannschaft auswärts an, gegen Udine. Überall wehen blauweiße Fahnen und Wimpel, an den Balkons sind die Bilder der Spieler angebracht, Trainer Luciano Spalletti hat einen Ehrenplatz, über den Gassen und zwischen den Häusern spannen sich lange Plastikbänder, ein Meer von Blauweiß. Die Bewohner ganzer Wohnblocks und Viertel haben sich verständigt, auf dieser Ebene funktioniert die Selbstorganisation. Fanclubs arbeiten seit Monaten an der Ausstattung der Plätze. Es gibt Inszenierungen mit Wandbildern, angemalte Treppenstufen, mit blauem Plastik überzogene Poller, dazwischen die Trikolore. Und es gibt eher garstige Anordnungen ausrangierter Toilettenbecken mit hämischen Bemerkungen gegen den Turiner Club Juventus, der in einem phänomenalen Handstreich besiegt wurde. Und an jeder Ecke stößt man auf Ehrungen von Diego Maradona, der Neapel die letzten beiden Pokale bescherte, 1987 und 1990, und längst eine Heiligenfigur der Stadt ist. Riesige murales, »Dios« flackert als Leuchtschrift auf, oder die Zahl 10, Maradonas Rückennummer. Im Stadion in Fuorigrotta, wo niemand spielt, sich aber trotzdem 50.000 Fans eingefunden haben und gerne doppelt so viele gekommen wären, kann man auf zehn riesigen Bildschirmen das Spiel verfolgen. Der Bürgermeister Gaetano Manfredi hat dort auf der Tribüne Platz genommen. »So viele Leute treffen sich, um Fernsehen zu gucken. Das gibt es nur in Neapel«, kommentiert er stolz, als sei der glänzende Lauf der Mannschaft mit siebzehn Siegen in Folge, von Luciano Spalletti stoisch und einfallsreich erarbeitet, auch sein Verdienst. Nicht das genialische Einzelgängertum eines einzigen Spielers wie Maradona, sondern die Gruppendynamik war dieses Mal entscheidend. Spalletti, der Toskaner, aus Certaldo bei Florenz gebürtig, betont seine Herkunft vom Land: Wie ein Bauer, der über seine buckligen Felder stapft, müsse man als Sportler mit seinem Körper arbeiten. Sein Spitzname lautet »der Zar«, denn nach eher unbefriedigenden Jahren als Coach mittelmäßiger Erst-Ligisten war er 2009 nach Sankt Petersburg gegangen und hatte die Mannschaft eines Gas-Magnaten trainiert und prompt mehrfach Meisterschaften und Pokale gewonnen. Vom Lebensstil hat Spalletti nichts oligarchenhaft Auftrumpfendes, sondern eher etwas Spartanisches. Seine engsten Freunde kennt er noch aus seiner Kindheit und Jugend; mit ihnen trifft er sich bis heute in denselben Bars und Trattorien seiner Gegend. Er ist unbeirrbar und holt das Beste aus seinen Leuten raus, erkennt Begabungen. »Als ich nach Neapel kam, gab es eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Mannschaft, was an den Enttäuschungen der vorangegangenen Spielzeiten lag«, diktiert er dem Sportreporter vom Lokalteil der Tageszeitung La Repubblica in den Block. »Es bestand die Notwendigkeit, allen zu sagen: Wir sind Napoli, aber Napoli gehört zur Stadt. Das ist meine Obsession: die Stadt Neapel glücklich zu machen.« Nach einer guten Saison 2021/2022 mit einem respektablen dritten Platz verlor der Verein drei seiner begabtesten und beliebtesten Spieler, Koulibaly, Insigne und Mertens; weggekauft von reicheren Clubs, und damit schien das Schicksal besiegelt. Kaum jemand hätte auf die Zukunft von Napoli gewettet. Doch genau dies schien Spalletti eher anzufeuern als zu entmutigen. Er machte einfach weiter, gab dem Slowenen Lobotka eine neue Rolle, setzte Giovanni Di Lorenzo anders ein, abgesichert durch Zieliński, der wie eine Ziehharmonika die Abwehr zusammenzog oder öffnete, und plötzlich passierte vorne sehr viel. Napoli gewann ein Spiel nach dem anderen, Niederlagen steckten sie weg. »Das Meisterwerk Spallettis«, nennen es die Sportreporter und betonen, dass vor allem der vierundsechzigjährige Trainer der wahre Erbe des »pibe de oro«, des Goldfußes Maradona sei.
Jetzt stockt im Zentrum endgültig der Verkehr, etliche Straßen sind gesperrt für die Heerscharen, die sich nach und nach vor den Bars, auf den Plätzen oder in den Restaurants versammeln. Man ist zu Fuß unterwegs. In den großen Wohnhäusern mit mehreren Parteien hat man sich Gemeinschaftsleinwände besorgt. Das Spiel wird zusammen geschaut, und ganz Neapel guckt zu, sogar bisher desinteressierte Damen jenseits der siebzig nehmen auf wackligen Stühlen Platz, selbst Doktorandinnen und Archivare der großen Bibliotheken, die noch nie im Stadion waren und Fußball für ein Schlafmittel halten, fiebern mit. In unserem Lokal sitzt ein Knäuel von Männern vor dem riesigen Bildschirm, mittendrin der Wirt, alle mit Schals und hellblauen T-Shirts ausgestattet. Anpfiff. Gegessen wird nebenbei, auch der Kellner hat während der Bestellung nur Augen für den Fernseher. In den ersten Minuten sind die Spieler gehemmt, verzögert, erschrocken von der Tatsache, dass an diesem Abend bereits einen Monat vor Ende der Spielzeit die Entscheidung fallen könnte. Geduldig rufen ihnen die Fans aufmunternde Worte zu. Man ist sich sicher, dass es heute klappen wird – schon einige Tage zuvor war bei einem Heimspiel gegen Salerno im Stadion Maradona alles für den Sieg vorbereitet gewesen, choreographiert von dem Filmregisseur Paolo Sorrentino, der seit La grande bellezza und Youth – la giovinezza zu den international erfolgreichsten neapolitanischen Künstlern gehört. Sie mussten die Feier verschieben. Es fehlt noch ein einziger Punkt, ein Unentschieden würde reichen.
Der Tempel von Maradona hinter dem Teatro San Ferdinando
Jetzt kicken sich die Spieler den Ball hin und her. In der dreizehnten Minute schießt Udine ein Tor, auch das noch. Es wird zäh, und die aufmüpfige Leichtigkeit, die die jungen Fußballer in der ersten Hälfte der Meisterschaft besaßen, stellt sich nicht mehr ein. Der Auftakt der Saison hatte etwas Hinreißendes besessen, lauter gewonnene Partien, und im September gelang dann im Mailänder Stadion San Siro auch noch der Sieg über den italienischen Meister Milan. Der wirtschaftlich viel potentere Norden, in dessen Clubs so viel Geld steckt, wird vom Thron gehoben. Kurz darauf besiegt Napoli Juventus Turin, und spätestens jetzt begannen die Fans, den unaussprechlichen georgischen Namen von Kvaratskhelia zu lernen, den sie aber schon bald in »Kvaradona« umtauften, als Hommage an Maradona. Auch das kurze »Kvara« hat sich eingebürgert. Der zuvor völlig unbekannte bärtige Georgier aus Tiflis, dessen Vater und Großvater Fußballer waren, kam für nur zehn Millionen Euro zu Napoli, eine geradezu lächerliche Summe. Unter Spalletti lief er zur Hochform auf. Beim Rückspiel im Januar verloren die Turiner auch seinetwegen dann sogar mit fünf zu eins. Gegen Atalanta Bergamo staunte selbst der sonst eher zurückgenommene Spalletti: »Das war ein Tor wie von Maradona!« Kvaras Freundin studiert Medizin in Tiflis, ganz Georgien fieberte bei der Champions League und der italienischen Meisterschaft mit, und ein Sponsor heuerte sogar einen Charterflug für die Fans aus Georgien an. Selbst dass er ein paarmal Elfmeter verschoss, machte ihn sympathisch. Seit er im April 2023 auch noch Vater wurde und den kleinen Khvicha beim Standesamt in Neapel anmeldete, kannte die Zuneigung seiner Fans kaum noch Grenzen.
Dann gibt es den aufbrausenden Portugiesen Mário Rui, »der Professor« genannt, weil er so klug verteidigt. Er gilt als Talisman der Truppe. Und den Slowenen Lobotka, »Lobo«, der mit den Füßen denkt, wie ihm die Reporter bescheinigen. Zu den großen Helden gehört außerdem der nigerianische Stürmer Victor Osimhen. »Osimääään« dehnen die Kommentatoren die Vokale, wenn er angreift. In seiner frühen Zeit galt er als Dynamit. Aber erst nach zwei Coviderkrankungen und einer schweren Verletzung sei er zu seiner eigentlichen Größe gereift, erklären die Fernsehreporter nebenbei. Seine Maske, die er wegen einer lebensgefährlichen Gesichtsverletzung nach einem Zusammenstoß bei einer Partie gegen Inter Mailand im März eine Zeitlang tragen musste, ist längst ein Modeaccessoire und vor allem unter kleinen Jungen beliebt. Ein bisschen erinnert sie sogar an die des listigen Ur-Neapolitaners Pulcinella aus der Commedia dell’arte. Osimhen setzt die Maske weiterhin auf, weil sie längst ein Glücksbringer ist, außerdem kann er sie in entscheidenden Momenten vom Gesicht reißen. So passiert es dann in der zweiten Halbzeit nach ein, zwei Chancen: Osimhen scheint vor Ungeduld zu platzen, rafft seine Kräfte zusammen, läuft nach vorn, setzt sich durch, schießt – und Tor in der dreiundfünfzigsten Minute. Die Männerriege vorm Fernseher springt geschlossen hoch, fällt sich in die Arme, beginnt zu singen. »Sarò con te, ma tu non devi mollaaaare«, »Ich werde an deiner Seite sein, aber du darfst nicht aufgeben«. Eine Woge geht durch ganz Neapel, die von Fuorigrotta durch die Quartieri Spagnoli bis in die Sanità und nach Scampia reicht. Draußen explodieren erste Feuerwerkskörper. Eine knappe halbe Stunde müssen sie noch durchhalten.
Dann kommt der Abpfiff. Die Erlösung. Jubel, Euphorie, wieder Gesänge: »Si’ stato ’o primmo amore«, »Du warst die erste Liebe« – allesamt herzergreifende Beteuerungen. Vorbereitete Prosecco-Flaschen werden mit großer Geste geöffnet, sie haben ein besonderes Etikett, weiß, mit einer großen Drei, für die dritte gewonnene Meisterschaft. »Campioni d’Italia«. Was sie wohl damit gemacht hätten, wenn es nicht geklappt hätte? Darüber denkt jetzt niemand nach. Alle stoßen an. Nun strömen noch die letzten Leute aus ihren Häusern. Das Kloster San Martino oben auf dem Berg erstrahlt in Blau und wirkt wie ein avantgardistisches Krippenhäuschen. Familienverbände mit kleinen Kindern, ausgestattet mit Tröten, großen Fahnen, hellblauer Mannschaftskluft und schwarzen Osimhen-Masken, riesige Freundesgruppen, alle ziehen durch die Straßen, singen, tanzen, beglückwünschen sich gegenseitig. Über der Via Foria leuchten Feuerwerke, über Fuorigrotta, der Piazza Plebiscito, den Quartieri sowieso. Viel mehr als zu Silvester, denn es geht stundenlang weiter. Vier junge Männer erklimmen das Dach des Kiosks an der Ecke zur Via Piazzi und improvisieren eine Show mit wehenden Flaggen. Neapel feiert seinen Club und sich selbst. Der Minderwertigkeitskomplex gegenüber Norditalien, die vielen Demütigungen, die Scham, aus dem Süden zu kommen, alles vergessen. Es ist eine Revanche. Napoli, das waren seit jeher die Underdogs, und es besteht immer die Gefahr, in diese Rolle zurückzufallen.
Der Argentinier Diego Maradona hatte als Erster das Image in etwas Positives umgemünzt. Mit seiner anarchischen Phantasie am Ball und seiner Schnelligkeit schien er die besten Seiten Neapels zu verkörpern und verbreitete in der seit dem Erdbeben von 1980 tief verwundeten Stadt plötzlich Aufbruchsstimmung. 1986 nach dem WM-Halbfinale in Mexiko gegen England mitten im Falklandkrieg lieferte er eine der mythischen Szenen des vergangenen Jahrhunderts: Der Ball klebte ihm am Fuß, als er in der eigenen Hälfte losrannte, sieben Gegenspieler dribbelnd austrickste und den Ball ins Tor schoss. Zwei zu null. Bei dem ersten Tor war sogar Gott im Spiel gewesen: Der Kopfball Maradonas entpuppte sich später in der Zeitlupe als geschickt mit der Hand verstärkt, was den Urheber zu der inzwischen sprichwörtlichen Erklärung hinriss, es habe sich eben um »die Hand Gottes« gehandelt. Sorrentino machte daraus 2021 einen Filmtitel. In sechs Jahren bei Napoli – er kam 1984 vom F.C. Barcelona – hatte Maradona zwei Meisterschaften, einen UEFA-Pokal, einen italienischen Pokal und zwei Liga-Pokale für seinen Verein geholt. 1988 schoss er gegen Juventus Turin in einem einzigen Spiel fünf Tore. Und 1989 in der Aufwärmphase vor dem Halbfinale des UEFA-Cups gegen Bayern München verhexte er das ganze Stadion mit seinen Nummern, jonglierte zu Live is life minutenlang den Ball vom Fuß auf die Oberschenkel über die Brust auf den Kopf und wieder zurück und noch einmal von vorn – Maradona mit seinem dicken Lockenkopf und der Ball, das ist ein und dasselbe. Napoli gewann mit zwei zu null, und der Song ist heute Abend eine der Hymnen im Stadion. Selbst Diegos Abstürze, die Unzuverlässigkeit, seine Unlust, sich an Regeln und Trainingszeiten zu halten, seine Nähe zum Camorraboss Carmine Giuliano, mit dem er vor der Kamera posierte, ausgerechnet in dessen schwarzer Badewanne in Form einer Muschel, die Kokserei – geschenkt. Im Stadion, das längst nicht mehr San Paolo heißt, sondern Maradona, gibt es in der Umkleidekabine eine Statue des Spielers, und Spalletti hat verraten, dass viele sie vor dem Betreten des Rasens berühren. »Ich tue das auch, weil wir ihn in unserer Mannschaft haben wollen. Er war jemand, der sich im Spiel durchgesetzt hat, der große Qualitäten besaß, und wir geben uns Mühe, ihm ähnlich zu werden. Maradona ist immer dabei.« Ein paar Monate später würde die lebensgroße Bronzefigur in der Pizzeria-Galerie Il tempio di Maradona in den Quartieri landen, gar nicht weit von einem der berühmten Wandgemälde Maradonas. An diesem Abend gegen Udine konnte keiner der Spieler die Statue berühren, aber vermutlich hat es jeder kurz vor der Abfahrt getan. Die Feier auf den Straßen von Neapel geht bis in die frühen Morgenstunden weiter. Für die Polizei ein Großeinsatz, bis auf ein paar Verletzte mit Feuerwerkskörpern oder Rauchbomben bleibt zunächst alles friedlich. Dann kommt es doch noch zu einem tödlichen Schusswechsel. Eine Camorra-Fehde, wie sofort vermutet wird, zwei verfeindete Clans hatten eine Rechnung offen, der sechsundzwanzigjährige Vincenzo Costanzo erliegt seinen Verletzungen. Die Stimmung trübt das nicht, auch am nächsten Tag herrscht Euphorie. Beim Mittagessen tausche ich mit einer alten Dame und ihrem Sohn Eindrücke vom Vorabend aus. »Sie waren wirklich anständig, haben gut gespielt und nicht betrogen«, meint die Signora. Auf der Via Foria geht kurz darauf eine Frau mit Hund vorbei. Sie hat dem Tier ein blauweißes Trikot über den Kopf und die Vorderbeine gezogen, extra angepasst für seinen Hundeleib. Mit der Nummer 10, Maradonas Nummer.
Der Bauch der CholeraDie Sanità
Es ist laut, es ist heiß, und es liegen tausend Gerüche in der Luft. Wenn man an der Piazza Cavour aus der U-Bahn kommt, die Treppen hochsteigt, die Porta San Gennaro auf der rechten Seite liegen lässt und ein paarmal um die Ecke biegt, ist Neapel so, wie es immer war. Vielleicht doch unveränderbar, nicht zu bändigen, nur mit wechselnder Belegschaft? Auf den Bürgersteigen herrscht Gedrängel, jeder geht irgendeinem Geschäft nach. An Ständen werden Obst und Gemüse feilgeboten, die Händler sitzen auf Stühlen neben ihren Auslagen und kommandieren Töchter, Söhne und Neffen herum. In einer Bäckerei stehen die Leute für Brot und taralli an, alle kennen sich mit Namen. Die Fischverkäufer legen Eisblöcke zwischen die Doraden und schöpfen Muscheln aus den großen flachen Schüsseln. Die Kleidungsläden haben gleich daneben auf Tischen ihre Waren ausgebreitet. Man kann Dessous, BHs in Übergröße, Nachthemden, Socken und Boxershorts im Fünferpack erstehen. Es gibt auch Schuhe. Das meiste spielt sich auf den Bürgersteigen ab, die Innenräume dienen vor allem als Lager, und hier sitzen Schwägerinnen oder Schwiegermütter hinter der Kasse und zerren die gewünschte Strumpfhose aus einem Regal hervor. In den Seitenstraßen haben ein, zwei srilankische Familien die Lebensmittelläden übernommen. Ein anderer an der Piazza wird von Ukrainern betrieben: Die Flagge hängt über der Tür, ab nachmittags sitzen Frauen und Männer vor dem Geschäft und trinken melancholisch Bier und Schnaps.
Vor der Post steht morgens oft eine lange Schlange: Etliche Bewohner der Sanità haben kein Konto, und hier können sie sich ihre Rente oder ihre Sozialhilfe auszahlen lassen, auch für Einschreiben und Überweisungen stellt man sich an. Bis vor wenigen Wochen traf man an dieser Stelle jeden Tag auf Andrea, einen Familienvater, der einer Arbeit nachging, die er selbst erfunden hatte: Er zog die Nummern aus dem Wartemarkenapparat, verteilte sie an die Neuankömmlinge, wusste, welches Formular wofür vonnöten war und regelte den gesamten Ablauf. Dafür steckte ihm jeder ein paar Münzen zu. In einem dieser modernen Unternehmen würde man ihn »welcome-Manager« nennen. Vor kurzem bekam Andrea einen Posten in der Regionalverwaltung und gab seine »Stelle« an seine Frau Anna weiter, die ihn schon früher öfter vertreten hat. Fünf Kinder haben die beiden. Genau wie ihr Mann weiß Anna alles über die Bürokratie mit ihren Steuermarken und Nummern. »Ich fülle die Formulare aus«, erklärt sie mir. »Die meisten Leute kennen meinen Mann und mich seit vielen Jahren, ich hebe auch Geld ab, sie sagen mir ihre PIN, es ist ein Vertrauensverhältnis. Entschuldigen Sie, da hinten stehen zwei Kunden.« Ich höre, wie sie die Frau berät und ihr ein Einschreiben mit Rückantwort empfiehlt, weil der Brief sonst nicht ankomme. Für eine andere bringt sie eine Überweisung auf den Weg. Natürlich spricht Anna, die besser informiert ist als die Beamten hinter dem Schalter, kein alltägliches Italienisch, sondern Dialekt, in Vierteln wie diesen ohnehin die Verkehrssprache. Während der Coronapandemie war die Post über einen langen Zeitraum geschlossen; Anna und Andrea hatten keine Einkünfte mehr. Die Kirchengemeinde der Sanità kümmerte sich um die Eheleute und sorgte dafür, dass sie trotzdem ein Auskommen hatten, denn wovon hätten sie ihre Kinder ernähren sollen? Informelle Arrangements wie dieses gibt es zahllose in Neapel.
Wir gehen durch den Bogen über den Supportico Lopez ein paar Stufen hinauf bis zur Salita Sant’Elia. Hier ist die Werkstatt der Brüder Forino, die letzte kleine Handschuhfabrik der Sanità und einer von zwei Betrieben in ganz Neapel. Fratelli Forino hieß das Familienunternehmen ursprünglich, jetzt steht Gloves fratelli Forino an der Klingel. Daniela Forino nimmt uns in Empfang. 1899 vom Großvater gegründet, arbeiten hier immer noch drei Generationen: ihr Vater Giovanni, der an einem Schneidetisch steht und sich gerade an einem Stück schwarzen Leder zu schaffen macht, dann ihr Bruder Roberto, dessen Sohn, der zuständig für Taschen ist, und sie als Managerin. Daniela koordiniert den Handel mit dem Ausland, von Japan über Osteuropa bis nach Deutschland, Frankreich, England. Hinter dem Büro, an dessen Wänden sich in breiten Regalen Pappkisten stapeln, öffnen sich die Werkstätten, wo zugeschnitten, genäht, gefüttert und gebügelt wird. »Wollen Sie eine Handschuhfabrik eröffnen?«, fragt der neunundachtzigjährige Giovanni, als ich mir jeden einzelnen Schritt erklären lasse. Mit vierzehn habe er von seinem Vater das Handwerk gelernt, erzählt er und dehnt das Lederstück mithilfe von Holzplatten, damit es später keine Falten wirft. Auf dem Tisch stapeln sich orange Pappschablonen mit den verschiedenen Größen. »Für Sie müsste ich eine Nummer sieben anfertigen«, bemerkt er mit einem Blick auf meine Hände. »Der Daumen wird extra zugeschnitten und dann eingenäht«, erläutert er und schiebt seine grüne Hornbrille kurz auf die Stirn. Mit ruhiger Konzentration nimmt er die Schere zur Hand. »Anderthalb Stunden brauche ich für ein Paar«, das sei seit jeher so gewesen, und deutet auf Fotografien seines Vaters, umringt von Näherinnen. Auch der habe es nicht schneller geschafft. Jeder einzelne Finger wird mit forchette, »Gabeln«, ausgestattet, wie die Seitenstücke genannt werden. Die Singer-Nähmaschinen im Nebenraum stammen noch aus den 1920er Jahren. »Solche gibt es gar nicht mehr.« Dort stehen auch die fünffingerigen Metallmodelle in verschiedenen Größen, aus dünnen Eisenstangen gefertigt. Bizarre Skulpturen, die Kerzenhaltern ähneln, auf die das Futter gezogen wird: Kaschmir für Winterhandschuhe, Seide für den Sommer. Nur am unteren Rand wird das Futter festgenäht. Zum Schluss kommt das fertige Stück auf ein Bügeleisen in Handschuhform. Dort darf man sie allerdings nicht vergessen. »Du glaubst nicht, wie viele Paare auf diese Weise dann ganz am Schluss ruiniert wurden«, meint Daniela. »Meine Mutter, die eine einfache Frau war, hatte mehrere Paar Handschuhe, passend zur Garderobe und für verschiedene Jahreszeiten«, erzählt die Näherin Enza, die im größten Raum unter einer hellen Lampe mit der letzten Qualitätskontrolle befasst ist, Nähte überprüft, lose Fäden abschneidet. Ob sie einen Kaffee wolle, fragt Daniela ihre Angestellte, die seit über dreißig Jahren für sie arbeitet. Nein, nein, »Ich mache doch den fiorello für die Madonna del Carmine«, sagt die Näherin, die einen blauen Arbeitskittel trägt. Den gesamten Monat Mai hindurch verzichtet man auf etwas, das einem wichtig ist – Kaffee, Wein, Zigaretten –, und pilgert dann zur Messe in die Kirche del Carmine. Früher habe sie das zu Fuß bewältigt, jetzt gibt es auch einen Bus. Enza, diskret geschminkt mit kurzen blonden Haaren, ist zweiundsiebzig Jahre alt. Aufgewachsen mit vielen Geschwistern, kam sie mit zwölf in die erste Fabrik und lernte das Handwerk, mit neunzehn wechselte sie dann in eine zweite. Sie hat den Niedergang der gesamten Branche beobachtet. »Alle haben früher hier im Viertel in Heimarbeit Handschuhe genäht, man war zu Hause und konnte die Familie versorgen und trotzdem arbeiten.« Die Sanità hat von Handschuhen gelebt. »Meine Mutter kaufte eine Maschine für zweihundert Lire, das war damals eine riesige Summe.« Gelangweilt habe sie sich nie bei der Arbeit, obwohl man konzentriert sein muss und sich nicht unterhalten kann, nur ab und zu ein paar Sätze wechseln. Ein bisschen Radio hören, das geht. »Es ist schwierig, heute noch Näherinnen zu finden. Man braucht Geschicklichkeit und vor allem Geduld, darauf haben viele keine Lust mehr«, erzählt Daniela. Ihr Bruder Roberto hinkt auf Krücken in die Werkstatt, er ist gestern mit der Vespa auf Öl ausgerutscht, sein Sohn huscht auch herein, er hat Friseur gelernt, aber befasst sich jetzt doch lieber mit Leder. »Für mich ist das keine Arbeit«, meint der Vater Giovanni. »Das bin ich.« Wir schauen uns die verschiedenen Modelle und Farben an und bewundern die feinen Nähte. Es gibt kurze und lange Handschuhe, welche für die Oper San Carlo und welche für feuchte Wintertage.
Ein Stück weiter, an der Piazza Sanità, stehen Jugendliche um Motorräder herum und registrieren, wer in welche Gasse biegt und welches Haus betritt. Zwischendurch springen sie auf ihre Fuhrwerke, quetschen sich zu zweit oder dritt auf den Sattel und absolvieren eine Tour, gern auch ohne Helm: Mit heulendem Motor die Via Arena hinunter, rasant um die Ecken, und jedes Mal wird kurz gehupt, denn Bürgersteige gibt es meistens nicht. Wer hier langgeht, weicht kurz zur Seite aus. Am besten wählt man sowieso die Straßen mit Treppen, dort entkommt man ihnen kurzzeitig. Die Mofas, Vespas und großen Maschinen wirken wie kleine Viehherden, die an bestimmen Ecken Aufstellung nehmen, bewacht von ihren Besitzern. Sie markieren das Terrain, dienen als Sofa und ersetzen ein eigenes Zimmer. Hier verabredet man sich, telefoniert, redet und isst ein Stück Pizza. Manche der Mädchen sind höchstens zwölf, aber zurechtgemacht wie kleine Frauen, frisiert, geschminkt, Perlonstrümpfe, hochhackige Stiefel. »Rione Sanità« ist an eine Wand gesprüht. Daneben ein großes Foto von einem Jungen in grüner Sportjacke, die kurzen Haare stehen nach oben, das Gesicht ist ernst, die Körperhaltung lässig, die Hände in den Hosentaschen, die Daumen draußen. Er schaut abwartend in die Kamera, so als wisse er nicht ganz genau, was er seinem Gegenüber alles zutraut. »Si è vivi finchè non si è dimenticati«, hat jemand auf die gegenüberliegende Fassade geschrieben. »Solange man nicht vergessen wird, ist man am Leben.« Genny Cesarano wurde am 6. September 2015 von Mitgliedern einer Baby-Gang mit Camorra-Ambitionen erschossen. Er war siebzehn. Ein Fehler, er hatte nichts mit den Fehden, die unter den Clans wüteten, zu tun. Die Täter wurden verurteilt und sitzen immer noch im Gefängnis. Inzwischen gibt es sogar eine Statue von dem jungen Mann, ganz in Bronze hockt er auf einer Bank. Sie stammt von einem örtlichen Bildhauer, der, wie viele andere auch, die Erinnerung an den Vorfall lebendig halten will. Denn immer wieder geraten Unschuldige ins Fadenkreuz der Camorristi, und in der Sanità hatte man damals gerade erst begonnen, ein bisschen durchzuatmen.
Die Sanità befindet sich extra moenia, außerhalb der Stadtmauern. Seit der Antike beerdigte man in dieser Gegend die Toten. Es gibt nicht nur die doppelstöckigen Katakomben von San Gennaro im Berg von Capodimonte, sondern auch den Cimitero delle Fontanelle, wo seit der Gegenreformation der Kult der »Heiligen Seelen im Fegefeuer« zelebriert wird und bis vor wenigen Jahren einzelne Gläubige Totenköpfe adoptierten. Jeder, der wollte, konnte sich einen Schädel, eine capuzzella, ein »Köpfchen«, aussuchen und sich darum kümmern, es säubern, polieren, auf ein besticktes Tuch betten, mit Blumen umkränzen, ein ewiges Licht anzünden und zu ihm beten. Denn der Totenkopf steht für eine Seele im Purgatorium, die man um Vergebung bitten kann. Der pagane Ritus, der die Wiedergeburt aus dem Erdinneren verspricht, scheint hier kaum verbrämt. »Die rituelle Totenklage ist in der antiken Welt eng mit dem Mythos des Heiligen verbunden, das stirbt und wieder aufersteht, also mit einem der zentralen Momente der antiken religiösen Gemeinschaften der mediterranen Welt«, stellte der große neapolitanische Anthropologe Ernesto De Martino schon 1959 in seinen Studien über Totenklagen in Süditalien fest. Überreste von 40.000 Leichnamen sind in den zehn bis fünfzehn Meter hohen Hallen der Fontanelle verwahrt, vor allem Opfer der großen Pestepidemie von 1656, die über die Hälfte der Einwohnerschaft das Leben kostete. Die Pest mit 1500 Toten pro Tag erzwang die Einrichtung neuer Friedhöfe, und der ehemalige Steinbruch, dessen Name auf die Wasserquellen, fontane, zurückgeht, bot ein günstiges Terrain. Später kamen die Toten der Choleraepidemie von 1836 hinzu. Mit großem Gespür für das Gefälle zwischen dem vermeintlich aufgeklärten, rationalen, protestantischen Nordeuropa und dem archaischen, bedrohlichen Süden lässt Roberto Rossellini in seinem Film Viaggio in Italia von 1954 seine Hauptfigur Katherine, eine halb-depressive Engländerin, von Ingrid Bergman mit untergründiger Verstörung gespielt, durch die Anlage der Fontanelle taumeln. Sie begleitet ihre Hausangestellte, die vor den anonymen Totenköpfen für ihren gefallenen Bruder betet und auf eine Schwangerschaft hofft. Katherine, mit einem pragmatischen Geschäftsmann namens Alex verheiratet, steckt in einer Ehekrise und fühlt sich abgeschnitten von jeder Vitalität. Dennoch tobt etwas in ihr, und dies scheint seinen Hallraum in dem exotisch wirkenden Neapel zu finden.
Rossellini spielt mit den Klischees, die Reisende aus dem Norden auf die fremde Umgebung projizieren: Unordnung, Lärm, Überfüllung, das Triebleben scheint allgegenwärtig. Gleich in der ersten Szene gerät das Paar, das zum Haus eines verstorbenen Onkels unterwegs ist, das verkauft werden soll, in eine Büffelherde hinein. Ein bisschen wirken die beiden wie jene desorientierten Amerikaner, die Henry James in seinen Romanen immer wieder nach Italien schickt. Der Plot des Films stammt eigentlich von Colette, allerdings hatte Rossellini es versäumt, sich rechtzeitig um die Rechte zu kümmern. Deshalb lässt er seinen Drehbuchautor, den Schriftsteller Vitaliano Brancati, als Sizilianer mit dem brodelnden Süden vertraut, die Konstellation des Paares so anlegen, dass die Referenz nur für Eingeweihte zu erkennen ist. Katherine und Alex, völlig entleert und entfremdet, verkörpern die Moderne, die sich bereits überlebt hat. Für Katherine werden die Gedichtverse eines verstorbenen Freundes, der in Neapel als Soldat der Alliierten stationiert war, zum Leitmotiv für die Erkundung des Fremden:»Keine Körper mehr, sondern asketische Bilder«.Aber sie begegnet bei ihren Besuchen im Archäologischen Museum dem Gegenteil: Die Statue eines bulligen Satyrs entfaltet eine bedrängende Sinnlichkeit, wie überhaupt alles um sie herum. Und ihr Aufenthalt wird dann zu einem Abstieg in die Tiefe. Bei dem Besuch des Friedhofs der Fontanelle ist sie plötzlich von Skeletten und Totenköpfen umzingelt und erlebt eine für sie beunruhigende religiöse Hingabe. Sexualität, Tod, Geburt, alles scheint miteinander verbunden. Ein Kraftquell, den sie verloren hat. Ähnlich verwirrend ist die Wirkung der fumarole, der Schwefelquellen von Pozzuoli mit ihren Nebeln, die plötzlich entfacht werden können und alles überlagern.
Immer wieder muss Katherine Schwellen überwinden, gerät in Bezirke, die Zwischenbereiche markieren. Die Körperhaltung der unglücklichen Ehefrau ist steif, ihre Bewegungen sind abgezirkelt, sie sitzt allein im Auto, während die Frauen auf den Straßen ausschließlich zu mehreren unterwegs sind und durcheinanderwimmeln. Überall sieht sie Schwangere, Mütter, die Kinderwagen vor sich herschieben, einen Leichenkarren, von schwarzen Pferden gezogen, hinter dem sich eine große Trauergemeinde versammelt. Mehrfach baut sich ein starker Gegensatz auf zwischen den Ingmar-Bergman-haften scharfen Dialogen des unglücklichen Ehepaares in ihrem geräumigen, aber verwaisten Landhaus und dem pulsierenden Leben auf den Straßen Neapels. Schließlich, gemeinsam mit Alex, als die Scheidung schon entschieden ist, unternehmen die beiden gegen ihren Willen einen Ausflug nach Pompeji. Ein befreundeter Archäologe legt dort ein mumifiziertes Liebespaar frei. Diesen Anblick kann Katherine nicht ertragen. Die Erfahrungen drohen sie nun vollends zu verschlingen, und die kinderlose Ehefrau muss erkennen, dass nicht nur ihr Mann von einem tödlichen Rationalismus bestimmt ist, sondern auch sie selbst. Als sie dann auf der Abreise Neapel mit dem Auto durchqueren, bleiben sie in einer Prozession stecken. Eine Marienstatue wird an ihnen vorbeigetragen, sie verlassen das Auto, und plötzlich scheint das Irrationale auch für sie eine regenerative Kraft zu entfalten: Inmitten der religiösen Handlungen versöhnen sie sich. Rossellinis Film, der damals eher durchfiel und an den Kassen floppte, wurde von Jacques Rivette als ein Meilenstein erkannt – das Kino sei mit einem Schlag um zehn Jahre gereift.
Das religiöse Substrat wabert immer noch durch die Sanità, als sei es Rauch aus den Schwefelquellen von Pozzuoli. Der Ethnologe Ulrich van Loyen ist tief eingedrungen in die Gepflogenheiten und Traditionen des Viertels und hat ein faszinierendes Buch über die Sphäre zwischen Lebenden und Toten geschrieben: Neapels Unterwelt. Über die Möglichkeit einer Stadt (2018). Es handle sich um ein ganz eigenes Reich, und Neapel ließe sich, so nahm der Wissenschaftler die Stadt vor elf Jahren während eines Forschungsaufenthaltes wahr, symbolisch als geschlossener Kreislauf betrachten, als »anderes Italien«. Die rituellen Handlungen seien liminale Erfahrungen, Grenzerfahrungen, sie stellten eine Ressource dar. Der Forscher, der am Kult der Anhänger der Madonna dell’Arco teilgenommen hat, sieht hierin das Widerständige Neapels, was sich der Gentrifizierung widersetzt. Zumal es vor allem einfache Leute des Viertels sind, die darin involviert sind, und mit ihren Familien die Niederlassungen dieser lose an einzelne Gemeinden angebundenen Gruppen unterhalten, kleine Räume, wo Fahnen und Devotionalien gelagert und die Prozessionen vorbereitet werden. Wenn dann in der Nacht zum Ostermontag die Gläubigen barfuß bis in die Peripherie pilgern, sich in der Kirche auf den Boden werfen, zur Madonna kriechen und tränenüberströmt beten, werden sie zu Mittlerfiguren zwischen drinnen und draußen, oben und unten, Heiligem und Profanem. Es ist ein Bereich, der sich – zumindest eine Weile lang – der Kontrolle entzieht. Außerdem sei die Ausübung dieser religiösen Praxis auch ein Mittel, so meint van Loyen, sich bestimmten klientelistischen Bindungen zu widersetzen. Das Charakteristische von Neapel, dessen Untergrund aus Tuffstein besteht, ist zweifellos seine komplexe Schichtung. Konkret und auch metaphorisch, denn ganz durchschaubar ist die Stadt nie. Immer wabert im Untergrund das Andere. Aber ob man hier Klientelismus als solchen überhaupt wahrnimmt? Was soll das sein? Es ist einfach die Art, wie Beziehungen gestaltet sind – man kennt sich, man tut etwas füreinander. Und inzwischen ist die Gentrifizierung selbst in der Sanità angekommen:An allen Ecken werden Ferienwohnungen eingerichtet, die traditionsreiche Pizzeria Concettina ai Tre Santi auf der Via Arena della Sanità, ein Familienbetrieb, hat 47,5 Prozent an die Firma Moncler verkauft, und das Hypogäum, ein antiker Grabbau an der Via dei Cristallini, wird schon am Flughafen beworben.
Kaum jemand kennt die Sanità mit ihren Katakomben, ihrer urtümlichen Religiosität, den Prozessionen und der Armut besser als der Fotograf Mimmo Jodice. Er wurde 1934 an den rampe, wie die Treppenstraßen hier heißen, geboren, gleich hinter der Kirche Santa Maria della Sanità, wo er auch aufwuchs. Einen Tag nach meinem Besuch bei den Handschuhmachern fahre ich bei strömendem Regen zu ihm, in ein Viertel auf der anderen Seite Neapels am Parco della Rimembranza. Sein Studio und die Wohnung befinden sich im selben Haus. Angela, seine Frau, öffnet mir die Tür. An so einen kalten und verregneten Mai kann sie sich nicht erinnern, und sie ist über achtzig Jahre alt. Normalerweise beginnt in diesem Monat die Badesaison. In Jodices Atelier, wo eine Corbusierliege steht, werden gerade Bilder verpackt, denn in Turin findet im Juni eine große Werkretrospektive statt. Einige Fotografien sind sofort wiedererkennbar, so ikonisch sind sie längst: die Silhouette eines Sprinters, der die Haltung einer Statue aufnimmt. Ein steinernes Gesicht. An der Wand im Flur hängt eine betörende Aufnahme der jungen Angela. Mimmo Jodice gehört zu den bekanntesten Künstlern Neapels und ist eine internationale Größe. Er wurde zu Ausstellungen in New York und Paris eingeladen, wo das Musée du Louvre seine Arbeiten zeigte, und hat eine Fülle von Bildbänden vorgelegt. Seit zwei Schlaganfällen ist der Neunundachtzigjährige nicht mehr gut zu Fuß, aber er nimmt sein Gegenüber genau in den Blick. Der neapolitanische Regisseur Mario Martone dreht gerade einen Dokumentarfilm über ihn. »Ich bin in der Sanità geboren«, fängt Jodice an zu erzählen. »Es war damals ein Ort voller Farben, alles passierte draußen. Man tanzte Tarantella, man arbeitete, oft wurde sogar vorm Haus gekocht, gegessen sowieso. Wie auf einem Dorf. Unsere Wohnung war kein richtiger basso, also eine dieser typischen neapolitanischen Wohnstätten im Erdgeschoss mit einer Tür auf die Straße, denn an den rampe gibt es das nicht, aber es war sehr bescheiden. Mein Vater starb, als ich sechs Jahre alt war. Er wurde bei uns zu Hause aufgebahrt, und ich erinnere mich noch an seine weißen Strümpfe. Ich habe seine Füße vor Augen, sein Gesicht nicht mehr.« Mitten im Krieg musste Mimmo Jodices Mutter vier Kinder allein durchbringen. Neapel wurde immer wieder bombardiert, die Familie flüchtete sich regelmäßig in den Luftschutzkeller. »Wir haben damals wirklich gehungert«, erinnert sich Angela. »Auch in den ersten Jahren nach dem Krieg. Es ging darum, ein Stück Brot zwischen die Zähne zu bekommen. Aber Schluss mit dem Krieg, Mimmo, unser Gast möchte etwas erfahren über deine Sozialreportagen in Neapel, die Sachen über die Kinderarbeit und die Cholera«, hilft ihm seine Frau auf die Sprünge. Ihr Mann ist noch nicht so weit. »Warte, jetzt habe ich gerade diese Jahre vor Augen. Ich würde gern mal wieder in die Sanità gehen und schauen, ob von damals noch etwas übriggeblieben ist. Vielleicht auch in den Gesichtern.« Als Zehnjähriger begann Mimmo Jodice zu arbeiten. Er musste zum Familieneinkommen beitragen und wurde Hilfskellner in einer Frühstücksbar, wischte den Tresen ab, brachte Kaffee in die angrenzenden Geschäfte. Einen besonderen Blick für Bilder besaß er schon damals. Er begeisterte sich für Kunst, begann, das Milieu der Akademie zu frequentieren, und wurde unter dem Einfluss der Maler De Pisis und Viani zu einem unersättlichen Autodidakten. Surrealismus, die Avantgarden, neue Materialien, alles interessierte ihn. Ende der 1950er Jahre näherte er sich der Fotografie an. »Waren Sie auf dem Friedhof der Fontanelle? Wir hatten dort einen der Köpfe adoptiert und gingen jeden Freitag hin und kümmerten uns und pflegten ihn. Ich habe später ein Buch über die religiösen Rituale gemacht, gemeinsam mit dem Anthropologen und Musikwissenschaftler Roberto De Simone. Diese Art der Religiosität gibt es heute nicht mehr, sie ist völlig verschwunden.« Angela legt den dickleibigen Band auf den Tisch: Chi è devoto, Wer fromm ist. Ein beeindruckendes Zeugnis gesellschaftlicher Praktiken mit Tausenden von Gläubigen, die sich in einen kollektiven Rausch hineinsteigerten. Nach langen barfüßigen Märschen warf man sich auf den Boden. »Wir waren die Einzigen mit einer Kamera«, sagt Angela. »Es gab niemanden, der so etwas dokumentierte, denn alle waren Teil des Ritus. Ich begleitete Mimmo, wir kletterten in die Kuppeln der Kirchen und fotografierten von dort. Schauen Sie, welche Massen damals zusammenkamen. Es waren überwältigende Momente, manchmal auch unheimlich, aber tief empfunden. Heute ist es übrigens umgekehrt, Hunderte fotografieren, und nur wenige nehmen an den Prozessionen teil.«
Die Aufmerksamkeit für diese Art von mystischer Religiosität schloss nicht aus, dass Mimmo Jodice viele Jahre lang soziale Fotografie betrieb. Es waren regelrechte Recherchen, Anklagen und kämpferische Aufklärungskampagnen: Auf den Bildern sind Kinder in Elendsquartieren abgebildet, man sieht Acht- und Zehnjährige, die arbeiten, Mütter, die höchstens vierzehn sind. Jodice ging in Schulen, Krankenhäuser und psychiatrische Anstalten und lichtete ab, was er dort vorfand. Eindrucksvolle Kompositionen in Schwarz-Weiß. »Ich wollte nie mit Farbe arbeiten«, erläutert Jodice seine Ästhetik. »Farbe verflacht die Realität, gibt ihr etwas anderes. Und ich habe immer viel Zeit in der Dunkelkammer verbracht, der Prozess der Entwicklung war mir sehr wichtig.« 1973 legte er Bilder zur damals gerade ausgebrochenen Choleraepidemie vor: Der Bauch der Cholera. In den 1980er Jahren verschwanden dann plötzlich die Menschen von seinen Fotografien. Nun ging es um Formen und Materialien, um Bauten, den Bezug zur Antike und Landschaften. Es gab Ausstellungen in der ganzen Welt.
Angela und Mimmo Jodice erzählen von einem Priester, mit dem sich die Verhältnisse in der Sanità zu wandeln begannen: Don Antonio Loffredo. Er holte die Jugendlichen von der Straße, machte gemeinsam mit ihnen die Katakomben von San Gennaro wieder zugänglich, gründete eine Kooperative und eine Stiftung. Für den Vorsitz gewann er Mimmo Jodice. »Wenn ich dort hinging, sagte er immer: ›Sehr ihr, dieser Mann ist auch hier geboren, und heute ist er ein berühmter Fotograf!‹ Ich sollte sie ermutigen und ihnen einen anderen Weg aufzeigen. Jetzt bin ich zu alt für diese Aufgaben, aber wer weiß, vielleicht habe ich dem ein oder anderen einen Anstoß gegeben.« Padre Antonio habe enorm viel verändert, da ist sich das Ehepaar einig. Als Person ist er so markant, dass er sogar zur literarischen Figur wurde – der Schriftsteller Ermanno Rea verarbeitete die Geschichte des Priesters in seinem Roman Nostalgia. Der Nachmittag bei Mimmo Jodice endet mit einem Gang durch sein Archiv. Fast meint man, die ekstatische Religiosität der sanitanesi zu hören, als liege plötzlich Gesang in der Luft. Zum Schluss empfiehlt der Fotograf, Don Antonio zu treffen, was aber nicht einfach sei.
Immerhin, Nostalgia von Ermanno Rea liegt in jeder Buchhandlung. Rea, 1927 in der Sanità geboren und wie kaum ein anderer Schriftsteller Chronist der Verwerfungen Neapels, besaß seit jeher ein entschiedenes Wesen. Mit fünfzehn ging er in den Widerstand, machte sich dann als Journalist für linke Blätter einen Namen, bis er aus Enttäuschung über die Haltung der Kommunistischen Partei Ende der 1950er Jahre Fotoreporter wurde und Bilder aus Berlin, Japan, Nepal, Indien und Nordafrika lieferte. »Mich interessierte vor allem die soziale Situation der Menschen«, erklärte er 2012 in einem Fernsehinterview. Der damals Vierundachtzigjährige strahlte die freundliche Gelassenheit eines Süditalieners aus, der sich wenig beeindrucken lässt von Unruhen und Gewalt. Seine ersten Romane veröffentlichte er erst im Pensionsalter. La fabbrica dell’obbedienza, Die Fabrik des Gehorsams (2011), heißt einer seiner Essays über die dunkle Seite der Italiener, und dort deutet Rea die Gegenreformation um 1600 als zentrale historische Erfahrung, also jene Phase, als aus Angst vor dem revolutionären Potenzial der Reformation die Freiheiten der Renaissance zurückgenommen wurden. In Neapel herrschte nach der französischen nun die spanisch-österreichische Krone mit absolutistischen Prinzipien, die staatliche Verwaltung war schlecht, auch in der Kirche galt es, sich von der – heidnischen – Antike abzuwenden und eine Erneuerung des Glaubens anzustreben. Niccolò Machiavellis Werke landeten auf dem Index, aus Giovanni Boccaccios Dekameron wurden delikate Szenen getilgt. Galileo Galilei, der für eine wissenschaftliche Forschung eintrat und sich nicht darum scherte, ob seine Erkenntnisse den Glaubensgrundsätzen entsprachen, war eines der berühmtesten Opfer dieser neuen Politik. Die republikanischen Tendenzen in Italiens Stadtstaaten hatten an Einfluss verloren, stattdessen kehrte man zu den Herrschaftsformen der Monarchie zurück. Wirtschaftlich lag das Land darnieder, die Verwaltung war in einem erbärmlichen Zustand, seine kulturelle Hegemonie verlor Italien an Frankreich. Seither gebe es eine große Bereitschaft, immer dem jeweils aktuellen Despoten zu applaudieren und ansonsten seinen Geschäften nachzugehen, meint Rea. Mit Pico della Mirandola und Giordano Bruno habe es Helden »del no«, also Neinsager, gegeben, aber die seien ermordet worden oder auf dem Scheiterhaufen gelandet. Stattdessen gewännen meistens die »yes-men«, und mit dieser Neigung müsse man dialektisch umgehen. Im Frühjahr 2024, anderthalb Jahre nach der Wahl der Postfaschistin Giorgia Meloni zur Regierungschefin, besitzt diese These einige Suggestivkraft. Die Verhältnisse wirken trotz allem volatil, und wenn man Rea glauben darf, ist das seit Jahrhunderten so. Nostalgia, sein letzter Roman, erschien 2016, und kurz darauf starb Ermanno Rea, unter großer Anteilnahme der ganzen Stadt. Der Schauplatz des Romans ist die Sanità, und der Tod ist hier allgegenwärtig. Im Grunde erzählt Rea eine Variation der biblischen Geschichte von Kain und Abel: Sein Held Felice Lasco, der unter dem Schutz eines Priesters steht, wird von seinem Schulfreund Oreste erschossen. Ein Brudermord.
Es ist erstaunlich, dass der überzeugte Laizist Ermanno Rea, der sich sein Leben lang mit sozialen und politischen Fragen befasst hat, in Nostalgia ausgerechnet einem Priester, eben dem schon genannten Don Antonio, ein Denkmal setzte. Bei Rea trägt der Geistliche einen anderen Namen und heißt Don Luigi Rega. Er nimmt Felice Lasco unter seinen Schutz, einen Mann, der genau wie Rea Neapel verließ und Jahrzehnte später seine alte Wohngegend durchstreift: »Arme Sanità! Enge verwinkelte Gassen, heruntergekommene Gebäude, auf dem Buckel eine mehr als zweitausendjährige Geschichte, bezeugt von Katakomben, Altären, gemeißelten Gräbern, Treppen, die so tief unter die Erde führen, als strebten sie zu den Eingeweiden des Planeten.« Hier wird Felice Lasco 1948 geboren, hier hat er mit seinem Freund Oreste Spasiano, inzwischen von allen Malommo, »böser Mann«, genannt und einer der gefürchteten Clanchefs der Sanità, sogenannte scippi begangen. Kleine Überfälle, bei denen man mit dem Mofa im Vorüberrauschen Taschen oder Fotoapparate erbeutet. Felices verwitwete Mutter gehört zu den berühmten Handschuhnäherinnen. »Wohnungen, bassi, Kellerräume waren ein einziges Vibrieren kundiger und fleißiger Finger«, heißt es bei Rea. »Alle an die Arbeit. Auch die Kinder. Auch die Alten. Im Sommer wurden die Nähmaschinen nach draußen gestellt: In vielen Gassen sangen die Frauen im Chor, wetteiferten untereinander, wer von ihnen am schnellsten nähte. Auch Felices Mutter zog mit ihrer Singer auf die Straße um und sang gemeinsam mit den anderen. […] Wenn eine Frau eine nagelneue Singer einweihte, zu deren Kauf sie einen Stapel an Wechseln unterschrieben hatte, jubelte das ganze Viertel: Man prostete sich zu, als wäre ein Kind zur Welt gekommen. Hauptsächlich wurden die Nähmaschinen aber ausgeliehen: fünfhundert Lire pro Woche. Oder vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt (nicht kostenlos). Ihr Besitz stellte ein soziales Ziel dar und vor allem ein Sprungbrett, der erste Schritt zu einer künftigen produktiven Autonomie.« Die emsige Handschuhnäherin ist mittlerweile alt und hinfällig, und aus diesem Grund ist Felice Lasco, in Ägypten ein einflussreicher Geschäftsmann, nach Neapel zurückgekehrt. Weshalb war er so lange weg, weshalb braucht er den Schutz des Priesters? Als Sechzehnjähriger war er Zeuge eines Mordes geworden, den sein Freund Oreste an dem verhassten örtlichen Wucherer Costagliola begangen hatte. Nach den Codes des Viertels musste er entweder Oreste treu bleiben oder der Sanità ganz den Rücken kehren. Das Ereignis müsste inzwischen verjährt sein, und kaum ist Felice zurück, wirkt der alte Magnetismus. »Die Sanità ist unendlich, sagte er, wer könne behaupten, jede ihrer Falten zu kennen? Er würde dem Viertel seine gesamte Energie widmen, angefangen von der Kuppe des Hügels, um dann jede einzelne Ader auszukundschaften, die den Berg hinunterläuft, eng, zerklüftet und erhaben.«
Hier ist es wieder: Neapel als Körper, bis in die Wörter hinein wird die Stadt als ein lebendiger Organismus porträtiert. Auch Lascos Gegenüber, dem er seine Geschichte anvertraut, ist nicht zufällig gewählt: Der Erzähler des Romans ist nämlich ein Arzt. Ein Diagnostiker, Spezialist für Herzerkrankungen, der sein Leben lang in diesem Viertel praktizierte, wo bis in die 1970er Jahre noch Krätze und Cholera herrschten und Kinder an Unterernährung und Geschlechtskrankheiten litten. Seit die Griechen 470 v. Chr. ihre Nekropolen im Berg von Capodimonte anlegten, habe sich die kollektive Besessenheit vom Tod in der Sanità nie mehr verloren, stellt der Doktor nüchtern fest. Hier liegen schließlich auch die Heiligengräber von Gaudioso und Gennaro, an denen die Neapolitaner um Gnade flehten. Von den Besuchen an Leib und Seele erfrischt und gesundet, sani, leitet sich auch der Name des Viertels ab: Sanità.
Reas Roman hat einen realen Kern. Wie die Clans Verräter bestrafen, ist sogar auf Video dokumentiert. Schräg gegenüber vom Palazzo dello Spagnolo, einem der herrschaftlichsten Gebäude auf der Via Vergini mit prachtvollen zweizügigen Treppenaufgängen im Hof, gibt es die Bar Vergini. Vor dem Eingang stand früher rechts eine große blaue Eistruhe der Firma Motta. Im Video sieht man auf der anderen Seite unter der Markise einen jener typischen Kühlschränke für Kuchenteile und einen kleinen Spielautomaten. Am 11. Mai 2009 kommt nachmittags ein Mann im weißen Hemd vorbei, man kennt ihn im Viertel und weiß, dass er wegen Bankraub und anderer Delikte schon vor Gericht stand. Er fühlt sich sicher, schließlich ist er hier zu Hause, lehnt sich lässig an den Spielautomaten, die Hände in den Hosentaschen, und lässt seinen Blick schweifen. Ein anderer mit grüner Jacke und Basecap, kein Ortsansässiger, wie sich später herausstellt, betritt die Bar, dreht eine Runde, kommt wieder heraus, zückt eine Pistole und gibt von hinten fünf Schüsse auf den Mann im weißen Hemd ab. Der Mann fällt auf die Knie und bricht zusammen, liegt längst am Boden, die Beine ausgestreckt, einen Arm wie zum Schutz über sich, als der Fremde ihm einen Gnadenschuss ins Genick verpasst. Dann geht der Mörder mit immer noch scharfer Waffe und gemessenem Schritt davon. Etliche Fußgänger steigen über den Toten hinweg, ohne ihn weiter zu beachten, dabei müssen sie die Schüsse gehört haben. Ein Vater trägt seine Tochter auf dem Arm, ein Verkäufer aus der nahegelegenen Metzgerei geht vorüber. Er wagt zumindest einen Blick zurück. Verhalten, vorsichtig über die Schulter, aber auch er setzt seinen Weg fort. Niemand scheint dem Opfer zur Hilfe zu kommen, niemand eilt herbei. Zumindest eine Weile lang nicht. Kurze Zeit später sind Hunderte Polizisten vor Ort, kreist ein Hubschrauber über der Straße, macht die Spurensicherung ihre Arbeit.
Der Rachemord an dem Camorrista Mariano Bacio Terracino wurde Sekunde für Sekunde von einer Überwachungskamera festgehalten. Um Zeugen aus der Reserve zu locken, gab die Staatsanwaltschaft von Neapel das Beweisstück frei. Es lief mehrfach in den lokalen Abendnachrichten und ist bis heute auf YouTube zu finden. Roberto Saviano, Verfasser des international gefeierten dokumentarischen Romans Gomorrha (2006) über die Camorra und damals bereits seit zwei Jahren unter Polizeischutz, veröffentlichte im Wochenmagazin Espresso einen Artikel mit einem kämpferischen J’accuse: Niemals sei man in seiner Heimatstadt so gleichgültig gewesen. »Die Hinrichtung ist ein rascher, einfacher Akt, fast stumpfsinnig. Aber eben diese Banalität, das absurd heitere Drumherum, durch das alles gedämpft oder ins Irreale verschoben scheint – eben dies lässt Zweifel an der Menschlichkeit der Anwesenden aufkommen. Wer diese Bilder sah, wird es schwer haben, Neapel und den Süden gegen seine angeblichen Verleumder zu verteidigen. Wer kann noch behaupten, dass sei alles Schwarzmalerei, Übertreibung? Wird man noch einmal jemanden so reden hören? Tausend Expertisen und hundert Urteile werden nicht reichen, um die Gleichgültigkeit zu erklären, mit der Menschen auf diesem Video beobachten, wie ein anderer Mensch vor ihren Augen kaltblütig hingerichtet wird.«
2009, das ist das Jahr, in dem auch Rea seinen Roman ansiedelt. Seine Recherche fand später statt, um 2015, damals zog er für einige Monate in die Sanità, schloss Freundschaft mit Don Antonio und ließ sich von ihm das Viertel erklären. Er verwertet viel Material aus den Gesprächen mit dem realen Priester und lässt auch die Männerfreundschaft aufleben, nur dass sie in Nostalgia zwischen dem Arzt Nicola, dem Erzähler, und Padre Rega besteht. Don Luigi Rega wird zum Gegenspieler des mörderischen Oreste Spasiano, denn er macht der Camorra das Territorium streitig. Der echte Don Antonio hat zwar nicht einen Mann wie Lasco unter seine Fittiche genommen, aber sein Einfluss auf das Viertel ist kaum zu überschätzen. Ihm ist zu verdanken, dass die Jugendlichen heute berufliche Perspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten haben. Er überließ seinen Schützlingen das an die Kirche angrenzende Kloster für ein Bed & Breakfast zur Selbstverwaltung. Nach lateinamerikanischem Muster gründete er in Santa Maria della Sanità ein eigenes Orchester. Den Kindern wird ein Instrument anvertraut, für das sie sorgen müssen. Seine Kooperative arbeitete Führungen für die Katakomben von San Gennaro aus und erstellte eine Webseite. Um die Jugendlichen von der Straße wegzubekommen, richtete Don Antonio in der Sakristei Boxringe ein. Bei seinem Besuch in Neapel ließ sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dorthin führen. Eine andere Kirche wurde zum »Teatro della Sanità« umgewidmet, Ausbildungsstätte und Spielort von Produktionen, die durch ganz Italien touren. Roberto Saviano überließ der Kompanie die Bühnenfassung seines Romans Der Clan der Kinder (2016). Inzwischen gibt es weitere Kirchen, die zu Museen umgewandelt wurden, an allen Ecken und Ende passiert etwas in diesem Quartier. Zwar kocht niemand mehr auf der Straße, wie noch in Mimmo Jodices Kindheit, aber es ist viel los.
Im BoxringMario Martone und Ermanno Rea
Es regnet, als ich in Begleitung meiner Freundin Mena, ein wandelndes Energiebündel mit wehenden Kleidern, an einem Dienstag im Mai 2023 an der großen Tür am Ende der Via dei Cristallini klingle. Polizia steht draußen, aber auch palestra, Turnhalle, und tatsächlich handelt es sich um eines der bemerkenswerten Projekte von Don Antonio Loffredo. Marco öffnet uns, neben ihm steht ein junger Polizist. Marco mag Anfang zwanzig sein, mit Basecap und Vollbart, ein bisschen aufgeregt. In seiner schwarzen Jogginghose sieht er aus, als sei er auf dem Sprung zum Training. Er tänzelt wie ein Boxer um uns herum, und er fällt immer wieder in den Dialekt. Italienisch, Neapolitanisch, ein wildes Hin und Her, und bei allen informell ausgesprochenen Dingen, Verabredungen oder dem Ausdruck von Gefühlen, ist dies die einzig mögliche Sprache. »Ich duze dich mal, du könntest schließlich mein Sohn sein«, eröffnet Mena, die um die Ecke wohnt und jeden kennt, das Gespräch, sie ist zwar Nachbarin, kommt aber auch zum ersten Mal. Die Einrichtung wurde 2021 eröffnet, mitten in der Pandemie, und begann erst im letzten Jahr langsam zu arbeiten. »Vor zwei Wochen, als der Minister euch besucht hat, haben sie die Straße endlich mal wieder saubergemacht, stimmt’s?«, prasseln ihre Sätze auf den jungen Mann ein. »Habt ihr denn hier einen Raum, wo wir mal ein Konzert veranstalten könnten?« »Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich sehe, was ihr hier gemacht habt – so etwas war noch vor fünfzehn Jahren undenkbar!« Wir stehen im Innenhof, große farbige Streifen laufen die Wände hinunter. Das Blau des Himmels von Neapel, auf der anderen Seite zackige Muster in Rot und Gelb, ein Abbild der Brücke der Sanità. Es ist die Brücke, die das Viertel zweieinhalb Jahrhunderte von der Stadt abschnitt. Il ponte Murat. Man fuhr darüber, das Elend darunter interessierte niemanden. »Ich war noch ein Kind, als Don Antonio seine Stelle antrat«, erzählt uns Marco. »Dort oben rechts war seine Pfarrwohnung. Hier unten war nichts als Müll. Wir haben selbst angefangen, alles in Ordnung zu bringen. Wenn wir auf die Stadtverwaltung gewartet hätten, wäre bis heute kaum etwas passiert.« Heute bereiten sich hier die Sportler der Fiamme oro